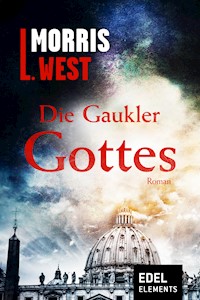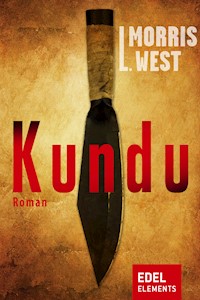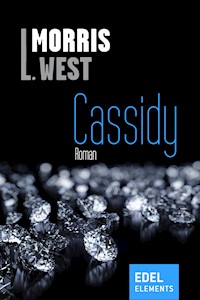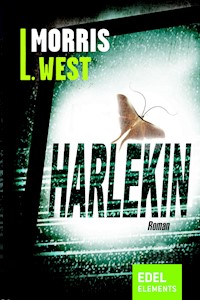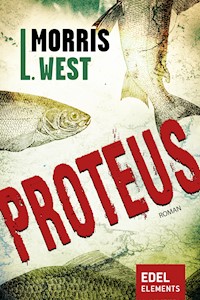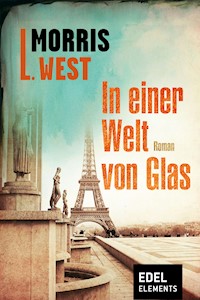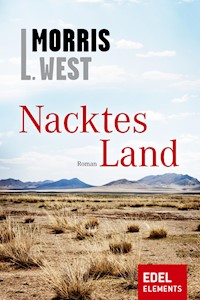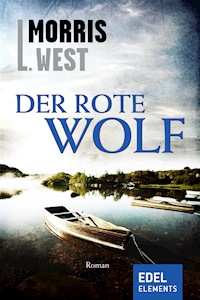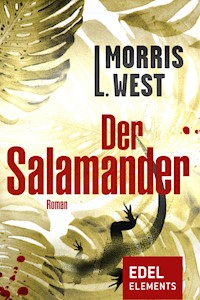Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwei Männer auf der Suche nach dem versunkenen Schatz der "Dona Lucia": Der eine, der gescheiterte Historiker Renn Lundigan, hat eine Goldmünze aus dem 18. Jahrhundert, die ihn zu der vor Australien versunkenen Galeone führen soll; der andere, der zwielichtige Spielclubbesitzer Mannix, verfügt über das nötige Geld. Doch aus der erhofften Zusammenarbeit wird ein Konkurrenzkampf auf Leben und Tod...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Morris L. West
Der Schatz der Dona Lucia
Roman
Ins Deutsche übertragen von Karl Heinz Sieber
Edel eBooks
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Epilog
Der erfolglose Historiker Renn Lundigan steht vor einem privaten und beruflichen Scherbenhaufen. Da kommt ihm das Glück zu Hilfe: Eine Goldmünze aus dem 18. Jahrhundert, die er in glücklicheren Tagen auf einer winzigen Insel vor der Küste von Queensland gefunden hat, führt ihn auf die Spur der versunkenen Galeone »Doña Lucia«, auf der er 20 Kisten mit spanischem Münzgold zu finden hofft. Mit der Bitte um finanzielle Unterstützung weiht er den dubiosen Spielklubbesitzer Mannix in seine Entdeckung ein, der jedoch seinen eigenen Nutzen aus der Sache ziehen will. Statt der erwarteten Hilfe hat Lundigan nun einen gefährlichen Konkurrenten...
1
Der Brief wurde mir um Viertel nach zwölf aufs Zimmer gebracht, am Mittwoch, den 30. Juni. Die Adresse lautete: Mr. Renn Lundigan, Institut für Geschichte, Universität Sydney, Sydney, Australien.
Der Umschlag war hinten mit einem barocken Siegel verschlossen und trug in der linken unteren Hälfte einen Absender in spanischer Sprache. Die Briefmarke stand leicht schief, die Maschinenschrift war fein und scharf. Ich erinnere mich an all diese Dinge noch so deutlich, weil ich den Umschlag lange, sehr lange anschaute, ehe ich ihn zu öffnen wagte.
Endlich ergriff ich ein Papiermesser, schnitt den Briefumschlag vorsichtig auf, zog das gefaltete Blatt heraus und begann zu lesen.
Der Mann, der den Brief geschrieben hatte, war der Oberstadtarchivar von Acapulco in Mexiko. Er berichtete mir mit den üblichen südländischen Floskeln über das Interesse, das meine Forschungen in seinem Amt ausgelöst hatten. Er berichtete, wie äußerst willkommen ihm ein so eindeutiger Beweis für eine Verbindung zwischen den spanischen Seefahrern des 18. Jahrhunderts und dem neuen Kontinent, Terra Australis Incognita, war, und versicherte mir seine Freude, mit einem so gelehrten Mann auf einem derart wichtigen Gebiet der geschichtlichen Forschung zusammenzuarbeiten.
Er berichtete, daß im Oktober 1732 die ›Doña Lucia‹ aus Acapulco ausgelaufen war; daß sie zwanzig Kisten Münzgold für die Kolonien Seiner Allerkatholischsten Majestät auf den Philippinen-Inseln geladen hatte.
Daß die ›Doña Lucia‹ aber nie in Manila angekommen sei und vermutlich entweder einem Sturm zum Opfer oder den Piraten der Chinesischen Meere in die Hände gefallen sei. Daß die Goldmünze, von der ich einen so ausgezeichneten Bleistiftabdruck geschickt hatte, eine Prägung aus der Zeit der ›Doña Lucia‹ war und in der Tat aus ihrer Ladung stammen konnte.
Er schrieb...
Aber der Rest war Höflichkeit, die mich nicht mehr interessierte. Ich dachte statt dessen an eine winzige Insel vor der Küste von Queensland, eine der hundert Inseln und Atolle, die längs des Großen Barrier-Riffs aufgereiht sind wie Jade- und Smaragdkristalle an einem Faden.
Ein zweihöckeriges Inselchen, auf der einen Seite steil ins Meer abfallend, auf der anderen mit einer schmalen Sichel weißen Strandes. Eine Insel, auf die die Wintertouristen niemals kamen, weil in den Verzeichnissen und Beschreibungen der Regierung von Queensland stand, es gebe dort kein Wasser, keine Durchfahrt durch die Riffe und keinen Schutz für Fischerboote oder Jachten.
Doch ich wußte eine Durchfahrt. Jeannette und ich hatten ein Zehn-Meter-Boot heil durch das Riff gebracht und es ohne einen Kratzer an seiner Kupferhaut auf den Sand gesetzt. Wir hatten mehrere Tage unter dem Pandangbaum gezeltet und am Fuß des westlichen Berghöckers eine Quelle gefunden. Wir waren übers Riff gelaufen und bei Flut zum Speerfischen gegangen, und eines Tages hatte Jeannette eine Goldkette, fast unkenntlich und von Korallen überkrustet, herausgefischt.
Dann, kaum einen Monat nach unseren Flitterwochen, starb Jeannette an Hirnhautentzündung, und ich blieb allein zurück – mit meiner Assistenzprofessur, einer abgegriffenen Münze und dem Traum von einem Mädchen, das an einem weißen Strand in der Sonne golden schimmerte. Und dem Traum von einem spanischen Schatzschiff, halb verborgen unter wild bewegten Korallenästen.
Die Erinnerung an Jeannette wurde langsam blasser, wurde zu einer dumpfen Schmerzempfindung in meinem Herzen, die gelegentlich zu zuckender Pein aufloderte und mich in wilde Nächte hineintrieb, in denen ich trank und meinem Glück beim Bakkarat und inmitten starrer Gesichter am Pokertisch nachjagte; und dann kamen die Schlepper, die im Morgennebel herumlungerten und sich die Gewinner des Samstagabends zu schnappen versuchten.
Die Erinnerung an Jeannette verblaßte, aber immer, wenn ich meine Schreibtischschublade herauszog, schien die alte, durch tägliche Berührung polierte Münze mich wie Feuer anzuglühen. Mein Mädchen war fort, verloren für mein Leben, aber mein Schatzschiff war da. Es mußte da sein – verrottete Balken, unter Korallen und Seegras begrabene Decks, im Schiffsbauch Regenbogenfische, die um die Goldkisten herumschwammen.
Es mußte da sein. Ich war Historiker. Ich konnte beweisen, daß es da war. Mindestens mußte ich beweisen, daß es da sein konnte.
Der alte Anson war es, der mich auf die richtige Idee brachte – George Baron Anson; noch vor seiner Zeit als Flottenadmiral, noch bevor er Erster Lord der Admiralität wurde; er kreuzte Monat um Monat im Gebiet zwischen Marianen und Karolinen und wartete auf Galeonen, die jedes Jahr von Acapulco nach Manila kamen. George Anson, der sein angeschlagenes Schiff im wahrsten Sinn zusammenband, um noch einen und noch einen Monat warten zu können, während sich am Schiffsrumpf bereits die Entenmuscheln ansetzten, die Wasserfässer Risse bekamen und seine Männer unter der Tropensonne an Skorbut starben.
Der alte Spanier war wahrscheinlich sozusagen witternd aus Acapulco ausgelaufen, hatte sich die Nordostwinde erschnüffelt, die ihn westlich entlang des Äquatorgürtels trieben, bis es Zeit wurde, sich wieder nach Norden zu wenden, vorbei an den Marianen bis nach Manila... aber Oktober war für ihn schon sehr spät. Dann wanderte der Sommer bereits in Richtung des Steinbocks hinunter; und wenn er zu weit nach Süden geriet, konnte es sein, daß er von einem Tornado eingefangen wurde, der ihn dann hinunterwirbelte, über den Bismarck-Archipel und die Salomoninseln hinaus westlich zum Großen Barrier-Riff. Bis dahin war er sicher schon längst unter Notsegel, hatte vielleicht Schlagseite und leckte, war nicht in der Verfassung, sich durch die Inseln und Riffe zu schlängeln. Und wenn der Sturm sich nicht von selbst gelegt hat, dann hatten ihm vielleicht eines Tages, eines Nachts, die Korallenklauen den Rumpf aufgerissen, und er war gesunken – vor dem äußeren Riffkranz einer Insel mit zwei Höckern.
So konnte es gewesen sein, so mußte es gewesen sein. Wo sonst sollte meine Dublone herkommen, dieses mattgoldene Auge, das mich aus der Tiefe meiner Schublade verhöhnte?
Es klopfte an meine Tür, und die kleine Blondine aus der Registratur kam mit einem Drahtkorb voller Lohntüten herein. Sie lächelte, riskierte einen Augenaufschlag und schwenkte den Korb, so daß ich sehen konnte, was ihre Strickjacke für ihre Figur tat, und machte ihr Witzchen, während sie mir die Lohntüte reichte. »Geben Sie nicht alles auf einmal aus, Mr. Lundigan.«
Ich lächelte und sagte danke und machte ebenfalls mein Witzchen. »Gehen Sie mit mir aus, dann geb’ ich einen Teil davon für Sie aus.«
Sie kicherte wie immer, ihr Busen hob sich ein wenig, dann ergriff sie den Korb und ging hüftschwingend hinaus.
Ich riß die Oberkante der Tüte ab und schüttete ihren Inhalt auf meine Schreibunterlage. Zwei Fünf-, acht Einpfundscheine, diverses Silber, das wöchentliche Gehalt – abzüglich der Steuern versteht sich – eines Assistenzprofessors für Geschichte.
Wenn man die wöchentliche Unterkunft und Verpflegung davon abzog und Zigarettengeld und Straßenbahnkosten und das eine Pfund, das ich Jenkins schuldete, dann blieb gerade noch genug für ein Spielchen bei Manny. Aber nicht genug, nicht annähernd genug, um eine Insel und ein Boot und eine Tauchausrüstung und Vorräte und Hilfskräfte und alles andere zu kaufen, was ein Mann braucht, der damit anfängt, gesunkene Schätze zu suchen und, wenn er sie gefunden hat, zu heben.
Immerhin, es blieb ein Einsatz. Und letzte Woche hatte ich erlebt, wie ein Typ einen Fünfer zu fünfhundert und dann zu tausend und dann zu zweitausend gemacht hatte. Wonach Manny ihn in einem Mietwagen nach Hause bringen ließ und ihm sogar noch einen seiner Schläger zum sicheren Geleit mitgab. Ich hatte es erlebt. Vielleicht konnte ich das auch.
Es müßten nicht einmal zwei Tausender sein. Einer wäre schon genug. Fünfhundert für die Insel. Die Regierung von Queensland verkauft billig, wenn es kein Wasser und keine Durchfahrt und keinen sicheren Hafen gibt. Zweihundert für ein Boot – kein Kajütboot natürlich. Hundert für ein neues Sauerstoffgerät. Damit würden zweihundert für ›Sonstiges‹ übrigbleiben, wovon es freilich mehr als genug geben würde, aber es könnte klappen... wenn ich bei Manny tausend Pfund gewann.
Ich faltete den Brief des Oberstadtarchivars von Acapulco zusammen und steckte ihn ein. Ich holte das Goldstück aus der Schublade und steckte es in die Uhrtasche der Hose, als eine Art Glückspfennig. Ich zählte acht Pfund zehn Schilling ab und schloß sie in einen Umschlag ein. Wenigstens hatte ich zu essen, ein Dach überm Kopf, könnte mit der Straßenbahn zur Arbeit fahren und zwanzig Zigaretten am Tag rauchen... wenn ich die tausend Pfund bei Manny nicht gewann.
Für einen Assistenzprofessor der Geschichte ist ein privater Telefonapparat nicht drin, so daß ich die Treppe hinuntergehen und in meiner Tasche Pennies zusammensuchen mußte, um meinen Anruf tätigen zu können.
Eine lakonische Stimme sagte: »Hier ist Charlie.«
»Hier ist der Kapitän. Wo ist es heute?«
»Wie letzte Woche. Es ist eine klare Nacht.«
»Danke.«
Ich hängte ein.
Es war eine klare Nacht. Die Polizei war geschmiert und würde heute bei Manny keine Razzia machen. Ich hatte meine Chance, die tausend Pfund zu gewinnen.
Sie müssen Manny Mannix kennenlernen.
Er ist kein Waisenknabe. Brooklyn-irisch väterlicherseits, Brooklyn-italienisch von der Mutter her. Manny war Sergeant bei einer Nachschubeinheit der U.S.-Army, führte von der King’s Cross* aus einen tapferen Krieg und beschloß, als der Krieg vorüber war, in Sydney zu bleiben. Sydney war für Manny ein auf handliches Format reduziertes New York, und Manny war bereit und willens, etwas in die Hand zu nehmen.
Er mischte mit im Verkaufsgeschäft und im Schwarzmarktgeschäft und im Gebrauchtwagengeschäft und im Einwanderungsgeschäft, und als die Profite zu purzeln begannen, purzelte auch Mannix, allerdings mit einem Banksaldo, mit dem er sich ein Mietshaus und einen Anteil an einem Nachtklub verschaffen konnte und dazu eine Reihe gutsortierter Puppen, die er wegen ihrer dekorativen Wirkung gern präsentierte. Manny war nie der Typ, sich durch Liebesdinge vom Geschäft abhalten zu lassen. Manny kaufte sich auch einen kleinen Teil der für verbotene Glücksspiele zuständigen Polizeiabteilung – genug, um jedesmal einen Anruf zu erhalten, ehe die Einsatzfahrzeuge in seine Straße einbogen. Für Manny war das mehr als genug... das Leben war zu schön, um es durch eine Verurteilung zu verderben. Manny war gut angezogen, aß gut und fuhr einen Cadillac, so lang wie eine Hausseite, aber was er auch trug und wo er auch speiste, immer haftete an ihm der Gestank des Nachtlebens, der Duft verbrauchter Frauen und der Geruch schnellverdienten Geldes.
Sie müssen Manny Mannix kennenlernen.
Er nennt mich ›Kapitän‹, weil ich ihm in einem unbedachten Augenblick erzählt habe, daß ich in den letzten Kriegsjahren bei den Trobriand-Inseln einen Logger kommandierte. Er drückt mir die Hand und klopft mir auf die Schulter und bietet mir einen Drink an, den ich nie zurückweise. Während wir trinken, redet Manny. Über Manny, über Money und Manny, über Mädchen und Manny und über Mannys Pläne für Mannys Zukunft. Und während er redet, lächelt er, aber nie mit den Augen, die von den Rausschmeißern an der Tür zu den dichtgedrängten kleinen Gruppen an den Tischen wandern und den Kellnern folgen, die mit schulterhoch getragenen Tabletts voller Drinks herumlaufen. Sie müssen Manny Mannix kennenlernen.
Sie würden ihn genauso hassen wie ich; aber vielleicht würden Sie sich selbst nicht so hassen, wie ich es tue, weil ich seinen Alkohol trinke und sein Geschwätz anhöre und über seine Witze grinse, weil ich auch weiterhin an dem Privileg festhalte, mein Geld an seinen Spieltischen zu verlieren und von ihm wohlwollend auf die Schulter geklopft zu werden, wenn er mir fürs nächste Mal mehr Glück wünscht.
Sollte ich heute gewinnen, gäbe es kein nächstes Mal. Ich würde meine Chips einwechseln und gehen; und mein Gesicht einer grünen Insel und einem weißen Strand zuwenden und einem Goldschatz, dort, wo das Riff steil ins tiefe Wasser abfällt.
Ich nahm also am Mittwoch den 30. Juni um neun Uhr abends ein Taxi und fuhr hinaus, vorbei an der Flugbootrampe in Rose Bay zu einer versteckten Straße bei Vaucluse, die auf eine Anhöhe führte. Am Scheitelpunkt der geschwungenen Straße war eine hohe Steinmauer zu sehen, die nur von einem Tor aus schmiedeeisernen Stäben unterbrochen war. Das Tor war verschlossen, aber am Mauerstock war ein Klingelknopf, und als ich ihn drückte, kam ein Mann aus dem Pförtnerhäuschen. Ich sagte ihm, daß es eine klare Nacht sei. Er knüpfte kein Gespräch daran, sondern öffnete die kleine Seitenpforte und ließ mich hinein.
Ich schritt den Kiesweg zum Haus hinauf. Die Vorhänge waren zugezogen und die Rolläden herabgelassen, die Vordertür jedoch stand offen, und ich sah Männer und Frauen, die Gäste einer Cocktailparty hätten sein können, und einen Kellner in weißer Jacke, der die teppichbelegte Halle durchquerte.
Ich nickte dem triefäugigen Polen zu, der an der Tür stand, reichte ihm meinen Mantel und ging die Treppe hinauf in den großen Saal mit der Bar aus schwarzem Glas und den großen Fenstern, von denen aus man die Lichter des Hafens hätte sehen können, wenn sie offen gewesen wären – aber sie waren nie offen.
Man muß den Mond und die Sterne und den Wind, der vom weiten Wasser hereinkommt, aussperren, um so ein Geschäft wie das von Manny zu betreiben. Man muß die Fenster verhängen und das Zirpen der Grillen und den sanften Wellenschlag der brandenden Ebbe hinausschließen. Man muß Musik und Gelächter hören und das Klickern des Glücksrads und das Klackern der Spielchips, wenn sie auf dem Filztableau angehäuft oder zusammengeschoben werden. Man muß starke Drinks schmecken und abgestandenen Zigarettenrauch und muß eine armselige Illusion von Freundschaft und Gemeinsamkeit pflegen.
Wenn man ein Geschäft wie das von Manny betreibt, trägt man polierte Stiefel und messerscharf gebügelte schwarze Hosen und eine rote Nelke im Knopfloch. Man nimmt seinen Ellbogen von der Bar, wenn ein Gast kommt, gibt der Schönheit, die auf dem hintersten Barhocker posiert, einen Wink und sagt:
»Hallo Kapitän. Lange nicht blicken lassen.«
»Hallo Manny. Lange nicht flüssig gewesen.«
Ich lieferte diese Zeile mit einem kleinen Grinsen ab, und Manny lachte und verschluckte sich an seinem Zigarrenrauch. Er nahm mich am Ellbogen und bugsierte mich auf den Hocker neben das Mädchen. Er klopfte auf die Bar und rief den Kellner.
»Mach was zurecht für den Kapitän, Frank. Rosa Gin. Käpt’n, darf ich Sie einer guten Bekannten vorstellen, Miss June Dolan. June, das ist Kapitän Lundigan. Nimm dich vor ihm in acht, Süße. Du kennst ja diese Jungs von der Marine.«
Manny hustete schon wieder und grinste, und die Schöne widmete mir ein kleines professionelles Lächeln und einen langen professionellen Blick, der meine sechs Fuß Körperlänge gegen die sechs Stellen auf Mannys Konto abwog; daß ich dabei den kürzeren ziehen würde, hatte Manny natürlich schon vorher gewußt. Sonst hätte er mich ihr niemals vorgestellt.
Manny sagte: »Haben Sie heute Glück, Kapitän?«
Ich zuckte die Achseln, spreizte die Hände und zog die Mundwinkel nach unten. Das ist eine kleine Nummer, die ich sehr gut beherrsche. Jeannette sagte immer, es sei ein Stück meines jungenhaften Charmes. Im Augenblick hatte ich ein eher peinliches Gefühl dabei. Das Ganze ähnelte zu sehr dem Lächeln von Mannys abgetakelter Freundin.
»Kein besseres Gefühl als gewöhnlich, Manny. Aber es käme mir sehr gelegen, wenn’s heute liefe.«
»Das glaube ich, wem käme das nicht gelegen«, sagte Manny. »Schauen Sie, Kapitän, was halten Sie von dem hier?« Er umschloß mit seiner Hand die schlaffen Finger der Schönen und hob ihren Unterarm hoch, so daß ein schweres, mit Münzen behangenes Goldarmband sichtbar wurde.
»Das habe ich ihr heute gekauft. Der kleine Liebling hat Geburtstag, und ich dachte, das ist das Richtige für mein Baby. Ich ging also einfach ’rein und kaufte es. Hat zwar einen ganzen Batzen gekostet. Aber ich schätze, sie ist es wert. Wie gefällt’s Ihnen, Käpt’n?«
»Ich glaube, es harmoniert mit der Persönlichkeit der Dame.«
»Sehen Sie, man kann noch mehr Münzen dranhängen. Also habe ich ihr gesagt, wenn sie schön brav ist und mir Glück bringt, dann kriegt sie nach und nach an jedes Glied eine.«
»Ich brauch’ was zu trinken, Manny«, sagte die Dame. Ihre Stimme klang flach und gelangweilt.
Manny runzelte die Stirn und klopfte auf den Tresen, und der Mixer huschte herbei und füllte ihr Glas. Die Münzen klingelten müde, als sie ihre Hand von Manny löste und in ihrer Handtasche zu kramen anfing. In diesem Moment hatte ich meine verrückte Idee.
Ich holte meine Goldmünze aus der Tasche, warf sie einmal in die Luft und legte sie auf die Bar.
»A propos Münzen, Manny – haben Sie jemals so eine gesehen?« Trotz aller Beherrschung zeigte sich in Mannys Augen ein kurzes interessiertes Flackern. Er nahm die Münze, untersuchte sie und ritzte ihr mit seinem Diamantring eine winzige Kerbe in den Rand.
»Gold?«
»Reines Gold. Ich habe sie als Glücksbringer bei mir.«
Ich ließ die Münze wieder in meiner Tasche verschwinden und beobachtete mit einer Art Genugtuung das schwache Leuchten in Mannys Augen.
»Was ist das für eine Münze, Kapitän?«
»Eine spanische. Achtzehntes Jahrhundert. Es gibt da so eine Geschichte.«
»Die würde ich gern mal hören.«
Das war der Einstieg, auf den ich gewartet hatte. Manny roch Gold. Ich sagte so beiläufig wie möglich: »Tatsächlich steckt in dieser Münze sogar ein Geschäft. Eins, das für Sie interessant wäre.«
Mannys Blick verhüllte sich augenblicklich. Seine Stimme nahm den faden, uninteressierten Ton eines Hökerers an. »Sie kennen mich ja, Kapitän. An jedem Geschäft immer interessiert, wenn’s ein gutes ist – und ein sicheres. Wollen wir jetzt darüber sprechen?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Später, Manny.«
Später konnte ich tausend Pfund besitzen, dann brauchte ich mit Manny über kein Geschäft mehr zu sprechen. Ich brauchte Manny kein einziges Wort mehr zu sagen – niemals mehr.
»Dann also später, Kapitän«, sagte Manny und drehte sich wieder zur Bar und zu der welken Schönheit mit dem rundlichen Busen, der flachen Stimme und den schlauen Profiaugen.
Eine Stunde und sieben Minuten später kam ich an die Bar zurück – total abgebrannt.
* King’s Cross ist die ›Reeperbahn‹ von Sydney.
2
»Einen Drink, Käpt’n?« fragte Manny.
Ich winkte müde ab.
»Tut mir leid, Manny, einen Drink kann ich mir nicht leisten. Ich bin blank.«
Manny schnalzte mit der Zunge und winkte beruhigend ab.
»Schade, Käpt’n – sehr schade. Es kommt, und es geht. Wenn ich recht sehe, schuldet das Haus dem Verlierer einen Drink. Setzen Sie sich.«
»Nein, danke, Manny. Es ist ein netter Zug, aber ich pack’ meine Sachen.«
Ich ging in Richtung Tür, aber Manny folgte mir. Ich hatte es noch nie erlebt, daß er solche Skrupel hatte, einen blanken Gast loszuwerden.
»Kapitän?«
»Ja, Manny?«
»Sie sagten da etwas von einem Geschäft. Wollen wir in meinem Büro darüber sprechen?«
Jetzt hatte ich ihn also an der Angel. Mein Herzschlag hämmerte, und mein Mund war trocken. Ich mußte die Fäuste ballen, um meine zitternden Finger unter Kontrolle zu bringen; aber ich versuchte, so gut es ging, eine gleichgültig klingende Antwort.
»Wie Sie wollen. Ich hab’s nicht eilig.«
»Hier herein, Kapitän«, sagte Manny und schob mich durch eine ledergepolsterte Tür auf einen riesigen Neureichenteppich unter einem Leuchter aus Murano-Glas.
Die Vorhänge hatten Goldschnüre. Vor einem mit Einlegearbeiten verzierten Schreibtisch stand ein Stuhl in italienischer Walnuß mit hoher Lehne. Vor einem offenen Adam-Kamin stand ein sagenhaftes Sofa in Goldbrokat, und die Drinks holte man sich aus einem in die pastellene Holztäfelung verdeckt eingelassenen Schränkchen. Die Nobelschwulen von der King’s Cross hatten sich für Manny ins Zeug gelegt. Alles war echt, alles war teuer, und das Ganze machte einen ebenso harmonischen Eindruck wie das Foyer im ›Haus der Nationen‹... und war ebenso erdrückend.
Manny warf mir von der Seite einen Blick zu, während er sich über die Drinks beugte.
»Gefällt es Ihnen, Kapitän?«
Ich schnalzte mit der Zunge und sagte: »Es muß Sie eine Menge Geld gekostet haben, Manny.«
Er nahm das als Kompliment, grinste und sagte: »Das ist sogar mir unheimlich, wieviel. Aber immerhin arbeite ich hier, und deshalb meine ich, darf es ruhig etwas gemütlicher sein. Außerdem macht es Eindruck auf die Kundschaft.«
»Ich hätte nicht gedacht, daß Ihre Kunden jemals hier hereinkommen, Manny.«
Ich zwinkerte und lächelte ihm über den Rand meines Glases zu, mit dem sehr anzüglichen Von-Mann-zu-Mann-Lächeln, das einem Mann wie Manny die Brust anschwellen und ihn vergessen läßt, daß er sich kaufen muß, was andere Männer nur der Liebe wegen bekommen. Manny zwinkerte zurück und hob sein Glas.
»Auf die Mädchen... Gott segne sie!«
Wir tranken. Dann winkte Manny mich auf das Sofa, während er selbst mit dem Rücken an dem Adam-Kamin lehnte, die Ellbogen auf den Marmorsims gestützt. Ich kannte diese Taktik. Es ist schwer, im Sitzen jemandem etwas zu verkaufen, der steht. Sie sollten es einmal versuchen. Ich entschied mich, es mir so bequem wie möglich zu machen. Ich lehnte mich tief in den Goldbrokat zurück, schlug meine Beine übereinander und versuchte, entspannt dazusitzen, während ich darauf wartete, daß Manny das Gespräch eröffnete.
Mannys Augen waren wieder verschleiert wie die eines Vogels, so daß kein Leuchten und kein Glanz darin zu sehen war. Als er redete, war seine Stimme weich, beinahe liebevoll.
»In welchem Geschäftszweig sind Sie tätig, Kapitän?«
»Was tut das zur Sache?«
Manny zwickte die Spitze einer teuren Zigarre ab und brannte sie umständlich an. Als sie richtig zog, blies er eine Rauchwolke von sich und deutete mit der Zigarre zur Tür. »Dort draußen an den Tischen – nein, da interessiert das nicht. Jeder zahlt für seine Drinks. Wenn sie verlieren, zahlen sie für die Chips. Wenn sie gewinnen, machen sie kein Aufsehen. Sonst will ich nichts von ihnen wissen. Sie sind so einer, Kapitän. Ich sehe Sie gern bei mir. Aber das hier ist was anderes. Hier geht es ums Geschäft. Da muß man zusammenarbeiten. Deshalb muß ich über Sie Bescheid wissen.«
Ich lächelte ihn an – nett und freundlich, ohne jeden böswilligen Hintergedanken. Ich sagte: »Nur aus Neugier, Manny – was glauben Sie, was ich so treibe?«
Manny stieß noch mehr Rauch aus und verzog den Mund und sagte: »Das habe ich schon öfter herauszubekommen versucht, Kapitän. Sie sind nicht beim Militär, obwohl Sie ein Militärgesicht haben. Wahrscheinlich verliert das keiner, der ’mal bei der Marine war. Sie könnten in der Wollbranche sein, aber dafür geben Sie zuwenig aus. Sie spielen vorsichtig, und wenn Sie keine Chips mehr haben, hören Sie auf. Sie könnten Vertreter sein, wenn Sie auch nicht gerade wie ein Verkäufer aussehen. Arzt, Zahnarzt vielleicht. Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht draufgekommen.«
»Ich bin Historiker.«
Die Zigarre fiel ihm fast aus dem Mund.
»Was?«
»Historiker. Ich halte Vorlesungen an der Universität von Sydney.« Manny war verdutzt. Man sah es trotz des Schleiers, der seine Pupillen überzog. Ich hatte einen Fuß drin. Wenn ich ihn dortbehielt, hätte ich vielleicht eine Chance. Manny gönnte sich eine Erholungspause, bevor er seine nächste Frage abschoß.
»Was bringt das ein?«
»Elfhundert im Jahr... zwölf mit Zusatzvorlesungen.«
»Taschengeld«, sagte Manny, knapp und treffend. »Für einen Kerl mit Köpfchen – ein Taschengeld.«
»Deswegen bin ich an Geschäften interessiert.«
Many schüttelte den Kopf. »Für Geschäfte braucht man Kapital. Was haben Sie?«
Ich stand auf und warf die Münze noch einmal vor seiner Nase hoch. »Ich habe das da.«
»Was ist sie wert?«
»Der Goldwert? – Etwa sechs australische Pfund. Der Sammlerwert – ungefähr dreißig. Ich habe sie schätzen lassen.«
»Damit können Sie vielleicht ins Popcorngeschäft einsteigen, Käpt’n, aber für Manny Mannix ist das nichts.«
Jetzt war der kritische Augenblick da. Wenn ich jetzt etwas Falsches sagte, war ich verloren und mein Schatzschiff ebenso. Ich sagte nichts, sondern lächelte. Ich ging mit meinem Glas zu dem Schränkchen hinüber und machte mir noch einen Drink. Das verwirrte Manny wieder etwas; verwirrte ihn und machte ihn neugierig. Ich brachte meinen Drink zum Kamin zurück und prostete ihm zu. Dann sagte ich: »Das Schlimme mit Leuten Ihres Schlages, Manny, ist, daß sie glauben, sie wüßten alle Antworten. Aber niemand kann Ihnen das erzählen, was ich Ihnen erzählen kann.«
Manny lief rot an, beherrschte sich aber.
»Und Sie glauben, mir etwas erzählen zu können, Kapitän. Ich habe alles, was ich will... und für alles habe ich bezahlt, mit Geld, das auf der Bank gespart war. Was können Sie mir schon erzählen, das ich noch nicht weiß?«
»Woher diese Münze kommt, zum Beispiel.«
»Nun spucken Sie’s schon aus. Woher kommt sie?«
»Von einer spanischen Galeone, die von Acapulco aus im Oktober 1732 in Richtung Manila auslief und mit Mann und Maus gesunken ist.« Mannys Miene entspannte sich, und er grinste skeptisch.
»Geschichten von versunkenen Schätzen, huhu? Der älteste Bauernfängertrick, den es gibt. Haben Sie auch eine Karte? Eine alte Piratenkarte vielleicht? Die kaufe ich für fünf Dollar das Stück überall in der Karibik. Die Eingeborenen machen sie für die Touristen wie die Schrumpfköpfe.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Nein, keine Karte.«
»Also, weiter, was haben Sie noch?«
Ich zog den Brief aus meiner Tasche und hielt ihn ihm hin. Er las ihn sorgfältig und versuchte, aus den Höflichkeitsfloskeln und dem gespreizten Englisch die Tatsachen herauszufiltern. Dann sah er mich an und klopfte mit dem Daumen auf den Brief.
»Ist der echt?«
»Ja. Niemand fälscht Ihnen so ein Dokument. Kostet auch nur ein Telegramm, um herauszufinden, ob es echt oder falsch ist.«
Manny nickte. So weit hatte er die Sache verstanden.
»Ja... ja. Kann stimmen. Aber der Brief sagt nicht genug. Es gab da ein Schatzschiff. Diese Münze könnte von ihm stammen. Es steht hier nicht, daß sie wirklich von ihm stammt.«
»Genau an diesem Punkt komme ich ins Spiel. Ich bin Historiker, wie ich Ihnen sagte. Es ist mein Beruf, historische Beweise zu suchen, abzuwägen und ihren Wert zu bestimmen. Ich habe genug Beweise beisammen, die zeigen, daß die vermißte Galeone in der Nähe der Stelle gesunken sein könnte, wo ich die Münze gefunden habe.«
»Wo war das?«
Jetzt war ich mir seiner sicher. Er fuchtelte nicht mehr mit der Zigarre herum. Der Schleier vor seinen Pupillen war verschwunden, und ich erkannte Begierde und Neugier und das kalte Kalkül des Händlers, der Kosten gegen Nutzen aufrechnet und seine Profitrate abschätzt. Ich hatte ihn jetzt besser unter Kontrolle, wie einen müden Fisch, der nicht mehr lange kämpfen wird. Ich redete eine deutliche Sprache.
»Die Stelle ist mein Geheimnis. Ich kenne sie. Ich habe diese Münze selbst dort gefunden. Ich werde es erst sagen, wenn wir einen gültigen Vertrag gemacht und unterschrieben haben.«
»Wieviel wollen Sie?«
»Gegen den halben Anteil – tausend Pfund und alle anfallenden Kosten.«
Jetzt war es heraus. Die Chips waren gesetzt. Es gab nichts mehr zu tun oder zu sagen. Jetzt mußte Manny Mannix ausspielen.
Aber Manny war noch nicht bereit zu einem Angebot. Er hatte noch Fragen.
»Angenommen, wir würden dieses Schiff finden – dort, wo es Ihrer Meinung nach liegt –, wieviel von diesem Zeug wäre da wohl drin?«
»Im Brief steht, zwanzig Kisten Gold. Ich habe keine Ahnung, wieviel das wert sein könnte... zwanzigtausend, dreißig..., so in etwa; könnte natürlich auch viel mehr sein.«
»Könnte sein. Könnte auch sein, daß das Ganze sich als taube Nuß herausstellt, dann haben wir nämlich gar nichts.«
»Könnte sein«, gab ich zu. »Ist aber nicht so. Ich weiß es. Meine Frau und ich haben die Münze selbst heraufgeholt.«
Manny warf mir einen schnellen, forschenden Blick zu. »Sie sagten mir nichts davon, daß Sie verheiratet sind.«
»Meine Frau ist einen Monat nach der Hochzeit gestorben.«
Manny gluckste und sagte: »Ihr Pech.« Dann kam die nächste Frage. »Sie sagten, Sie wollen tausend für sich und alle anfallenden Kosten. Was für Kosten sind denn das, Kapitän?«
»Zweitausend Pfund – plusminus etwas. Man könnte es für weniger machen, aber das würde mehr Arbeit kosten.«
»Was ist denn da alles miteingerechnet?«
Manny war so offenkundig interessiert, wir waren so offenkundig vom spekulativen Feilschen zu praktischen Überlegungen vorgedrungen, daß ich meine Vorsicht vergaß.
Ich beantwortete seine Frage, klar und einfach.
»Fünfhundert, um die Insel zu kaufen. Damit hätten wir die Land- und Wasserrechte und unterlägen nicht mehr dem Ablieferungsgesetz. Dann ein Kajütboot, Sauerstoffgeräte und Vorräte und vielleicht einen Berufstaucher für die letzte Phase. Wenn wir uns einig werden, könnte ich Ihnen eine genaue Aufstellung machen.«
Ich hatte meine eigene Fallgrube ausgehoben und ging fröhlich pfeifend hinein; damals allerdings wußte ich das noch nicht. Ich wußte es erst viel später. Damals wußte ich nicht einmal, warum Manny lächelte. Als er unseren dritten Drink mixen ging, glaubte ich, er wolle damit unsere Vereinbarung besiegeln. Das zeigte, daß ich Manny nicht kannte. Es zeigte, daß ich das war, wofür Manny mich hielt: ein einfältiger Historiker, der die grundsätzlichen Lehren aus der Geschichte nicht gezogen hatte: die blinde Eitelkeit des menschlichen Wünschens, den Wankelmut der Frauen und die Tatsache, daß ein Dummkopf niemals eine gerechte Chance erhält – weil er keine verdient.
Manny kam mit den Drinks zurück. Wir erhoben unsere Gläser und lächelten uns über die Ränder zu. Dann sagte Manny, ganz sanft: »Tut mir leid, Käpt’n... aus dem Geschäft wird nichts.«
Es war so endgültig wie ein Schlag ins Gesicht. Und Manny lächelte und lächelte und lächelte.
Ich lächelte nicht. Ich fühlte mich krank, müde und gedemütigt, und ich wollte nach Hause gehen. Dann holte Manny zu einem letzten Schlag aus.
»Ich mache Ihnen ein Angebot, Kapitän. Damit Sie sehen, daß ich es gut mit Ihnen meine, kaufe ich Ihnen die Münze für den Marktpreis ab – dreißig Pfund. Wird an dem Armband der Kleinen hübsch aussehen.« Jetzt lachte ich selbst. Gott weiß warum, aber ich lachte. Ich warf die Münze, fing sie auf und sagte zu Manny: »Spendieren Sie mir dazu noch einen Kuraufenthalt an Ihrer Bar heut’ nacht, und die Sache ist gemacht.«
Manny sah mich mit kühler Verachtung an, ging dann zu seinem Schreibtisch hinüber und zählte dreißig Pfund in knisternden neuen Banknoten ab. Er spannte einen Gummi um das Bündel und legte es flach in meine ausgestreckte Hand. Er sagte: »Wenn Sie gescheit sind, Käpt’n, bleiben Sie von den Tischen weg und halten sich an die Bar. Die Drinks gehen auf Rechnung des Hauses, wie Sie verlangt haben.«
»Danke, Manny«, sagte ich, »danke und gute Nacht.«
»Gute Nacht«, sagte Manny, »gute Nacht, Dummkopf.«
Ich weiß noch, daß ich zur Bar ging und einen doppelten Scotch bestellte.
Danach nichts mehr.
Um neun Uhr am nächsten Morgen fand mich der Dekan der Universität schnarchend zwischen den Ziersträuchern seines Vorgartens.
Um vier Uhr nachmittags desselben Tages nahm die Fakultät mein Entlassungsersuchen an und gewährte mir ein Monatsgehalt anstelle einer fristlosen Kündigung. Ich stand da mit einem schrillen Katzenjammer, ohne Job, ohne Aussichten und mit etwas über hundert Pfund Bargeld. Manny war nämlich gut zu mir gewesen. Bevor er mich auf die Straße beförderte, hatte er seine dreißig Pfund in meiner Brusttasche angeheftet und einen Zettel dazugesteckt:
»Ihr Pech, Kapitän. Es war ein nettes Spielchen.«
Das ist Manny. Ein freundlicher Mensch mit Sinn für Humor.
3
Freitagmorgen ging ich eine Schuld einkassieren.
Ich nahm den Frühzug nach Camden, einem kleinen schmucken Städtchen, das seinen Wohlstand dem ältesten eingewanderten Geldadel des jüngsten Landes der Erde verdankt. Die grünen Grasflächen kriechen hier bis zu den Türschwellen hinauf, und die schwarze Asphaltstraße windet sich durch Hektar um Hektar sanftgewelltes, saftiges Weideland, das gesprenkelt aussieht durch die Schattenflecken der großen weißen Gummibäume und der Weiden, die den Lauf der kleinen Siedlungsbäche markieren. Die graugetönten Häuser sind weit ins Innere des eingezäunten Besitzes hineingebaut, und die Familien, denen sie gehören, leiten sich vom ersten Schiffskonvoi ab und von den rüden, rauhbeinigen Zeiten der Sträflingskolonie.
Es ist Zuchtland, alles hier herum. Milchkuhland, Merinoschafland, flaches Pferdezüchterland, in dem nie Trockenheit herrscht und die Bäche nie austrocknen und die Wurzeln tief hinunterreichen und wo für mich, einen wurzellosen Menschen aus der Großstadt, kein Platz war.
In Camden nahm ich ein Taxi und fuhr fünf Meilen auf der Hauptstraße hinaus bis zu einem Gitterdrahttor, über das sich, nach Art einer Pergola, eine Inschrift erhob – ›McAndrew-Gestüt‹. Man geht noch ein ganz schönes Stück vom Tor bis zum Siedlungshaus, so machte der Taxifahrer erstaunte Augen, als ich hier bereits zahlte und ihm sagte, er solle mich in einer Stunde wieder abholen.
Er konnte nicht wissen, daß ich mich meines Vorhabens und meiner selbst schämte und den Fußmarsch unter den blühenden Gummibäumen nötig hatte, um mich auf mein Treffen mit Alistair McAndrew vorzubereiten.
Der Fahrweg stieg eine Zeitlang sanft bergan und neigte sich dann hinab zum Haus, einem niedrigen, weitläufigen, zwischen Zieranpflanzungen eingebetteten Sandsteingebäude, das umringt war von weißen Nebenbauten und den Zäunen der Hauskoppeln.
Zur Linken lag eine weite Weidefläche, auf der ein Teil des McAndrew-Kapitals graste. Rechts war eine kleine gelbbraune Einfriedung, wo eine Gruppe Leute zuschaute, wie ein Fohlen unter den Sattel gezwungen wurde.
McAndrew war einer von ihnen – ein stämmiger, schwarzhaariger, keltischer Typ in Khakihemd und Reithosen.
Er lehnte am Koppelgeländer in der lässigen Haltung der Landleute, aber seinen von Runzeln eingerahmten Augen entging keine Einzelheit des Vorgangs, und von Zeit zu Zeit rief er dem Zureiter im Sattel ein leises Kommando zu. Beim Geräusch meiner Schritte drehte er sich um, zögerte einen Moment und kam dann mit breitem Grinsen und ausgestreckter Hand auf mich zu.
»Lundigan! Hol’ mich der Teufel! Das freut mich, dich zu sehen.«
Ich lächelte blöde und drückte seine Hand und sagte die banalen Worte:
»Guten Tag, Mac.«
»Was treibt dich hier heraus in die Camdener Gegend?«
»Nun ja, ich... ich wollte dich sehen, Mac. Natürlich nur, wenn du Zeit hast.«
Meine Stimme oder meine Augen schienen mich verraten zu haben, denn er schaute mich mit einem merkwürdig besorgten Blick an und sagte: »Natürlich. Für dich immer. Entschuldige, noch eine Minute, ich muß den Jungs ein paar Dinge sagen.«
Ich sah ihm zu, wie er sich umdrehte und den um die Zureitkoppel Herumstehenden seine Anweisungen gab. Er ging selbstbewußt, seine Stimme verriet Autorität; ein Mann, der sein eigener Herr war und mit seinen Leuten und seinen Pferden und seinen gesprenkelten Weiden friedlich lebte. Mir fiel der Tag wieder ein, an dem ich ihn auf einer der Trobriand-Inseln über den Strand geschleppt hatte, ein gelbes, abgemagertes Knochengerüst, der letzte Überlebende eines Pioniertrupps, den die Japaner zwei Tage nach ihrer Landung in Stücke gehauen hatten. Geschüttelt vom Malariafieber, von Ruhrkrämpfen zusammengeschnürt, hatte er sich bis zum Sammelpunkt durchgeschlagen, und wir hatten ihn unter dem Beschuß einer in dem Palmenwäldchen verschanzten Patrouille weggebracht... und jetzt kam ich und präsentierte die Rechnung.
McAndrew kam zurück, und wir gingen zusammen aufs Haus zu.
»Es ist lange her, Renn.«
»Elf Jahre... zwölf. Ja... eine lange Zeit, Mac.«
»Meine Frau ist heute in der Stadt. Sie würde dich gern kennenlernen. Du bleibst natürlich hier. Ich muß dir eine Menge zeigen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, Mac. Ich muß in einer Stunde wieder weg.«
Das brachte ihn in Verlegenheit und verletzte ihn auch ein wenig. Er insistierte.
»Aber du kannst doch nicht herkommen und gleich wieder rausstürmen. Natürlich mußt du bleiben.«
»Hör dir lieber erst einmal an, warum ich hier bin.«
Es war eine unhöflich trockene Antwort einem Mann gegenüber, den man zwölf Jahre lang nicht gesehen hat; andererseits, was hätte ich sagen sollen? Ich kam mir linkisch, tölpelhaft vor. Ich bereute schon, überhaupt gekommen zu sein.