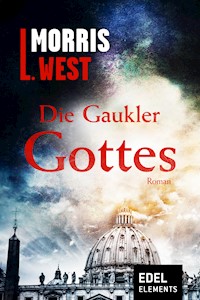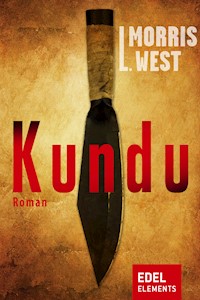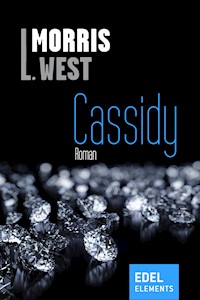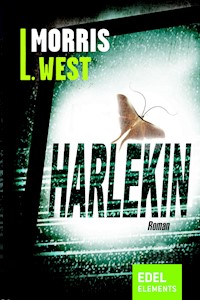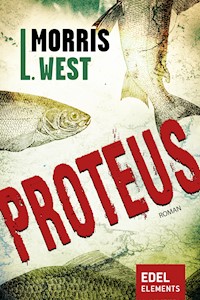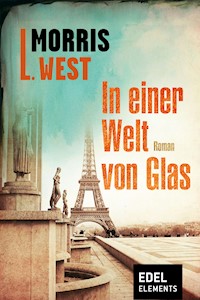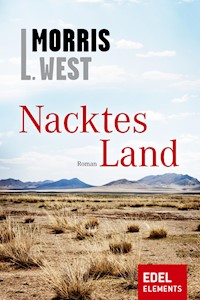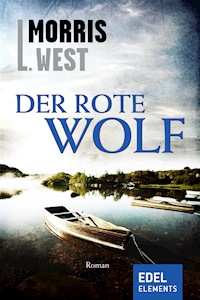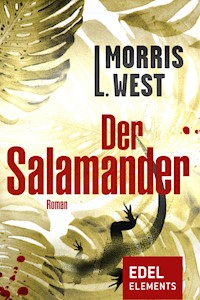Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Typisch Morris L. West: Ein meisterhaft erzählter Roman voller Spannung, Dramatik und Leidenschaft! Der Erdölexperte McCreary wird in Djakarta für eine private Bohrung angeheuert. Bald jedoch bemerkt er, daß er einem Schwindel aufgesessen ist. Doch aussteigen kann er nicht mehr – weil ihn sein Auftraggeber in einen Mord verwickelt hat. Als sich McCreary zudem in die schöne vietnamesische Geliebte seines Auftraggebers verliebt, bleibt den beiden nur ein Ausweg: Sie begeben sich auf eine Flucht voller lebensgefährlicher Abenteuer...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Morris L. West
Die Konkubine
Roman
Ins Deutsche übertragen von Werner Peterich
Edel eBooks
Das Buch
Ein Job ist so gut wie jeder andere, denkt McCreary, der Erdölexperte irischer Abstammung, als ihm in Djakarta von Mr. Walkerton der Vorschlag gemacht wird, für ihn eine private Bohrung durchzuführen. Aber schon bald muß er entdecken, daß er in die Maschen eines großangelegten Schwindelunternehmens geraten ist. Doch zu diesem Zeitpunkt kann er aus dem Geschäft nicht mehr aussteigen, da ihn Walkerton in einen Mordfall verwickelt hat. So tut McCreary das einzig Vernünftige: Er beschließt, das Spiel mitzuspielen.
An Bord von Walkertons Luxusjacht, die ihn zu der exotischen Bohrinsel bringen soll, verliebt er sich in Walkertons Begleiterin, eine wunderschöne Vietnamesin. Damit beginnt ein dramatisches Geschehen, in dem die beiden Liebenden immer neue Gefahren zu bestehen haben.
1
Als er erwachte, war es früher Nachmittag.
Das erste, was er sah, war der altmodische Ventilator, der langsam und völlig wirkungslos in der stickigen Luft rotierte. Er verursachte nicht den geringsten Luftzug, sondern nur ein schläfriges Summen, als wäre die Spindel abgenutzt und müßte geölt werden. Dann erkannte er das Sonnenlicht, das durch die Ritzen der Jalousien aus Spanisch Rohr hereindrang.
Das reichte fürs erste.
Er lag in einem Bett, in einem Zimmer mit Ventilator. Und es war Tag. Alles andere konnte warten, bis er wieder bei Kräften war, um sich damit auseinanderzusetzen. Er schloß die Augen wieder. Seine Zunge war trocken, und er hatte einen bitteren, metallischen Geschmack im Mund. Seine Haut hingegen war feuchtkalt und roch durchdringend. Als er versuchte, sich zu bewegen, zeigte es sich, daß seine Muskeln schlaff waren und nicht so recht gehorchen wollten.
Ihm fiel ein, daß er Fieber gehabt hatte.
Müßig sann er darüber nach, wie lange der Anfall gedauert hatte und ob jemand gekommen war, sich um ihn zu kümmern. Irgend jemand mußte das getan haben. Man hatte ihn ausgezogen, denn er lag nackt unter dem Leintuch. Irgendwie erinnerte er sich an Stimmen und daran, daß jemand ihm die Stirn abgetrocknet und den Kopf hochgehalten hatte, während ihm jemand anders ein Glas an die klappernden Zähne hielt. Hände und Stimmen, aber keine Gesichter und keine Namen.
Vorsichtig schlug er die Augen auf, und er drehte den Kopf. Er sah ein Nachtschränkchen aus rotem geschnitztem Holz, darauf einen halbvollen Krug mit Wasser und ein großes Glas. Er stemmte sich hoch, bis er saß, und schenkte sich Wasser ein. Seine Hand zitterte, der Krug klirrte gegen das Glas und etwas Wasser schwappte auf die Tischplatte. Das Wasser war eine Enttäuschung. Es war warm und fade, und auch den bitteren Geschmack hatte er noch im Mund, nachdem er getrunken hatte. Er stellte das Glas wieder hin und sah sich im Zimmer um: ein schmales Flügelfenster mit der Jalousie aus Spanisch Rohr davor, weiße Wände, ein Schrank, eine Frisierkommode und ein Schreibtisch – alles aus dem gleichen roten Holz; ein Stuhl aus Flechtwerk, darauf ein Kissen mit Batikbezug; zwei Türen, an einer davon ein gerahmter Anschlag.
Jetzt fiel ihm alles übrige wieder ein.
Er war in einem Hotel – dem Tanjil-Hotel in Djakarta. Er war von Pakanbaru auf Sumatra hierhergeflogen, und das Fieber hatte ihn ganz unversehens eine Stunde nach seiner Ankunft gepackt – eine zermürbende, zähneklappernde Agonie, die in Dunkelheit geendet hatte. Er hieß Mike McCreary, und er war ein Öl-Mann ohne Job.
Er trank noch ein Glas Wasser, schlug dann das Laken zurück, ließ sich aus dem Bett gleiten und hielt sich so lange am Nachtschränkchen fest, bis der erste Schwindel vorüber war. Dann ging er langsam über den glänzenden Fußboden zum Badezimmer hinüber. Aus dem Rasierspiegel starrte ihn ein ausgemergeltes gelbes Gesicht entgegen: ein irisches Gesicht mit leuchtenden, pfiffigen, tief in den Höhlen liegenden Augen, einer neugierigen Nase und einem dünnen Mund, der einnehmend grinsen konnte, wenn er glücklich war, und wie ein Tellereisen geschlossen blieb, wenn ihn etwas bedrückte wie jetzt.
Denn McCreary lag praktisch auf der Straße, war völlig pleite, und viele Tausend Meilen von seiner irischen Heimat entfernt.
Mit unsicherer Hand rasierte er sich sehr sorgfältig und rieb sich hinterher mit einer After-Shave-Lotion das Gesicht ein. Dann drehte er die Dusche auf, stand lange unter der Brause, seifte sich ein und spülte den Schaum fort, bis der Fiebergeruch von seiner Haut verschwunden war und er sich wieder frisch fühlte. Anschließend kehrte er ins Schlafzimmer zurück, rubbelte sich mit dem Handtuch ab und stand dabei nackt unter dem träge sich drehenden, leise summenden Ventilator. Kaum war er trocken, trieb die brütende Hitze ihm wieder den Schweiß aus allen Poren; nach einer Weile gab er es auf, sich zu frottieren, zog sich an und pfiff dabei die nicht ganz richtige Melodie von »The Raftery Little Red Fox«, einem Lied, das die Flößer daheim in der Grafschaft Kerry sangen, unbeschwerte Männer, die immer auf der Walze waren genauso wie er selbst.
Es wurde an die Tür geklopft. McCreary hörte auf zu pfeifen und rief: »Herein!« Die Tür ging auf, und Hauptmann Nasa trat ein.
Nasa war ein kleiner, gedrungener Javaner mit einem verzerrten Lächeln und einer sanften Stimme. Er trug einen grauen Tropenanzug von militärischem Schnitt und dazu einen schwarzen, schief auf seinem Kopf sitzenden Fez. Er schloß die Tür hinter sich und verneigte sich steif.
»Guten Tag, Mr. McCreary.«
McCreary sagte: »Guten Tag«, und ließ sich nicht dabei stören, seine Krawatte zu binden. Hauptmann Nasa holte eine Zigarette hervor, klopfte sie auf dem Daumennagel zurecht und zündete sie sich an. Durch den Rauch hindurch grinste er McCreary an.
»Sie sind ziemlich krank gewesen, mein Freund. Wie fühlen Sie sich jetzt?«
McCreary zuckte mit den Achseln.
»Ich weiß es noch gar nicht richtig. Ich bin eben erst aufgestanden.«
»Fühlen Sie sich schwach?«
»Was erwarten Sie sonst?«
Hauptmann Nasa lächelte, schnalzte mit der Zunge und nahm noch einen Zug aus der Zigarette.
»Morgen werden Sie sich besser fühlen.«
»Hoffentlich«, sagte McCreary ohne rechte Überzeugung.
»Dann hole ich Sie morgen mittag ab und begleite Sie hinaus zum Flugplatz.«
McCreary drehte sich langsam um und baute sich vor ihm auf.
»Sie haben es eilig, mich loszuwerden, was?«
»Der Ausweisungsbefehl ist bereits seit einigen Tagen in Kraft«, erklärte Nasa glatt. »Ich habe den Auftrag, ihn so rasch wie möglich zur Durchführung zu bringen. Und bis dahin…« Er betrachtete den Rücken seiner kleinen braunen Hände. »…bis dahin wäre es mir sehr lieb, Sie würden das Hotel nicht verlassen. Es ist für einen Europäer nicht ratsam, sich in dieser Stadt zu bewegen, wenn seine Papiere nicht in Ordnung sind.«
»Das kann ich mir vorstellen«, erklärte McCreary.
»Dann also bis morgen mittag?«
»Ich werde Sie erwarten.«
»Guten Tag, Mr. McCreary.«
»Sie können mich mal, Hauptmann«, sagte McCreary leise.
Nasa verneigte sich nochmals und verließ leichtfüßig und gewissermaßen auf Zehenspitzen wie ein Tänzer das Zimmer. McCreary wartete, bis die Tür sich hinter seinem Besucher geschlossen hatte, dann tat er sich keinen Zwang mehr an und stieß einen Schwall von saftigen Flüchen aus. Nasa war Polizeibeamter – der Vertreter von Recht und Ordnung –, aber das Gesetz ging seltsame Wege in dieser weit verstreuten, eigenartigen Republik aus dreitausend Inseln mit ihren neunundsiebzig Millionen Seelen. Es funktionierte besser, wenn man das Getriebe ein wenig ölte. Nur bestanden McCrearys Habseligkeiten aus nichts weiter denn einem Flugticket nach Singapur und einem Monatslohn in indonesischen Rupiahs – sowie dem sprichwörtlichen Glück der Iren.
Mit dem Flugticket wurde er von einem Gestade zum anderen getragen. Von den Rupiahs konnte er zwanzig Prozent abschreiben, wenn sie erst einmal durch die Hände der Wechselhaie gegangen waren. Und das sprichwörtliche Glück der Iren schien ihn verlassen zu haben.
McCreary zog sein Jackett über, ging in die Halle hinunter und bestellte sich dort einen Gin-Sling sowie eine Strait Times. Er fand, es sei an der Zeit, sich nach einem Job in Singapur umzusehen. Doch noch ehe er die Zeitung überhaupt aufgeschlagen hatte, wußte er daß er nur seine Zeit verschwendete. Singapur, Saigon Bangkok, Hongkong – Durchgangsstationen, Lumpenstädte. Dort war nichts für ihn zu holen.
Es war überhaupt nirgends etwas für ihn zu holen, außer dort, wo die riesigen Stahlskelette in den Himmel ragten und knirschendes Bohrgestänge sich durch tiefe Bodenschichten und Felsen hindurch in den schwarzen Sand hineinfraß, in das Eingeweide der Erde. Er war ein Öl-Mann, kein Bürohengst oder eine Krämerseele. Er war Bohrfachmann, und sein Platz war hier, auf den Inseln, oder drüben in Amerika, oder in Neuguinea, höchstens noch am Rand der australischen Wüste.
Öl – das war jedoch ein tückisches Geschäft, ein politisches Geschäft. Ihrer Konzessionen wegen waren die großen Gesellschaften auf die Gunst ausländischer Regierungen und auf die kostspielige Zusammenarbeit mit den Beamten der örtlichen Behörden angewiesen. Man ließ lieber die Finger von einem Mann, der es nicht fertigbrachte, sich und seine Fäuste zu beherrschen und den Mund zu halten. Nach dieser Geschichte in Pakanbaru konnte er Gift drauf nehmen, daß sein Name auf der Schwarzen Liste stand; ihm blieb nichts anderes übrig, als sich an die kleineren Firmen zu halten, die sich in den Randgebieten auf riskante Unternehmungen einließen – vorausgesetzt, es gelang ihm, dorthin zu kommen.
Er gab es auf, die Anzeigen durchzusehen, und wandte sich einem halbseitigen Artikel über die neue Fächertänzerin zu, die im »Golden Dragon« auftrat. Doch selbst eine eurasische Fächertänzerin vermochte nicht, ihn von den Drinks, der drückend feuchten Treibhausluft und dem Summen der Ventilatoren loszureißen. Die Buchstaben tanzten vor seinen Augen, und die schwülstige Prosa des Schreiberlings aus Singapur ergab überhaupt keinen Sinn für ihn.
Dann drang eine Stimme an sein Ohr, eine englische Stimme, allerdings hoch und schrill wie das Gepiepse einer Fledermaus.
»Sind Sie McCreary?«
Er sah erschrocken auf und erblickte einen stämmigen untersetzten Mann in rohseidenem Anzug. Sein Haar war schwarz, die Farbe seiner Augen graugrün, seine Nase wie der Schnabel eines Raubvogels und sein Mund über dem kantigen Kinn klein und rot wie der einer Frau. Seine Gesichtsfarbe war leichenweiß bis auf jene Stellen, wo sich am Kinn dunkler Bartwuchs zeigte. Seine Hände waren gedrungen, knubbelig und schwarz behaart. Es fiel einem schwer, diesen Mann mit der piepsigen, hohen Stimme in Verbindung zu bringen. McCreary sah ihn einen Augenblick an, ehe er ihm antwortete.
»Ich bin McCreary. Und wer sind Sie?«
»Walkerton. Was dagegen, wenn ich mich setze?«
»Nur zu!«
Der Mann nahm Platz und tupfte sich die Stirn mit einem seidenen Taschentuch. Dann holte er ein Etui mit dicken Zigarren heraus und bot McCreary eine an.
»Nein, vielen Dank, ich rauche Zigaretten.«
Walkerton steckte das Etui wieder in die Tasche und legte die dicken Hände flach auf den Tisch. Er schob sich in seinen Sessel zurück und lächelte McCreary an.
»Wie ich höre, sind Sie in Schwierigkeiten, mein Freund.«
»Soso?« sagte McCreary nachsichtig. »Was haben Sie gehört und wo?«
»Sie haben für die Palmex in Pakanbaru gebohrt. Dort haben Sie einen sudanesischen Arbeiter zusammengeschlagen, der Sie bei der Polizei anzeigte. Die Firma wollte nichts mit der ganzen Sache zu tun haben und lehnte jede Verantwortung ab, woraufhin die Polizei einen Ausweisungsbefehl für Sie ausstellte. Drei Tage lang haben Sie dann hier auf der Nase gelegen, und morgen sollen Sie mit der Zwei-Uhr-Maschine Djakarta verlassen. Stimmt’s?«
»Das ist ein Teil der Geschichte.«
»Und der andere?«
»Eigentlich geht es Sie ja nichts an«, sagte McCreary mit seiner weichen irischen Aussprache, »aber der Bursche hat durch bloße Unachtsamkeit einen neuen Bohrmeißel und zehn Meter Futterrohr kaputtgemacht. Das hat uns mit unserer Arbeit um einen ganzen Monat zurückgeworfen. Ich hatte ihn schon ein dutzendmal gewarnt, aber diesmal habe ich zugeschlagen.«
»Ein Ausrutscher, der einen teuer zu stehen kommen kann.«
»Nun, die Rechnung habe ich zu bezahlen. Was kümmert Sie das?«
»Es kümmert mich nicht, Mr. McCreary – ich bin nur interessiert.«
»Warum?«
»Ich möchte Ihnen einen Job anbieten.«
Ohne zu begreifen, starrte McCreary ihn an.
»Ich verstehe nicht.«
»Sind Sie interessiert?«
»Klar bin ich interessiert. Was für einen Job denn? Und wo?«
»Lassen Sie uns was zusammen trinken, ja?« sagte Walkerton mit seiner hohen Fistelstimme.
Er klatschte in die Hände, und ein Malaienboy mit albernem Kopftuch und in einem gebatikten Sarong eilte herbei, um seine Bestellung entgegenzunehmen. Während sie auf ihre Drinks warteten, rauchte McCreary eine Zigarette, und Walkerton beobachtete ihn ironisch und belustigt. Unvermittelt fragte er dann:
»Wie alt sind Sie, McCreary?«
»Achtunddreißig.«
»Verheiratet?«
»Nein.«
»Irgendwelche Laster?«
»Nur die üblichen.«
»Ein bißchen jähzornig?«
»Ich kann nun mal nicht mit Dummköpfen auskommen. Und ich hasse schlampige Arbeit.«
Walkerton nickte zustimmend.
»Das würde ich positiv bewerten. Und jetzt sagen Sie mir mal, wie ist es um Ihren Ehrgeiz bestellt?«
McCreary grinste ihn zwischen zwei Zügen aus seiner Zigarette an. »Das ist die verrückteste Frage, die man mir jemals gestellt hat.«
»Haben Sie denn keinen Ehrgeiz?«
»Klar hab’ ich den, aber ich weiß nicht recht, ob Sie mich verstehen, wenn ich es Ihnen erkläre.«
»Sie können’s ja mal versuchen.«
McCrearys Blick verschleierte sich. Mit einer unerwarteten Geste drückte er seine Zigarette aus und lehnte sich über den Tisch vor.
»Ich hab’ keine Ahnung, wer Sie sind, Walkerton, oder was Sie wollen. Ich weiß auch nicht, ob Ihnen meine Antwort gefallen wird, aber das ist mir ziemlich schnurz. Sei’s drum. Ich bin ein verrückter Ire, den’s in den Füßen juckt und der sein Zuhause auf dem Rücken trägt. Das einzige, wovon ich wirklich was verstehe, ist, Löcher in die Erde zu bohren, um an Öl ranzukommen. Der einzige Ehrgeiz, den ich habe, besteht darin, genug Geld zu machen, um damit zwanzig Meilen außerhalb von Dublin ein kleines Gestüt zu kaufen und zu versuchen, einen Gewinner des Grand National zu züchten. Wenn Sie jetzt lachen wollen – bitte schön!«
»Das fällt mir gar nicht ein«, sagte Walkerton. »Sie interessieren sich also für Geld?«
McCreary zuckte mit den Achseln und sagte: »Wer tut das nicht?«
In diesem Augenblick kam der Boy mit den Drinks. Walkerton zahlte, wartete, bis der Junge außer Hörweite war, und hob sein Glas. »Auf Ihr Glück, McCreary!«
»Slainte!«
Walkerton nippte an seinem Drink und wischte sich die roten Lippen ab. Mit großem Bedacht sagte er dann:
»Geld ist das Allerunwichtigste auf der Welt!«
»Wenn man es hat«, erklärte McCreary unbewegt.
»Genau. Wenn man es hat, weiß man, was es wirklich ist: ein Bündel dreckiges Papier, eine Handvoll ordinäres Metall, die schmierige Gewähr für etwas, was weit, weit wichtiger ist als Geld – Kreditwürdigkeit. Nehmen Sie mich zum Beispiel«, er klopfte sich auf den breiten Brustkasten, »ich trag’ nie mehr Geld mit mir herum, als ich brauche, um zu bezahlen, was ich im Augenblick möchte. Trotzdem habe ich überall Kredit…in Hongkong, Djakarta, New York, Paris, London.«
»Glückspilz!« sagte McCreary trocken.
Walkerton ging über diese Bemerkung hinweg und fuhr fort:
»Und mit diesem Kredit kann ich auf der ganzen Welt Geschäfte machen. Ich brauche bloß den Telefonhörer aufzunehmen, und schon habe ich fünfzigtausend Pfund verdient. Ich kann in Singapur in Kautschuk spekulieren und auf Celebes in Pfeffer. Wenn ich will, kann ich die Palmex-Aktien an einem Nachmittag um drei Punkte fallen lassen – oder aber Ihre Aktien auf genau die gleiche Weise in die Höhe schnellen lassen.«
»Ich hab’ aber keine Aktien«, sagte McCreary.
»Können Sie aber«, sagte Walkerton mit seiner kastratenhaften Stimme, die so überhaupt nicht zu ihm passen wollte. »Sie brauchen nur diesen Job anzunehmen.«
»Worum geht’s denn?«
Walkerton lächelte und schüttelte den Kopf.
»Nicht hier, McCreary. Leute unterhalten sich. Andere hören zu. Die besten Geschäfte macht man unter vier Augen. Sehen Sie, wie Sie selbst gesagt haben, sind Sie ein Mann, den es in den Füßen juckt und der sein Zuhause auf dem Rücken mit sich rumträgt. Ich biete Ihnen dreitausend US-Dollar, bloß damit Sie mit mir kommen und sich die Sache einmal ansehen. Gefällt sie Ihnen nicht, steigen Sie aus und haben Ihr Geld trotzdem verdient. Wollen Sie aber, behalten Sie Ihr Geld und machen noch mehr – viel mehr. Was sagen Sie dazu?«
»Wohin soll’s denn gehen?«
»Ziemlich weit weg von hier. In die Celebes-See – auf eine der kleineren Sunda-Inseln.«
»Die gehören aber immer noch zur Republik Indonesien, und ich bin hier ausgewiesen. Meinen Paß hat die Polizei beschlagnahmt. Den bekomme ich erst wieder, wenn ich morgen das Flugzeug besteige.«
Walkerton setzte ein sanftes Lächeln auf und kramte in seiner Brusttasche herum. Dann zog er ein kleines Heft mit dem Wappen der Republik Irland darauf hervor und legte es auf den Tisch. McCreary machte große Augen.
»Das ist mein Paß! Wie zum Teufel kommen Sie…?«
Walkerton machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Kredit, mein Lieber! Der ist überall nützlich. Hauptmann Nasa versteht das. Er ist wesentlich weniger an Ihnen interessiert als daran, daß sein Bankkonto ein bißchen größer wird. Er ist bereit, Ihnen eine andere Form der Abreise zu gestatten – und nicht zu viele Fragen über den Bestimmungsort zu stellen.«
»Und?«
»Wenn Sie einverstanden sind, können Sie um Mitternacht bei Hochwasser mit mir auslaufen.«
Verwirrt starrte McCreary ihn an und schüttelte den Kopf.
»Ich kapier’ das nicht, Walkerton. Ich kapiere überhaupt kein einziges Wort. Sie sind Geschäftsmann. Sie wollen Geld verdienen. Das machen Sie doch nicht aus Nächstenliebe. Warum wollen Sie ausgerechnet mich? Einen Bohrfachmann, der im Moment keinen Job hat? Wieso glauben Sie, Sie könnten durch mich Geld verdienen?«
»Im Moment«, sagte Walkerton langsam, »brauche ich einen Mann, der im östlichen Teil von Indonesien eine gewisse Aufgabe für mich erledigt. Ich bin dringend auf ihn angewiesen. Ursprünglich hatte ich jemand in Singapur, der auf Abruf für mich bereitstand. Jetzt kann er nicht kommen. Sie stehen zur Verfügung, und ich bin bereit, es mit Ihnen zu versuchen. Die einzige Frage ist: Sind Sie auch bereit, es mit mir zu versuchen?«
»Für dreitausend US-Dollar?«
»Und die Aussicht auf wesentlich mehr.«
McCreary blickte ihn eine Weile an, dann verzog sich sein hageres Gesicht zu einem schiefen Grinsen.
»Einer von uns beiden muß ein verdammter Narr sein, Walkerton. Und ich hab das unangenehme Gefühl, daß ich es bin.«
»Warum nennen Sie es nicht das sprichwörtliche Glück der Iren?«
McCreary zuckte mit den Achseln und streckte ihm die Hand hin.
»Ja, warum eigentlich nicht? Einverstanden, Walkerton, Sie haben Ihren Mann.«
Walkertons Händedruck war schlaff und weich, aber seine graugrünen Augen verrieten scharfes Interesse. Er sagte kurz und bündig:
»Gut, abgemacht. Gehen wir jetzt auf mein Zimmer und reden wir übers Geschäft.«
Sie standen auf.
Einem Zug keltischer Verschrobenheit folgend, warf McCreary einen Blick auf seine Uhr. Es war halb fünf. Das Datum: der zehnte Juli. Wenn irgendwelche bösen Omen darin lagen – er vermochte sie nicht zu sehen. Und es waren auch keine Propheten da, die dem Reisenden ein cave! zugerufen hätten. Neben Walkerton einhergehend, verließ er die Hotelhalle.
Walkertons Zimmer war ein großer, kühler, in Teak eingerichteter Raum. Flügeltüren führten zu einem Balkon mit durchbrochenem Geländer, und an den Wänden hingen Bilder javanischer Künstler: dunstverhangene Berggipfel, Reisfelder mit farbenfroh gekleideten Bauern, langgestreckte Strände, die golden zwischen den Bergen und der schillernden See lagen.
Aber die Bilder verblaßten und waren leblos – neben der Frau.
Sie war klein, hatte hochsitzende Brüste und war vollkommen wie eine Wachspuppe. Ihr Haar glänzte schwarz, und ihre Haut hatte die warme Honigfarbe einer métisse – jenen exotischen Schimmer von Blüten, die entstehen, wenn ein westliches Reis auf ein östliches aufgepfropft wird. Ihr Körper war eingehüllt in jadegrünen Brokat, das Kleid bis zum Hals geschlossen. Sie trug Ringe an den Fingern – Brillanten und einen blutroten Rubin. Ihre bloßen Füße staken in hochhackigen Sandalen, wie nur chinesische Handwerker sie herstellen können.
Als sie eintraten, war sie gerade dabei, sich eingehend in einem Spiegel zu betrachten. Sie drehte sich um und sah sie neugierig an. McCreary grinste sie an, doch ihre dunklen Augen verrieten nicht das geringste Interesse. Walkerton stellte beide einander vor:
»Das hier ist Lisette. Lisette – ein neuer Kollege, McCreary. Er wird mit uns reisen.«
»Es wird mir ein Vergnügen sein, Madame«, sagte McCreary blumig. Das Mädchen sagte nichts. Walkerton lächelte dünnlippig, und McCreary kam sich irgendwie lächerlich vor.
Walkerton zeigte mit dem Daumen über die Schulter auf die Flügeltüren.
»Geh nach draußen, Lisette. Warte auf uns.«
Das Mädchen wandte sich achselzuckend vom Spiegel ab. Sie ging auf die Flügeltüren zu und machte sie auf. McCreary sah einen Liegestuhl unter den Ranken der Pergola stehen. Das Mädchen trat hinaus und schloß die Tür hinter sich.
»Sie ist wunderschön«, sagte McCreary.
»Sie gehört mir«, sagte Walkerton mit Nachdruck. »Ich mag dekorative Frauen.«
»Dann können Sie glücklich sein, daß Sie sich sie leisten können.«
Walkerton zuckte gleichmütig mit den Achseln, trat an einen Schrank, schloß eine Schublade auf und holte eine kleine schweinslederne Mappe heraus. Diese Mappe öffnete er und entnahm ihr eine lange Rolle Transparentpapier, die er sorgfältig auf der Tischplatte ausbreitete.
»Sehen Sie sich das mal an, McCreary.«
McCreary beugte sich über die Zeichnung und ließ einen leisen Pfiff vernehmen. Es handelte sich um eine von einer berühmten amerikanischen Sachverständigenfirma und deren Geologen erstellte Karte. Die Unterschrift, die darunter stand, war die ihres besten Mannes. Sowohl die Firma als auch der Name dieses Mannes waren McCreary vertraut. Walkerton ließ ihn nicht einen Moment aus den Augen.
»Sagt Ihnen die Karte etwas?«
»Selbstverständlich.«
»Was ist es denn?«
»Eine aufgrund geologischer Untersuchungen erstellte Karte der Bodenschichten.«
»Und was geht aus ihr hervor?«
»Wenn sie echt ist…«
»Das ist sie. Sie hat mich zwanzigtausend Dollar gekostet.«
»Das ist noch billig«, sagte McCreary. »Ich rieche Öl. Und zwar massenweise.«
»Wie lange würde es dauern, zu bohren und fündig zu werden?«
»Moment mal, Walkerton!« McCreary richtete sich auf und sah Walkerton an. »Lassen Sie uns erst einmal Klarheit über ein paar Dinge schaffen. Eine Untersuchung und das Fündigwerden – das sind zwei grundverschiedene Dinge.«
»Wieso?«
»Ein Gutachter«, erklärte McCreary, »ist ein Mensch und kein Maulwurf. Er lebt auf der Erdoberfläche. Er kann nicht durch die Erde hindurchsehen. Aufgrund seiner wissenschaftlichen Ausbildung und seiner Erfahrung kann er Ihnen eine ganze Menge über Erdschichten und Felsformationen verraten. Außerdem kann er Ihnen, wie dieser hier es getan hat, eine vielversprechende Antiklinale aufzeigen, wo sich eigentlich Öl finden lassen müßte. Aber er kann Ihnen nicht sagen, ob das Öl wirklich da ist oder nicht. Das ist ein Vabanquespiel für Finanzleute und Bohrleute.«
Walkerton nickte. Die Antwort schien ihm zu gefallen. Er stellte eine weitere Frage.
»Ich bin bereit, mich auf dieses Vabanquespiel einzulassen. Trotzdem hätte ich gern eine Antwort auf meine Frage. Mal angenommen, diese Antiklinale trägt Öl, und zwar in einer Tiefe, wie sie hier aus dieser Karte hervorgeht – wie lange würde es dauern, das Öl anzubohren?« McCreary dachte nach.
»Ist der Boden vorbereitet?«
»Ja.«
»Und was für eine Ausrüstung haben Sie?«
»Die beste.«
»Dann würde ich sagen: zwischen einer Woche und vierzehn Tagen, um den Bohrturm aufzustellen und mit der Arbeit zu beginnen. Dann noch einen Monat. Wenn dieser Bursche hier recht hat, dann stoßen wir in einer Tiefe zwischen dreihundert und vierhundert Metern auf den Sand. Alles in allem, würde ich sagen, müßten sechs Wochen genügen, Ihnen eine positive oder negative Antwort zu geben.«
»Gut!« Das Wort kam heraus, als wäre Walkerton ein Stein vom Herzen gefallen.
McCreary faßte ihn genau ins Auge.
»Wohlverstanden, Walkerton, versprechen kann ich nichts. Gegen menschliches Irren und höhere Gewalt bin ich machtlos.«
»Das erwarte ich auch gar nicht von Ihnen. Was für Arbeiter brauchen Sie?«
»Zunächst mal einen Ingenieur – jemanden, der den Bohrturm in Ordnung hält, das Gerät zurichtet und Reparaturen ausführen kann. Alles andere schaffe ich mit ungelernten Arbeitern, die man an Ort und Stelle anheuern kann – vorausgesetzt, ich habe freie Hand.«
»Einen Ingenieur habe ich. Und dort, wo wir hinfahren, bekommen Sie Ihre Arbeiter – und Sie haben freie Hand.«
»Wohin geht es denn?«
Walkerton lächelte und schüttelte den Kopf.
»Die Einsatzbefehle sind versiegelt, McCreary. Sie werden erst aufgemacht, wenn wir Djakarta drei Tage hinter uns haben.«
McCreary vollführte eine schwache Geste, die Gleichgültigkeit ausdrückte.
»Das ist mir gleich, Walkerton. Sie bezahlen den Flötenspieler und sagen, was für ein Lied er spielen soll. Aber da ist noch was.«
»Ja?«
»Sobald wir anfangen zu arbeiten, gebe ich die Befehle. Ich verstehe was von meiner Arbeit und möchte nicht, daß mir irgend jemand dazwischenfunkt. Ist das klar?«
»Vollkommen.«
Walkerton rollte die Karte wieder zusammen, tat sie in die Mappe zurück und verschloß diese in der Schublade. Dann wandte er sich McCreary zu, und seine Augen leuchteten voll Zufriedenheit; sein roter Mund lächelte sanft.
»Sie gefallen mir, McCreary. Ich glaube, wir zwei könnten gemeinsam viel erreichen.«
McCreary stopfte die Hände in die Taschen und lehnte sich gegen den Tisch. Mit leiser Stimme sagte er: »Ehe wir irgendwohin gehen, Walkerton…«
»Ja?«
»…wüßte ich gern, wieviel ich bekomme – abgesehen von der Pauschale.«
Ohne zu zögern, legte Walkerton die Bedingungen auf den Tisch.
»Dreitausend Dollar Pauschale, dreihundert pro Woche während der Bohrzeit, einen Bonus von zehntausend, wenn Sie fündig werden oder einen entsprechenden Anteil an einer noch zu gründenden Gesellschaft. Solange Sie für mich arbeiten, werden sämtliche Auslagen ersetzt, und hinterher haben Sie eine freie Fahrt zu jedem Hafen, den Sie wollen. Es sei denn, selbstverständlich, Sie hätten Lust, weiterhin für mich zu arbeiten. Wie finden Sie das?«
»Gut«, sagte McCreary kühl.
»Möchten Sie das schriftlich?«
McCreary schüttelte den Kopf.
»Ich verlasse mich auf Ihr Wort.«
Ein wenig verwundert sah Walkerton ihn an und runzelte nachdenklich die Stirn.
»Wenn es um Geld geht, sollten Sie sich nie auf das Wort eines Mannes verlassen, McCreary.«
McCreary steckte eine Zigarette in den Mundwinkel und grinste Walkerton an.
»Wenn das Wort eines Mannes nichts gilt, dann gilt seine Unterschrift auch nichts. Aber wenn Sie mir einen schriftlichen Vertrag geben wollen, nur zu! Das Mädchen kann Zeuge spielen.«
»Das wäre mir lieber«, sagte Walkerton gleichmütig. »Rufen Sie sie rein, McCreary, und lassen Sie sie uns einen Drink mixen. Und noch was, McCreary…« Auf dem Weg zwischen Tisch und Flügeltüren drehte McCreary sich um. Walkerton lächelte ihn an, aber seine Augen waren hart wie Kieselsteine. »Lisette gehört mir. Denken Sie daran, ja?«
»Warum sollten Sie da Angst haben«, sagte McCreary sanft, »bei Ihrem Pulver!«
Er machte die Flügeltüren auf, stand da und blickte auf das Mädchen hinunter. Sie ist wie ein Vogel, dachte er, ein goldgrün schillernder Vogel unter den Zweigen in der Pergola.
2
Abends um acht Uhr desselben Tages packte McCreary seine Segeltuchtasche, bezahlte seine Rechnung beim Portier und trat hinaus in die warme Dunkelheit.
Die Sterne hingen niedrig an einem samtenen Himmel, und die Lichter der Stadt breiteten sich zu seinen Füßen aus – fünfzehn Kilometer weit: hell um die Neustadt herum, spärlicher in den Bungalowsiedlungen, wo inmitten üppiger Vegetation die reichen Chinesen lebten, gelb und grell in den Kampongs, weit verstreut und schimmernd im Fischerviertel jenseits des Hafens von Tanjung Periuk.
Selbst hier oben stieg ihm noch der Geruch der Stadt in die Nase, obwohl er weit entfernt war von dem fieberverseuchten Schwemmland und den grachtenähnlichen Kanälen der Altstadt, wo es von braunhäutigen Javanern wimmelte, die handelten, feilschten und ihre Abfälle in die träge dahinfließenden Wasserläufe entleerten. Ein eigentümlicher, exotischer Geruch war das, eine Mischung aus Gewürzen und verwesenden Pflanzen, trocknendem Fisch und Sumpfwasser sowie den Ausdünstungen von zwei Millionen Menschen, die in der lauen Luft schwitzten. Er bedrängte die Nasenschleimhäute, reizte den Gaumen und setzte sich in den Kleidern fest. Abschütteln konnte man ihn nie. Und wenn man Djakarta verließ, erinnerte man sich noch lange an diesen unangenehmen Geruch.
McCreary stellte die Tasche auf den Boden und lehnte sich einen Augenblick gegen den Stamm eines riesigen Banyanbaums, um sich eine Zigarette anzuzünden. Die Flamme seines Feuerzeugs war noch nicht erloschen, da kamen mit hektischem Geklingel schon drei Fahrradrikschas herbeigeschossen. Die Fahrer sprangen herunter, zerrten ihn am Ärmel und priesen in papageienhafter Sprache die Schnelligkeit und Sauberkeit ihrer Gefährte. McCreary grinste, schob sie beiseite und lud sein Gepäck auf den Sitz dessen, der als erster herangekommen war. Der Fahrer lachte, verhöhnte seine Rivalen mit einer anzüglichen Bemerkung und einer noch obszöneren Gebärde, und gleich darauf rasten sie die Straße hinunter: die Federung wippte, die Klingel schellte, und die Luft sauste in den Gummischnüren, die unter dem Sitz gespannt waren.
In der Neustadt war der Verkehr ruhig. McCreary lehnte sich zurück und ließ sich den Wind ins Gesicht wehen. Die mageren Beine des Fahrers traten kräftig in die Pedale, und er sang, rief, gluckste und klingelte bei jeder Kreuzung und jedem vorüberfahrenden Auto.
Sonderbare Menschen, dachte McCreary, eigenartig wie die Iren: Sie sind schlicht und höflich, lieben Farben und Musik. Sie haben einen Gang wie Ballettänzer und sprechen wie Dichter. Trotzdem gärt ständig ein kleines bißchen Hefe in ihren braunen Schädeln, und wie die Iren neigen sie dazu, wegen Schnaps oder Liebe oder der einfachsten Frustrationen, die das Leben mit sich bringt, durchzudrehen. »Amok laufen«, nennen sie das – und wenn ein Mann mit einer Axt oder einem geschwungenen Kris Amok läuft, wird er rasch in einer dunklen Ecke oder in einer Polizeizelle umgebracht, denn es besteht keine Hoffnung mehr für ihn.
Als sie in die Altstadt gelangten, kamen sie nicht mehr so rasch voran. Die Häuser der alten holländischen Kolonialherren lagen weit von der Straße ab zwischen den Bäumen, doch jetzt schliefen vier javanische Familien in jedem Raum, und die parkähnlichen Gärten waren von Bambushütten verunziert, aus denen sich das Leben in die nahegelegenen Straßen ergoß: balgende Kinder, Händler, die ihre Waren auf flachen Körben feilboten, pickende, scharrende Hühner und Händler mit Körben voll Sojamehl und gekochtem Reis, getrocknetem Fisch und scharfen Gewürzen.
Batikballen wurden unter überdachten Verkaufsständen angepriesen. Ein Holzschnitzer hockte zwischen geschnitzten Vögeln und winzigen Mädchenfiguren mit hochsitzenden Brüsten. Aus einem offenen Torweg drangen die Klänge eines Gamelanorchesters, und im Hof erkannte McCreary über die Köpfe eines auf dem Boden hockenden Publikums hinweg die grotesken Umrisse eines Schattenspiels.
Sein Fahrer fuhr kreuz und quer zwischen den Menschen hindurch, ließ seine Klingel aufschrillen, stieß mit dem Fuß nach auseinanderstiebenden Kindern, und zehn Minuten später gelangten sie auf das offene Areal, das den Hafen von Tanjung Periuk säumte. McCreary zahlte den Rikschafahrer, ging zum Kai und blickte auf das ölige Wasser des Hafenbeckens hinaus.
Hier lagen Schiffe aus aller Herren Länder: Tanker aus Balikpapan, rostige Frachter aus dem Chinesischen Meer, ein weißer italienischer Passagierdampfer mit Reihen hell erleuchteter Bullaugen, auf dem Rückweg von Sydney voll Sommertouristen, hochragende Dschunken mit flackernden Lichtern am Vordersteven, ein schnittiger Frachter aus Yokohama sowie die kleinen, schmucken Schiffe der neuen indonesischen Flotte, über deren Namensschilder mit weitausgebreiteten Schwingen der legendäre Garudavogel gemalt war, das Wappentier Indonesiens.
Hier schimmerten Lichter, Tauwerk knarrte und man vernahm das Geratter eines Riesenbaggers, der Treibsand aus der Fahrrinne schaufelte. Ein Boot der Wasserschutzpolizei rauschte vorüber, langsam lief die Prau eines malaiischen Fischers in den Hafen ein, und man hörte Leichter gegen die Bordwand eines gerade eingelaufenen Schiffes prallen.
Dann erblickte er, wonach er suchte.
Das Schiff lag an einem der Liegeplätze zum Bunkern rund zweihundert Meter entfernt an der östlichen Rundung des Hafenbeckens – ein langgestreckter weißer Rumpf mit den Umrissen einer Korvette, um die es sich vermutlich auch handelte. Das Schiff war vom Vordersteven bis zum Heck hell erleuchtet, und er konnte die emsig umherlaufenden Gestalten der Malaien erkennen, die sich um die schwarzen Schläuche kümmerten, welche in die Ölbunker hineinführten.
Er las den Namen am Vordersteven: Corsair, Panama.
Er nahm seine Tasche und ging rasch den Kai entlang.
Ein malaiischer Bootsmann wies ihn zuvorkommend die Gangway hinauf, und als er oben ankam, wurde er schneidig von einem jungen Deckoffizier begrüßt, der ihn in passablem Englisch nach seinem Begehr fragte.
»Ich bin McCreary.«
»Sie werden schon erwartet, Sir. Soviel ich gehört habe, fahren Sie mit uns. Arturo Caracciolo, Zweiter Offizier.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Arturo. Wo ist Mr. Walkerton?«
»Im Salon, Sir. Er erwartet Sie zum Dinner.«
»Das ist nett von ihm. Wohin soll ich?«
»Hier entlang, Sir.«
Er bemächtigte sich McCrearys Tasche und führte ihn einen Niedergang hinunter. McCreary fiel auf, daß die Schotten frisch gestrichen waren und die Treppe mit einem neuen Gummiläufer bedeckt war. Arturo machte die Tür zu einer Kabine auf und trat beiseite, um ihn eintreten zu lassen. McCreary stieß einen überraschten Pfiff aus. Die Kabine war so groß wie ein Prunkzimmer. Da standen ein Bett und ein Schreibtisch sowie ein am Boden festgeschraubter Sessel. An den Wänden hingen farbenfrohe italienische Aquarelle, und Koje wie Bullauge schmückten moderne Vorhänge. Außerdem war eine kleine Dusche abgeteilt und ein Spind für seine Sachen vorhanden.
»Hm«, meinte McCreary anerkennend. »Das verspricht eine angenehme Fahrt zu werden.«
Arturo setzte ein zufriedenes, jungenhaftes Lächeln auf.
»Gebaut worden ist es in England, Sir, und in Genua umgebaut. Wir sind stolz auf unser Schiff.«
McCreary sah ihn sich genauer an. Ein netter junger Mann: frisch von der Offiziersschule, nahm er an. Harmlos fragte er: »Was heißt ›wir‹?«
»Die Besatzung, Sir. Holländischer Kapitän, italienische Offiziere.«
»Und der Rest?«
»Malaiische Deckarbeiter, im Maschinenraum Laskaren, und in der Kombüse Chinesen.«
McCreary nickte. Dieser Walkerton schien zu wissen, was er wollte, und ein Auge für die Details zu haben. Divide et impera – trenne und herrsche! Mit einer solchen Mannschaft sollte es eigentlich keine ernsthaften Schwierigkeiten geben. Er warf seine Tasche aufs Bett und ging in die Duschecke, um sich fürs Essen zurechtzumachen. Dann führte Arturo ihn in den Salon und meldete ihn großspurig an. »Käpt’n Janzoon, Mr. Walkerton…Mr. McCreary.«
Die Anwesenden erhoben sich, um ihn zu begrüßen: ein blonder Hüne mit kurzgeschorenem Schädel und Spitzbart, Walkerton selbst und das Mädchen.
Walkerton begrüßte ihn mit ausgesuchter Zuvorkommenheit. Das Mädchen nickte ihm kurz zu, und Kapitän Janzoon quetschte ihm mit einer riesengroßen Pranke die Hand, schlug ihn auf die Schulter und keuchte in seinem kehligen, asthmatischen Englisch:
»McCreary, eh? Die wilden Iren! Da sind wir ja der reinste Völkerbund: Holländer, Italiener, Engländer und eine wunderschöne Frau, die…«
Walkertons hohe Stimme schnitt ihm das Wort ab.
»Ein Drink für Mr. McCreary, Käpt’n.«
Janzoon schoß die Röte ins Gesicht. Er sagte aber nichts, sondern goß zwei Finger hoch Whisky in ein Glas und reichte es McCreary, der sorgsam Wasser hinzugoß und den anderen zutrank. Janzoon und Walkerton tranken mit ihm. Das Mädchen rauchte eine braune Zigarette, die in einer langen Zigarettenspitze mit Goldmundstück und Jadeende steckte. Dann stellte Walkerton sein Glas hin und sagte abrupt:
»Etwas, was Sie niemals vergessen sollten, McCreary.«
»Ja?«
»Wir vier sind die einzigen, die etwas mit diesem…hm, diesem Unternehmen zu tun haben. Alle anderen sind Angestellte, die das Schiff bedienen und sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern sollen. Ist das klar?«
»So klar wie nur möglich«, sagte McCreary. »Noch was?«
»Im Augenblick nein. Gefällt Ihnen mein Schiff?«
»Nach dem bißchen, was ich gesehen habe, sehr. Ich glaube, ich werde mich recht wohl fühlen.«
»Zwanzig Knoten«, sagte Janzoon mit seiner kehligen Stimme. »Dreitausend Seemeilen in den Tanks. Sie sollten mal meine Brücke sehen. Das Allermodernste und Beste.«
»Ich kaufe immer das Allerbeste«, sagte Walkerton.
»Wir haben Glück mit unserem Boss«, sagte McCreary und grinste.
»Alle, wie wir da sind.«
Zum erstenmal zeigte sich ein Hauch von Interesse in Lisettes dunklen Augen, doch McCreary nahm das nicht wahr. In diesem Augenblick trat ein chinesischer Steward ein. Janzoon sprach auf kantonchinesisch mit ihm. Nachdem er hinausgegangen war, hörten sie, wie er draußen auf den Gängen und oben auf dem Deck seinen kleinen Bronzegong schlug.
Walkerton warf einen Blick auf die Uhr und sagte munter:
»Dinner in einer Viertelstunde. Meine Herren, entschuldigen Sie uns. Komm, Lisette!«
Er drehte sich um und verließ den Salon. Das Mädchen folgte ihm, ohne McCreary oder Janzoon auch nur einen Blick zu schenken. Mit abschätzenden Blicken sahen sie hinter ihr her. Wenn ihr Gang etwas Kokettes hatte, nahmen sie das jedenfalls nicht wahr. Sie war wunderschön und kalt wie eine Wachspuppe.
McCreary und Janzoon sahen einander an. McCreary grinste, und Janzoon ließ ein kehliges Glucksen vernehmen.
»Wie finden Sie sie, na, McCreary?«
»Sie darf mir nicht gefallen«, sagte McCreary. »Die Stewards haben mir schon gesagt, ich soll die Finger von ihr lassen.«
»Kluger Junge. Wir sollten uns besser kennenlernen, Sie und ich. Ich glaube, wir könnten gute Freunde werden.«