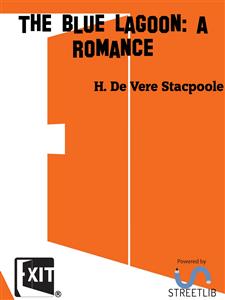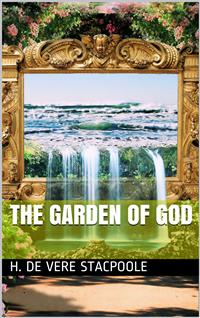Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein sagenhafter Schatz. Eine gefährliche Reise. Ein skrupelloser Verrat. Im London des 18. Jahrhunderts, einer Zeit der Perücken und strengen Konventionen, ist dem jungen Dick Bannister sein Leben zu eng. Als er zufällig von einem Schatz im Wert von 700.000 Pfund erfährt, der auf der einsamen Insel Bird Cay verborgen liegt, gibt es für ihn kein Halten mehr. Im goldenen Zeitalter der Segelschiffe schmuggelt er sich als blinder Passagier an Bord der Brigg Albatross und schließt sich der wagemutigen Expedition von Kapitän Horn an. Doch die Reise über den Atlantik birgt tödliche Gefahren. Nicht nur die stürmische See, sondern auch der Verrat in den eigenen Reihen stellt die Crew auf eine harte Probe. Ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit und gegen einen gerissenen Feind beginnt, der ihnen immer einen Schritt voraus zu sein scheint. Nach Schiffbruch und Meuterei muss eine kleine, loyale Gruppe in einem winzigen Boot allein auf dem offenen Meer ums Überleben kämpfen. Können sie die Schatzinsel noch rechtzeitig erreichen, oder wird die Gier ihre Träume für immer auf dem Grund des Ozeans begraben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Schatz von Bird Cay: Historischer Roman
Inhaltsverzeichnis
Der Schatz von Bird Cay: Historischer Roman
Copyright
KAPITEL I
KAPITEL II
KAPITEL III
KAPITEL IV
KAPITEL V
KAPITEL VI
KAPITEL VII
KAPITEL VIII
KAPITEL IX
KAPITEL X
KAPITEL XI
KAPITEL XII
KAPITEL XIII
KAPITEL XIV
KAPITEL XV
KAPITEL XVI
KAPITEL XVII
KAPITEL XVIII
KAPITEL XIX
KAPITEL XX
KAPITEL XXI
KAPITEL XXII
KAPITEL XXIII
KAPITEL XXIV
KAPITEL XXV
Orientierungspunkte
Titelseite
Cover
Inhaltsverzeichnis
Buchanfang
Der Schatz von Bird Cay: Historischer Roman
H. De Vere Stacpoole
Ein sagenhafter Schatz. Eine gefährliche Reise. Ein skrupelloser Verrat.
Im London des 18. Jahrhunderts, einer Zeit der Perücken und strengen Konventionen, ist dem jungen Dick Bannister sein Leben zu eng. Als er zufällig von einem Schatz im Wert von 700.000 Pfund erfährt, der auf der einsamen Insel Bird Cay verborgen liegt, gibt es für ihn kein Halten mehr. Im goldenen Zeitalter der Segelschiffe schmuggelt er sich als blinder Passagier an Bord der Brigg Albatross und schließt sich der wagemutigen Expedition von Kapitän Horn an.
Doch die Reise über den Atlantik birgt tödliche Gefahren. Nicht nur die stürmische See, sondern auch der Verrat in den eigenen Reihen stellt die Crew auf eine harte Probe. Ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit und gegen einen gerissenen Feind beginnt, der ihnen immer einen Schritt voraus zu sein scheint. Nach Schiffbruch und Meuterei muss eine kleine, loyale Gruppe in einem winzigen Boot allein auf dem offenen Meer ums Überleben kämpfen.
Können sie die Schatzinsel noch rechtzeitig erreichen, oder wird die Gier ihre Träume für immer auf dem Grund des Ozeans begraben?
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Bathranor Books, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2025 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
KAPITEL I
IM ZEICHEN DES SPIEGELS
Eine Dorfstraße
Der Laden meines Onkels in Cornhill war so eng und wirkte zwischen den Gebäuden auf beiden Seiten so winzig, dass, da bin ich mir sicher, neunzehn von zwanzig Passanten nicht wussten, dass Simon Bannister dort wohnte und Teleskope verkaufte.
Nicht einer von neunzehnhundert hätte gewusst, wie man durch ein Teleskop schaut, und was die Kompasse, Quadranten, Sextanten und Weltkarten betrifft, die zum Repertoire des alten Mannes gehörten, wie viele Londoner hätten jemals deren Namen gekannt, geschweige denn deren Verwendung?
Bannister und Slimon war der Name der Firma, und wenn man aufgrund der geringen Größe des Ladens in Cornhill vermutet, dass es sich um eine kleine Firma handelte, dann war sie das nicht – zumindest nicht, was den Gewinn anging.
Das große Geld wurde in der Brook Street in Minories verdient, denn dort leitete Mr. Slimon, ein hagerer Mann, hart und trocken wie eine Nuss, die kleine Fabrik, in der das Messing für die Sextanten zugeschnitten und die Linsen für die Teleskope poliert wurden, und wo die Luft ständig vom Summen der Drehmaschinen und dem Husten der Messingarbeiter erfüllt war – bleiche Männer in Hemdsärmeln mit gebeugtem Rücken, die in Räumen wohnten, in die nie die Sonne drang.
Diesen Eindruck prägte sich die Fabrik meinem jugendlichen Geist ein, wann immer ich mit einer Nachricht zu Herrn Slimon geschickt wurde – ein Eindruck, der weder durch die elenden Straßen, die ich auf dem Weg dorthin passieren musste, noch durch Herrn Slimon selbst, der in seinem kleinen Büro vor Papierstapeln saß, umgeben von Reihen von Geschäftsbüchern, eng zugeknöpft in einen schnupftabakbraunen Mantel, einen Stift hinter dem Ohr und mit schief sitzender Perücke, noch milder oder freundlicher wurde.
Ich mochte diesen Mann nicht, mit der einfachen und ehrlichen Abneigung eines Jungen. Ich mochte ihn genauso wenig wie das Aufstehen um fünf Uhr an einem frostigen Morgen, wie Regentage, Novembernebel oder den Schwefel- und Sirupsaft, mit dem mich die alte Mrs. Service, die Haushälterin meines Onkels, alle zwei Wochen betäubte.
Und er erwiderte meine Abneigung. Ich würde ihm die Nachricht oder den Brief überbringen, den ich zu überbringen hatte, und dann würde ich mich so schnell wie möglich mit der Antwort aus seiner Gegenwart entfernen und so schnell wie möglich durch die belebten Straßen nach Hause eilen, soweit es deren Reiz zuließ.
Bis heute erinnere ich mich daran, wie beim Öffnen und Schließen der Ladentür der Lärm von Cornhill verstummte und die Hektik der Welt aus mir herausströmte. Zurück blieb nur die Stille des dunklen, alten Ladens und das Ticken der Acht-Tage-Uhr. Manchmal öffnete und schloss ich die Tür mehrmals, um diesen Effekt zu erzielen – ein sicherer Weg, meinen Onkel verärgert aus dem Hinterzimmer zu locken. Denn alte Leute, ja, und selbst die mittleren Alters, haben oft genug wenig Geduld mit der Unruhe eines Kindes und vergessen dabei, dass die große Welt für es noch ein Spielzeug ist, mit dem man spielen kann, oder besser noch, ein Märchen aus realen Dingen und Fantasie.
Insofern bin ich nie erwachsen geworden. Ob es nun eine Gabe ist oder ein Bedürfnis meines Geistes, die Welt erfreut und überrascht mich noch immer so wie in meinen frühesten Jahren, als mich der Abenteuergeist aus dem Lärm Londons rief und jede Wendung etwas Neues versprach.
Der Laden hatte einen mit einer Glasvitrine bedeckten Tresen, wie man ihn aus Juweliergeschäften kennt, und an der Wand hinter dem Tresen und über den Schließfächern, in denen Seekarten aufbewahrt wurden, standen weitere Glasvitrinen, die alle mit nautischen Instrumenten gefüllt waren, genug, um ein Dutzend Großsegler auszustatten; und der Raum zwischen dem Tresen und den Vitrinen war so schmal, dass mein Onkel ihn seitwärts nehmen musste.
Er war ein sehr großer, keuchender Mann mit einem gleichmäßig roten Gesicht, Mitglied der ehrwürdigen Zunft der Brillenmacher, und er hatte das Meer noch nie gesehen.
Er, ich und Frau Service wohnten über dem Laden, denn damals waren ein Kaufmann und sein Laden eins, und er hatte kein anderes Haus, obwohl er eine gläserne Kutsche besaß, um zu einem Abendessen im Herrenhaus oder zu einer Versammlung seiner Zunft zu fahren.
Alter Mann mit Periskop
KAPITEL II
KAPITÄN HORN
Junger Junge liest ein Buch
An einem Samstagnachmittag im Juni, einem der strahlendsten und hellsten Tage, die Cornhill je erleuchtet hatten, kam ich von der Schule zurück – ich war Tagesschüler an St. Paul’s – und sah meinen Onkel im Begriff, sich mit Freunden zu treffen. Er trug seinen besten Anzug aus maulbeerfarbenem Stoff, Seidenstrümpfe, Schuhe mit massiven Messingschnallen und einen riesigen Strauß Robben an seiner Halskette. Er hatte seine zweitbeste Perücke auf – er besaß vier Perücken, die er stets griffbereit hatte – und in der Hand hielt er seinen trüben Spazierstock, den ihm ein Schiffskapitän aus Indien als Geschenk mitgebracht hatte.
„Sie bleiben hier“, sagte er, „bis fünf Uhr. Die Kasse ist abgeschlossen und leer, falls also jemand dringend Wechselgeld braucht, wissen Sie, was Sie sagen müssen. Schreiben Sie alle Nachrichten auf die Schiefertafel. Sollte Kapitän Horn kommen, sagen Sie ihm, er soll warten. Im Schrank steht eine halbe Flasche Portwein; stellen Sie sie ihm hin, zusammen mit meinen Grüßen, und ich bin um fünf wieder da.“ Er zog eine Uhr, die wie eine kleine goldene Rübe aussah, aus der Tasche, betrachtete sie, steckte sie zurück und stapfte aus dem Laden.
Ich sah ihm zu, wie er mit dem beschlagenen Stock eine Droschke herbeiwinkte; dann fuhr er weg, und ich blieb mit meinen Betrachtungen und dem Ticken der Acht-Tage-Uhr allein.
Meine Tasche, voll mit Schulbüchern, lag noch immer auf dem Tisch im kleinen Wohnzimmer. Ich hatte an diesem Tag Aufgaben zu erledigen, deren Namen ich vergessen habe – zweifellos Rechenaufgaben und Übungen. Doch in der Stille, mit dem Ticken der Uhr in den Ohren, dem Gefühl, gefangen zu sein, und der Ahnung, dass jeden Moment die Ladentür aufgehen und ein Kunde hereinkommen könnte, konnte ich mich nicht auf die Rechenaufgaben und Übungen konzentrieren. Also stellte ich Portwein und ein Glas auf den Tisch, holte ein Buch aus dem Regal, wo mein Onkel seine Bücher und seine Tabakdose aufbewahrte, und mit den Ellbogen auf dem Tisch und dem Buch vor mir vergaß ich mich selbst, den Laden, die Kunden und Kapitän Horn und wurde zu Robinson Crusoe auf seiner Insel.
Ich hätte das Buch, glaube ich, auch verkehrt herum lesen können, wenn es mir nur dazu gegeben worden wäre; so aber hatte ich es von Anfang bis Ende gelesen, vorwärts und rückwärts, hier und da. Es war ein schweres, altes Exemplar mit einem blau-goldenen Einband, und zwei Bilder fehlten; aber Bilder waren mir wenig wichtig, denn ich konnte, so klar, als blickte ich durch die Luft, die Insel, die Ziegen, die in der Sonne trocknenden und zu Rosinen werdenden Trauben, Freitags Fußabdruck, Robinsons Pelzmütze, seine beiden Gewehre und die an den Strand spülenden Wellen sehen – ich, der ich das Meer noch nie gesehen hatte.
Während ich da saß und las, drang ein Geräusch an mein Ohr, an das ich mich später auf einsamen Inseln des Südens in Hörweite des Meeres erinnern sollte, denn das Geräusch von Cornhill, das ich in der kleinen Stube meines Onkels hörte, wenn die Ladentür geöffnet wurde, klang genau wie das Rauschen des Meeres an einem streitenden Strand.
Ich schaltete „Robinson“ genau an der Stelle aus, wo ihn die Angst vor den Schritten im Sand dazu brachte, sich zu verstecken, und schob die angelehnte Glastür auf und ging in den Laden.
Ein großer, seefahrender Mann stand in der Nähe des Tresens, drehte den Kopf herum und blickte hier und da auf die Armaturen, die Chronometer, die Kompasse; und „Hallo“, sagte er, als er mich erblickte, „ist das hier das Schild des Fernglases – ein gewisser Simon Bannister?“
„Sie sind Kapitän Horn?“, fragte ich.
Er starrte mich an, als hätte ich ihn geschlagen. „Nun“, sagte er schließlich, „steht mein Name auf meiner Galionsfigur? Horn ja, und Kapitän ja, aber wo haben Sie das denn auf mir gesehen?“
„Mein Onkel sagte, er erwarte Sie“, erwiderte ich, erfreut über seine Überraschung und darüber, dass ich mit seinem Namen ins Schwarze getroffen hatte, „und wenn Sie ins Wohnzimmer kommen, Platz nehmen und auf ihn warten, gibt es Wein, den er mir aufgetragen hat, für Sie bereitzustellen.“
„Gehen Sie nur“, sagte der Kapitän und folgte mir ins Wohnzimmer. „Und so“, sagte er und ließ sich in den großen Sessel am Tisch fallen, „hat er Sie mit der Aufsicht über das Anwesen und all diese Ferngläser, Kompasse und dergleichen betraut?“
„Das hat er.“
„Nun“, sagte der Kapitän, legte seinen Hut auf den Tisch und kniff ein Auge zu, während er nach dem Glas griff und die Flasche ansah, „er hätte kein klügerer Bursche sein können – niemals einen klügeren Burschen. Und wie lautet Ihr Name?“, fragte er und schenkte sich ein Glas Portwein ein.
„Dick Bannister“, antwortete ich.
Er füllte seinen Mund mit einem halben Glas Portwein, schien damit seine Zähne auszuspülen und schluckte es dann herunter.
Ich glaubte, noch nie einen größeren oder groberen Mann gesehen zu haben. Sein Gesicht war sehr groß, spärlich behaart, von der Sonne fast mahagonifarben gebrannt, und es hatte keinen Ausdruck – zumindest veränderte es sich während unseres Gesprächs nicht, sondern blieb einfach das Gesicht eines großen Seemanns: eine bronzene Galionsfigur, die ewig über die Wellen zu blicken schien.
Der Kapitän leerte sein Glas und sagte dann, ganz vertraut und in der Art, wie ein Mann sprechen würde, wenn er in tiefes Nachdenken versunken ist: „Sehen Sie hier“, sagte er.
„Sir!“, sagte ich.
„Ich kann diesen Schrott unmöglich anrühren. Haben Sie denn keinen Tropfen Rum im Haus? Gin würde zur Not auch gehen, oder Brandy, aber bitte nur Sperrits.“
„Nein“, erwiderte ich, ganz aufgeregt vor Gastfreundschaft. „Onkel trinkt nie Alkohol. Ich könnte dir welchen im Gasthaus „Zum Weingut“ gegenüber besorgen, nur – nur – Onkel könnte etwas dagegen haben – verstehst du?“
Der Kapitän nahm eine Guinee aus seiner Tasche; aus einer anderen Tasche holte er eine leere Flasche.
„Dick“, sagte er, „meine Beine sind steif vom Laufen; bring mir diesen vollen Rum und behalt einen Schilling vom Wechselgeld. Das ist eine Sache zwischen Mann und Mann, und wer soll hier den Laden sprengen? Ich jedenfalls nicht.“
Ich nahm die Flasche und die Guinee und, fest entschlossen, den Schilling nicht anzunehmen, holte ich den Rum.
Als ich zurückkam, saß der Kapitän in einer blauen Rauchwolke, die Pfeife im Mund, das Zunderkästchen auf dem Tisch. In seinen Händen hielt er „Robinson Crusoe“, das er anscheinend verkehrt herum las.
„Und da hast du deinen Anteil“, sagte er und knallte mit seinem hornigen Daumen einen Schilling auf den Tisch, nachdem er das Wechselgeld gezählt hatte. „Kommt schon, das ist eine Sache zwischen Mann und Mann; wer soll denn hier den Spieß umdrehen? Ich nicht – äh – wer soll denn hier den Spieß umdrehen?“
Ich weigerte mich, er ließ nicht locker, und ich gab nach.
Auf dem Beistelltisch standen ein Wasserkrug und ein Glas. Er mischte sich ein Glas Grog und kostete davon, während ich „Robinson Crusoe“, das er hatte fallen lassen, aufhob und auf den Tisch stellte.
Der Kapitän saß gelassen in seinem Sessel, als wäre er zu Hause. Seine große Faust ruhte auf dem Tisch und spielte mit dem Glas Grog, seine Pfeife zwischen den Zähnen störte sein Gespräch kein bisschen. Er löcherte mich mit Fragen nach meinem Alter und meinen Kenntnissen. Er schien beeindruckt davon, dass ich rechnen und lesen konnte, doch als ob er mir nicht ganz glaubte oder sich vergewissern wollte, befahl er mir, das Buch, das er fallen gelassen hatte, aufzuschlagen und ihm ein paar Zeilen daraus vorzulesen. Ich kam seiner Bitte sofort nach und schlug zufällig „Robinson“ genau an der Stelle auf, an der ich aufgehört hatte. Dann blätterte ich ein paar Seiten zurück, bis zu der Stelle, kurz bevor er Freitags Fußabdruck im Sand gefunden hatte.
„Er war auf einer einsamen Insel gestrandet, wissen Sie“, sagte ich, „und er war ganz allein; er hatte aber zwei Pistolen und einen Papagei.“ Dann las ich.
Der Kapitän saß rauchend und trank seinen Grog, aber er hörte zu, denn wenn ich zu schnell las, befahl er mir, die Leine zu sichern oder einen Stopper anzubringen; er ließ mich erneut lesen und befahl mir dann, weiterzulesen, wobei er immer einen Seemannsbegriff benutzte, als ob er ein Schiff befehligen würde und nicht meine einfache Geschichte.
Als ich jedoch den Fußabdruck im Sand erreichte, richtete sich der Kapitän in seinem Stuhl auf. Ohne aufzusehen, konnte ich erkennen, dass ihn das Ding mit außergewöhnlichem Interesse erfüllte.
Alter Mann spricht mit kleinem Jungen
Er schlug mit der Faust auf den Tisch.
Dann, plötzlich und mit einem Ausruf, schlug er mit der Faust auf den Tisch, sodass die Gläser zuckten.
„Genau das“, sagte er, „das ist die Wahrheit, denn ich habe es selbst mit diesen beiden gesegneten toten Lichtern gesehen. Ich strandete auf Palm Cay, einer Insel, die nicht besonders groß ist, aber man könnte sie überspucken, und dann stieß ich eines Tages auf eine Fußspur. Ich war völlig einsam und durchgeschüttelt, weil mir ein Schluck Rum fehlte, und dann stieß ich auf eine Fußspur, und nichts half mir, außer den Möwen, die gegen den Wind kreischten; kein Lebewesen außer mir, völlig verdutzt und dastehend wie der Kerl, von dem du erzählt hast. Wahrheit? Ich kann es sehen. Und wessen Fußspur war das, meinst du? Nun, wessen denn sonst als meine eigene? Ich hatte sie am Tag zuvor dort hinterlassen, denn manche Sandkörner nehmen einen Abdruck wie einen hohen an und kleben daran wie Wachs. Verrückt wäre ich vielleicht durchgedreht und Amok gelaufen, hätte ich nicht gesehen, dass da kein großer Zeh war, denn meinen hatte ich zwölf Jahre zuvor bei einer Durchquerung verloren.“ südlich der Antillen, als wir eine ——
Der Kapitän hielt plötzlich inne, als ob er sich wieder bespräche. Welches alte Seeabenteuer südlich der Antillen er nun so plötzlich verschwiegen hatte, wer weiß? Die Frage bewegte mich tief, doch ich brachte es nicht übers Herz, sie ihm zu stellen. Irgendetwas in mir sagte mir, dass es nicht ans Licht kommen sollte; aber ich hatte nicht lange Zeit zum Nachdenken, denn der Kapitän stocherte mit einem hornigen Finger im Tabak seiner Pfeife herum, zündete sie erneut an und blies dichte Rauchwolken aus. Dann befahl er mir, weiterzusegeln. Ich tat es ein Stück, doch dann wurde ihm die unaufhörliche Erzählung zu viel, und er befahl mir, anzuhalten. Anschließend befragte er mich nach Robinsons Treiben – den er übrigens für eine reale Person zu halten schien – und dem Verbleib der Insel. In diesem Punkt konnte ich ihn nicht zufriedenstellen, aber ich erzählte ihm viel von Robinsons Taten – wie er sich Kleidung aus Ziegenfellen gefertigt hatte, wie er dies und jenes getan hatte – und so unterhielt und belehrte ich einen wettergegerbten alten Seemann, dem der Ozean und seine einsamen Inseln so vertraut waren wie mir Cornhill – ich, der weder den Ozean noch eine einsame Insel je gesehen hatte. Doch der Untergang des spanischen Schiffes fesselte ihn mehr als alle anderen Ereignisse in dieser wunderbaren Geschichte.
„Sie war Spanierin?“, fragte der Kapitän. „Sie saß oben auf den Felsen, nicht wahr?“
„Das ganze Heck und die Seitenschiffe waren von der See zerfetzt“, fuhr ich fort und rezitierte „Robinson“ aus dem Gedächtnis. „Ein Hund war an Bord und fand zwei Truhen voller Geld – zumindest war da neben anderen Dingen eine Menge Geld drin – Dublonen, Acht-Real-Stücke und einige kleine Goldbarren.“
„Bars, sagten Sie?“, rief der Kapitän.
„Goldbarren“, antwortete ich.
Was der Kapitän auf den Lippen hatte, sprach er nicht aus, denn in diesem Augenblick ließ mich eine leichte Bewegung hinter mir auf meinem Stuhl herumfahren, und da, in der Tür des Zimmers, stand Mr. Slimon. Er war so leise in den Laden gekommen, dass ich ihn nicht gehört hatte. Es war seine Angewohnheit, sich leise zu begeben und die Leute zu überraschen, und da stand er nun, den Blick abwechselnd auf mich und die Flasche auf dem Tisch gerichtet, dann von der Flasche zum Kapitän.
„Guten Abend, Kapitän“, sagte Mr. Slimon. „Haben Sie lange gewartet?“
„Nun, ich bin wohl noch keine Stunde hier“, sagte der Kapitän und zwinkerte mir zu, als wolle er mir absolute Geheimhaltung bezüglich des Rums zusichern. „Ich saß hier und rauchte Pfeife, wartete auf Sie und Mr. Bannister, und sein Bruder saß auch hier bei mir.“
„Ich hoffe, Sie haben es bequem gehabt“, sagte Herr Slimon und ging seitwärts um den Tisch herum, sodass sein Gesicht die ganze Zeit dem Kapitän zugewandt war, der wieder Platz genommen hatte.
„Ja, ja, bequem genug“, erwiderte der Kapitän und klopfte den Rauch aus seiner Pfeife in seine Handfläche. „Und darf ich fragen, ob Sie mit Mr. Bannister bezüglich dieser hier vereinbarten Route bereits eine Einigung erzielt haben?“
„Dick“, sagte Mr. Slimon und wandte sich scharf mir zu, ohne dem Kapitän zu antworten, „der Laden.“
Niemand war hereingekommen, und es gab auch niemanden, um den er sich kümmern musste; er wollte, dass ich den Raum verließ, und das war seine Art, mir Anweisungen zu geben. Ich stand auf, nahm meine Schultasche und ging zur Tür. Als ich den Raum verließ, begegnete ich dem Blick des Kapitäns, und er zwinkerte mir noch einmal ernst zu; nicht nur das, sondern sein Daumen, der auf dem Tisch lag, zuckte in Richtung Mr. Slimon. Ich weiß nicht, wie er es tat, aber ohne ein Wort zu sagen und ohne dass Mr. Slimon es auch nur im Geringsten bemerkte, gelang es ihm, mir seine geringe Meinung über diesen Herrn und sein Wissen, dass ich sie teilte, zu vermitteln.
Hätte ich es gebraucht, hätte dies meine Zuneigung zum Kapitän abgerundet und vollendet.
Ich breitete meine Bücher auf der Theke aus, aber zum Lernen hätte ich sie genauso gut in der Tasche lassen können. Was war das für ein „Feldzug“, den Mr. Slimon gleich gegen Kapitän Horn führen würde? Der Kapitän hatte bei einem Feldzug südlich der Antillen einen Zeh verloren – im Kampf, ganz sicher; höchstwahrscheinlich abgehackt mit einem Säbel oder getroffen von einer Musketenkugel. War er ein Pirat?
In jenen Tagen war Piraterie fast ausgestorben. Britische Kreuzer hatten sie beinahe ausgerottet, die gefürchteten Seeräuber waren verschwunden; doch hin und wieder erreichten uns Nachrichten von Schiffsbesatzungen, die sich erhoben, ein Schiff kaperten und es für Plünderungen nutzten – kurzlebige Unternehmungen, die unrühmlich endeten, aber für mich und meine Schulkameraden gab es immer noch Piraten – lebendig, schwarzbärtig, die in Schonern die Meere befuhren, ihre Opfer hängten und sich selbst an den Rahsegeln erhängten, wie es sich für Piraten gehörte.
Mitten in meinen Überlegungen kehrte mein Onkel zurück. Er fragte, ob Kapitän Horn angekommen sei, und als ich mit „Ja“ antwortete, ging er ins Wohnzimmer, wo ich hörte, wie er Herrn Slimon dem Kapitän förmlich vorstellte. Dann schaute er in den Laden und befahl mir, die Fensterläden hochzuklappen. Normalerweise erledigte das Herr Prance, der Gehilfe meines Onkels, der nicht im Laden wohnte, aber da er heute frei hatte, fiel die Aufgabe mir zu.
Als ich fertig war, zündete ich die Lampe an und stützte die Ellbogen auf die Theke, um mich wieder meinen Büchern zuzuwenden. Mein Onkel hatte die Tür zum Salon jedoch noch nicht ganz geschlossen, und ich konnte ihre Stimmen hören – Mr. Slimons Stimme, tief und geheimnisvoll wie er selbst, die Stimme meines Onkels und die von Kapitän Horn. Ich spitzte die Ohren, konnte aber nichts Genaues verstehen, nur dies: Mein Onkel schien Fragen zu stellen, die Mr. Slimon und Kapitän Horn beantworteten. Ich hatte schon eine Weile gespitzt, als ein Wort von Mr. Slimon mit hoher Stimme an mein Ohr drang.
"Gold!"
Das war mir zu viel, und so bewegte ich mich vorsichtig hinter dem Tresen entlang, bis ich die Tür zum Salon erreichte. Dort blieb ich stehen und lauschte der Stimme des Kapitäns, tief und schnurrend, mit einem gewissen Lachen darin.
„Sie wird nicht gegen uns kämpfen, meine Herren, sie wird nicht gegen uns kämpfen“, sagte der Kapitän, und dann schien sich die Stimme von Mr. Slimon wie ein dünner Keil in die Stimme des Kapitäns einzuschneiden:
„Nein, aber in einem solchen Fall unterbewaffnet zu sein, ist genauso schlimm wie unterbesetzt zu sein – eine törichte Strategie. Leg 110 für Waffen und Munition bereit, Richard.“
Und dann ertönte die Stimme meines Onkels, wie die Stimme des Schreibers in der Kirche, der die Antworten gibt: „Hundertzehn.“
Kleiner Junge erschrak vor Schatten
Sie hatten die Lampe im Wohnzimmer angezündet, und ich konnte den Schatten des Kopfes meines Onkels auf dem gedämpften Glas der Tür sehen. Wie ein Junge streckte ich den Finger aus und berührte den Schatten, als würde ich ihn berühren, aber ohne die Angst vor dem Ohrfeigenschlag, den ich bekommen hätte, wenn er meinen Finger berührt hätte.
Dann hörte ich zu.
„Hast du das verstanden?“, fragte Herr Slimon.
"Ja."
„Nun, das war’s.“
„Alles?“, rief der Kapitän. „Um Himmels willen, ihr habt die Vorräte nicht geladen! Was glaubt ihr denn, was wir essen sollten – die Munition?“
„Die Geschäfte“, sagte Herr Slimon, „werde ich organisieren.“
„Das werden Sie nicht tun“, sagte der Kapitän. „Ich fahre nicht zur See, ohne ausrangierte Vorräte der Admiralität an Bord. Kornkäfer stören mich nicht, aber ich brauche auch Zwieback; Stiefel an den Füßen sind ja schön und gut, aber ich will keine alten Stiefel im Magen oder im Geschirrfass haben; und keine schwarzen Bälge in der Melasse. Brot und Rindfleisch, mehr will ich nicht.“
„Hören Sie mal“, sagte Mr. Slimon, „ich kümmere mich um die Geschäfte bei Jervis. Ist das in Ordnung für Sie? Ich sage ihm, er soll die Besten an Bord nehmen. Ist das in Ordnung für Sie?“
„Ja, ja“, sagte der Kapitän; „Jervis ist in Ordnung. Sorgt dafür, dass er mich mit Proviant versorgt, und ich beschwere mich nicht.“
„Dann wäre das geklärt“, sagte Herr Slimon.
Ich hörte, wie sich der Kapitän mühsam aufrichtete; der Schatten meines Onkels erhob sich und verdeckte die gesamte gedämpfte Türfüllung, und ich huschte zurück zu meinen Büchern auf der Theke.
Der Kapitän ging in Begleitung von Herrn Slimon in Ohnmacht, und dann kam Frau Service herunter, um unser Abendessen zu decken.
Während des Essens unternahm ich mehrere Versuche, das Thema des Kapitäns anzusprechen, doch mein Onkel wich jeglichem Hinweis aus. Er wirkte nachdenklich und unruhig – so wie man es von einem Mann erwarten würde, der sich zu einem Abkommen verpflichtet hat, an dessen Richtigkeit er zweifelt.
Ich für meinen Teil war zu dem Schluss gekommen, dass mein Onkel und Mr. Slimon im Begriff waren, ein Schiff für einen anderen Zweck als den Handel auszurüsten. Die Worte des Kapitäns hallten mir noch in den Ohren: „Sie wird nicht gegen uns kämpfen.“ Wer war „sie“?
Ich stellte mir diese Frage und schlief in jener Nacht ein. Es war der ereignisreichste Tag meines Lebens gewesen, denn hatte ich nicht mit einem Mann gesprochen, der tatsächlich Schiffbruch erlitten hatte, und ihm zugehört, wie er seine Geschichte mit seinen eigenen Lippen erzählte?
KAPITEL III
MAST UND SPANER
Hafenszene
Tage und Wochen vergingen, und ich hörte nichts mehr vom Kapitän. Ich hätte das Ganze für einen Traum gehalten, wenn da nicht mein Onkel gewesen wäre, der seit jener Nacht in Gedanken versunken schien – und seinem Temperament nach zu urteilen, waren es keine angenehmen Gedanken. Es war nie gut, selbst in den besten Zeiten nicht, aber heutzutage fuhr er Herrn Prance, den Assistenten, wegen der kleinsten oder vermeintlichen Kleinigkeit an, und mir verpasste er grundlos oder fast grundlos einen Klaps aufs Ohr. Und was Frau Service betraf, so trieb er sie mit seinem Gezeter über das Essen oder die Kasse in Rage. Da sie es selbst nicht mehr aushielt, ließ sie ihren Frust an mir aus, sodass ich wie ein Federball zwischen zwei Streithähnen war: froh, morgens zur Schule zu gehen, und traurig, abends wieder nach Hause zu kommen.
Dann kamen die Feiertage.
Gleich am ersten Morgen der Ferien – einem Montag, und vielleicht dem heißesten Montag, den London je erlebt hatte – erschien Mr. Slimon im Gasthaus „Zum Fernglas“ und befahl mir, mich bereitzumachen, einige Pakete für ihn zu tragen, da er zu den Docks fahren wollte. Ich hatte die Docks noch nie gesehen, und Sie können sich vorstellen, wie schnell ich mich erschrocken habe. Mr. Slimon hatte eine Droschke vor der Tür stehen, die uns ein Stück des Weges bringen sollte. Wir stiegen ein, ich saß vorne, er mit den Paketen hinten. Er wies mich an, die Straßen im Auge zu behalten und mir ihre Namen zu merken, falls er mich später noch einmal mit einer Nachricht auf demselben Weg schicken müsste. Dann nahm er für den Rest der Fahrt Schnupftabak und sprach kein Wort mehr, außer um sich mit dem Kutscher über den Fahrpreis zu streiten, als wir in der West India Dock Road anhielten. Hier fuhren große Karren entlang, beladen mit allerlei Dingen, und Seeleute (einige von ihnen betrunken) und Kinder, die schmutzigsten, die ich je gesehen habe, die in der Gosse spielten, und als Mr. Slimon voranging, dachte ich, ich hätte noch nie so schmutzige Läden gesehen, die einen so beherbergten, denn es gab welche, die Papageien und alle möglichen seltsamen Vögel verkauften, alte Trödelläden, Schiffsausrüster, Segelmacher, alle möglichen Gewerbe, von denen ich noch nie gehört hatte, und jedes zweite Haus schien eine Taverne zu sein, und der Geruch von Schnaps war, als ob sie die Straße damit getränkt hätten.
Mr. Slimon drängte sich durch die Menge und ermahnte mich immer wieder, die Augen offen zu halten und mir den Weg zu merken. Wir überquerten die Straße, schlängelten uns zwischen Karren und Lastwagen hindurch, unter Pferdenasen hindurch, und plötzlich, mitten in London, fand ich mich inmitten von Schiffen wieder. Man hätte meinen können, sie seien auf Grund gelaufen. Die Schiffe, die ich bis dahin gesehen hatte, waren Schiffe auf Bildern, Schiffe auf Felsen wie das spanische Schiff in „Robinson Crusoe“, Schiffe, die mit dem Meer um sich herum segelten; aber hier lagen Schiffe, sozusagen, auf den Straßen, mit ihren Bugsprieten, die über die Mauern ragten, und ihren Galionsfiguren so nah, dass man sie fast berühren konnte.
Der Himmel war wolkenlos blau, übersät mit Masten und Spieren, und die kleinen Fahnen, die von den Mastspitzen flatterten, schienen im Wind zu leben. Und ich weiß nicht, woher es kam, aber hier, obwohl kein Schiff in Bewegung war, überkam mich ein Gefühl von Freiheit, Weite und einem Hauch von Wind, wie ich es nie zuvor und nie wieder erlebt hatte, obwohl ich schon die halbe Welt besegelt habe.
Der Geruch von Teer, Seilen und verrottetem Holz wechselte zwischen stark und schwach. Grüne Galionsfiguren waren von Sonne und Salz matt geworden, weiße Galionsfiguren, manche mit gelb bemalten Kronen. Einige Schiffe wirkten frisch gestrichen, doch die meisten – vermutlich jene, die von langen Reisen zurückkehrten – waren matt und rostig, mit großen schwarzen Blasen, wo die Sonne die Farbe angehoben hatte.
Als ich Herrn Slimon folgte, mich zwischen Ballen und Kisten hindurchschlängelte und über die dicken braunen Taue stieg, warf ich immer wieder einen Blick über die Kaimauer auf das Wasser zwischen den Schiffen. Wo es nicht glitzerte und vom Kohlenteer gefärbt war, zeigte es sich in jenem klaren Grün, das nur in den Schatten der Schiffe zu finden ist. Doch was mich am meisten beeindruckte, war das Weinen der Matrosen, die ein Schiff von seinen Ankerplätzen loszogen. Es vermischte sich mit dem Knarren der Taue und dem Klirren der Ketten, dem Rascheln der losen Segel und dem schrillen, berstenden Klang einer Flöte, der sich mit allem vermischte, vom Sonnenlicht bis zu den flatternden Flaggen.
„Da sind wir ja!“, sagte Mr. Slimon, als er an einer Planke stehen blieb, die zu einem Schiff führte, das quer zum Kai vertäut war.
Wir hatten uns ihr vom Heck genähert, und ich las auf ihrem Deck den Namen Albatross, ohne die geringste Ahnung zu haben, was dieser Name mir bedeuten würde. Doch als Mr. Slimon an der Gangway stehen blieb, wusste ich sofort, dass es sich um das geheimnisvolle Schiff handelte, das mein Onkel und Mr. Slimon gerade ausrüsteten. Mit einem Schlag ergossen sich all meine Fantasien und Spekulationen über sie. Sie wirkte gewaltig, war aber nur eine Brigg von etwa dreihundert Tonnen. Als ich meinem Führer über die wackelnde Gangway folgte und auf dem breiten Deck zwischen den hohen Schanzkleidern stand, schienen mir die mächtigen Masten, die Spieren darüber, das stehende Gut, das laufende Gut, die Beiboote, die Anker, die Blöcke – alles sprach zu mir und erzählte mir Dinge, die ich nie zuvor gehört hatte und die mir doch irgendwie vertraut vorkamen.
Hinter dem Besanmast stand ein Deckshaus, und kaum hatten wir das Deck betreten, erschien Kapitän Horn aus der Tür des Deckshauses und begrüßte meinen Begleiter. Er nickte mir zu, und dann, nachdem Herr Slimon meine Pakete entgegengenommen hatte, gingen beide ins Haus, schlossen die Tür und ließen mich allein.
Dort, in der heißen Sonne an diesem fremden Ort, allein, mit dem geschäftigen Treiben am Kai in der Ferne, schien das Abenteuer selbst neben mir zu stehen, und die alte Brigg schien zu sagen: „Komm, berühr mich, fühl mich, zieh an meinen Tauen, klatsch mit der Hand auf meinen Anker; ich bin real. Ich entferne mich vom Land, und dann gibt es nichts mehr als mich, das Meer ringsum und den Wind, der weht, Matrosen an Deck, und ich nehme sie überall hin – überall hin – überall hin.“
Das sagte die alte Brigg zu mir, und ich antwortete ihr, indem ich mit ihr spielte wie ein Welpe mit seiner Mutter. Ich zog an einigen Fallen, untersuchte die Blöcke der Beschlagsplatten, trat vor und versuchte, den großen Anker zu rütteln. Die Luke des Vorschiffs war offen, und ich spähte in die Dunkelheit des Vorschiffs hinunter; die Spillwinde und Spillwinden, die Belegnägel, die alte grün gestrichene Glocke, die Pumpe – all das untersuchte, fühlte und berührte ich, bis die alte Brigg, wenn sie denn Stolz auf sich besaß, zufrieden gewesen sein musste, sollte man meinen. Ja, ich roch sogar an ihr, und sie hatte zwanzig köstliche Gerüche – zumindest für meine Nase –, vom Tabak- und Slush-Lampen- und Fusselgeruch des Vorschiffs bis zum Hanf- und Teergeruch der Taue und Taue.
Ich hatte mich gerade von der Kombüse abgewandt, in die ich meinen Kopf gesteckt hatte, als ein lautes „Hallo!“ von der Kaiseite mich dazu brachte, mich umzudrehen.
Auf dem Kai, tanzend in der Sonne, schreiend und grinsend, völlig zerlumpt und mit krausem, zu kleinen Knoten zusammengebundenem Haar, stand der außergewöhnlichste schwarze Mensch, den ich je gesehen hatte.
Ich hätte ihn beinahe einen schwarzen Mann genannt, aber obwohl er die Statur eines Mannes hatte, waren seine Späße so kindlich, sein ganzes Auftreten so sorglos und fröhlich, er schien so wenig mit den ernsten Dingen des Lebens zu tun zu haben, dass selbst mein Junge sich weigerte, ihm den vollen Titel eines Mannes zu verleihen.
„Hallo!“, rief das Wesen. „Hi, weißer Junge! Hast du einen Penny für Jam? Jam springt für einen Penny, Jam dreht ihn auf den Rücken –“
Er hing kopfüber, die Hände auf dem Granit des Kais, die nackten Füße strampelten gegen die Sonne. „Hallo! Jam liegt jetzt wieder kopfüber. Hallo! Massa Johnson, hat jemand einen Penny für Jam?“
„Hallo! Massa Johnson, er ist weg,
Und die Byes und die Mädchen tanzen und schreien.
Hallo! Massa Johnson, er ist weg.
Und dann kommen die spielfreien Spielerinnen zum Einsatz.“
„Hallo! Herr Johnson, haben Sie einen Penny für Marmelade?“
Er schlug einen Salto, dann stand er da, grinste und brutzelte in der Sonne.
„Jam hat Hunger, Herr – gib ihm einen Keks.“
Ich war so angetan von ihm, dass ich in meine Tasche griff, um nach Geld zu suchen.
„Ich habe nur einen Vier-Penny-Schein“, sagte ich, ganz so, wie man zu einem Bettler sagen würde: „Ich habe nur ein Sovereign“, oder mit anderen Worten: „Ich habe kein Wechselgeld.“
„Ich habe nur ein Vier-Penny-Stück.“
„Vier Penny! Das reicht, Herr, das reicht, Herr. Alles klar für Jam; wirf sie hoch, Herr! Sieh zu, wie Jam sie fängt.“
„Wie heißt du denn?“, fragte ich und spielte mit der Münze, denn sie war mein einziger Geldbesitz.
„Marmelade, Herr. Wirf sie hoch, sonst wird ihr kalt.“
„Oh, die Freilose und die Mädchen kommen zum Spielen heraus.“
Als der Buckra-Massa ihn weggebracht hatte, ——”
Ich warf ihm die Münze zu; er fing sie in der Luft auf, steckte sie sich in den Mund, und im nächsten Augenblick hing er wieder kopfüber und lief diesmal auf seinen Handflächen herum.
In diesem Moment öffnete sich die Tür des Deckhauses. Herr Slimon und der Kapitän traten heraus, und die Gestalt am Kai, die sie erblickte und meine Existenz vergaß, ging, immer noch auf den Händen gehend, zum Heck des Schiffes.
„Hallo, Herr Kapitän, guten Tag, Herr; schöner Tag, Herr. Möchten Sie kochen, Herr? Jam hat reichlich leckeres Kochen, Herr; gallerte Kartoffeln, Herr. Hallo! Herr Kapitän, Jam liegt jetzt oben. Hallo! Herr Kapitän, haben Sie vielleicht einen Keks für Jam?“
Kapitän Horn warf nur einen Blick auf die Gestalt am Kai, griff nach einem Belegnagel, packte ihn am Schanzkleid und tat so, als wolle er ihn seinem Fragesteller an den Kopf werfen. Im nächsten Moment war Jam auf den Beinen und verschwunden.
Ich habe noch nie jemanden so schnell verschwinden sehen, und ich dachte, ich hätte noch nie jemanden so völlig sorglos und glücklich wie Jam gesehen, und ich bereute es kein bisschen, ihm meine vier Pence gegeben zu haben; er war es wert.
Kapitän Horn steckte wortlos den Belegnagel wieder ein und geleitete uns zur Gangway, um uns vom Schiff zu verabschieden.
Herr Slimon ging voran, und als ich ihm folgte, traf mein Blick den des Kapitäns, der mir feierlich zuzwinkerte und mit dem Daumen in Richtung des Partners meines Onkels deutete. Seine Meinung über diesen Herrn hätte man nicht besser ausdrücken können, und obwohl wir nie darüber gesprochen hatten, schuf Herr Slimon ein Band zwischen uns, denn so sehr Kapitän Horn seinen neuen Besitzer auch verachtete und missachtete, er hätte ihn nicht mehr verachten oder missachten können als ich.
„Ich muss geschäftlich einen Händler aufsuchen“, sagte Mr. Slimon, als wir wieder in der West India Dock Road waren. „Hier sind drei Pence; gehen Sie zurück nach Cornhill, kaufen Sie sich unterwegs Brot und Käse – es ist kaum eine Stunde Fußweg – und merken Sie sich auf dem Rückweg die Straßen genau, da ich Sie möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt um eine Nachricht bitten muss.“
Er ging davon, seine finstere Gestalt in den tabakfarbenen Mantel eingehüllt, und ich machte mich auf den Rückweg, froh genug, ihn los zu sein.
Junge macht einen Handstand
KAPITEL IV
DIE BRIG
Mann tritt durch Tür
In den folgenden Wochen wurde ich mehrmals mit Nachrichten zum Hafen geschickt. Auf der alten Brigg herrschte nun reges Treiben, denn die Luken waren geöffnet und die Ladung wurde verladen. Kapitän Horn nahm Mr. Slimons Nachrichten wortlos mit einem „Jawohl“ oder „Alles klar, Junge“ entgegen. Er trug keinen Mantel, saß auf dem Lukenrand oder lehnte an der Reling, kaute oder rauchte Tabak und hatte die Ladung stets im Blick. Hin und wieder unterbrach er sich, um einem Bekannten am Kai etwas zuzurufen oder einen der Hafenarbeiter zu beschimpfen. Es störte ihn jedoch nicht, dass ich auf dem Schiff herumlungerte und ihm Fragen stellte.
Eine Frage brannte mir auf der Zunge, doch ich stellte sie nie: die Frage nach den Goldbarren und dem Schiff, das nicht kämpfen wollte. Nichts deutete auf etwas anderes als Handel hin: eine Handelsbrigg mit offenen Luken, Fässer, Kisten und Kartons, die in den Laderaum hinabgelassen wurden, ein alter Kapitän mit mahagonifarbenem Gesicht, der die Beladung überwachte. Doch irgendetwas jenseits des belauschten Gesprächs sagte mir, dass dies keine Handelsreise war, oder nur teilweise. Vielleicht waren es Mr. Slimons häufige Besuche bei meinem Onkel und die Tatsache, dass sie stundenlang bei geschlossener Tür im Salon berieten, vielleicht war es die Veränderung in Onkels Wesen; was auch immer es war, ich war überzeugt, dass etwas Geheimes, Verbotenes und Verlockendes im Gange war, dass Kapitän Horn die Fäden zog und dass die alte Brigg dazu dienen sollte, ihre Pläne in die Tat umzusetzen.
Alles, was ich je von Schmugglern, Piraten und verzweifelten Taten auf See gelesen oder von meinen Gefährten gehört hatte, kam mir wieder in den Sinn, und nachts, wenn ich im Bett lag, befand ich mich an Bord der Albatross, umgeben von allerlei Schurken, die mit Säbeln bewaffnet waren, und das Deck war beladen mit Goldbarren, die von dem Schiff stammten, das nicht kämpfen wollte.
Das blutrünstigste Vorhaben hätte meine Fantasie nicht so sehr angeregt wie dieses halb verhungerte Gespräch. Was für ein Schiff war sie, goldbeladen und doch unfähig, sich selbst zu verteidigen?