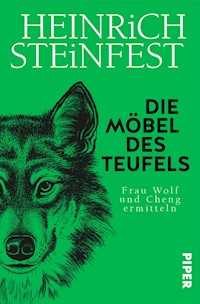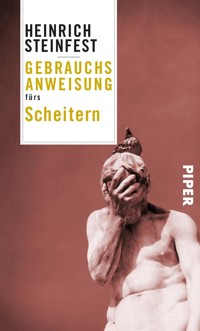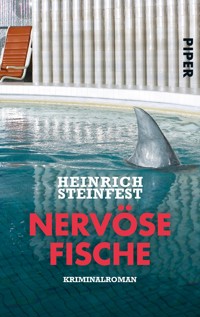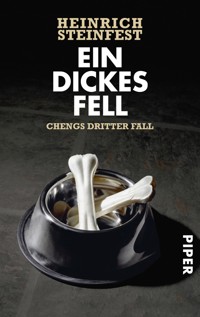9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Cheng macht Urlaub. Besser gesagt, entfernt er sich räumlich, um fernab von Wien auf andere Gedanken zu kommen. In der Bar seines mallorquinischen Hotels spricht ihn ein Mann an - Peter Polnitz, die Synchronstimme des englischen Weltstars Andrew Wake. Cheng und Polnitz unterhalten sich über Gott und die Welt, gehen aber ohne die Absicht auseinander, sich je wieder zu sehen. Ein Jahr später melden die Nachrichten, Polnitz sei wegen Mordes an Wake zu lebenslanger Haft verurteilt worden - und seine Tochter taucht in Chengs Büro auf: Sie überredet ihn, den Fall zu übernehmen und Polnitz' Unschuld zu beweisen. Am Ende kennt er Polnitz besser, als ihm lieb sein kann - und weiß endlich, was er mit dem Rest seines Lebens anstellen soll.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
0
Sechs Jahre früher
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
Widmung
Im Andenken an den Herrn Stefan, der das Wirtshaus »Adlerhof« in Wien in einer Weise führte, die geeignet gewesen wäre, ein von einer Kugel durchschossenes Herz mit zwei Pfropfen heilsam zu verschließen.
*
Und im Andenken an den Hund Lauscher, der eine solche Widmung wohl für so was von unnötig gehalten hätte.
2
PP
Cheng aß nicht im Hotel zu Abend, sondern besuchte ein um die Ecke gelegenes indisches Restaurant, das offensichtlich zu dieser Jahreszeit vor allem vom Lieferservice lebte. Im Lokal selbst blieb Cheng der einzige Gast. Er hatte einen guten Blick auf das in die Dunkelheit gleitende, leicht stürmische Meer und wurde von einem ständig zwischen drei Sprachen wechselnden Kellner bedient, dem Cheng zweisprachig seine Wünsche mitteilte. Wünsche, die bestens erfüllt wurden. Das Alleinsein störte Cheng dabei nicht im Geringsten. Es hatte etwas ungemein Vornehmes, als traue sich niemand, ihn, Cheng, beim Essen und Nachdenken und Genießen der vielen kleinen Gerichte zu stören. Allein dieser indische Kellner mit der Ausstrahlung eines göttlichen Boten, der zwar seine Botschaft nicht mehr so richtig im Kopf hatte, aber zufrieden damit war, silberne Schälchen zu balancieren.
Beim Bezahlen der erstaunlich moderaten Rechnung kam Cheng dann noch ein wenig mit dem Kellner ins Gespräch und musste ihm versprechen, sich in den wenigen Tagen seines Aufenthalts ein weiteres Mal hier einzufinden. Cheng versprach es gerne. Und hätte größte Lust gehabt, den mallorquinischen Inder hinüber in die Hotelbar einzuladen, aber das wäre natürlich zu weit gegangen. Denn so wenig Cheng an Gott glaubte, auch an keinen indischen, hielt er sich doch an die Regel, nach der es sich nicht gehörte, mit einem göttlichen Boten an einem Tresen zu sitzen. Boten waren stets dienend. Was zu bedenken war, wenn man ihnen ein Trinkgeld gab, beziehungsweise wenn man ihnen kein Trinkgeld gab. Cheng bedachte es und zeigte sich großzügig.
Hätte man Cheng übrigens nach seiner Religiosität befragt, hätte er vielleicht geantwortet, dass er bei allem Unglauben doch meine, es könne nicht schaden, sich an ein paar Regeln zu halten. Und dass möglicherweise das Paradoxon bestehe, dass selbst in einem von Gott oder Göttern völlig freien Universum dennoch göttliche Boten existierten. Leute mit einem Auftrag.
So kehrte er also zurück zum Hotel, betrat die große Halle und war gezwungen, das Restaurant zu durchqueren, um an die rückwärtig gelegene Bar zu gelangen. Ähnlich wie beim Frühstück saßen auch hier ausschließlich Paare an kleinen Tischen, weiß und glänzend von Geschirr und Glas.
Als sich nun Cheng an die Bar begab – eine längliche, dunkle Theke, darüber ein Plafond aus altem Holz, davor weiß gepolsterte Hocker, dahinter drei Reihen beleuchteter Spirituosen –, erkannte er im Näherkommen einen einzelnen Mann, der am unteren Ende saß. Es war Peter Polnitz.
Natürlich, Cheng hatte im Internet nachgesehen, wie er hieß, der Mann, der die deutsche Stimme jenes weltbekannten Schauspielers verkörperte. Und in der Tat gab er der Stimme viel Körper: Peter Polnitz. Von seinen Freunden wie von der Presse auch gerne PPgenannt, eigentlich die Abkürzung für Papa, womit der Papst gemeint ist, der beim Unterschreiben eines Dokuments dieses Kürzel hinter seinen Namen setzt. Einige Rezensenten hatte dies zur durchaus ernst gemeinten Behauptung verführt, Polnitz sei der »Papst unter den Synchronsprechern«. Jedenfalls lieh Polnitz nicht nur besagtem Superstar seine deutsche Stimme, sondern auch noch anderen Größen des Filmgeschäfts, war viel im Radio zu hören, in Hörspielen und Dokumentationen. Nicht zuletzt arbeitete er für die Werbung, wo er einem Auto stimmlich schmeichelte, einem Auto, das noch ein bisschen berühmter war als der weltberühmte Schauspieler. Auch der Wagen eine Naturerscheinung.
Auf einigen Seiten wurde zudem erwähnt, dass Polnitz eine sehr ungewöhnliche Nonstop-Lesung der drei bedeutendsten Monumentalromane des zwanzigsten Jahrhunderts eingespielt hatte, nämlich Auf der Suche nach der verlorenen Zeit,Der Mann ohne Eigenschaften und selbstverständlich Ulysses, zwar nicht ohne die Unterbrechung von Schlaf und Nahrungsaufnahme, aber doch in einem Zug, in einem Aufwasch, wie man so sagt, was ihm neben dem Kürzel PP auch die Initialen PMJ – Proust, Musil, Joyce – eingebracht hatte, nicht zu verwechseln mit dem New Yorker Musikkollektiv Postmodern Jukebox.
Peter Polnitz alias PP alias PMJ.
Es war eigentlich so gar nicht Chengs Art, jemand Fremden anzusprechen. Auch gehörte er nicht zu den hysterisch leidenschaftlichen Fans jenes Hollywoodstars und damit eben auch nicht von dessen deutscher Stimme. Dennoch, etwas trieb ihn dazu, sich nicht nur nahe diesem Mann – bloß einen einzigen Sitz aussparend – niederzulassen, sondern nach einiger Zeit, in der er sein Gläschen Averna wie ein kleines, ein wenig unnützes Möbel hin und her geschoben hatte, sich zu dem Mann hinzudrehen und …
Cheng konnte gerade noch vermeiden, ihn tatsächlich anzusprechen.
Es war Polnitz, der sich praktisch im gleichen Moment zu Cheng hinwandte und erklärte, er wolle nicht aufdringlich erscheinen, meine sich aber zu erinnern, man sei sich vor einigen Jahren in einem Hörspielstudio in Berlin begegnet.
Wobei Polnitz dies auf Englisch sagte. Cheng ihm jedoch auf Deutsch antwortete, ganz sicher niemals in einem Hörspielstudio gewesen zu sein.
»Dann muss ich mich entschuldigen«, meinte Polnitz, jetzt mit genau jener deutschen Stimme, die aus ihm einen PP gemacht und ihm die Gunst vieler Film- und Hörspielfreunde beschert hatte.
»Nein, keineswegs«, sagte Cheng, »es ist mir eine Ehre. Ich erkenne natürlich Ihre Stimme. Wer nicht?«
Polnitz reichte Cheng die Hand und fragte feststellend: »Sie sind Österreicher, nicht wahr?«
»Das haben Sie rasch herausgehört. In der Tat, ich bin geborener Wiener.«
Darauf Polnitz: »Das war der Mann, mit dem ich Sie gerade verwechselt habe, definitiv nicht. Sondern Ire. Chinesischer Abstammung zwar und … nun, Sie entschuldigen, er hatte nur einen Arm. Darum meine Annahme. Er besaß aber auch Ihre Figur. Und Ihren Schick. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich das sage.«
»Kein Problem«, versicherte Cheng, wobei es ihm schon einen kleinen Stich versetzte, nämlich die Vorstellung, es existiere ein Mann, der ihm auf solche Weise glich.
»Ein Mann mit Bart?«, fragte Cheng.
»Nein, darum war ich mir ja heute Morgen unsicher, als ich Sie das erste Mal sah. Und auch wegen dem Hund, den Sie bei sich hatten. Der andere hatte keinen Hund.«
»Ich ebensowenig«, beteuerte Cheng. »Ich habe keinen Hund.«
»Wirklich?«
»Wirklich. Sehen Sie einen Hund?«, fragte Cheng, der sich freilich bewusst war, dass das heute nicht zum ersten Mal geschah.
»Jetzt nicht.« Polnitz schien ehrlich verwirrt. »Schauen Sie, es ist schon verrückt, wie man sich täuschen kann. – Sie kommen also nicht aus dem Filmgeschäft.«
»Nein, gar nicht. Ich arbeite …«
Cheng stockte. Fast wollte er lügen. Wollte davon sprechen, im Aktienhandel tätig zu sein, oder als Manager einer Modefirma, als Architekt. Meine Güte, warum nicht als Buchhalter oder Steuerprüfer? Wie schon mittags in Gegenwart der Polizisten widerstrebte es ihm, die Wahrheit über seine Profession zu sagen.
Dennoch, aus dem kurzen Stocken heraus entglitt sie ihm. Wie bei einem Kind, dem die im Mund versteckte Schokoladenkugel beim Versuch zu lügen aus dem Mund fällt.
Polnitz war begeistert: »Detektiv! Toll! Das klingt, als würden Sie also doch fürs Kino arbeiten. Fürs Kino der Wirklichkeit.«
»Es gibt auch langweilige Filme«, erklärte Cheng. »Die meisten meiner Fälle würden sich kaum als Vorlage für ein Drehbuch eignen.«
»Und Sie haben wirklich keinen Hund?«, fragte Polnitz. Dieser Punkt hatte es ihm offensichtlich angetan.
»Aber Sie haben eine Frau«, erwiderte Cheng, dem das Hundetheater langsam auf die Nerven ging. Er vermutete, dass es sich bei der Frau heute Morgen an Polnitz’ Tisch um dessen Ehefrau gehandelt habe. Zumindest trug Polnitz einen darauf hinweisenden Ring an seinem Finger.
»Ja. Doch!«, sagte Polnitz. »Aber sie musste abreisen. Wegen ihrer Mutter. Ihre Mutter ist die perfekte Kranke. Ich bin schon gespannt, wie der Tod es schaffen wird, diese unverwüstliche, leidende Person ins Jenseits zu befördern. Sie entschuldigen, dass ich das so sage. Aber Gabrielas Mutter ist achtzig, dreimal verwitwet und bekommt Krankheiten, von denen Sie noch nie ein Wort gehört haben. Sie scheint diese Krankheiten richtiggehend zu erfinden. Darum können ihr diese Krankheiten auch nichts anhaben. Na ja, und wenn sie ruft, weil sie wieder eine neue Krankheit erfunden hat, dann springt meine Frau sofort. Und ich sitze alleine an der Bar und belästige Sie.«
»Das geht schon«, meinte Cheng lachend.
»Ich habe noch zwei Tage hier«, sagte Polnitz, »und die will ich auch genießen, bevor wieder die Arbeit losgeht.«
»Ein neuer Film?«
»Wir sind zu zwei Drittel fertig und arbeiten jetzt am Schluss. Wieder im Studio in Hamburg. Aber Mitte März muss ich dann nach London. Ich treffe dort … Sie werden es nicht glauben, seit dreißig Jahren synchronisiere ich Andrew Wake. Nur zweimal ist es passiert, dass jemand anderer ihn gesprochen hat. Einmal, weil ich über einen längeren Zeitraum fürchterlich verkühlt war. Beim zweiten Mal aber gab’s das Problem, dass ich auch für den anderen Hauptdarsteller der Stammsprecher war. Und da hat sich die Produktion entschieden, ich solle dessen Rolle sprechen und die von Wake abgeben. Was ein fürchterlicher Fehler war. Jedenfalls bin ich von diesen zwei Ausnahmen abgesehen seit den späten Achtzigern die Stimme von Andrew Wake und bin ihm trotzdem noch kein einziges Mal persönlich begegnet.«
»Der Mann ist sicher viel unterwegs.«
»Das ist er ganz gewiss. Aber dennoch hätte es eine Menge Gelegenheiten gegeben, sich zu sehen. Alle anderen, die ich synchronisiere, habe ich längst kennengelernt. Und einer von denen war es ja auch, der … also er hat gemeint, Wake würde mir darum ausweichen, weil er mir meine Stimme neidet. Was man sich mal vorstellen muss!«
So weit hergeholt schien Cheng das gar nicht. Manche Zuseher und nicht wenige Kritiker fanden, PPs Stimme würde letztlich besser zu Andrew Wake passen als dessen eigene. Derartiges geschah. Man nehme nur Woody Allen. Oder den alternden Robert Redford, gesprochen von Kaspar Eichel. Oder Christian Bale, wenn er Batman spielt und »seine« deutsche Stimme, nämlich die von David Nathan, dem dunkel gebrochenen Wesen des Fledermausmanns so viel eher entspricht als seine eigene. Denn darum geht es ja, dass eine Stimme und ein Gesicht (oder die Maske über dem Gesicht, welche Maske auch immer) harmonieren, vereint sind, wozu es mitunter zwei Menschen braucht. Sicher auch im Falle nicht so berühmter Personen. Jemand hört wen reden und denkt sich: Verdammt, das ist doch meine Stimme. Das ist die Stimme, die ich verdient hätte.
Polnitz schränkte ein, dass der Schauspieler, der diese Behauptung aufgestellt habe, sich mit Wake zuerst wegen einer Filmrolle und dann wegen einer politischen Äußerung zerstritten habe. Somit ein Feind sei.
»Feinde sagen gerne die Wahrheit«, stellte Cheng fest.
Cheng hatte nie darüber nachgedacht. Aber jetzt, wo man es besprach, kam ihm ebenfalls vor, dass sich Polnitz’ deutsche Synchronstimme viel eindringlicher in Wakes Darstellung von Figuren füge. In seine Art des Gehens, seine Gestik, sein Mienenspiel, und auch darin, selbst in Momenten der Verzweiflung zu dominieren. Besser als die Originalstimme Wakes, die Cheng ja kannte, vor allem aus der Werbung. Der deutschen Werbung wohlgemerkt, in der Wake mit seiner englischen Originalstimme auftrat. Oder von den paar Malen, da er sich einen Wake-Film auf Englisch angesehen hatte. (Wobei es aber so war, dass wiederum PP für jenes erwähnte weltberühmte Auto nicht nur auf Deutsch warb, sondern dies auch in der englischen Version tat: This car is more than a car. It’s a driven spirit.)
Die Stimme PPs verlieh dem ganzen Wake den idealen klanglichen Körper. Nicht dass Wakes eigene Stimme etwa hässlich war, natürlich nicht, keine Pieps- oder Reibeisenstimme, auch keine irgendwie verletzte Stimme …
Aber das war es doch eigentlich, dass nämlich Wakes eigener Stimme so völlig ein Verletztsein abging, eine Wunde, während hingegen sein Gesicht, also Wakes Gesicht, bei aller maskulinen Attraktivität durchaus Spuren einer Läsion besaß. Nicht jedoch seine Stimme. Die von Polnitz schon. Keine lächerliche Verletzung, sondern eine elegante, männliche Verletzung, eine rätselhafte Narbe oder ein geradezu historisches Gebrechen.
Jedenfalls fand es Cheng nicht ganz abwegig, sich vorzustellen, der Superstar Andrew Wake sei so lange einem Mann ausgewichen, dessen Stimme ihn gerade dadurch beleidigt habe, genau die richtige zu sein.
Doch irgendetwas musste sich geändert haben.
Jedenfalls erklärte Polnitz, Wake wolle ihn darum in London treffen, weil dort eine Pressekonferenz anlässlich des im Herbst erscheinenden neuen Films stattfinden sollte. Die mit Spannung und einigem Getöse erwartete englisch-amerikanische Produktion A Man for Endings, für den natürlich Polnitz es übernommen hatte, Wakes deutsche Stimme zu sprechen.
»Ich werde ihm also endlich leibhaftig begegnen«, erklärte Polnitz, »schon komisch, nach drei Jahrzehnten, in denen ich ja viel Zeit hatte, ihn genau zu studieren, praktisch jeden Winkel in seinem Gesicht, und vor allem natürlich jede Bewegung seiner Lippen. Manchmal träume ich, er zu sein. Manchmal träume ich, ein kleiner Mann zu sein, der in seinem Mund steckt, mit einem Megafon in der Hand. So was träume ich bei keinem anderen. Dabei ist es ja nur ein Beruf, oder? Ihn jetzt aber zu sehen … allerdings, man hat mich gewarnt. So freundlich und umgänglich er nach außen hin und vor der Presse auftritt, dürfte er unter vier Augen auch zu der einen oder anderen Grobheit fähig sein. Nun, man wird sehen, ob er mir meine Stimme verzeiht.«
»Wo treffen Sie ihn?«
»Im Hotel. Zum Frühstück in seiner Suite. Im Beaumont. Kennen Sie das Beaumont?«
»Um ehrlich zu sein«, sagte Cheng, »bin ich froh, das Hotel zu kennen, in dem wir beide uns gerade befinden. Es ist teuer genug.«
»Sie haben recht, Hotelpreise zeugen vom Grad der Unanständigkeit, die in einer Gesellschaft waltet. Das Zimmer, in dem ich Wake treffe, kostet pro Nacht zweitausend Euro. Nun, es ist natürlich kein Zimmer, sondern wohl eher … ich weiß nicht, wenn es zweitausend Euro kostet, wohl eher des Teufels Adresse, wenn er gerade in London ist.«
(Das konnten weder Polnitz noch Cheng wissen, aber das Zimmer, in dem Andrew Wake absteigen würde, war in der Tat etwas sehr Besonderes, besonderer als jegliche Präsidentensuite, die es im Beaumont natürlich ebenso gab. Und wenn Polnitz spaßeshalber den Teufel ins Spiel brachte, so lag er zumindest in einem ästhetischen Sinn gar nicht so falsch.)
Vorerst aber einmal wollte Polnitz doch etwas über das Detektivgeschäft erfahren. Nicht ohne sich zu erkundigen, ob er Cheng auf einen Drink einladen dürfe.
»Einen Kaffee«, bat Cheng, der seinen Averna kaum angerührt hatte. Alkohol war nicht so seine Sache. Früher schon, jetzt nicht mehr. Er bestellte ihn zwar hin und wieder, wie aus einer alten Gewohnheit heraus, aber wenn dann die vom Glas eingefasste alkoholisierte Flüssigkeit vor ihm stand, fiel ihm wieder ein, dass die Liebe zum Alkohol eine verflossene war. Gleich anderen Lieben. Er war ein Mann ohne Liebe. Aber nicht ohne Liebesgeschichte. Er war ein Mann, der von den Liebesgeschichten seines Lebens zehrte. Und der in dieser Hinsicht weder eine Gegenwart noch eine Zukunft, nur eine Vergangenheit kannte.
Als Detektiv lebte er freilich in Gegenwart, Zukunft wie auch Vergangenheit. Aus dem einen simplen Grund des Geldverdienens und dem anderen simplen Grund, nichts anderes zu können. Wie viele Menschen seines Alters schien er in der einmal begonnenen Tätigkeit gefangen und alternativ zu dieser nur ein Leben ohne Arbeit denkbar.
»Wissen Sie«, fragte Cheng, »was Chesterton über den Wert der Detektivgeschichte gesagt hat? Dass sie die bis jetzt einzige Form volkstümlicher Literatur ist, in welcher sich ein gewisser Sinn für den poetischen Gehalt des modernen Lebens ausdrückt.«
»Wie? Sie schreiben über Ihre Fälle?«
»Nein, Gott behüte!«, antwortete Cheng mit einem Lächeln, das aber nicht von seinem Mund stammte, sondern aus seinen schmalen Augen mit den kleinen Angelhaken am inneren Rand trat. Lider, die sich im Moment des Lächelns zu zwei leicht geschwungenen Bögen schlossen. Als er die Augen wieder öffnete, erklärte er: »Fürs Schreiben fehlt mir die Kraft, ehrlich. Von der Sprache einmal abgesehen. Aber was ich sagen will, ist, dass ich in meiner Arbeit als Detektiv versuche, den poetischen Gehalt modernen Lebens festzuhalten. Immerhin bin ich damit beschäftigt, Leute zu beobachten. Manchmal auch Leute, die gar nicht mehr leben, genauer gesagt, ich beobachte die Auswirkungen ihres Totseins.«
»Sie sprachen zuvor auch von der Langeweile mancher Aufträge.«
»Was nicht bedeuten muss, es fehle die Poesie. Ein Mann, der meint, seine Frau betrüge ihn, und darum ihre Observation in Auftrag gibt, ist ja nicht nur von Zorn erfüllt, sondern auch von Angst und Liebe und dem Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit. Und der tiefen Scham, jemanden wie mich zu beauftragen.«
»Ist Scham poetisch?«
»Sie besitzt sicher mehr Poesie als … zum Beispiel der Straßenverkehr.«
Polnitz wendete ein, gerade der Verkehr würde einen recht prägnanten Ausdruck des modernen Lebens darstellen.
»Hätte ich Autoverkäufer werden sollen«, fragte Cheng, »weil mich die Poesie so kümmert?«
Polnitz erklärte, nicht behaupten zu wollen, Autoverkäufer seien ausgesprochen poetisch veranlagte Wesen, doch die Autoschlangen, die unsere Erde beherrschen …
»Wenn man sich vorstellt«, sagte er, »irgendein fremdes Wesen würde die Welt von oben betrachten. Was sieht dieses Wesen? Autoschlangen! Und würde von deren Schönheit berichten, wenn in der Nacht die Lichterketten über die Kontinente ziehen.«
»Das stimmt schon«, sagte Cheng, »aber ich spreche ja vom Leben der Menschen, das zwar teilweise auch hinter Steuerrädern stattfindet und Schlangen hervorbringt, sich aber doch viel stärker in der Scham äußert.«
»Ehepartner haben einander schon immer betrogen.«
»Richtig. Aber deswegen einen Detektiv zu beauftragen ist doch neu.«
»Ist das Ihr Spezialgebiet, der Ehebruch?«
»Nicht unbedingt. Meine Aufträge ergeben kein Muster. Ich habe ein Leben lang versucht, ein Muster darin zu entdecken. Umsonst. Vielleicht bin ich darum auf den Begriff der Poesie gekommen. Als das einzige Muster, das ich erkennen kann.«
»Man müsste Poesie definieren«, sagte Polnitz, »Sie meinen schließlich keine Gedichte.«
»Es gibt da einen alten Spruch«, sagte Cheng, »und zwar, dass der Poesie anheimfällt, was im Leben untergeht. Doch das gilt natürlich für die Poesie eines Lebens, wie man es früher kannte. Der Poesie des modernen Lebens hingegen fällt eher das anheim, was im Leben überläuft. Würde ich sagen. Der viele Hass und das viele Ungemach, das die Menschen im Überfluss gerade dort verbindet, wo es ihnen besonders gut geht. Weshalb Detektive existieren.«