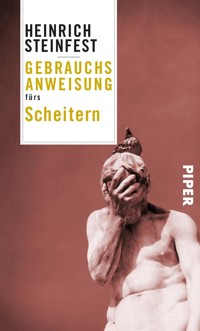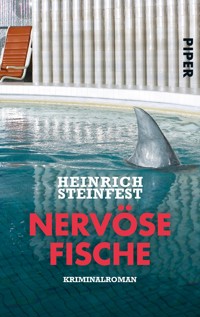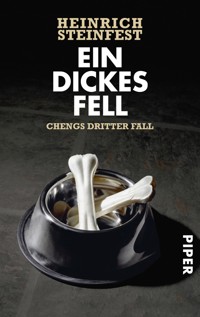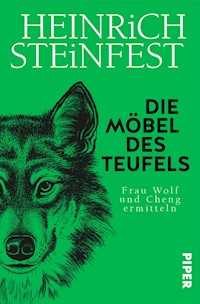
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Frau Wolf und Cheng ermitteln Nach 44 Jahren kehrt Leo Prager aus dem Südpazifik zurück nach Wien: Dort liegt seine Schwester Eva zur Identifikation in der Gerichtsmedizin - und für Leo stellen sich viele Fragen. Wer tötet eine Parlamentsstenografin? Ist der Mord politisch, oder liegt das Motiv in Evas streng gehütetem Privatleben? Dass er bei den Antworten von Chengs Frau Wolf Unterstützung erfährt, ist nichts als reiner Zufall. Aber ein glücklicher. Ein Kriminalroman der ganz besonderen Sorte. Spannend, unwahrscheinlich und sehr sehr realistisch - dabei voller Liebe. Und die führt bekanntlich immer ans Ziel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Möbel des Teufels« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Covergestaltung: zero-media-net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Prolog
Anfang Dezember 2019. Nicht irgendwo auf der Welt, sondern in einer Stadt namens Wien, in einem Bezirk mit der Zahl Vier, in einer Gegend im Rücken einer formschönen Barockkirche. Und, um ganz genau zu sein, in einem kleinen, modernen Friseurladen. Geführt von einem jungen Mann, der sich als Wiener gleichermaßen wie als Österreicher und Türke empfand, in erster Linie aber eben Friseur war. Während die Frau, die soeben in seinem Friseurstuhl wie in einer gepolsterten Muschel saß, in erster Linie Detektivin war.
Bei der Dame im Stuhl, deren goldblond gefärbtes und mit einer einzigen schokoladenbraunen Strähne durchsetztes Haar unter den gefühlvollen Händen des Haarkünstlers an Volumen gewann, handelte es sich um Frau Wolf. Klar, sie besaß auch einen Vornamen, aber den kannte niemand und brauchte auch niemand zu kennen, sie war für alle nur »Frau Wolf«.
Frau Wolf besaß trotz ihrer Sechzigjährigkeit ausgesprochen gutes, festes Haar – so ganz genau wollte sie sich nicht auf ihr Alter festlegen, weniger aus Eitelkeit, mehr aus einer Gelassenheit gegenüber dem Phänomen der Zeit, ganz gleich, was da in ihren Dokumenten stand. Sie sagte gerne: »Ein paar Jahre rauf oder runter sollten eigentlich kein Thema sein. Jedes Alter darf über eine kleine Toleranz verfügen. Einen Bonus in beide Richtungen.«
Solche Gelassenheit änderte nichts daran, dass Frau Wolf mindestens zweimal, eher dreimal in der Woche diesen Friseur besuchte, manchmal auch nur, um eine Winzigkeit in ihrer Frisur zu ändern: eine farbige Strähne, eine Welle, wo vorher keine war, ein Auftoupieren, das sie gewiss auch selbst gut hinbekommen hätte, dann allerdings ohne die Magie, die aus den Händen dieses Friseurmeisters floss. Mitunter kam sie auch nur auf einen Mittagsplausch vorbei und um den ausgezeichneten Espresso zu trinken, der dort serviert wurde, besser als in jedem der so gerne überschätzten Wiener Kaffeehäuser.
Heute war es etwas aufwendiger gewesen, da sie zum Nachfärben erschienen war, einer goldbraunen Auffrischung, wobei die dunklen Ansätze nicht den Ton der ursprünglichen Färbung erhalten hatten, sondern der im Laufe der Wochen veränderten Coloration angepasst worden waren. Eine gewisse Ironie bestand nun darin, dass diese eine schokoladenbraune Strähne gar nicht auf einer Färbung beruhte, sondern es sich um Frau Wolfs natürliche Haarfarbe handelte. Ein schmales Relikt, eine auf den Ursprung verweisende Auslassung.
Wie sagte der junge Friseur, während er die Paspelierung löste und den Schutzumhang mit Schwung entfernte: »Viel Kunst und ein Hauch Natur.«
Frau Wolf schwenkte ihren Kopf hin und her, sich im Spiegel betrachtend, und meinte: »Wunderbar, wie immer.«
Zum Friseur zu gehen war ihre Droge. Sie fühlte sich danach deutlich besser. Was naturgemäß zu einer Abhängigkeit führte, die sie sich auch vollauf eingestand. Sie wäre gerne jeden Mittag hierhergekommen. Aber Sucht war andererseits kein Grund für Maßlosigkeit, denn am Ende der Maßlosigkeit stand leider immer das Gleiche: Lächerlichkeit.
Und lächerlich sein war das Letzte, was ihr vorschwebte.
Frau Wolf erhob sich aus dem Sitz und ließ sich nun von ihrem Friseur noch einmal von vorne betrachten. Es war, als studiere er eine Malerei. Er konnte es auch nicht lassen, mit dem Finger eine Strähne ihres Haars über eine andere Strähne ihres Haars zu legen und dieser Intervention mit einem Fixierspray zu einem gewissen Glanz, vor allem aber zu einer gewissen Dauer zu verhelfen.
Frau Wolf selbst sagte gerne: »Eine gute Frisur ist ständigen Gefahren ausgesetzt, angefangen bei der frischen Luft. Ganz zu schweigen vom Schlaf. Der Schlaf ist der größte Feind einer jeden Frisur.«
Immerhin, als sie jetzt den kleinen Laden verließ, war das Wetter trotz der Jahreszeit gütig zu nennen. Kein Regen, kein Wind, keine große Kälte, sondern ein mildes, von einem zarten Wolkenschleier besänftigtes Sonnenlicht. Es würde tatsächlich einer der fünfzehn wärmsten Dezembermonate seit dem Beginn der Messreihe im Jahr 1767 werden. Und das war zu spüren, als Frau Wolf da aus dem Geschäft trat und in der lauen, fast windstillen Mittagsluft sich die wenigen Meter Richtung Süden bewegte, dorthin, wo dann die Taubstummengasse begann, in die sie nun einbog. Gleich im ersten Haus lag im dritten Stock ihr Büro. Sie blieb vor dem hohen Eingang stehen und betrachtete die beiden Männer, die gerade dabei waren, neben die senkrechte Reihe von vier klassischen Messingschildern ein modernes Plexiglasschild anzubringen. Darauf war in hellblauen Lettern die Aufschrift »Detektei Wolf« zu lesen.
Sicherlich, Hellblau, genau genommen ein warmer Ton von Himmelblau, Fernblau genannt, französisch Bleu distant – der Name, den Frau Wolf bevorzugte –, war eine ungewöhnliche Farbe, um ein Detektivbüro auszuweisen, aber Frau Wolf wollte so dem Begriff der Detektei eine luftige und atmosphärische Note verleihen, eine Leichtigkeit und mithilfe des Plexiglases auch etwas Schwebendes, umso mehr als sie fand, dass ihr Gewerbe etwas ungemein Diffiziles besaß. Es nicht nur um die Suche nach der Wahrheit ging, sondern vor allem um die Suche nach Erlösung. Die Menschen, die zu ihr kamen, wollten eigentlich eine Form von Absolution. Die Wahrheit, mitunter eine schreckliche oder ernüchternde Wahrheit, war in der Regel sowieso das, was sie erwarteten. Es war stets eine Ahnung, die sich im Zuge von Frau Wolfs »Darlegung der Verhältnisse« materialisierte. Damit aber auch eine Befreiung einleitete.
»Sie sehen schon, dass das Schild ein wenig schief ist«, sagte Frau Wolf zu den beiden Handwerkern, die sich jetzt erschrocken umdrehten. Der eine oben auf der Leiter, der andere seitlich stehend und die Leiter haltend.
»Wirklich?«, fragte der auf der Leiter.
»Wirklich, glauben Sie mir«, erklärte Frau Wolf. »Minimal, mag sein. Aber minimal ist auch die Schraube, die sich in einem Flugzeug löst und es zum Absturz bringt. Oder der Beistrich, der einen Nebensatz von einem Hauptsatz trennt …«
»Ich habe verstanden«, antwortete der Mann in einem Ton unterdrückten Ärgers.
»Gut«, sagte Frau Wolf, trat an den beiden vorbei in das Gebäude und begab sich zum Aufzug, in dessen Spiegeln sie noch einmal die gelungene Färbung und Formung ihres Haars überprüfte. Im dritten Stockwerk verließ sie die Kabine und schritt sodann durch die hohe, dunkle Holztüre in das Vorzimmer ihres Büros.
Und dort saß er, ihr ehemaliger Chef, der Detektiv Markus Cheng. Der nun ihr Sekretär und Assistent war. Während sie zuvor seine Sekretärin und Assistentin gewesen war. Aber das war den beiden mit der Eindringlichkeit eines Naturgesetzes irgendwann klar geworden, dass die Verteilung ihrer Rollen nicht stimmte. Was rein gar nichts mit Frauenbewegung und Quotenregelung und einem Jetzt-sind-halt-mal-die-Frauen-dran oder einem In-Matriarchaten-sind-die-Leute-glücklicher zu tun hatte, sondern eben einer Einsicht in ein vernünftiges Grundmuster. Ein Muster, das bedeutete, dass Frau Wolf die bessere Detektivin war und Markus Cheng der bessere Sekretär und Assistent. Es hatte wirklich etwas mit Biologie zu tun. Die Biologie ist unbestechlich.
Cheng saß vor einem hohen Fenster sowie hinter einem massiven, dank geschwungener Beine aber auch leicht anmutenden Art-déco-Schreibtisch. Man konnte sagen, der ganze Cheng hatte etwas Art-déco-artiges mit seiner verinnerlichten Eleganz. Er trug einen dunkelblauen Anzug, dessen linker Ärmel aufgrund des fehlenden Arms hochgesteckt war. Außerdem hatte Cheng ein Einstecktuch in der Brusttasche, aber nichts Übertriebenes, wie man das jetzt leider häufig sah: hässlich bunte Tücher, die dann oft noch mit ähnlich hässlich bunten Socken korrespondierten, oft auch hollywoodesk aufgebauscht. Nein, das blütenweiße Tuch stand allein als ein schmaler, waagrechter Streifen in Form einer Rechteckfaltung heraus. Gerade so viel, dass darauf ein kurzer, prägnanter Satz hätte Platz finden können. Natürlich war da kein Satz, aber doch das Potenzial eines Satzes. Und dieses Potenzial stellte Chengs Statement dar.
Zu Chengs Beinen lag ein Hund. Eigentlich war es ein Schatten zwischen Chengs linkem Fuß und dem geschwungenen Schreibtischbein, ein ganz natürlicher Schatten. Aber Frau Wolf ging es so wie auch anderen Personen, nämlich immer wieder einmal zu meinen, Chengs längst verstorbenen Hund mit Namen Lauscher kurz an dessen Seite zu sehen, eben als Schatten, als Spiegelung, im Schein des Lichteinfalls oder im Moment einer Verdunkelung, wenn eine Wolke vor die Sonne trat. Ein Sekundeneindruck.
Nein, Frau Wolf glaubte nicht an Geister. Auch nicht an Hundegeister. Und Cheng selbst bestand darauf, diesen Hund weder zu sehen noch zu spüren, auch wenn er immer wieder von Leuten darauf angesprochen wurde, sie hätten ihn, Cheng, letztes Mal aus der Ferne, beim Überqueren der Straße … da wäre doch ein Hund bei ihm gewesen, oder?
Frau Wolf meinte, es sei einfach Chengs Haltung. Er sei eben ein Mann, der nie aufgehört hatte, sich so zu bewegen und so zu sitzen, als wäre da noch immer der alte, kranke Lauscher an seiner Seite, auch wenn der längst begraben war. So wie Leute, die nicht aufhören konnten, einen Platz neben sich frei zu halten für einen geliebten Menschen, der gar nicht mehr lebte.
Vor allem aber dachte Frau Wolf in diesem Moment, wie ungemein gut Herr Cheng in dieses Zimmer passte. Als wäre dieser Raum extra für ihn geschaffen worden. Den perfekten Sekretär.
Cheng hob den Kopf, ließ kurz den Stift sinken, mit dem er soeben etwas notiert hatte, und meinte: »Schon toll, was dieser Friseur mit Ihren Haaren macht, wenn ich das sagen darf.«
»Dürfen Sie, Herr Cheng, danke.«
Sie wandte sich nach rechts, dorthin, wo eine offene Flügeltüre in das große Büro führte, das einst Chengs Büro gewesen war. Im Vorbeigehen bat sie ihren Sekretär und Assistenten, einen Termin mit einer Dame von der Gerichtsmedizin zu vereinbaren. Einen Fall betreffend, den man kürzlich übernommen hatte.
Cheng nickte und griff nach dem Telefon.
Die Arbeit ging voran. Dezember 2019. Und niemand ahnte, was demnächst kommen würde.
1
Er kehrte zurück. Nach einer Ewigkeit.
Wofür es zwei Gründe gab.
Der eine Grund war: Er würde sein Augenlicht verlieren. Nicht vollständig, aber mit großer Wahrscheinlichkeit bliebe letztendlich nur noch eine Art unscharfer Rand übrig, das zentrale Gesichtsfeld hingegen würde von einem grauen oder schwarzen Fleck beherrscht sein. Noch war es nicht so weit. Noch verfügte er über genügend Sehkraft, um die Welt zu erkennen, mit Einschränkungen, das schon, Eintrübungen und Verzerrungen, sodass einiges wie in einem Nebel zu stecken schien. Aber es war eben noch ein leichter Nebel – verschwommen war etwas anderes –, mehr, als hauche jemand auf ein Glas. Ein impressionistischer Hauch, nicht ohne Reiz, trotz aller Bedrohung.
So würde sein Sehen in einen Zustand münden, der ihm als die optische Vorwegnahme seines Endes erschien. Und seines Übergangs. Gewissermaßen durch das Dunkel in der Mitte seines Gesichtsfeldes hindurch.
Richtung Himmel oder Richtung Hölle? Das würde sich noch zeigen.
Jedenfalls war das der eine Grund. Nämlich zurückzukehren, um noch einmal dem Ort seiner Kindheit und Jugend zu begegnen, sosehr sich dieser in über vierzig Jahren verändert haben mochte. Zurückzukehren, solange er überhaupt noch in der Lage sein würde, das Veränderte vom Gleichgebliebenen unterscheiden zu können.
Der andere Grund war seine Schwester. Genauer gesagt, der Tod seiner Schwester. Er hatte sie, nachdem er als Neunzehnjähriger die Stadt verlassen hatte, nicht wiedergesehen. Zumindest nicht leibhaftig. Denn immerhin waren die beiden im letzten halben Jahr miteinander in Kontakt gekommen. Dank moderner Technik, die es den über sechzigjährigen Geschwistern ermöglicht hatte, sich über einen Bildschirm auf der einen Seite der Welt und einem Bildschirm auf der anderen Seite gegenüberzusitzen. Nach mehr als vier Jahrzehnten, in denen sie nichts voneinander gehört hatten. Woran nicht sie, die Schwester, sondern er, der Bruder, schuld gewesen war.
Und nun war Eva tot und Leos Aufgabe würde es sein, sie zu beerdigen. Indem er an den Ort seiner Kindheit und Jugend zurückkehrte, um ihren Körper verbrennen und das Verbrannte im Grab der Eltern beisetzen zu lassen, würde er mit dem, was ihm derzeit an Augenkraft noch zur Verfügung stand, die Stadt sehen, die er 1976 verlassen hatte. Hätte er sie nicht verlassen, so wäre er nicht mehr am Leben. Sondern hätte sich umgebracht. Für ihn war das eine Tatsache.
Der Tag, an dem Leo Prager vierundvierzig Jahre zuvor die Stadt verlassen hatte, war ein Sonntag gewesen. Und zwar ein Sonntag, der sich lange im Gedächtnis der an diesem Ort und in diesem Land lebenden Menschen halten würde. Indem zum einen etwas nicht für möglich Gehaltenes geschah, und zum anderen etwas, das man auf eine gewisse Weise erwartet, vielleicht sogar auf leidenschaftliche Weise gefürchtet hatte. In beiden Ereignissen steckte ein Höchstmaß an Sensation, die ein ganzes Meer an heftigen Empfindungen auslöste, alles zwischen Trauer, Verzweiflung, Spannung, Verwirrung, Angst und dem einen oder anderen Gefühl schwer aussprechbarer Freude, Genugtuung oder Überlegenheit. Vor allem aber jenes Gefühl, welches zur Sensation ganz unmittelbar dazugehört, nämlich die Lust, weshalb die zwei Wörter ja konsequenterweise in einen gemeinsamen Begriff münden, der Sensationslust. Das wahrscheinlich aber treffendste Wort, das diesen Sonntag charakterisierte, war: Erregung.
Diese Erregung begann für Leo zunächst jedoch in der wohl gebräuchlichsten, wenn auch nicht banalsten Form, kurz nach Mitternacht. Indem er unter die Bettdecke eines Mädchens geriet, das er erst eine Woche zuvor kennengelernt hatte. Sie war achtzehn, und man befand sich in der Wohnung ihrer Eltern, die kaum erfreut gewesen wären, Leo dort zu finden, wo er war. Die streng katholische Mutter des Mädchens hätte es wohl so ausgedrückt: Ein Kinderzimmer ist kein Bordell.
Dementsprechend leise lief die Begegnung in genau jenem Kinderzimmer der jungen Frau ab. Leise und auch vorsichtig. Auf eine leidenschaftliche Weise zurückhaltend, und ohne dass es zu einem Koitus kam. Allein jene Praxis zärtlicher bis wilder Berührung nutzend, die man Petting nannte (so nennt man es noch immer, aber in den 1970er-Jahren war dieses Wort in aller Munde, ausgesprochen oder unausgesprochen, ein Wort mit einem Glanz. Während es in unseren Tagen rein gar nicht mehr glänzt, wenn es nicht ohnedies für einen Fachbegriff aus der Haustierpflege gehalten wird).
Es war kurz nach vier in der Früh, als das Mädchen erwachte und Leo wachrüttelte, um ihm zu sagen, er solle jetzt bitte gehen. Ihre Eltern hätten leider auch an den Wochenenden die Angewohnheit, sehr zeitig aufzustehen: der schlaflose Vater und seine ihm auch in diesem Punkt treue Frau.
»Die sind wie Zwillinge«, sagte das Mädchen. »Schrecklich.«
Und dann küsste sie Leo noch einmal sehr heftig, fügte jedoch an diesen Kuss einen leichten Tritt an, um ihn aus dem Bett zu bekommen.
Er zog sich an, ließ sich von dem Mädchen durch die dunkle Wohnung führen, die ihm wie ein schwarz lackiertes Spiegelkabinett erschien, und gelangte – mit einem allerletzten Kuss bedacht – hinaus ins Freie, hinaus auf die menschenleere, von der ersten Dämmerung aufgehellte Straße.
Er dachte sich: »Das war jetzt der letzte Kuss meines Lebens.«
Dass dieser Satz eine gewisse Berechtigung besaß, ahnte er. Aber er ahnte nicht, in welcher Form.
Denn als er nun losmarschierte, waren seine Gedanken die gleichen, die er schon so lange mit sich herumtrug, dieses unweigerliche Gefühl, sein Leben demnächst aus der Hand geben zu wollen. Nicht, weil er im Leben keinen Sinn sah. Er sah den Sinn, aber er konnte ihn nicht greifen. Das eigene, tief empfundene und unfassbare Unglück vereitelte ihm jeglichen Zugriff auf den Sinn.
Ein Unglück, das frei war von Begründungen. Es brauchte keine Erlebnisse, weder gute noch schlechte. Es war nicht entscheidend, geküsst oder ungeküsst zu sein. Das Unglück war einfach da, wie ein Stein in seinem Kopf. Ein Stein, an dessen Existenz sich niemals etwas ändern würde, gleich, was er tat oder unterließ. Wie viel Liebe oder Abneigung er auch erfuhr. Dieser Stein ließ sich im wahrsten Sinne durch nichts erweichen. Er wurde nicht einmal größer oder schwerer, wie man das etwa von einem Tumor hätte behaupten können.
Leo wehrte sich gegen den Begriff Depression. Er sah sich nicht als eine »Wirtschaft im Abschwung«. Sondern sprach weiterhin vom »Stein«, der schon immer in diesem seinem Kopf gewesen war. Mit dem zusammen er auf die Welt gekommen war.
Nicht zum ersten Mal überlegte er, wie er sich umbringen könnte. Er war – er drückte es selbst so aus – verliebt in diese Idee. So wie er verliebt war in die Geschichten bekannter Selbstmörder. Sich mit ihnen zu beschäftigen erschien ihm als ein großer Trost. Trost und Vorbild. Und Klischee natürlich: junge, verzweifelte Poeten, schwermütige Schönheiten, Duellanten, Romantiker. Ja, er liebte auch das Klischee. Das ganz besonders.
Zugleich fürchtete er, indem er sich tötete, das Unglück, das er so tief und steinartig fundamental empfand, an seine Familie weiterzugeben. An seine Eltern und seine Schwester. Sich selbst zu befreien, aber dadurch den Stein weiterzugeben. Weiterzugeben an diese überhaupt nicht unglücklichen Eltern und diese überhaupt nicht unglückliche Schwester. Denen er durch seinen Freitod einen ewigen Schmerz zufügen würde. Davon war er ebenso fest überzeugt wie von der eigenen Unheilbarkeit.
Über dieses Dilemma nachdenkend, bog er nach rechts ab, ausgerechnet in eine Straße, die nach Franz Kafka benannt war, der zwar kein Selbstmörder gewesen war, aber doch einer der früh verstorbenen Heiligen des Unglücks. Über die Kafkastraße gelangte Leo hinunter zur Donau, an der entlang er sich in Richtung Mexikoplatz bewegte.
Seinen Selbstmordfantasien zum Trotz war er entschlossen, die Donau in diesem Dämmerlicht eines beginnenden Tages zu filmen. Er hatte sie immer dabei, seine Super-8-Kamera, die er zwei Jahre zuvor, siebzehnjährig, vom ersten selbst verdienten Geld erworben hatte und die ihn seither ständig begleitete. Wobei er das, was er filmte, als ein Dokument seiner Umgebung ansah. Nicht als Kunst, aber ebenso wenig als Unterhaltung, wie im Falle der zu dieser Zeit so beliebten Aufnahmen familiärer Aktivitäten: Menschen beim Essen, vor Weihnachtsbäumen, beim Skifahren im Schnee liegend, oft lachend, auch im Sturz lachend, das Missgeschick geradezu suchend als den heimlichen Höhepunkt unendlicher Langeweile, dazu immer den Blick in die Kamera gerichtet. Derart, dass man als Kamera hätte meinen können, sie, die Menschen, würden mit den Linsen in ihren Augen die Kameras filmen.
Nein, Leo wollte einfach das ihn Umgebende festhalten, etwas, das er »die Wand der Welt« nannte. Und wozu eben auch dieser Fluss gehörte.
Er filmte im Gehen, während er sich entlang der Donau in Richtung jener sandburgartigen katholischen Kirche bewegte, die man dadurch aufgewertet hatte, sie dem heiligen Franz von Assisi zu widmen.
Er befand sich noch ein kleines Stück vor dieser Kirche, den Blick durch die Kamera gerichtet. Deren Surren konnte einem so vorkommen, als handle es sich um eine Nähmaschine, die hier ein Abbild der Wirklichkeit auf einen Kodachrome-Film nähte.
In diesem Moment … Er vernahm ein Geräusch. Also zuerst wirklich nur das Geräusch, von dem er in seiner Erinnerung dachte, es sei ein Geräusch gewesen, wie wenn etwas sehr Kleines, sehr Dünnes bricht, eher ein Zahnstocher als ein Ast. Es allerdings von jemand vernommen wird, dessen übergroße Nähe zum brechenden Objekt bewirkt, dass dieses kleine Geräusch als ungemein mächtiger Knall in sein Ohr gerät.
Und dann begriff er.
Er schwenkte seine Kamera hinüber zur knapp oberhalb der Assisi-Kirche gelegenen sogenannten Reichsbrücke, einer monumentalen Kettenbrücke, die an dieser Stelle die Donau querte und vom einen Teil der Stadt in den anderen führte. Vom Diesseits ins Jenseits, wie es salopp hieß, das Zentrum mit der Peripherie verbindend.
Tatsache war, dass Leo, als er jetzt durch das optische System seiner Kamera hindurch zur Konstruktion der über tausend Meter langen Reichsbrücke sah, erkennen musste, wie diese vollkommen aus ihren Fugen geriet, sich heftig schwankend aufbäumte, und wie in der Folge der ganze mittlere Teil des Bauwerks in sich zusammenbrach und in den Fluss stürzte.
Stand er unter Drogen?
Eigentlich nicht. Denn er hatte schon früh einsehen müssen, wie wenig irgendeine Droge ihm half, den Stein in seinem Kopf zu erweichen. Keine Drogen also. Auch keine Einbildung. Nein, soeben war eine der wichtigsten Brücken der Stadt Wien in der fünften Stunde eines ersten Augusttags mit einer geradezu filmreifen Leichtigkeit und einem im Verhältnis zur Wirkung kleinen Keuchen eingestürzt, auch wenn nachher von einem großen Krachen gesprochen wurde und es sogar hieß, diverse Seismografen hätten wie bei einem Erdbeben ausgeschlagen.
Es war sonderbar, irre, unwahrscheinlich, aber letztlich geschah es mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der sich ein Blatt von einem Zweig löst.
Und er, Leo, hatte es gesehen. Gesehen und gefilmt.
Die Wand der Welt gefilmt, die in diesem Moment aus einer einstürzenden Brücke bestanden hatte.
Wer nun vierundvierzig Jahre später versuchte, sich Leos Dokument dieser Katastrophe, diesen zwischenzeitlich doch wohl digitalisierten Film anzusehen, oder auch nur meinte, in irgendeinem alten Zeitungsausschnitt oder zeithistorischen Bericht etwas über seine Existenz zu erfahren, und sei es bloß ein Kommentar zu seinem dubiosen Verschwinden, würde kein Glück haben. Nicht auf YouTube, nicht einmal auf den Seiten der Verschwörungstheoretiker, die jeden Tag ein Ufo sichteten und jeden Tag einen verheimlichten Asteroiden witterten. Nichts. Nicht einmal etwas Verwackeltes oder Verschwommenes oder Gelöschtes.
Denn alle Filme und Fotos, die das Unglück betrafen, zeigten es von dem Moment an, als der Einsturz bereits geschehen war und der gebrochene Brückenteil vollständig in der Donau gelegen hatte.
Leo Pragers Film hingegen dokumentierte das gesamte Geschehen. Allerdings sollte dieser Film nie die Kamera verlassen, mit der er aufgenommen worden war. Nicht in den folgenden über vierzig Jahren.
Dabei hatte Leo das gesamte Schlingern und Aufbäumen und Einstürzen der gewaltigen Brücke dokumentiert. Zuletzt wechselte er ein wenig seine Position, um auch jenen später berühmt gewordenen »Donaubus« aufzunehmen, einen Bus der Wiener Verkehrslinien, der im Moment des Einsturzes in der Mitte der ansonsten fast leeren Brücke auf seinen Fahrtbeginn gewartet hatte und der trotz des Einsturzes an genau dieser Parkposition geblieben war, um dort von den Fluten der Donau umspült zu werden. Ohne dass diese ihn aber weggerissen hätten und er zur Gänze versunken wäre.
Nachdem dies alles geschehen und von Prager gefilmt worden war, vernahm er punktgenau den markanten Ton, der das Ende der Filmrolle anzeigte (in seiner Erinnerung würde dieser Ton immer wieder zu dem merkwürdigen Bild eines toten, sich aber im Totsein selbstständig einrollenden kleinen Vogels führen).
Er nahm die Kamera von seinem Auge, senkte das Gerät und konnte feststellen, dass dies alles auch wirklich geschehen war und er nicht etwa einer verzauberten und in ihrer Verzauberung perversen Kamera auf den Leim gegangen war.
Erst dann erstarrte er in Fassungslosigkeit. Brach aber bald aus dieser Starre aus und entschied sich, augenblicklich den Ort der Katastrophe zu verlassen. Er wollte nicht als Zeuge dienen, oder, viel schlimmer, als ein Verdächtiger befragt werden. So langsam war die Wiener Polizei nicht. Und auch wenn man recht schnell vermuten und schließlich auch belegen würde, dass technische Mängel zu diesem nicht vorhersehbaren Einsturz geführt hatten, so war Leos erster Gedanke, es würde sich um einen Anschlag handeln. Etwas, das möglicherweise mit jener hinter der Brücke gelegenen Baustelle der sogenannten UNO-City zusammenhing. Und die Annahme eines Anschlags wurde anfangs auch nicht ganz ausgeschlossen.
Leo Prager entfernte sich. In aller Eile.
So kam es, dass eine Stunde später, als er seine kleine, an der Rechten Wienzeile gelegene Wohnung im 5. Wiener Gemeindebezirk erreichte und sein Radiogerät einschaltete, bereits mit der gebührenden Aufregung über etwas berichtet wurde, was nicht wenige im ersten Moment für einen Scherz hielten. Hätte es nur so etwas wie einen Ersten-August-Scherz gegeben.
Gab es aber nicht. Und während eine Menge Wiener und Wienerinnen sich auf den Weg machten, um sich vor Ort davon zu überzeugen, dass keinerlei Verwandlung eines ersten Aprils in einen ersten August vorlag, legte sich Leo Prager in sein Bett. Getroffen von einer Müdigkeit, die sich weniger durch den kurzen und unruhigen Schlaf an der Seite eines begehrten Körpers erklären ließ, als durch die Erschöpfung, die daraus resultierte, im Moment, da er gerade die Möglichkeiten eines Selbstmordes bedacht und abgewägt hatte, Zeuge dieses Einsturzes geworden zu sein. Und das war ja nicht irgendein Brücklein gewesen, sondern ein Wahrzeichen dieser Stadt, eine technische Schönheit, mit der selbst jene vertraut waren, die nie über diese Brücke gefahren oder gegangen waren. Wie man ja auch nie mit dem berühmten Riesenrad gefahren sein musste, um sich selbst als ein Teil dieser Konstruktion zu empfinden. Stadt und Menschen sind letztlich vollkommen verwoben, jeder Fußgänger, jeder Autofahrer, jeder, der irgendwie unterwegs ist oder irgendwie stillsteht. Und wenn dann so ein Bauwerk wie mit einem diabolischen Fingerschnippen in sich zusammenkracht, werden sich die Menschen dieser symbiotischen Verbindung auf eine schmerzvolle Weise bewusst. Jeder fühlte den Verlust dieser Brücke als einen Verlust in sich. Man spürte das Wasser der Donau auf der eigenen Haut. Wie man auch ahnte, dass das, was anstelle der niedergegangenen Konstruktion entstehen würde, nie wieder die gleiche Eleganz und Anmut und Herrlichkeit erreichen würde (und so kleinkariert eine solche Anschauung auch sein mochte, die Realität würde sie in der Folge bestätigen).
Leo schlief bis in den Nachmittag hinein. Als er erwachte und aus dem Radio erneut dramatische Stimmen der Betroffenheit wahrnahm, brauchte er eine Weile, bis er verstand, dass diese Betroffenheit – dieser Versuch, das Unaussprechliche in Worte zu fassen – nun gar nicht mehr der eingestürzten Brücke galt, sondern einem schweren Unfall des österreichischen Formel-1-Rennfahrers Niki Lauda auf dem Nürburgring. Wobei es in diesem Moment völlig unklar schien, ob Lauda die starken Verbrennungen überleben würde (tatsächlich waren es aber in erster Linie die Lungenverätzungen, die seinen kritischen Zustand bedingten).
Leo konnte es nicht glauben. Dabei gehörte er nicht einmal zu den Anhängern dieses Mannes, der da in einem Ferrari an einer Stelle der Strecke verunglückt war, die immer schon als höchst gefährlich eingestuft worden war und es ja ausgerechnet Lauda gewesen war, der sich aufgrund regennasser Bedingungen ursprünglich gegen einen Start ausgesprochen hatte.
Dieser Unfall musste also sehr viel weniger überraschen als der Einsturz einer Brücke, die immerhin den zweiten Weltkrieg heil überstanden hatte und deren Existenz im Unterschied zu der eines noch so gottgleichen Rennwagenfahrers als ewig eingestuft worden war.
Dennoch erging es Leo wie den meisten seiner Landsleute. Er konnte sich dem Zeichenhaften eines solchen Zusammentreffens zweier Ereignisse nicht entziehen. Er empfand das Zeichenhafte mit großer Wucht. Auch wenn er nicht um Laudas Leben bangte. Und dennoch konnte er sich nicht der Bedeutung der Koinzidenz entziehen. Einer Koinzidenz, die trotz des zeitlichen Unterschieds zwischen den beiden Ereignissen die Wirkung von zwei Signalen besaß, die man als ein einziges wahrnahm. Der Tag wurde zum Punkt. Wie hier das Äußere – nämlich eine einstürzende Brücke und der Unfall eines Helden – bei allen Symbionten – also vielen Wienern und nicht wenigen Österreichern – etwas Inneres auslöste. Und im Falle Leos eine persönliche Entscheidung erzwang. Umso mehr, als Leo eins der beiden Ereignisse wie kaum ein anderer verfolgt hatte.
Erst später würde sich Leo auch jener Parallele bewusst werden, die darin bestand, dass die Filmaufnahmen, die Niki Laudas Unfall zeigten, von keiner der offiziellen Fernsehkameras stammten – denn solche waren an dieser Stelle der Rennstrecke einfach nicht postiert gewesen –, sondern dass diese ins Bewusstsein einer ganzen Nation eingegangenen Bilder des plötzlich nach rechts ausscherenden, in die Felswand krachenden, in Flammen aufgehenden und von einem weiteren Wagen getroffenen Ferrari von zwei Hobbyfilmern aufgenommen worden waren. Und auch diese hatten mit einer Super-8-Kamera gedreht. Immerhin waren das die Jahre gewesen, in denen diese handlichen, für so gut wie jeden gedachten Schmalfilmkameras im Zenit ihrer Beliebtheit standen. Und es darum weniger wunderte, dass Laudas Unfall von Amateuren gefilmt worden war, sondern es vielmehr erstaunte, dass dies nicht auch im Falle des Reichsbrückeneinsturzes geschehen war.
Aber dieser Film existierte ja. Allerdings seit vier Jahrzehnten eingeschlossen in ein Kassettengehäuse und dieses eingeschlossen in ein Kameragehäuse.
Leo hatte diese Kamera, als er am Abend des ersten August 1976 die Stadt verließ, im Gepäck. Nicht, dass er in diesem Augenblick bereits entschieden hatte, den Film unentwickelt zu lassen. Das geschah erst Tage später, nachdem er vom nahen Ausland aus die Nachrichten verfolgt hatte. Nachrichten aus diversen Zeitungen.
Der verwirrende Punkt für ihn war: kein Wort darin über eine sechste Person.
Worüber berichtet wurde, war der bei aller Tragik glückliche Umstand eines einzigen Toten, bei dem es sich um den Lenker eines Kleintransporters handelte, ein junger Mann, der für den ORF unterwegs gewesen war und dessen Leiche man erst Tage nach dem Unglück aus seinem Wagen barg. Der Fahrer eines VW-Käfers hingegen, sowie zwei Mitarbeiter einer Pannenhilfe, hatten auf einem intakt gebliebenen Teil der Kaibrücke überlebt, und der Fahrer des Linienbusses, der mit dem Mittelteil in die Donau gestürzt war, war so gut wie unverletzt geblieben.
Fünf Personen auf einer Brücke, auf der untertags Hunderte gewesen wären. Fünf Personen mit Namen und Schicksal. Und einer davon gestorben.
Fünf, nicht sechs.
Leo aber … Leo hatte gleich zu Beginn der Katastrophe gemeint, weit oben, in die Luft katapultiert – für einen Moment geradezu über dem Geländer schwebend –, jemanden ausgemacht zu haben. Einen Mann wohl. Jedenfalls eine Person, die unrettbar von der massiven Bewegung der Brücke in die Höhe geschleudert wurde.
Da war sich Leo ziemlich sicher gewesen.
Eine Sicherheit, die nun freilich ins Wanken geriet, nachdem er erkennen musste, dass über diese sechste und an ungünstigster Stelle befindliche Person nirgendwo etwas geschrieben stand. Nicht direkt nach dem Unglück und auch später nicht. Niemand erwähnte je diesen einen Mann, keine Zeitung, keine Dokumentation, kein Journalist, vor allem keine von den Personen auf der Brücke, die das Unglück überlebt hatten, und auch keiner von den wenigen Augenzeugen, die frühmorgens unterwegs gewesen waren oder von ihren Schrebergärten aus die Katastrophe beobachtet hatten.
Natürlich, nichts hätte nun so sehr Gewissheit geschaffen, wie einfach den Film entwickeln zu lassen. Und tatsächlich war Leo in der ersten Zeit nach den Ereignissen kurz davor gewesen, fern der alten Heimat ein Fotogeschäft aufzusuchen.
Was ihn dann aber auf eine verrückte Weise abhielt – und es sollte ihn vier Jahrzehnte abhalten –, war der Gedanke, dass, indem er diesen Film entwickelte und damit das Geschaute bewies, er zum Mörder dieses unbekannten Mannes auf der Brücke werden würde. Und zwar in dem Sinne, dass allein die Beobachtung so etwas wie Realität schuf. Eine Idee, die er schon lange mit sich trug.
Im Falle dieses Mannes auf der Brücke würde die Beobachtung, die mittels der Kamera erfolgt war, erst dadurch Gewicht erhalten, dass ein Labor den Film im Zuge der Entwicklung sichtbar machte. Anschaubar. Ein nicht entwickelter Film würde den Umstand eines sechsten Mannes gewissermaßen in der Schwebe halten. Besser gesagt, dieser Mann würde einfach nie auf dieser Brücke gewesen sein, irgendwo anders vielleicht, aber nicht auf dieser Brücke.
Stimmt, Einstein sagte einmal, der Mond sei auch da, wenn keiner hinschaut. Aber von Einstein besaß Leo zu dieser Zeit so wenig Ahnung wie von denen – etwa Niels Bohr oder Werner Heisenberg –, die zumindest im Quantenbereich sich einen »Mond« vorstellen konnten, der nicht gänzlich unabhängig war vom Umstand der Messung und der Beobachtung. Der eben nicht aufging, wenn man nicht auch hinsah.
Leo jedenfalls vertrat die Anschauung, dass die Existenz der Dinge durchaus davon beeinflusst wurde, ob man sie beobachtete oder nicht. So wie er auch meinte, dem Stein in seinem Kopf allein dadurch zu unheimlicher Realität verholfen zu haben, indem er diesem Stein eine Gestalt zugewiesen hatte. Eine Vorstellung von diesem Stein entwickelt hatte, die er nicht mehr rückgängig machen konnte.
Verrückt oder nicht, Leo entschloss sich, die Entwicklung des Films hinauszuschieben. Zuerst schob er sie hinaus, dann verwarf er sie endgültig, um nicht zum Mörder dieses Mannes zu werden. Letztlich aber auch aus der Haltung heraus, dass es eigentlich egal sei, ob er mit seiner Annahme recht habe oder nicht. Es jedoch logischer und vernünftiger sei, auf eine Entwicklung des Films zu verzichten, falls an seiner »irren« Vorstellung eben doch etwas dran sei.
Auf gewisse Weise war das Leos Gesetz.
Nicht unähnlich jener pascalschen Wette, die besagt, es sei sinnvoller, an Gott zu glauben, als nicht an ihn zu glauben, egal, was davon stimmt, weil man als der, der an Gott glaubt, entweder gewinnt oder aber nichts verliert.
»Glaube also, wenn du kannst«, postulierte Pascal.
Und Leo sagte sich: »Lass den Film unentwickelt, wenn du kannst.« Und er konnte es. Lange Zeit.
Am Abend dieses Tages jedenfalls entschied sich Leo für Flucht. Eine Flucht, die ihm schon lange durch den Kopf gegangen war. Sosehr ihm auch die Naivität des Gedankens bewusst war, nämlich seinem von Dunkelheit geprägten Gemütszustand dadurch begegnen zu können, indem er den vertrauten Ort aufgab und an unvertraute Orte wechselte. Und doch war ihm diese Möglichkeit schon seit Kindertagen ein ähnlicher Trost gewesen wie seine romantische Bewunderung für berühmte Selbstmörder. Beziehungsweise für Leute, die mittels irgendeiner Verwegenheit oder Übertreibung das Risiko des Sterbens eingingen. Leute, die in einer tatsächlichen oder übertragenen Weise zu weit nach oben geklettert waren.
Fortgehen!
So konnte er jenen Selbstmord vermeiden, von dem er fürchtete, dadurch eine Übertragung seiner Krankheit auf seine Eltern und seine Schwester zu verschulden. Indem er aber Wien verließ, radikal und endgültig, konnte er sein Leben aufgeben, ohne sterben zu müssen. Denn das war schon klar, dass die Reise, die er antrat, weder Abenteuer noch Urlaub bedeutete oder den Pathos und die Verwegenheit des Aussteigertums in sich trug. Und ebenso wenig etwas darstellte, was in augenzwinkernder Weise die Möglichkeit einer baldigen Rückkehr beinhaltete. Er hatte nicht vor, gefunden zu werden, gleich den Leuten, die sich die Pulsadern aufschnitten, aber vorher noch fleißig herumtelefonierten und diverse Andeutungen über Pulsadern machten.
Einen Brief ließ er allerdings zurück, einen »Abschiedsbrief« für seine Mutter und seinen Vater und seine Schwester, in welchem er das Versprechen ausdrückte, sich trotz aller Sehnsucht nach dem Tod eben nicht das Leben zu nehmen, zugleich aber, um dieses Versprechen überhaupt geben zu können, Ort und Leben und damit auch die Familie verlassen zu müssen. Wobei er betonte, dass sie, die Familie, keine Schuld trage an dem, was ihn so quäle: der Stein in seinem Kopf. Beziehungsweise schrieb er vom »Schatten auf seiner Seele«, weil er davon ausging, dass dieses Bild sich am ehesten eignete, verstanden zu werden, und nicht die Bilder, die ihm tatsächlich einfielen, die aber zu Missverständnissen hätten führen können.
Er beendete seinen Brief mit der Bitte, ihm zu verzeihen. Eigentlich wollte er den Satz wieder wegstreichen, er hatte etwas Widerwärtiges und Kokettes an sich. Aber hätte er jetzt einen sogenannten Tintentod oder Tintenkiller zur Hand genommen und versucht, das Geschriebene zu vertuschen, es hätte eher Anlass gegeben nachzuforschen, was er da eliminiert hatte.
Er ließ den Satz also stehen, ergänzte ihn jedoch um ein Ich liebe Euch!
Dann packte er eine große Tasche zusammen, in der sich auch jene Super-8-Kamera befand. Darin der Kodachrome-Film, der die nächsten vierzig Jahre unentwickelt bleiben würde. Auf diese Weise allerdings auch geschützt, eine Art embryonalen Zustand erhaltend. Am Leben, aber nicht im Leben.
Kein sechster Mann auf der Brücke.
Als Leo ging, hatte er gerade so viel Geld in der Tasche, um am Wiener Westbahnhof ein Zugticket zu bezahlen. Es ist aber nicht wichtig zu sagen, wohin er als Erstes fuhr. Er fuhr weg, das war der Punkt. Vor vierundvierzig Jahren fuhr er weg.
2
Dezember 2019.
Er war drei Tage unterwegs gewesen, hatte dabei die halbe Welt umrundet und landete nun auf jenem Flughafen, der gleich einer Gruppe sich dehnender, waagrecht und senkrecht streckender Bodenturnerinnen südlich von Wien ausgebreitet dalag. Mit dem Taxi ließ er sich hinein in die Stadt und zu der Adresse bringen, an der seine Schwester zuletzt gelebt hatte, dorthin, wo ihr entstellter, toter Körper aufgefunden worden war.
Er würde also zuerst den Tatort sehen, erst dann seine Schwester. So wollte es der Chefinspektor, der Leo kontaktiert hatte, ihm von Evas Tod berichtet und ihn sodann gebeten hatte, nach Wien zu kommen, nicht zuletzt, um ihren Leichnam zu identifizieren.
Das hatte angesichts der langen Trennung zwischen Bruder und Schwester etwas Absurdes, auch war Leo nicht der einzige lebende Verwandte, aber anscheinend der Einzige, der bereit war, eine lange Reise auf sich zu nehmen, um dem Willen der Polizei, dem Willen seiner Schwester und dem Willen eines Beerdigungsunternehmens nachzukommen.
Der Chefinspektor empfing Leo vor dem dunklen Gründerzeitbau in der kleinen, engen Straße. Sein Name war Rosig. Allerdings hatte er nichts an sich, was diesen Namen auf eine optische oder charakterliche Weise bestätigt hatte. Hätte er Berg, Fest, Winter oder Schwarz geheißen, hätte das sehr viel besser gepasst. Sein Name war eine Täuschung.
Begleitet wurde Rosig von einer jungen Frau, die, groß gewachsen, schlank und jung, an eine Volleyballspielerin erinnerte. Auch physiognomisch. Es war eine beträchtliche Aufmerksamkeit und Wachheit in ihrem Gesicht. Man könnte sagen, sie sah die Bälle kommen. Die kleinen wie die großen. Und sie war die Assistentin, die Rosig wirklich nötig hatte.
Leo Prager würde das nach und nach verstehen, weil Rosig bei aller kriminalistischen Erfahrung und seinem guten Ruf leider jemand war, der gerne vergaß, was er vor zehn Minuten gesagt oder welche Entscheidung er am Vortag getroffen hatte. Nicht, dass je das Wort Demenz oder auch nur Vergesslichkeit gefallen wäre, vielmehr schaffte es die junge Frau, den Chefinspektor an dieses oder jenes zu erinnern, ohne dass es nach einer Korrektur oder einem Soufflieren geklungen hätte, eher kam es als ein Zitat daher. Sie zitierte ihren Vorgesetzten, der auf diese Weise daran erinnert wurde, was er zuletzt erkannt, entdeckt, geschlossen oder gemeint hatte. Und wieso man an einem bestimmten Ort war und nicht an einem anderen.
Dabei wirkte Rosig in keiner Weise verwirrt oder fragil, wahrlich nicht. Sondern einfach ergänzt. Ergänzt um eine Frau, die den Namen – und das ist jetzt bitte kein Witz –, den Vornamen Roswitta trug. Und man sich also vorstellen konnte, wie viel dumme Sprüche über dieses »Ermittlerpaar« in der Mordkommission in Umlauf waren.
Kurt Rosig und Roswitta Bregenzer.
Rosig und Roswitta!
So, wie vielleicht ein Herrscher- oder Heiligenpaar, ein Eiskunstlaufpaar, vor allem aber ein Schlagersängerduo hätte heißen können.
»Kommen Sie«, sagte der Chefinspektor zu Leo Prager, nachdem er ihm die Hand geschüttelt und sich und seine Assistentin vorgestellt hatte (niemand ahnte, welche Bedeutung, welcher Wert in dieser Freiheit bestand, die Hand des anderen zu nehmen, einen Moment lang im gegenseitigen Griff vereint zu sein, und wie sehr man das, was man da soeben recht automatisch tat, der Konvention folgend, bald nur noch als eine bittere Reminiszenz erleben würde).
Gemeinsam trat man in ein lang gestrecktes Stiegenhaus und gelangte in einen schmalen Innenhof, in dem ein hoher, vom Winter entlaubter Baum stand, der aber auch mit seinen bloßen Ästen eine Menge Licht zu verschlucken schien. Von dort ging es weiter in das dahinterliegende Gebäude, die »zweite Stiege«, wie das hieß. Im dritten Stock dieser zweiten Stiege erreichten sie eine Türe, von welcher der Chefinspektor das Siegel entfernte, einen Schlüssel ins Schloss führte und sie öffnete.
Alle drei traten ein.
Was hatte Leo erwartet? Weniger Trostlosigkeit? Weniger Düsternis?
Nun, es war eben keine besonders helle Wohnung.
»Und Sie haben Ihre Schwester wirklich das letzte Mal vor … wie vielen Jahren gesehen?«, fragte Rosig.
»Vor vierundvierzig Jahren.«
»Praktisch ein Leben«, sagte Rosig.
»Fitzgerald«, antwortete Prager.
»Wie meinen?«
»F. Scott Fitzgerald, der Autor von Der große Gatsby. Der wurde genau vierundvierzig Jahre alt.«
»Haben Sie was mit Literatur zu tun?«, fragte Rosig. In seinem Gesicht war eine Falte, die sich vom Kinn bis zur Stirn seiner bemächtigte. Eine Falte wie eine Wurzel.
»Nein, gar nicht«, sagte Prager. »Ich erwähnte das nur, weil Sie meinten, vierundvierzig Jahre seien ein Leben.«[1]
»Ja, richtig.« Rosigs Gesicht entfaltete sich wieder. Dann gab er die Richtung vor und man wechselte vom Vorraum in eins der beiden Zimmer, die hinaus auf den schmalen Innenhof wiesen.
Frau Bregenzer schob die schweren Vorhänge zur Seite. Ein wenig von dem Licht, das vor dem hohen Baum hatte flüchten können, drang herein.
Wie traurig, dachte Leo beim Anblick der Einrichtung. Dabei hätte sich seine Schwester mit ihrer ganz anständigen Pension eigentlich etwas Besseres leisten können. Kein Luxusappartement, das nicht. Aber doch eine Wohnung mit Gegenständen, die weniger trostlos anmuteten. Diese alten, billigen Möbel drückten für Leo eine gewisse Verachtung aus. Wie wenn jemand erklärt, es nicht besser und nicht anders verdient zu haben.
»Hier haben wir Ihre Schwester gefunden«, erklärte Rosig und zeigte auf die Mitte des Bodens, dorthin, wo ein zerschlissener Knüpfteppich von müdem Grau an beiden Längsseiten große Flecken getrockneten Bluts aufwies. Auch auf dem alten Parkett war das Blut zu erkennen. Die Flecken wirkten in Summe wie ein Paar rotbrauner Flügel.
»Gott, wie kann man so viel Blut verlieren«, meinte Leo und hielt sich selbst an den Händen.
»Man kann, Herr …«
»Ja, Herr Prager, man kann«, fügte Roswitta Bregenzer den Namen des Angesprochenen an.
»Zwölf Messerstiche«, sprach nun wieder der Chefinspektor. Und erklärte, dass die große Anzahl an Stichwunden natürlich ein Verbrechen nahelege, welches mit beträchtlicher Wucht und irrationaler Wut vorgenommen worden sei und auf einen persönlichen Kontakt zwischen Opfer und Täter verweise. Auch sei, soweit man das bisher sagen könne, nichts gestohlen worden. Nicht einmal Eva Pragers Computer, dessen Inhalt derzeit noch ausgewertet werde. Keine Einbruchsspuren. Auf den ersten Blick also eine Beziehungstat.
»Aber wie sicher können wir da sein?«, fragte Rosig. »Möglicherweise sollen wir nur denken, hier sei ein Wahnsinniger am Werk gewesen, der mit Ihrer Schwester persönlich verbunden war. Man könnte sich jedoch vorstellen, dass mit einem ersten Messerstich der eigentliche Zweck bereits erreicht war und alle elf, die noch folgten, einzig und allein – entschuldigen Sie, dass ich das so ausdrücke – für uns vorgenommen wurden. Damit wir denken, was wir denken sollen. Deshalb ein Messer und keine Pistole. Messer besitzen etwas Intimes, weil nahe am Haushaltlichen und in nächster Nähe zum Opfer. Pistolen dagegen sind unpersönlich, auch wenn so mancher Familienvater … die töten dann aber auch mehr als nur eine Person.«
Er machte eine kleine Pause und verzog für einen Moment erneut sein Gesicht zu einer Wurzel, einer nicht ganz so großen wie bei der Frage nach Pragers Zugehörigkeit zur Literatur, aber doch recht heftig. Die Wurzeln in seinem Gesicht kamen und gingen, als seien sie Natur, die sich beeilt.
»Allerdings«, sprach er weiter, »haben wir einen Verdächtigen. Ihre Schwester hatte einen Mitbewohner. Sie scheint diesen …«
»Erich Feiler«, sagte Rosigs assistierendes Gedächtnis, wobei Roswitta Bregenzer nie in Eile sprach, sondern perfekt die kleinen Leerstellen in Rosigs Rede füllte. Und nie sah man sie dabei ihre Augen verdrehen.
»Ja, also dieser Feiler«, setzte Rosig fort, »ist ein Junkie, den ihre Schwester bei sich aufgenommen und dem sie das andere Zimmer überlassen hat. Ohne dass er dafür zahlen musste. Immerhin aber war er angemeldet. Soweit wir wissen, haben sich Feiler und Ihre Schwester zufällig auf der Straße kennengelernt. Ich behaupte nicht, dass er ihr Drogen verkauft hat.«
»Was mich auch gewundert hätte«, sagte Leo.
»Wieso? Weil Sie meinen, Damen über sechzig nehmen keine Drogen.«
»Ich bitte Sie! Das war wirklich nicht ihr Stil.«
Rosig ersparte Leo den Hinweis auf dessen über vierzigjährige Absenz und erklärte, dass Feiler sich aufgrund des dringenden Tatverdachts derzeit in Untersuchungshaft befinde.
»Er behauptet«, sagte Rosig, »die Leiche entdeckt, sie angefasst und sich dabei blutig gemacht zu haben. Daraufhin sei er in Panik aus der Wohnung gelaufen, um erst später mit seinem Handy die Polizei zu benachrichtigen. Natürlich ist er verdächtig. Obdachlos, süchtig, und dann nimmt Ihre Schwester ihn auf. Warum auch immer sie das getan hat. Vielleicht wollte sie ihn ja wieder hinauswerfen, vielleicht ist er in seinem Rausch durchgedreht. Und keine Frage, der Mann weist eine hübsche kleine Liste an Vorstrafen auf. Allerdings keinerlei Körperverletzungen. – Hat Ihnen Ihre Schwester überhaupt von ihm erzählt?«
»Ja, schon«, sagte Leo. »Dass da ein junger Mann … Na, wenn man selbst über sechzig ist, ist ein Dreißigjähriger natürlich ein junger Mann. Dass er also bei ihr wohnen würde. Aber nicht, weil sie etwas mit ihm hatte. Das kann man ausschließen.«
»Sicher?«, fragte Rosig.
»Meine Schwester hat diesen Mann definitiv nicht aufgenommen, weil sie so etwas wie einen Liebhaber nötig hatte. So wenig wie Drogen.«
»Und dann lässt Ihre Schwester also rein zufällig einen kleinen Dealer bei sich wohnen«, stellte Rosig fest.
»Na, ich denke, das mit den Drogen hat sie einfach nicht gekümmert. Allerdings hat sie gemeint, dass sie sich nun sehr viel sicherer fühle, seitdem sie nicht mehr allein in dieser Wohnung lebe.«
»Sie hatte also doch Angst«, meinte Rosig.
»Ich kann nicht wirklich sagen, was es war«, erklärte Leo, »ich dachte halt, es ist ein Bedürfnis nach Geselligkeit. Nicht nach Sex, nach Geselligkeit. Allerdings …«
»Ja?«
Es war vor einem halben Jahr gewesen, als Leo Prager durch Zufall einen Kommentar seiner Schwester im Internet entdeckt hatte. Soweit man es als einen Zufall ansehen kann, wenn zwei Menschen, die im Zuge derselben genetischen Disposition in derselben Weise am Auge erkranken, sich im Internet kundig machen und einander dabei elektronisch über den Weg laufen. Eva, indem sie auf der Seite einer deutschsprachigen Selbsthilfegruppe eine Frage in die Runde warf, und Leo dadurch, dass er diese Seite besuchte, um in die Zukunft seiner Krankheit zu blicken. Und dort eben auf den Kommentar einer Frau traf, die nicht nur wie seine Schwester hieß, sondern sich dann auch wirklich als diese herausstellte.
Eva war dabei, in der gleichen unweigerlichen Weise ihre Sehkraft einzubüßen wie ihr Bruder. Als Folge von etwas, das als altersbedingte Makuladegeneration bezeichnet wird. Wobei beide an der »trockenen« Form dieser Krankheit litten, die im Vergleich zur »feuchten« Variante sehr viel langsamer verlief, die möglichen Therapieformen aber nicht direkt auf die Krankheit zu zielen vermochten. Sondern nur über einen Umweg. Zudem befanden sich beide, obgleich zu den jüngeren Patienten zählend, bereits in einem fortgeschrittenen Stadium dieser Erkrankung. Und beide waren sie vom fatalen Ende, jener Beinaheerblindung, überzeugt. Eva trotz diverser Behandlungsmethoden, Leo wiederum, ohne irgendeine Therapie vorgenommen zu haben. Er war in diesen vielen Jahren sein eigener Arzt gewesen, hatte sich einiges an medizinischem Wissen angeeignet, aber keines, mit dem man dem Verlust an Sehkraft begegnen konnte. Im Grunde war er auch gleichgültig gegen das Sterben und gleichgültig gegen den Verfall. Dennoch nicht uninteressiert.
Und dann also der Kommentar seiner Schwester. Er konnte der Versuchung nicht widerstehen, sie zu kontaktieren.
Nachdem die Geschwister auf solche Weise zueinandergefunden hatten, einigten sie sich bald darauf, von ihrer »gemeinsamen impressionistischen Krankheit« zu sprechen. Dabei die Auflösung der Konturen sowie den Eindruck eines herbstlichgrauen Nebels bedenkend, von der ihrer beider Blick auf die Welt nach und nach bestimmt wurde.
Die Welt wurde anders. Anders und kleiner. Und eben impressionistischer.
Sie vereinbarten, wenigstens einmal in der Woche Verbindung aufzunehmen. Wenn denn gerade eine solche möglich war. Zwischen Wien und der Insel. Dieser Insel, auf der Leo seit vier Jahrzehnten lebte, ohne sie auch nur einmal verlassen zu haben, von seinen Bootsfahrten und Schwimmtouren im Umkreis dieses kleinen Stück Lands einmal abgesehen.
Nachdem Leo im Sommer 1976 seine Heimat zurückgelassen hatte, war er ein Jahr lang durch die Welt gezogen, hatte kleine Jobs angenommen und sich damit auch in Bewegung gehalten. In Bewegung, aber ohne wirkliches Ziel. Was für eines hätte das auch sein sollen? Für jemand, der sich theoretisch bereits umgebracht hatte und nur noch praktisch auf der Welt war.
Als dieses erste Jahr vorbei war, befand er sich auf der anderen Seite ebendieser Welt in einer unangenehm warmen und feuchten Gegend, wo es ihm vorkam, als würden alle in einer sehr großen, stark behaarten Achselhöhle leben. Dann jedoch wechselte er an die Küste und in eine Hafenstadt und gelangte schließlich als Küchenhilfe an Bord eines Fabrikschiffs, eines Fang- und Verarbeitungsschiffs, dessen Mannschaft keine Ahnung hatte, dass an Bord auch Waffen geschmuggelt wurden. Ein Schiff, das im Zuge einer nie öffentlich gewordenen Piraterie gekapert wurde. Was wiederum zu einer Befreiungsaktion durch das amerikanische Militär führte, was ebenso wenig publik wurde.
Es bedarf keiner Verschwörungstheorien, um zu erkennen, dass immer eine Geschichte neben der Geschichte existiert.
Doch noch bevor die Amerikaner auf das Schiff gelangt waren, hatten die Piraten einen Teil der Besatzung über Bord geworfen, darunter auch Leo. Auf ihn und die anderen wurde von Deck aus geschossen. Die meisten traf es. Nicht jedoch Leo, der tauchend davonkam – am Rücken seinen wasserdichten schweizer Armeerucksack, darin sich nichts anderes als seine gut verpackte Super-8-Kamera befand –, sich dann aber inmitten des Südpazifiks wiederfand, umgeben von nichts als Meer. Großes, leeres Meer. Und der weiterkämpfte. Nicht ohne ein Gefühl des Ärgers darüber, wie sehr ihm – dem noch immer von Lebensüberdruss Gezeichneten – daran gelegen war, am Leben zu bleiben. Zu schwimmen – und er war ein ziemlich guter Schwimmer –, anstatt einfach unterzugehen. So gering seine Chancen waren.
Aber manche Chancen besitzen einen gewissen Witz, einen Humor, der sich gegen alle Widerstände des Ernstes durchsetzt. Ein Humor, der möglicherweise überhaupt erst zum Entstehen des Universums geführt hat.
Ein Humor, der es freilich auch kleiner konnte.
Nachdem Leo Prager bis in die Dämmerung hinein geschwommen war, trieb er nun auf dem Rücken liegend über das nur leicht bewegte Wasser – ohne unterzugehen und ohne ein Opfer von Haifischen zu werden, die es in diesen Gewässern durchaus gab. Die Nacht brach herein. Und es wurde die wohl prächtigste Sternennacht in Leos Leben. Keine verstaubte Luft, keine Laterne nirgends, auch kein Wölkchen. Er war voller Glück ob dieses Anblicks, auch wenn dieses Glück ebenso wie sein gewohntes Unglück keinen für ihn greifbaren Sinn erkennen ließ. Tausende Sterne, teilweise vielleicht schon erloschen, wie Leute, die nur noch durch ihre Bücher, ihre Musik oder ihre Gemälde nachwirken, oder mittels des Schreckens, den sie einst verursacht haben. Fliegendes Licht, die deutlich herausstechende Milchstraße, der Eindruck von extremer Fülle, die Lüge dieses Eindrucks angesichts eines objektiv betrachtet eher ziemlich leeren Kosmos.
Von dieser Illusion, dieser Schönheit verzückt, geriet der entkräftete Leo Prager in einen Zustand, der gerne als einer zwischen Traum und Wirklichkeit bezeichnet wird. Im Liegen taumelnd! Und während er nun endgültig seine Balance einbüßte und unterzugehen drohte, glitt ein Körper unter ihm hinweg. Er meinte die Spitze einer Flosse zu spüren, wie sie eine kleine, feine Linie auf seinen Rücken zeichnete.
Also doch noch ein Hai! Er erinnerte sich gelesen zu haben, dass man sich bei der Begegnung mit einem Hai nicht bewegen sollte.
Er lachte innerlich. Denn sich nicht zu bewegen, war ohnehin das Einzige, wozu er noch in der Lage war. Dann verlor er gänzlich sein Bewusstsein.
Doch Leo Prager starb nicht.
Als er wieder zu sich kam und seine Augen öffnete, nahm er das zuerst verschwommene und nach und nach klarere Bild eines weißen Strandes wahr. Er lag bäuchlings im Sand, umspült vom zurückströmenden Wasser und bildete im feuchten Sand seinen eigenen Abdruck. Als er den Blick nach vorn richtete, erkannte er eine lange Reihe von Kokospalmen.
War er wirklich am Leben? Oder erwies sich das Jenseits als eine prospektartige Urlaubsidylle? Die aufhören würde, eine Idylle zu sein, sobald man bemerkte, dass auch Insekten, Spinnen und Schlangen ins Jenseits gelangten und Kokosnüsse sich noch immer nicht auf bloßes Geheiß öffneten.
Er erinnerte sich an die Flosse und meinte sich auch zu erinnern, dass der Körper des Tiers nach einigen Umkreisungen schließlich genau unter ihm gehalten hatte und ihn mit einer Aufwärtsbewegung nach oben getragen und dabei ein Stück über das Wasser gehoben hatte. Und wie er erneut zu atmen begonnen und seinen Arm um die hohe, kräftige Flosse geschlossen hatte. Und wie er halb ohnmächtig, halb bei Bewusstsein die beträchtliche Geschwindigkeit gefühlt hatte, mit der ihn das Tier durchs Wasser zog.
Ein Delfin?
Ja, Delfine waren berühmt dafür, auf solche Weise die Rettung ihnen wildfremder Menschen vorzunehmen. Delfine und Orcas, auch wenn die Gründe für ein solches Handeln sich einem nur schwer erschlossen. Moral? Laune? Langeweile?
Doch umso klarere Formen Leos Erinnerung annahm, umso stärker war seine Überzeugung, dass es kein Delfin gewesen war, sondern ein Hai, ein mächtiges, meterlanges Tier. Genauer gesagt: ein Weißer Hai. Und um ganz genau zu sein: ein trächtiges Weibchen.
Er fragte sich, woher er das wissen konnte. Wie er sich auch fragte, ob das Meer in dieser Gegend für Weißhaie nicht eigentlich zu warm war. Und wenn schon mal ein Hai auf die Idee kam, ein menschliches Wesen zu retten, wieso dann ausgerechnet ein Hai von jener Art, die – tausend Mal verflucht – ja nicht gerade als des Menschen bester Freund galt?
Dennoch, er war sich ungemein sicher, auch wenn seine Sicherheit aus einem ziemlich angestrengten Kopf stammte. Einem Kopf, der deutlich schmerzte.
Aber noch mehr tat ihm sein Hals weh. So, als hätte er Glas geschluckt. Er richtete sich auf, tat einige Schritte und fiel zurück in den weichen, warmen Sand. Stimmt, er würde sich einen Sonnenbrand holen. Mit diesem Gedanken schlief er ein.
Wer oder was auch immer Leo Prager gerettet hatte – und vielleicht war es ja das Meer selbst gewesen, dessen bewegte Oberfläche ihn getragen hatte –, er war jedenfalls an den Strand einer kleinen Insel gespült worden. Beziehungsweise handelte es sich um zwei kleine Inseln, eine etwas größere, ovale, flache, und eine kleinere, fast kreisrunde mit einer leichten Erhöhung. Beide waren sie durch eine Sandbank verbunden.
Eine ziemlich entlegene Insel im Südpazifik, aber zum Glück keine unbewohnte. Eine Privatinsel, das Land eines reichen Engländers, der im Musikgeschäft genügend Geld gemacht hatte, um sich nicht nur zwei Privatjets, Appartements in London und New York und eine Farm in Australien zu leisten, sondern eben auch diese zweiteilige Insel. Ein Kindheitstraum, wie er selbst sagte. Ein Schatzinselkindheitstraum, den er sich knapp dreißigjährig erfüllt hatte.
Und nun, ein Jahr nach der Fertigstellung sämtlicher Bauten, hatten zwei seiner Bediensteten einen ohnmächtigen Zwanzigjährigen am Strand der nur sieben Hektar großen Hauptinsel entdeckt und ins Haus des zu diesem Zeitpunkt abwesenden Besitzers getragen.
Als dann drei Monate später jener superreiche Musikproduzent auf einer Segeljacht seine im Grunde gar nicht so teure Insel erreichte – viel teurer war die Errichtung des auf einem offen liegenden Tragwerk gebauten mächtigen Strandhauses gewesen, dazu diverse Anlagen wie die Regenwassertanks, die Wasseraufbereitung, die fotovoltaisch gestützte Batteriestation und die unterirdischen Lager- und Bunkerräume –, da war Leo Prager bereits festes Mitglied der jetzt auf vier Köpfe angewachsenen Belegschaft. Vier Männer, die in komfortablen Hütten lebten und zusahen, dass Haus und Grundstück in bestem Zustand blieben. Wie natürlich auch das kleine Observatorium und die Anordnung aus Parabolantennen, die der Besitzer – ein Mann namens Henry Oak, der aus einer Bradforder Arbeiterfamilie stammte – auf die Anhöhe des kleineren Inselteils hatte bauen lassen. Wobei er der kleineren Insel den Namen Mönchengladbach gegeben hatte, was anscheinend damit zusammenhing, dass es sich bei der gleichnamigen deutschen Großstadt um eine der Partnerstädte Bradfords handelte, vor allem aber, weil Mister Oak ein Anhänger des Fußballvereins Borussia Mönchengladbach war und im Zuge seiner Beteiligung an einer Sportartikelfirma auch zu deren Sponsoren zählte. Die Hauptinsel hingegen trug keinerlei deutschen oder fußballaffinen Namen, sondern hieß einfach Claire, was wohl eine Widmung darstellte, deren Hintergrund Leo erst begriff, als er bereits drei Jahrzehnte auf der Insel verbracht hatte und zum obersten »Pfleger« von Haus und Grundstück aufgestiegen war. Henry Oak war bei einem Verkehrsunfall gestorben, und sein Erbe – zumindest betreffs der Geschwisterinseln Claire und Mönchengladbach – trat eine Frau an, die genau diesen Vornamen trug. Sie kam auf die Insel, um Leo zu erklären, dass sie Inseln prinzipiell nicht möge, andererseits aber nicht an einen Verkauf denke und ihn, also Leo, weiterhin mit der Aufrechterhaltung der idealen Zustände auf ihrem Besitz beauftrage. Sodass er und ein Team, das mal aus drei, mal aus vier Leuten bestand, nun etwas instand hielt, was man auch »Oaks Museum« nennen konnte.
In diesen über vierzig Jahren, in denen Leo Prager kein einziges Mal das doppelte Eiland verlassen hatte, waren insgesamt drei Schiffbrüchige an die Gestade der Insel geraten und von Leo und seinen Leuten gerettet worden: ein Mann von einem Öltanker und zwei australische Segler. Und … ein Elefant.
Als Leo Prager an einem Morgen Ende der 1990er-Jahre wie jeden Tag sehr frühmorgens aus seiner Hütte trat und an den Strand ging, lag da ein ausgewachsener Elefant. Er dachte zuerst an einen gestrandeten Wal, natürlich, aber nein, es war ein Elefant. Schwer verletzt, jedoch am Leben. Selbstredend gab es auf dieser Insel keine Elefanten, nur Vögel, Insekten, einige Schlangen und ein paar Schildkröten.
Die Sache damals mit dem Weißen Hai war ja eher unglaubwürdig und wohl auf eine Einbildung im Todeskampf zurückzuführen gewesen, sosehr Prager an dieser Einbildung festhielt. Der Elefant hingegen war eindeutig real.
Es handelte sich wohl um einen Asiatischen, der also nicht ganz so riesig war wie die aus Afrika. Leo konnte sich nichts anderes vorstellen, als dass in der Nähe ein Schiff mit einer Ladung von Zootieren, die für den südamerikanischen Raum bestimmt waren, gesunken sein musste. Wollte er nicht daran glauben, dass dieses Tier von der betrunkenen Besatzung eines Transportflugzeuges von Bord geworfen worden war. Was angeblich manchmal geschah und zu scheinbar verrückten Ereignissen wie jenem führte, bei dem eine Kuh auf einem japanischen Walfängerschiff aufgeschlagen war.
Jedenfalls erschien Leo das Auftauchen dieses Tieres wie ein markantes Zeichen seiner eigenen Landung auf der Insel, weit mehr als das bei dem schiffbrüchigen Matrosen und den beiden Seglern der Fall gewesen war.
Hätte es sich nun um einen Wal gehandelt, wie im ersten Moment angenommen, es wäre um einiges leichter gewesen, ihn zu retten. Einen Wal hätte man zurück ins Wasser schieben können. Der Elefant aber musste vom Strand in einen geschützten Teil der Insel befördert werden. Allerdings war er zu entkräftet, um sich erheben zu können, auch klafften mehrere große Wunden in seinem Körper. Keine Frage, Asiatische Elefanten waren hervorragende Schwimmer, die auch längere Strecken bewältigen konnten und ihre Rüssel gleich Schnorcheln einsetzten. Doch so großes Glück Leo zehn Jahre zuvor mit einem Hai gehabt hatte, der Elefant hatte dieses Glück nicht gehabt. Die Verletzungen des zweieinhalb Tonnen schweren Tiers stammten eindeutig von einem Haiangriff.
Leo und sein Team gelang es schließlich mithilfe von Planen und mehrerer Seilzüge, das bewusstlose Weibchen hoch zur ersten Palmenreihe und in den Schatten einer Überdachung zu befördern. Wo man dann begann, die Wunden zu versorgen. Natürlich war keiner aus dem »Inselteam« ein Veterinär, der Besitzer der Insel in England, und zudem war niemand vor Ort, der auch nur hobbymäßig eine Ahnung von Elefanten besaß. Dennoch, es gelang. Manchmal reicht eben auch der Wille aus. Und der Wille bestand darin, die Wunden zu versorgen und das Tier am Leben zu halten.
Aufgrund der ausgeprägten Flora und der eher eingeschränkten Fauna auf der Insel war es kein geringer Nachteil, dass es sich bei Elefanten um sogenannte generalisierte Pflanzenfresser handelt, wobei Leo nach und nach auch Gräser wie Bambus und Silberhaar auf Claire kultivierte. Jetzt mal abgesehen davon, dass wirklich eine Menge Kokospalmen auf dieser Insel standen. Elefanten sind, gelinde gesagt, nahrungsintensive Haustiere, und als dann Henry Oak auf die Insel kam, war er alles andere als begeistert angesichts eines zwischenzeitlich gesundeten Tiers, das täglich weit über hundert Kilo Nahrung zu sich nahm. Andererseits hätte es eine immense Anstrengung bedeutet, die Elefantendame von der Insel zu bekommen. Unmöglich, eins der Wasserflugzeuge zu benutzen, die hin und wieder vor Claire landeten. Nein, der Elefant blieb auf der Insel, bekam sein eigenes Areal zugesprochen und erhielt auch einen Namen: Salty Dog. Was wohl auf den berühmten Procol-Harum-Song von 1969 anspielte. Ein alter Seebär also, auch wenn eigentlich von einer alten Seekuh die Rede hätte sein müssen, abgesehen davon, dass das Tier ja gar nicht so alt war. Aber der Name blieb, und die Elefantendame hörte auf ihn. Sie erwies sich als so gelehrig wie gutmütig und war bald auch an einigen Schwerarbeiten auf der Insel beteiligt, ohne dass aber der Begriff »Arbeitselefant« gefallen wäre. Salty Dog nahm regelmäßige Schlammbäder in einem künstlich angelegten, von Regenfällen gespeisten Teich in der Mitte der Hauptinsel (während sie Mönchengladbach kein einziges Mal betrat) und lebte noch gut fünfzehn Jahre, bevor sie starb. In welchem Alter konnte Leo nicht sagen, auch nicht woran, sie wurde einfach schwach und schwächer, zog sich in den letzten Winkel ihres Areals zurück und wartete auf ihr Ende.