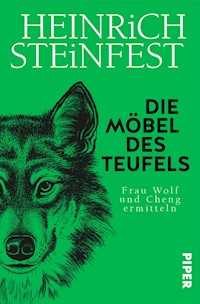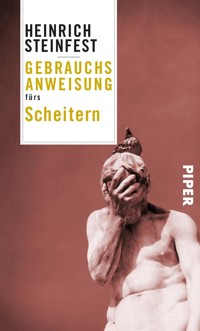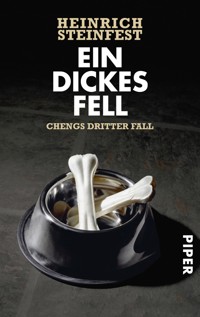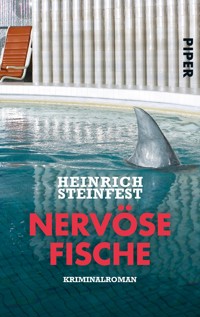
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Für den Wiener Chefinspektor Lukastik, Logiker und gläubiger Wittgensteinianer, steht fest: »Rätsel gibt es nicht.« Das meint er selbst noch, als er auf dem Dach eines Wiener Hochhauses im Pool einen toten Mann entdeckt, der offensichtlich kürzlich durch einen Haiangriff ums Leben kam. Mitten in Wien, 28. Stockwerk. Und von einem Hai keine Spur. Nun steht der Wiener Chefinspektor nicht nur vor einem Rätsel, es sind unzählige: Ein Hörgerät taucht auf, zwei Assistenten verschwinden. Und die Haie lauern irgendwo … Der neue Krimi Heinrich Steinfests, 2004 Preisträger des Deutschen Krimipreises.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
13. Auflage Dezember 2011
ISBN 978-3-492-95799-1
© 2004 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagfoto: Erik Dreyes / Stone / Getty Images
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Zuerst Wien
1 Der Mann, der hier das Sagen hatte, blickte hinauf in den Himmel. Eine halbe Minute und mehr betrachtete er die schweren, grauen Wolken, betrachtete die Veränderungen an den Rändern, das Ausstrecken kleiner Arme und Tentakel, die auch gleich wieder verschwanden oder sich abstießen, um für einen Moment ein flüchtiges Eigenleben zu führen.
Mit diesen Wolken war ein kühler Wind gekommen und hatte nach zwei Wochen Hitze und Schwüle der Stadt eine Erleichterung beschert, als wäre einem Atemlosen ein Sauerstoffgerät übergestülpt worden. Es war ein Heer von Wiederbelebten, das an diesem Morgen zu den Arbeitsplätzen strebte. Ein ungeheurer Fleiß, ein großer Schwung in einem jeden Tun und Handeln würde an diesem Tag zu verzeichnen sein. Und würde solcherart diesen heißen Juli in ein Davor und ein Danach spalten. Denn bereits am nächsten Tag sollte sich eine weitere Hitzeperiode ergeben, so daß die Menschen erneut in einen betäubten Zustand verzögerter Bewegung und nur halb gedachter Gedanken verfallen würden.
Jetzt aber, an diesem einen Tag, der seinen Sonnenaufgang drei Stunden zuvor erlebt hatte, zog eine klare, belebende Frische in die Hirne der Menschen ein und zwang die meisten von ihnen, ihre Gedanken als einen Schnürschuh zu empfinden, der nur mittels einer gebundenen Schleife auch einen echten Nutzen ergab. Was einmal leichter und einmal schwerer fiel: eine Schleife binden.
Letzteres – die Umständlichkeit manch gedanklicher Schnürung – mußte wohl ausnahmslos für jenes gute Dutzend Personen gelten, das sich auf dem Dach eines Wohnhochhauses eingefunden hatte. Die freiliegende Plattform im achtundzwanzigsten Stockwerk wurde von der Vertiefung eines gefüllten Pools beherrscht. Eine gläserne Brüstung grenzte die Längsseiten ab, während die Breiten von den kaffeebraunen Fassaden überstehender Gebäudeteile abgeschirmt wurden. Pool ist ein zu harmloses Wort. Es handelte sich um ein regelrechtes Schwimmbad, das sich in luftiger Höhe über die Fläche erstreckte, von wo man beinahe sämtliche Teile der Stadt übersehen konnte.
Der Mann, der hier das Sagen hatte, war aber nicht an der Stadt interessiert, weder am Zentrum, das im Strahl einiger durchbrechender Lichtstrahlen gesegnet anmutete, noch an den Ausläufern im Westen, die an bewaldete Hügel stießen. Vielmehr hatte er seinen Kopf in den Nacken gelegt und sah gerade nach oben. Er genoß die kühle Luft, als gäbe es nichts Schöneres und Besseres auf dieser Welt. Tatsächlich wäre ihm in diesem Moment auch kaum etwas eingefallen, was er dem vorgezogen hätte.
Die anderen freilich gingen davon aus, daß Richard Lukastik schlichtweg nachdachte. Daß seine ganze Haltung einen Ausdruck hochkonzentrierter Grübelei darstellte.
Da nun aber andererseits eine Menge Leute darauf warteten, ihre Arbeit zu erledigen, trat Lukastiks Assistent von der Seite an seinen Chef heran, feuchtete sich die Lippen mit seiner belegten Zunge und fragte mit gedämpfter Stimme: »Was sollen wir tun?«
Das Gedämpfte seiner Stimme war spöttisch gemeint. Ohne einen gewissen Spott hätte er die vielen Jahre der Zusammenarbeit nicht überstanden. Er verachtete Lukastik. Was sicher auch darin begründet lag, daß er nun mal nicht der jugendliche oder zumindest jüngere Mitarbeiter an der Seite seines Vorgesetzten war, sondern wie Lukastik siebenundvierzig Jahre zählte. Wer genau von den zweien der ältere war, wußten beide nicht. Dieses lächerliche kleine Geheimnis zwischen ihnen war erhalten geblieben wie ein letztes Band, das nicht verbindet, sondern trennt. Natürlich hätte es kaum eine Mühe bereitet, das genaue Geburtsdatum des jeweils anderen herauszufinden. Aber beide Männer schreckten davor zurück. Und das war auch gut so. In ihrer Scheu steckte nichts weniger als eine tiefe Moral.
Es muß noch gesagt werden, daß auch Lukastik für seinen sogenannten Assistenten eine ähnliche Abneigung verspürte wie dieser für ihn. Alles an diesem Mann erzeugte bei Lukastik einen Ekel, der einem leichten Frösteln gleichkam: dessen Gang, dessen Kleidung, das Klappern genagelter Schuhe, die stets blanke, vom Rasieren wie geschmirgelt wirkende rötlichsilbrige Gesichtshaut, vor allem aber seine Art, die Lippen zu befeuchten und sie nahe an den Kopf und die Ohren des Gegenübers heranzuführen, bevor er etwas sagte. Eine solche Nähe war Lukastik zuwider. Er meinte ein jedes Mal zu spüren, wie der Speichel von den Lippen weg verdampfte und einen blasenartigen Raum tropischen Klimas erzeugte.
In den Kreisen der Wiener Polizei jedoch galten die beiden Männer als kongenial. Manche meinten sogar, die zwei seien sich freundschaftlich verbunden. Lukastik und Jordan nahmen solche Gerüchte und Vermutungen mit der Gelassenheit langjährig Leidender hin.
Während Peter Jordan gesprochen hatte, war Lukastik einen kleinen, schnellen Schritt zur Seite getreten. Dennoch hatte die »tropische Blase« flüchtig seine Wange berührt. Er verzog unmerklich das Gesicht, nahm seinen Blick vom Himmel und sah hinunter auf die stellenweise glatte, dann wieder vom Wind gefaltete und gekämmte Wasserfläche des Schwimmbades. Endlich sagte er: »Holt ihn raus!«
»Wie rausholen?« fragte Jordan und stützte die Hände in seine geraden Hüften. Der ganze Mann war in erster Linie gerade. Nicht steif und schon gar nicht straff, sondern einfach gerade, so wie Wände gerade sind oder Fassaden oder gewisse runde, große Flächen, wenn man mit der Nase an ihnen klebt. Seine Geradheit war ohne Charme, aber auch ohne Aufdringlichkeit. Alle sahen das so. Nur Lukastik nicht, welcher Jordans Geradheit einen buckligen Hintergrund unterschob. Und somit irgendeine Verlogenheit witterte.
»Vorsichtig halt«, sagte Lukastik. »Die Taucher sollen das machen. Und auch gleich nachsehen, ob sie auf dem Boden des Bassins etwas finden. Etwas, das uns weiterhilft.«
»Ja, das wäre nicht schlecht. Vielleicht ein paar Zähne.«
Der jetzt gesprochen hatte, war der zuständige Polizeiarzt Dr. Paul, ein kleiner Mann mit schiefer Krawatte, der vor allem bekannt war für die Schönheit seiner viel jüngeren Frau, deren selbstverständliche und radikale Treue den meisten ein Rätsel und ein Ärgernis war.
Wenn Jordan in erster Linie gerade war, dann war Dr. Paul primär gekrümmt. Er besaß eine gebeugte, arthritische Haltung, eine rundliche Figur, brünettes, gekräuseltes Haar sowie ein volles Gesicht, das auch an trockenen Tagen einen feuchten Glanz besaß. Er war weder reich noch eine bedeutende Persönlichkeit. Er war verglichen mit seinem akademischen Grad ein absolutes Nichts. Er erfüllte eine Rolle, wie Polizeiärzte sie auch in Filmen verkörpern, wenn sie als erste eine Leiche begutachten und völlig unbedeutende und zudem ungenaue Kommentare zu Tatzeit und Hergang abgeben, um in der Folge von weit kompetenteren Gerichtsmedizinern abgelöst zu werden.
Dennoch war Dr. Paul geachtet wie kaum jemand innerhalb des kriminalistischen Apparates dieser Stadt. Der Umstand, ohne ersichtlichen Grund eine als umwerfend geltende Frau erobert zu haben, provozierte ja nicht nur Unverständnis und Neid, sondern bestätigte auch den romantischen Verdacht, daß manche unscheinbaren Männer einen namenlosen Reiz aufwiesen, etwa in der Art einer unsichtbaren und geruchlosen, jedoch wirksamen Duftwolke. Und eine solche »reizende« Wolke schien Dr. Paul zu verströmen. Indem diese eine attraktive Frau sich in ihn verliebt, ihn zumindest geheiratet hatte, war Dr. Paul auch für große Teile der ihn umgebenden Damenwelt so etwas wie ein unbedingter Anziehungspunkt geworden.
Er selbst stand diesem Phänomen mit kontrollierter Fassungslosigkeit gegenüber. Man spürte seine kleine Unsicherheit in einer jeden seiner Bewegungen. Es war, als würde dieser Mensch über den eigenen Zweifel balancieren. Wankend, aber nicht ohne Geschick. Und darin besteht ja ein Drahtseilakt: gekonnt unsicher zu sein.
Wenn Dr. Paul nun davon sprach, daß man eventuell ein paar Zähne auf dem Grund des Pools finden würde, so hatte das seinen guten Grund. Menschenzähne freilich waren nicht gemeint. Obgleich es durchaus ein menschlicher Körper war, der auf der Oberfläche des Wassers trieb. Aber wenn etwas unbeschadet geblieben war, dann der Kopf des Toten und damit auch seine Zähne. Alles andere an ihm war verletzt worden oder gar verschwunden. Das rechte Bein fehlte von der Mitte des Oberschenkels an. Von einer Hand war nur noch ein Hautfetzen übriggeblieben. Die anderen Teile des Körpers waren mit Bißwunden übersät, was aussah, als sei dieser Leib mit einem großen Falleisen traktiert worden. Allerdings mußte auch dem Nichtzoologen klar sein, daß derartige Verletzungen allein von einem Fisch stammen konnten, genauer gesagt von einem Hai.
So eindeutig dies war, so völlig unmöglich erschien dieser Umstand angesichts des Ortes. Man befand sich schließlich nicht in der Umgebung eines einschlägigen Aquariums, schon gar nicht am Strand eines Meers, sondern im luftigen Freizeitbereich einer Gebäudeanlage, die aus mehreren solcher Wohntürme und solcher Schwimmbecken bestand und aus einer Stadt aufragte, die weitab des Lebensraums jener Fische lag, welche eine derartige Zerfleischung zu leisten imstande waren.
In diesen Etagen lebte ein in Fragen alltäglicher Auseinandersetzungen gemäßigter Mittelstand. Zehntausend Leute, nicht lauter Heilige, versteht sich. Jedoch kaum klassisches Gesindel. Ein paar Kampfhundbesitzer. Auch Aquarien, aber keine, in die ein Hai gepaßt hätte. Putzkolonnen waren tagaus, tagein unterwegs, um in den Hallen, Gängen und Liften jenen Gesichtsverlust zu verhindern, den vergleichbare Objekte in der Regel hinnehmen mußten. Nach zwanzig Jahren hatte die Anlage kaum an Substanz und Frische verloren, vorausgesetzt, man meinte überhaupt, daß es hier etwas zu verlieren gab. Bloß in den Schächten der Fluchttreppen zeugten Filzstift Graffiti, zertretene Kartoffelscheiben und hin und wieder ein demoliertes elektronisches Gerät vom intimen, codierten Unmut Jugendlicher.
Nun, es gab also gefährlichere Orte in dieser Welt und in dieser Stadt. Andererseits war kein weltlicher Platz so sakrosankt, also auch dieser nicht, um vor einer Grausamkeit oder Monstrosität gefeit zu sein. Wobei wiederum eine jede Grausamkeit, so monströs sie wirken mag, einen logischen, vernünftigen Hintergrund besitzt. Gespenster, wenn sie denn existieren, verbleiben klugerweise in den Köpfen der Menschen. Nie und nimmer fungieren sie als Illusionisten oder Zirkuspferde. Und schon gar nicht verwandeln sie sich aus dem Nichts heraus in fleischfressende Knorpelfische, die in bürgerlichen Schwimmbassins Badegäste anfallen und töten, um dann wieder in jene Unsichtbarkeit zu verschwinden, aus der sie gekommen sind.
Nein, es mußte eine nachvollziehbare Erklärung dafür geben, daß dieser von einem Haifisch entstellte Körper einbeinig in einem Pool trieb. Einem Pool, der – weitab mariner Gefilde oder auch nur zoologischer Einrichtungen – im Süden Wiens einen komfortablen Gebäudeabschluß bildete. Ein wäßriges Dach.
Aber das Logische einer Erklärung ergibt sich in der Regel vom Ende her gesehen. Lukastik und seine Leute standen hingegen erst am Anfang. Und obgleich die erwähnte Kühle dieses Morgens eine große Wachheit verursacht hatte, empfand ein jeder von ihnen angesichts dieses völlig unpassenden Toten eine frustrierende Ratlosigkeit. Allein diverse Assoziationen halfen in diesem Moment, sich selbst eine bestimmte Richtung zu weisen. So erinnerte sich Lukastik an jene lang zurückliegende Zeitungsmeldung, in der man von einer Leiche berichtet hatte, die in einem niedergebrannten Waldstück gefunden worden war und dadurch größte Aufmerksamkeit erlangt hatte, daß sie mit einem Taucheranzug und einer Druckluftflasche ausgestattet gewesen war. Erst später hatte man eruiert, daß der Taucher – offensichtlich beim Aufnehmen von Meerwasser – in den Tank eines der Löschflugzeuge geraten und schließlich beim Auswerfen des Wassers von beträchtlicher Höhe – quasi im Moment der Löschung – auf den Boden des Einsatzgebietes aufgeschlagen war. In der Folge war dieser Vorfall nicht nur in den Zeitungen behandelt, sondern auch von einem berühmten Schriftsteller aufgegriffen worden. Allerdings konnte sich Lukastik nicht mehr daran erinnern, welcher berühmte Schriftsteller es gewesen war. Jedenfalls empfand er diese erstaunliche Geschichte als ein schönes Beispiel dafür, wie hinter der Skurrilität, ja Regelwidrigkeit eines ersten Eindrucks eine vollkommen logische, Punkt für Punkt nachvollziehbare, eine wahre, eine gott- und geisterlose Abfolge von Geschehnissen stehen konnte, nein, stehen mußte.
Gut möglich, daß irgendein krankes Hirn sich diese deplazierte Haifischopfer-Inszenierung ausgedacht und mittels eines erheblichen Aufwands auch realisiert hatte, aber dann steckte eben noch immer das Faktum eines kranken Hirns dahinter und nicht irgendein übernatürlicher oder naturgesetzloser Vorgang. Am Ende würde es wie immer sein: banal. Gleich diesem Taucher, dessen mit einem Neoprenanzug umhüllter Körper inmitten verkohlter Bäume geradezu zauberisch, engelhaft und symbolträchtig angemutet haben mußte. Während das tatsächliche Geschehen zwar tragisch zu nennen war, aber dieselbe Ingredienz besaß wie jeder andere tödliche Unfall: dort gewesen zu sein, wo man nicht hätte sein sollen, das Schicksal einen jedoch hingeleitet hatte. Als schicke man einen Blinden über die Autobahn. Es existiert eine Fürsorge, die tödlich sein kann.
Die Mehrzahl der Tauchgänge erwies sich freilich als ungefährlich. Einen solchen bewerkstelligten nun die beiden Polizisten, die in voller Montur ins Wasser des Pools glitten und die Leiche vorsichtig an den Beckenrand schoben, wo selbige von zwei Beamten der Spurensicherung nicht minder sorgsam herausgehoben und auf eine weiße Plane abgelegt wurde. Überhaupt war anzunehmen, daß dieser tote Mann nie in seinem Leben mit einer vergleichbaren Behutsamkeit angefaßt worden war (der Begriff »Zärtlichkeit« verbietet sich natürlich, und dennoch muß gesagt werden, daß die meisten Spurensicherer mit den aufgefundenen Leichen und Leichenteilen einen Umgang pflegen, der ein wenig an die leise Hingabe von Philatelisten erinnert).
Während die beiden Taucher im von Blutschlieren aquarellartig verfremdeten Wasser untertauchten, um nach etwaigen Zähnen und anderen Beweisstücken zu suchen, bildeten die übrigen Anwesenden einen Kreis um den aufgebahrten Körper.
»Ein Sportler«, sagte Dr. Paul und trat in das Innere des Kreises. Er ging neben der Leiche in die Knie und legte eine Fingerkuppe auf die Brust des Toten, wie um einen Schalter zu drücken und somit einen sinnlos gewordenen Stand-by-Betrieb außer Kraft zu setzen. Diese kleine Handlung vollzog er an einer jeden Leiche, ohne daß jemand hätte sagen können, ob sich dahinter auch ein medizinisch relevanter Akt verbarg. Jedenfalls unternahm er selten mehr. Auch jetzt erhob er sich gleich wieder und präzisierte: »Ein Sportler, aber kein ausgesprochener Schwimmer. Zumindest kein typischer. Auch keiner von diesen neumodischen … Ironmen … ich muß dabei immer an Ironie denken. Wobei ich finde, daß viel zu viele dieser Sportskanonen ins Ziel kommen. Das kann doch nicht ernsthaft der Sinn einer Konkurrenz sein. Überall herrscht Selektion. Und das zu Recht. Warum aber in Teufels Namen will ausgerechnet der Sport demokratisch sein. Wenn mehr als drei Leute ins Ziel kommen, verliert dieses Ziel jeden wirklichen Wert. Auch im philosophischen Sinn. Das Ziel zerfällt. Ich glaube …«
»Dr. Paul, bitte!« mahnte Jordan.
»Sie sehen ja selbst«, sagte Dr. Paul ein wenig beleidigt, »der Mann ist nicht sonderlich groß. Vielleicht ein Ringer oder Gewichtheber. Kein aktiver mehr, aber dennoch voll austrainiert. Etwa in Ihrem Alter, Chefinspektor.«
»Kann sein«, meinte Lukastik und betrachtete nicht ohne Neid die makellose Bauchmuskulatur des Toten, auf der freilich ebenfalls die Spuren eingedrungener Zahnreihen klafften. Dann sagte er: »Lassen Sie uns über die Todesursache sprechen. Ich meine das ernst. Gibt es eine Möglichkeit außerhalb jener, die uns ins Auge sticht?«
»Die gibt es immer«, meinte Dr. Paul, »aber auf den ersten Blick kann ich auch nicht mehr sagen, als daß es sich bei dem Mörder um einen Fisch der Gattung Hai handeln muß. Wir werden einen Experten hinzuziehen müssen, um die Art genau zu bestimmen. Aber ein Katzenhai war es wohl nicht.«
»Was ist mit einer Simulation?«
»Woran denken Sie? An ein motorenbetriebenes Haifischgebiß?«
»Ich versuche mir vorzustellen, wie es gewesen sein könnte. Soll ich glauben, der Hai sei aus einem Flugzeug gefallen? Was ja noch irgendwie vorstellbar wäre, wäre das Tier noch im Becken.«
Dr. Paul zuckte mit den Schultern, erklärte dann aber, der Tote weise keinerlei Deformationen auf, die vermuten ließen, daß er es gewesen war, der da vom Himmel gefallen sei. Nein, dieser Mann scheine ganz einwandfrei zu den seltenen Opfern eines Haifischangriffes zu zählen.
»Ein Badeunfall also«, sagte Jordan und machte ein verächtliches Gesicht, indem er seinem Mund die Form eines eingedrückten Lederballs verlieh.
»Wenn Sie so wollen«, sagte der Arzt und zuckte erneut mit den Schultern. Er zuckte gern und viel und wollte damit sagen, daß er als Mediziner noch lange nicht für das Unglück und die Fatalität dieser Welt verantwortlich war. Dann äußerte er, sich den Toten so bald als möglich auf dem Tisch seiner – wie er das nannte – Studierstube zu wünschen, um eine eingehende Untersuchung vornehmen zu können. Jetzt aber müsse er los. Auf ihn warte ein Frühstück mit seiner Frau, welches man traditionsgemäß in einem kleinen Café in Ottakring einnehme. Daran führe kein Weg vorbei, solle auch gar keiner vorbeiführen. Rituale und ihre strenge Einhaltung seien das Salz im Leben zweier Menschen. Unverzichtbar.
Die Sache mit dem Café erläuterte Dr. Paul so gut wie jede Woche. Entweder, weil er immer wieder vergaß, wie oft er bereits darüber gesprochen hatte, oder wie um seinen Kollegen, Männern wie Frauen, ein Geheimnis zu offenbaren. Was aber die wenigsten begriffen. Vor allem Leute wie Jordan erkannten nicht, wie sehr Dr. Pauls mysteriöse Attraktivität davon lebte, sich an Vereinbarungen, die er mit seiner Frau traf, auch rigoros zu halten. Natürlich bestand darin nicht sein ganzer Reiz. Irgendeine verrückte kleine Teufelei mußte da schon noch im Spiel sein, vielleicht auch bloß die Art, mit der er seine Fingerkuppe eben nicht nur auf tote, sondern auch auf lebende Brustkörbe aufsetzte. Was weiß man schon? Und doch war Dr. Pauls unbedingte Verläßlichkeit in Sachen gemeinsames Frühstück so viel wert wie ein ebenmäßiges Gesicht, ein flotter Spruch, ein gut gefülltes Bankkonto oder ein flacher Bauch. Ja, eigentlich mehr. Denn über ein gut gefülltes Bankkonto verfügte Frau Paul schon selbst und brauchte es deshalb nicht anderswo zu suchen. Und was mit flachen Bäuchen passieren konnte, das war deutlich an diesem Toten zu sehen, der hier im Kreis irritierter Polizisten lag und im silbergrauen Licht des Tages an die delikat verrenkten Gestalten von Théodore Géricaults Genieschinken Floß der Medusa erinnerte.
Dr. Paul schlug ganz leicht mit den Haken zusammen, was seiner rundlichen Gestalt weniger einen soldatischen, denn einen musikalischen Eindruck verlieh. Als stelle der ganze Dr. Paul nichts anderes als ein Triangel dar und somit ein selbstklingendes Schlaginstrument. Ein Musikwerkzeug, welches zwar selten zum Einsatz kam, aber dennoch immer wieder die allergrößte Aufmerksamkeit erlangte. So ein Triangel war den meisten nichts ganz geheuer. Man vermutete, daß mehr dahintersteckte, als zu sehen und hören war.
Indem Dr. Paul also die rückwärtigen Innenseiten seiner Schuhe kurz aneinanderstieß – eher schlug der eine Schuh sanft gegen den anderen – ergab sich so etwas wie ein unhörbarer, aber wirksamer Triangelton, der noch eine Weile nachklang und sämtliche Umstehende in eine leichte Schwingung versetzte. Dann wünschte der Polizeiarzt einen schönen Vormittag und verließ den Tatort über eine Treppe, die auf die nächste Etage und von dort zur Liftanlage führte.
Ein paar Minuten später tauchte einer der Froschmänner aus dem Bassin auf, in welchem das Blut an einen gerade erst beigefügten Badezusatz erinnerte, bewegte sich an den Bekkenrand und streckte seinen Arm aus. Lukastik, der sich soeben ein Paar lilafarbene Schutzhandschuhe übergezogen hatte, in denen seine Finger wie in zehn kleinen Badehauben steckten, griff nach dem Gegenstand, den ihm der Taucher entgegenhielt. Bei dem Objekt, das der Chefinspektor nun für alle sichtbar zwischen Daumen und Zeigefinger in die Höhe hielt, handelte es sich allerdings nicht um den erwarteten Zahn, sondern um ein etwa zwei Zentimeter großes, fleischfarbenes und knorpelartiges Gebilde. Bei genauer Betrachtung war zu erkennen, daß an dem einen, etwas dickeren Ende sich die Linie einer winzigen, geschlossenen Klappe abzeichnete. Zudem war die Oberfläche an dieser Stelle von dünnen, roten Bahnen durchzogen, was den Eindruck einer stark geäderten Haut ergab. Noch weit schwerer wahrzunehmen war der transparente Faden, der ein paar Millimeter von der Gehäusefläche abstand. Die meisten der Anwesenden befanden sich jedoch viel zu weit weg, um diesen zu bemerken. Aus der Ferne konnte man das ganze Ding eher für den abgebrochenen Daumen einer kleinen Puppe halten oder schlichtweg für ein Stück Knetmasse. Allein eine Frau von der Spurensicherung führte ihr Gesicht nahe heran, stellte ihren Kopf ein wenig schräg und sagte schließlich: »Wenn unser Toter und diese Winzigkeit zusammengehören, dann hatte der Mann ein Problem mit seinen Ohren, zumindest mit einem davon. Das hier ist ein Hörgerät.«
Lukastik blickte zweifelnd, weshalb die Frau erläuterte, es handle sich um eine Apparatur, die kaum sichtbar in den Bereich des äußeren Ohrs eingeführt werden könne. Der kleine Abschnitt, welcher nach außen gerichtet und für einen eventuellen Betrachter zu sehen sei, weise jene imitierten Blutgefäße auf. Hinter der Öffnung liege der Raum für die Batterie. Die kleine weiße Schnur stelle wiederum einen Zugfaden dar, mit dem der Träger seine Gerät aus dem Ohr nehmen könne.
»Ein modernes Ding«, erklärte die Frau. »Neueste Technologie. Und, wenn man so will, perfekte Tarnung. Muß eine Spezialanfertigung sein, eine dem Gehörgang des Trägers angepaßte Form.«
»Wie ein Fußabdruck?« fragte Lukastik.
»Könnte man so sehen«, sagte die Frau. »Gehörgänge unterscheiden sich. Jedenfalls dürfte es nicht schwer sein, zu überprüfen, ob der Tote diesen kleinen Verstärker getragen hat. Es wäre schon ein sehr merkwürdiger Zufall, wenn jemand anders, dessen Ohr eine vergleichbare Kontur besitzt, gerade jetzt sein Hörgerät in diesem Schwimmbecken verloren hätte. Kaum vorstellbar. Nein, wenn das Gerät paßt, dann stammt es von unserer Leiche. Mittlerer Hörverlust, schätze ich.«
Sie beugte sich hinunter, sah in das eine Ohr des Toten, schob dann seinen Schädel auf die andere Seite und betrachtete das zweite Ohr. Beide Gehörgänge waren leer. Entweder hatte der Mann nur in einem seiner Ohren über eine Hörhilfe verfügt oder ein weiteres Exemplar befand sich noch im Pool. Oder aber das digitale Maschinchen gehörte eben doch zu einer ganz anderen Person.
Lukastik betrachtete mit einigem Widerwillen diese Abformung einer Körperöffnung zwischen seinen Fingern. Es kam ihm jetzt vor, als halte er ein Bruchstück des Leichnams in der Hand, und zwar einen lebendig gebliebenen Teil, der losgekoppelt von seinem toten Wirt noch immer in der Lage war, genauestens zu hören, was da um ihn herum gesprochen wurde. Vielleicht sogar ein wenig mehr, als ein konventionelles Ohr aufzunehmen imstande war. Auch meinte Lukastik eine bestimmte Elastizität zu spüren. Nicht, daß er wirklich an die Beseeltheit oder gar einen hinterlistigen Zerstörungs- und Unterdrückungswillen technischer Geräte glaubte, aber er ahnte eine gewisse Eigenständigkeit. Als führten diese Apparaturen und Maschinen abseits ihrer Funktion ein unabhängiges, durchaus tiefschürfend zu nennendes Leben. Als sei ihnen die reale Welt bloß ein Traum.
»Stecken Sie’s ein«, sagte Lukastik und reichte der Frau das Hörgerät.
Sie öffnete eine handtaschengroße Plastikhülle, in die sie das Objekt behutsam gleiten ließ. Genau da war er wieder, der liebevolle Umgang mit den kleinen Dingen, die wie gefallenes Laub einen Toten umgaben.
Lukastik wies an, das Hörgerät an Dr. Paul zu schicken, damit dieser feststellen könne, ob es tatsächlich dem Ohr des Toten entstamme. Welcher übrigens nicht nackt war, sondern im Einklang mit der Vorstellung, daß jemand in ein solches Becken nicht zum Sterben ging, sondern zum Schwimmen, eine Badehose trug. Und zwar eine sportiv geschnittene, dunkelblaue, auf der das Logo eines bekannten Sportausstatters in dottergelber Farbe dreifaltig leuchtete.
Ansonst fand man nichts, was von Bedeutung schien. Einige Knochensplitter und kleine Fleischteile, die wohl vom Toten stammten. Außerdem ein Kinderspielzeug, das mit der Sache höchstwahrscheinlich nichts zu tun hatte. Unauffälliger Kleinkram: Haare, Zehennägel, Dreck, was eben in jedem Schwimmbad so zusammenkam. Auch wurden mehrere Wasserproben entnommen. Zusätzlich gab Lukastik Anweisung, feine, großflächige Filter durch das Wasser zu ziehen. Er wollte keinesfalls etwas unversucht lassen, um eine optimale Spurenausbeute zu gewährleisten. Die vier Aufzüge, sämtliche Zugänge, die Nottreppe, der unterirdische Garagenbereich, alles sollte penibelst durchleuchtet werden.
Jemand von der Spurensicherung, der mit einem weichen Pinsel über den Boden einer Liftkabine strich, fragte laut, wonach man hier eigentlich suchen würde. Etwa nach Spuren eines meterlangen Hais?
Gegen zehn, kurz bevor die Leiche abtransportiert werden sollte, erschien Lukastiks Vorgesetzter zusammen mit einem blutjungen Mitarbeiter des Bürgermeisters. Trotz seiner blutigen Jugend fiel dem Mann eine bedeutende Aufgabe zu, indem er alles und jedes, was in dieser Stadt an Öffentlichem geschah, auf Nutzen und Schaden zu untersuchen hatte. Für einen modernen Menschen wie ihn gab es nichts Schreckliches, in dem nicht auch ein Nutzen gärte. Dinge zu verbergen, zu unterdrücken war passé, pure Vertuschung eine Methode der politischen Steinzeit. Freilich verbarg sich umgekehrt auch in einem jeden Nutzen der Wille zur Katastrophe.
Der Vorgesetzte, seines Zeichens Major, sowie der blutjunge Mensch standen mit verschränkten Armen und ein klein wenig breitbeinig vor der Leiche. Ein Handy klingelte. Es blieb ungehört.
»Meine Güte, was ist davon bloß zu halten?« richtete sich der Major an Lukastik, wobei seine Stimme die übliche Genervtheit verriet. Das war nichts Neues. Er tat stets so, als könne man die Kompliziertheit eines bestimmten Falles dem untersuchenden Beamten anlasten. Der Major witterte gerne Schlampereien, im Zuge derer das Einfache sich ins Schwierige verkehrte. Dieser Verdacht war prinzipiell und durch kein Faktum wirklich außer Kraft zu setzen. Was wohl daran lag, daß der Major eine ganz grundsätzliche Aversion gegen Polizisten hegte, eine Aversion, die selbstverständlich uneingestanden bleiben mußte. Er war wie ein Arzt, der ständig die Gesundheit im Mund führend selbige für einen schlimmen Betrug hielt.
»Der Mann wurde von einem Hai getötet«, erklärte Lukastik und bemühte sich dabei, wie von einer Nebensächlichkeit zu sprechen.
»Was Sie nicht sagen, Kollege Lukastik. Ein Hai also. Können Sie mir das vielleicht näher erklären?«
»Nein«, sagte Lukastik. Und nach einer kurzen Pause: »Ich will nicht unhöflich sein. Schon gar nicht in Anwesenheit eines Vertreters des Bürgermeisters. Aber was verlangen Sie von mir? Daß ich diese Leiche durch eine andere ersetze? Eine plausiblere? Eine, die gewissermaßen ins geographische Bild paßt?«
»Wir wollen nur hören, was Sie darüber denken«, sagte der Jungblüter.
»Es wäre unsinnig, eine Meinung abzugeben, bevor der Leichnam eingehend untersucht wurde. Am Nachmittag kann ich Ihnen mehr sagen. Jedenfalls sollte man die Medien zunächst einmal heraushalten. So verführerisch obskur diese Angelegenheit auch sein mag.«
»Nicht doch«, meinte der junge Mann, »wir leben in einer Demokratie. Wir können das Obskure nicht aussparen.«
»Am Ende wird von dieser Geschichte ein einfaches, blödsinniges, kleines Verbrechen bleiben«, prophezeite Lukastik.
»Das mag schon sein«, sagte der moderne Mensch, »aber da unten vor dem Gebäude wartet bereits eine beträchtliche Schar von Reportern. Diese Leute – vergessen wir das bitte nicht! – sind unsere Freunde.«
»Wessen Freunde?« fragte Lukastik. »Ihre oder meine?«
»Unsere natürlich. Die Presse ist das Organ der Politik wie der Polizei. Darüber darf ein mitunter beleidigender Tonfall nicht hinwegtäuschen. Ich halte es für überholt, Journalisten am Gängelband zu halten, nur weil sie sich die Freiheit nehmen, Klagen auszusprechen, die ohnehin ein jeder sich denkt. Ich meine, wir sind den Medien verpflichtet. Und gerade eine obskure Geschichte wie diese sollte von Beginn an öffentlich diskutiert werden dürfen.«
»Das bringt Unruhe«, sagte Lukastik. »Betrachten Sie meine Arbeit und die meiner Mannschaft als ein Theaterstück, das geprobt werden muß. Es geht nicht an, gleich zu Beginn der Probenarbeit die Kritikerköpfe ins Auditorium zu lassen.«
»Soll ich diesen Vergleich wirklich ernst nehmen?«
»Ich bitte darum«, sagte Lukastik, wandte sich von den beiden Männern ab und gab Anordnung, die Leiche einzupacken und in Dr. Pauls Studierstube zu überführen.
»So geht das nicht«, rief Lukastiks Vorgesetzter hinterher. »Sie können uns nicht einfach stehenlassen wie dumme Buben.«
Nun, so ging es wirklich nicht, obgleich Lukastik keine Angst zu haben brauchte, eine Impertinenz würde ihn seinen Job kosten oder eine Versetzung nach sich ziehen. Auch war es undenkbar, daß man ihn zwang, den Fall abzugeben. Das Abgeben von Fällen war bloß ein beliebtes Element in Kriminalfilmen, nicht in einer von Personalnot gestrafften Wirklichkeit. Andererseits war auch der Major in seiner Position wie eingeschweißt, eine Beförderung so unwahrscheinlich wie eine Degradierung. Er und Lukastik waren nicht minder aneinandergekettet, als dies zwischen Lukastik und Jordan der Fall war. Weshalb ein gewisses laues Verhältnis erhalten werden mußte.
Lukastik ging noch einmal auf seinen Vorgesetzten und dessen Begleiter zu und erklärte, daß er derzeit für die Presse nicht zur Verfügung stehe. So wenig, wie er sich zu einer Spekulation hinreißen lassen wolle.
»Ich kann doch nicht einmal sagen«, sagte Lukastik, »von welcher Art Hai wir eigentlich reden.«
»Aber ist denn wenigstens erwiesen«, ließ der Major so etwas wie ein Flehen anklingen, »daß der Mann nicht hier oben getötet wurde? Das wäre ja wohl kaum möglich. Man müßte sich dann überlegen, wo denn der Fisch abgeblieben ist.«
»Das ist genau die Frage, die wir uns stellen.«
»Irgendein Hinweis auf die Identität des Toten?«
»Nichts«, sagte Lukastik. »Keine Kleidung, kein Ausweis, keine Wohnungsschlüssel. Die Leiche wurde von einem Angestellten des Reinigungsdienstes gefunden. Der Mann war außer sich vor Angst. Ich habe ihn wegbringen lassen, damit unsere Freunde von der Presse gar nicht erst in Versuchung geraten, ihre demokratische Pflicht zur Ausquetschung eines Zeugen zu erfüllen.«
»Was heißt wegbringen lassen?« empörte sich der Berater des Bürgermeisters. »Das klingt nach vorgestrigen Schutzhaftmethoden.«
»Ach, wenn Sie so wollen«, blieb Lukastik gelassen und verabschiedete sich. Er behauptete nicht einmal, zu tun zu haben. Die Lächerlichkeit, den Gestreßten zu spielen, ersparte er sich. Er spielte bloß den Gelangweilten.
Der Major sah hinter Lukastik her, als bemerke er eine Unregelmäßigkeit, etwa unterschiedlich lange Hosenbeine oder einen dunklen Fleck auf der Rückseite des hellen Jacketts. Freilich war weder das eine noch das andere der Fall. Die Unregelmäßigkeit, die der Major zu erkennen meinte, lag gewissermaßen hinter allem Materiellen.
»Schrecklicher Mensch«, sagte der Jungblüter. »Rückständig und gleichzeitig eitel. Eine schlimme Kombination.«
»Ein Polizist«, antwortete der Major vielsagend. Nicht, daß er seufzte. So weit ging er nun doch wieder nicht.
2 Die Studierstube Dr. Pauls war weit weniger gemütlich, als der Name dies hätte vermuten lassen. Vielmehr handelte es sich um einen der üblichen Sezierräume, nicht ganz neu, nicht ganz alt. Die Fensterreihen waren von pastellfarbenen Jalousien verdeckt. Von der Decke strömte Bürolicht. Drei metallene Flächen thronten auf quadratischen Sockeln. Man konnte darauf, so Dr. Paul, liegen wie auf schwebenden Betten. Traumhaft, weit besser als auf Zahnarztstühlen oder auf jenen Operationstischen, die einem möglichen Überleben gewidmet waren.
Es sei so typisch wie traurig, erklärte der Arzt weiter, daß es sich ausgerechnet auf einer solchen, dem Zerschneiden von toten Körpern zugeeigneten Liegefläche besonders gut ausruhen lasse. Er könne das beschwören, habe den einen oder anderen Mittagsschlaf darauf verbracht, im bekleideten Zustand, versteht sich, und mit einer Decke als Unterlage. Weniger der Bequemlichkeit wegen. Mehr als eine Geste, um den Unterschied zum eigentlichen Zweck dieser Konstruktion zu bekunden.
Als nun Lukastik nachmittags den Raum betrat, war allein der mittlere der drei Tische belegt. Darauf lag der um ein Bein und eine Hand verminderte Körper jenes unbekannten Toten. Dr. Paul saß hinter seinem Schreibtisch, hatte sich zurückgelehnt und rauchte. Er rauchte in der Art wie jemand, der beim Ausblasen Ringe erzeugt, nur daß er eben nicht wirklich welche hervorbrachte, sondern sozusagen Variationen zum Thema »Ringe«. Der Begriff der Variation ließ auch noch das kümmerlichste Gebilde als Ring durchgehen. Jedenfalls wirkte Dr. Paul entspannt. Die Ecke, in der er saß, war so gestaltet, daß der Begriff der »Studierstube« doch noch eine Entsprechung fand, indem nämlich zwei überlebensgroße hölzerne Regale den Rücken des Mediziners abdeckten, Regale, in denen abgegriffene und an vielen Stellen weit in den Raum stehende Folianten den Eindruck unbedingten Studierwillens dokumentierten. Keine zehn Computer hätten eine solche Wirkung vollbracht. Es bleibt dabei: Allein Bücher – am besten, wenn ihre Umschläge blaß anmuten wie blutarme Prinzessinnen – sind dazu imstande, die Intelligenz und Bildung eines Menschen optisch und exemplarisch zur Schau zu stellen.
Auf dem Tisch lagen ein paar bemalte Knochen, Geschenke von Dr. Pauls Kindern aus erster Ehe. Ein Diktiergerät stand aufrecht wie ein Bergkreuz auf einem hohen Stoß von Büchern. Zwei Bildschirme waren auf einem abseits positionierten Tischchen untergebracht, als stelle ihre Benutzung nicht die Regel dar, sondern sei bloß Folge eines Notfalls.
Dr. Paul wies Lukastik mit einer Armbewegung einen freien Stuhl zu, während er mit der anderen Hand hinüber auf die Leiche zeigte und sagte: »Kein Zweifel mehr. Der Mann wurde von einem Hai getötet.«
Auf der Schreibfläche vor Dr. Paul, auf einer mit Papier unterlegten Glasplatte aufgereiht, befanden sich mehrere kleine Splitter. Eins dieser Fragmente hob er mit einer Pinzette in die Höhe, hielt es gegen das Licht und erklärte, daß es sich dabei um das Bruchstück eines Haizahns handle.
»Und sehen Sie das hier«, sagte Dr. Paul und präsentierte ein winziges, kieselsteinartiges Gebilde, das einen metallischen Schimmer besaß. »Ein typischer Hautzahn.«
»Hautzahn?«
»Ich hatte selbst keine Ahnung und mußte schnell einmal im Internet nachschlagen. Mir ist das immer ein bißchen peinlich.«
»Was ist Ihnen peinlich? Ins Internet gehen?«
»Ja«, bestätigte Dr. Paul. »Es hat etwas von einer Schummelei an sich. Als beziehe man sein Wissen aus einer verbotenen Zone. Als wildere man im Revier der Ungebildeten und Unsportlichen, die sich quasi auf Tastendruck bedienen wie in einem Supermarkt.«
»Und in diesem Supermarkt sind Sie also auf Hautzähne gestoßen«, folgerte Lukastik.
»Plakoidschuppen«, präzisierte Dr. Paul, »auf denen schöne, ungemein harte Emailzähnchen aufsitzen. Eine wirklich praktische Einrichtung: vermindert die Reibung und schützt wie ein Kettenhemd. Denn auch so ein Hai besteht ja aus einer einzigen fleischlichen Verletzbarkeit. Man vergißt das gerne, wenn man die Viecher sieht. Haie sind keine Insekten, nicht wirklich robust, eher sensibel, scheu und träge. Melancholisch. Die meisten gehören zu den Lebendgebärern, noch dazu mit langer Tragezeit. Das erzwingt geradezu die Melancholie.«
»Das ist jetzt aber nicht mehr sehr wissenschaftlich«, stellte der Kriminalist fest.
»Stimmt. Ich vergesse mich. – Also! Ich habe im Körper des Toten Fragmente von Gebißzähnen und Hautzähnen eines Hais entdeckt. Die Größe und Art der Verletzungen sowie der Umstand, daß unserem Toten nicht bloß eine Hand, sondern auch gleich ein ganzes Bein abgerissen wurde, setzt eine gewisse Größe des Fisches voraus. Gleichzeitig brauchen wir schon angesichts der geringen Wassertiefe des Beckens keine von den filmreifen Sechsmeterphantasien zu entwickeln.«
»Angesichts eines Beckens mit gechlortem Süßwasser sollten wir eigentlich gar keine Phantasien entwickeln können.«
»Ich bin Ihrer Meinung. Der Mann wurde anderswo getötet. Und natürlich müssen wir davon ausgehen, daß ihm die markanten Verletzungen auf künstlichem Wege beigebracht wurden. Daß jemand fein und säuberlich und fachkundig – hoffentlich nicht zu fachkundig – einen Angriff durch einen Hai vorgetäuscht hat, Bein und Hand in Haimanier abgetrennt und Segmente eines Haikörpers dem Toten appliziert hat.«
»Und das viele Blut?«
»Viel? Ich würde sagen viel zu wenig. Wäre der Mann in diesem Bassin auf diese Weise getötet worden, hätten wir ihn aus einer roten Suppe ziehen müssen und nicht aus einem leicht verfärbten Wässerchen. Einer hellen Brühe. Nein, von viel Blut kann wirklich nicht die Rede sein. Eher davon, daß es sich so ziemlich ausgeblutet hatte, als man den Toten umquartierte. Trotzdem war die Leiche … nun, man kann sagen, sie war frisch.«
»Und das heißt?«
»Daß der Mann in derselben Nacht, wahrscheinlich sogar während der zweiten Nachthälfte zu Tode kam. Es muß alles sehr schnell gegangen sein, die Präparation in Richtung auf einen Haiangriff und die Beförderung an den neuen Ort. Zwischen zwei und vier in der Frühe, schätze ich.«
»Prämortale Verletzungen? Eigentlicher Todesgrund?«
»Schwer zu sagen. Am ehesten ist der Mann während seines Todeskampfes ertrunken. Jedenfalls deutet nichts darauf hin, daß er die längste Zeit tot oder zumindest betäubt gewesen war, als die vermeintliche Haiattacke erfolgte.«
»Ertrunken?«
»Vielleicht wurde er anfänglich untergetaucht und erstickt und erst daraufhin die Amputation und die Zufügung simulierter Bißverletzungen vorgenommen. Vielleicht geschah alles gleichzeitig. Nicht auszuschließen, daß der Täter auch den Todeskampf eins zu eins nachgestellt hat.«
»Wie denn? Etwa als Weißer Hai kostümiert?«
»So weit würde ich nicht gehen. Wenngleich im Bereich der Rollenspiele einiges denkbar ist.«
»Hinweise auf Sex?«
»Der Bereich des Anus ist unbeschadet, wenn es das ist, was Sie hören möchten. Auch sonst keine Verletzungen, die über das Wirken eines Hais hinausgehen würden. Keine veralteten Hämatome, keine Einstiche, die Genitalien unauffällig, die Mundhöhle unversehrt. Ich spreche von einer ersten Untersuchung. Wir werden da noch ins Detail gehen müssen. Ich glaube aber nicht, daß wir auf eine sexuelle Komponente stoßen werden. Beziehungsweise hoffe ich das. Ehrlich gesagt, nervt mich alles Sexuelle. Und vor allem das Sexuelle im Verbrechen.«
»Wir können uns das nicht aussuchen.«
»Man kann einiges übersehen, wenn man will«, erklärte Dr. Paul und schien diese Bemerkung durchaus ernst zu meinen. Tatsächlich war er der Ansicht, daß es besser wäre, so manches Verbrechen unter den Teppich zu kehren. Vieles mußte bestraft, vieles verhindert werden. Gar keine Frage. Aber nach seinem Dafürhalten hätte es höchster kriminalistischer Reife entsprochen, all das zu vertuschen, was im Zuge lückenloser Aufklärung voraussichtlich zu noch größerem Schaden führte. Manche Dinge heilten, indem man sie einfach unberührt ließ. Dies galt für eine ganze Reihe von Themen. Es wurde keineswegs zuviel, sondern – im Gegenteil – viel zu wenig vertuscht. Dabei von einer gläsernen Gesellschaft zu sprechen empfand Dr. Paul als ausgesprochen verharmlosend. Er selbst bevorzugte den Begriff einer nackten, einer entblößten Gesellschaft. Das Bedürfnis nach Aufklärung und Offenlegung hatte vielerorts einen Zustand der Schamlosigkeit erreicht. Die Nacktheit oder, noch schlimmer, die freie Sicht, die sich mittels gehobener Röcke und heruntergelassener Hosen ergab, galt sonderbarerweise als Indiz für eine gelebte Demokratie.
Und genau daran mußte Dr. Paul jetzt denken. Es war wie ein Anfall, der ihn schlagartig packte, als er jetzt, ohne wirklichen Anlaß, ausrief: »Eine schöne Demokratie ist das!«
»Nicht doch«, bat Lukastik, der Dr. Pauls plötzliche Ausbrüche zur Genüge kannte.
Aber der Arzt war in diesem Moment unerbittlich. Lautstark beschwerte er sich, es würden immer wieder die persönlichen Verfehlungen gewisser Politiker über deren politische Konzepte gestellt werden.
»Ich frage mich«, sagte Dr. Paul, »was nützt uns ein idiotischer Ehrenmann? Dann doch lieber ein Schweinepriester, der gute Ideen verbreitet. Man würde ja auch nicht auf die Idee kommen, die Qualität etwa eines Philosophen nach seinen Eßgewohnheiten, seiner Verdauung oder an seinem Drogenkonsum zu beurteilen. Nehmen Sie Wittgenstein. Ich habe vor kurzem gelesen, er und sein Freund David Pinsent hätten 1913 in Norwegen versucht, ein ihnen lästiges Wespennest mit Petroleum, dann mit Benzin zu zerstören, um schließlich im Zuge eines dritten, halbwegs geglückten Manövers halbbetäubte Wespen zu zertreten. Zur gleichen Zeit leistete genau dieser Wittgenstein entscheidende Vorarbeiten zu seinem frühen Hauptwerk, dem Tractatus. Man bedenke also, der Mann war erwachsen. Und gerade darum muß sein Angriff auf ein Wespennest als degoutant, hysterisch und dümmlich empfunden werden. Trotzdem hört sein Tractatus natürlich nicht auf, ungemein geistreich zu sein. Auch dann nicht, wenn Wittgenstein es mit Schafen und Hühnern getrieben hätte, was man sich sogar ganz gut vorstellen kann. Sexuell war der Mann ja indiskutabel. Was aber keinen seiner Sätze auch nur kratzt. Und ebenso hört ein guter Politiker nicht auf, ein guter Politiker zu sein, selbst wenn er sich schmieren läßt oder im privaten Kreis Frauenkleider trägt. Sich schmieren zu lassen oder Frauenkleider zu tragen, das wäre erst dann von Bedeutung, wenn es die Politik dieses Mannes maßgeblich beeinflußt. Das muß aber keineswegs der Fall sein. Wäre es der Fall, wäre er wiederum kein guter Politiker, sondern eben bloß ein korrupter oder perverser Kerl.«
»Lieber Dr. Paul!« unterbrach Lukastik den Redeschwall und intonierte solcherart eine Warnung. Denn weder war er sonderlich scharf auf die außermedizinischen Kommentare des Arztes noch wollte er sich weitere Ausführungen hinsichtlich Wittgensteins Verhältnis zu Wespen und Hühnern anhören müssen. Es war allgemein bekannt, daß er, Lukastik, in der intensivsten Weise für die philosophischen Überlegungen Wittgensteins schwärmte, weshalb der gebildete Teil der Polizei gerne diesbezügliche Anspielungen fallenließ. Nichts konnte Lukastik weniger leiden.
Dr. Paul hob abwehrend die Hände. Die Erregung fiel so rasch von ihm ab, wie sie gekommen war. Er versprach, einen haarscharfen Bericht abliefern zu wollen. Dann beugte er sich beschwerlich über den Tisch und legte ein Stück Papier vor Lukastik hin, auf dem ein Name und eine Adresse notiert waren.
»Was soll ich damit?« fragte der Chefinspektor.
»Nehmen Sie die Zahnfragmente und Schuppen und suchen Sie diesen Mann auf. Herr Slatin ist ein alter Freund. Er ist besessen, verschroben und ziemlich unerträglich. Aber er scheint ein begnadeter Meeresbiologe zu sein. Wenngleich er sich aus dem Wissenschaftsbetrieb heraushält. Und zwar rigoros.«
Lukastik erklärte, sich eine Begnadung in dieser Disziplin nicht so richtig vorstellen zu können.
»Der Triumph des Geistes kennt keine Standesdünkel«, verkündete Dr. Paul ein wenig hochtrabend. »Es gibt geniale Radfahrer, geniale Theaterbesucher und geniale Installateure. Es besteht keine Disziplin, in der nicht irgendein Genie tätig wäre, mindestens eines. Das ist eine Regel in der Natur des Menschen.«
»Und dieser Herr Slatin ist also ein solches Genie.«
»Kann ich nicht wirklich sagen«, gestand Dr. Paul. »Jedenfalls heißt es, kaum jemand würde sich so gut mit Haien auskennen. Wenngleich die akademische Zunft ihn mißachtet. Aber das gehört natürlich dazu. Die Mißachtung ist das wichtigste dekorative Element im Leben eines wirklichen Genies. Ein Genie, das man anerkennt, was wäre das? Nun, es käme einem Sturm ohne Sturmschaden gleich. Also einem Sturm, der weder Bäume knickt noch Dächer abträgt. Der nicht einmal Hüte von Köpfen reißt. Und schon gar nicht Poeten anregt. Keine Krämpfe verursacht, keine schlaflosen Nächte. Also ein Sturm im Wasserglas, wie man so sagt.«
»Wäre es nicht sinnvoller«, zweifelte Lukastik, »wir würden uns bei dieser Recherche an die Universität halten. Schließlich benötigen wir weniger ein verwirrend brillantes Gutachten als eine präzise Analyse.«
»Mein Bester, Sie können doch machen, was Sie für richtig halten. Zwar habe ich Herrn Slatin bereits angekündigt, Sie würden vorbeisehen – nur, um keine Zeit zu verlieren. Aber das kann man ja rückgängig machen.«
»Schon gut«, winkte Lukastik ab, nahm den Zettel vom Tisch, steckte ihn ein und erhob sich. Dann bat er: »Seien Sie so nett und packen Sie mir die Zähne ein.«
»Gerne«, sagte Dr. Paul und nahm eine Telephonkarte zur Hand, mittels derer er die einzelnen Fragmente zu einer geraden Linie zusammenschob und sie in einer Aluminiumhülse mit Schraubdeckel verschloß. Es sah aus, als portioniere er Kokain. Dann stand er auf und trat hinüber zu Lukastik, der sich über die Leiche beugte, die unter dem grellen Licht einer Operationsleuchte durchaus selbst wie ein großer, heller Fisch aussah. Noch deutlicher als im Wasser und am Beckenrand war nun die verrenkte Haltung zu erkennen, der weit in den Nacken geschobene Kopf, die nach oben gerichteten, paarig spitzen Schulterteile, der zu einer Brücke gebogene Rumpf, die gegen die schlanke Taille gepreßten, kegelförmigen Unterarme sowie die verkrallte Stellung der Finger der rechten Hand, während das Fehlen der linken Hand eine Pathetik des leeren Raums schuf. Das vorhandene Bein wies vom Knie abwärts zahlreiche Bißstellen auf und war wie ein verdrehtes Puppenbein aus der Symmetrie des Körpers ausgebrochen. Der Hai, oder wer auch immer, schien versucht zu haben, auch diesen Teil vom Körper loszusägen.
Im Kontrast zur krampfartigen Verbogenheit des Körpers und des Kopfes stand das Gesicht des Mannes. Nicht, daß sich im Moment des Todes eine Gelöstheit der Züge ergeben hätte, ein Erschlaffen, wie dies immer wieder gerne beschrieben wird. Vielmehr besaß das Antlitz einen interessierten Ausdruck, als sei dieser Mann gerade dabeigewesen, eine Frage zu stellen. Keine dramatische Frage, wie etwa die nach dem Sinn des Lebens oder erst recht des Todes. Eher eine alltägliche Erkundigung. Überhaupt offenbarte sich hier ein Mensch, der dem Alltäglichen und Handfesten verbunden gewesen war. Er trug einen modischen Spitzbart, in dem einzelne graue Haare das Schwarz linierten. Dasselbe Schwarz, das gewissermaßen unliniert seine Kopfhaut füllte. Haarausfall war nicht sein Problem gewesen. Wenn er tatsächlich annähernd so alt wie Lukastik und Jordan gewesen war, hatte er sich gut gehalten. Kein schönes, aber ein markantes Gesicht. Um die offenen Augen herum spannte sich ein feines Netz, das man für ein Relikt attraktiver Lachfalten halten konnte. Die Lippen waren zwar nicht wulstig zu nennen, aber doch auffallend groß. Der Mund halb geöffnet.
»Schöne Zähne, nicht wahr?« sagte der Arzt. »Ich schau mir immer zuerst die Zähne an. Erstklassiger Zustand. Da gibt’s nichts zu meckern. Dieser Mann hat sich auf ein langes Leben vorbereitet. Schade.«
»Die Ohren?«
»Stimmt. Die Sache mit dem Hörgerät.« Dr. Paul griff nach einer Pinzette, zog die kleine Hörhilfe aus dem linken Ohr heraus, hielt sie ein paar Sekunden in die Luft und schob sie sodann wieder zurück an ihren Platz. Dazu kommentierte er: »Paßt! Es ist, als gleite man mit einem Schlüssel in das richtige Schloß. Der Mann scheint wirklich einen Gehörfehler gehabt zu haben. Und war eitel genug, keins von den Geräten zu tragen, die wie kleine Geigenkästen hinter den Ohrmuscheln stecken. Aber so scheint ja alles bei ihm gewesen zu sein: perfekt! Die ganze Figur, der ausrasierte Bart, Zähne, manikürte Nägel, eine makellos sitzende Badehose, gestutzte Haare in den Nasenlöchern, dazu rasierte Beine, beziehungsweise ein rasiertes Bein. – Haben Sie schon eine Ahnung, um wen es sich handeln könnte?«
Lukastik schüttelte den Kopf und erklärte, man sei gerade dabei, zu überprüfen, ob jemand aus dem Haus oder zumindest der Wohnanlage in Frage komme. Bisher allerdings fehle jeglicher Hinweis. Kein Vermißter, zu dem dieses Gesicht passen würde. Auch der Computer sei ratlos.
»Entweder Computer lügen, oder sie haben keine Ahnung«, betonte Dr. Paul, der ein gestörtes Verhältnis zu Rechnern hatte und sich ihrer – wenn unvermeidbar – mit Todesverachtung bediente. Gleich einem Schiffsbrüchigen, der Salzwasser trinkt. Und ja ganz gut weiß, welche Folgen das hat.
»Ihre Zähne!« erinnerte Dr. Paul und drückte dem Chefinspektor die schlanke, zigarrenförmige Hülse in die Hand. Dann lachte er und meinte: »Wenn wir den Hai gefunden haben, können wir ihn damit überführen.«
»Richtig«, stimmte Lukastik zu, der alles andere als ein humorvoller Mensch war. Er schob die Dose in seine Jackentasche, wies Dr. Paul an, das Hörgerät zurück an die Leute von der Spurensicherung zu leiten und ging.
Wenn zuvor gesagt worden war, daß Dr. Paul einen Gang besaß, der einem geschickten Balancieren gleichkomme, so konnte im Falle Lukastiks der Eindruck entstehen, hier trete jemand von Stein zu Stein. So gerade und eben konnte ein Weg gar nicht sein, daß Lukastiks kräftiger Schritt und seine leicht angewinkelten, schwingenden Arme nicht an eine Person erinnerten, die sich auf einer Bergwanderung befand. Lukastik hielt das Leben für eine durch und durch anstrengende Angelegenheit. Und das merkte man seiner Art zu gehen auch deutlich an.
3 »Ich habe Sie erwartet«, sagte der Mann, der Lukastik die Tür öffnete. Er mochte auf die Sechzig zugehen. Seine ganze Erscheinung widersprach der Vorstellung von einem Haiforscher. Seine Gesichtsfarbe dokumentierte ein frischluftarmes Leben, in welchem Sonne und Meer und herzhafte Brisen mit Sicherheit keine Rolle spielten. Unter dem weißen, durchscheinenden Hemd flatterte ein schmächtiger Körper. Nur um den Bauch herum ging das Flattern in eine stationäre Gewölbtheit über, die den weißen Stoff spannte. Der schmale, längliche Kopf steckte im viel zu großen Hemdkragen wie in einer Krause. Das kurze, graue Haar begrenzte eine glatte Stirn, auf der einige Schweißtropfen wie Tau standen. Ein strenges Augenpaar lag unter buschigen Brauen. Die Nase wies eine deutliche Schramme auf. Die Wangen erinnerten an weiße Vorhänge, die im Dunst einer Raucherwohnung einen gelblichen Stich angenommen hatten. Die Lippen waren gerade, schmal und verbissen. Bartstoppeln markierten das Kinn. Die Ohren lagen so dicht am Kopf, als seien sie zurückfrisiert worden.
Lukastik wurde in einen großen Raum gebeten, der im Schatten eines Hinterhofs und einer hohen Buche lag, weshalb mehrere Spots eingeschaltet waren. Entgegen Lukastiks Erwartung herrschte Übersicht, Ordnung und Reduktion. Keine bis zum Anschlag offenen Haigebisse, keine fossilen Zähne, keine Amphoren, keine Schaukästen, keine lädierten Tauchanzüge, die das eigene Gerade-noch-überlebt-Haben zur Schau stellten. Statt dessen wurde das Zentrum des Raums von einem weiten Arbeitstisch beherrscht, über den mehrere Graphikblätter verteilt waren, alte Stiche, soweit Lukastik sehen konnte, Stadtansichten, jedenfalls nichts, was mit Fischen zu tun hatte. Zwei Stühle standen weitab des Tisches, die Vorderkanten der Sitzflächen zueinander gerichtet, als dienten sie einem Duell. An den Wänden hingen alte Fotographien, die von hellen, hölzernen Leisten umrahmt und von entspiegeltem Glas abgedeckt waren. Historische Aufnahmen – so schien es zumindest im ersten Moment. Auch hätte Lukastik zunächst gar nicht sagen können, was genau darauf abgebildet war. Der Eindruck des Historischen ergab sich wohl nicht nur aus dem Umstand der bräunlichen Farbgebung, der körnigen Struktur und überhaupt einer neblig-nebulösen Wirkung, sondern auch, da jene alten Drucke sorgfältig über den Tisch verteilt lagen und im gesamten Raum eine Atmosphäre des Antiquarischen hervorriefen.
Slatin unterließ es, Lukastik einen von den duellierenden Stühle anzubieten, stellte sich seinerseits hinter den Arbeitstisch, auf den er seine schmalen Finger pianistisch aufstützte, und erklärte, daß Dr. Paul ihn darum gebeten habe, der Polizei behilflich zu sein. Was er gerne tun würde. Die Polizei verdiene Unterstützung. Auch sei er Dr. Paul einiges schuldig. Allerdings müsse er vorausschicken, daß seine Fachkompetenz sich in Grenzen halte. Natürlich, er handle mit alten Radierungen und Lithographien, sei aber mehr ein Sammler als ein Händler und mitnichten ein Götterliebling unter den Experten.
»Es geht nicht um Radierungen«, unterbrach Lukastik.
»Nein?«
»Es geht um Haie. Um einen bestimmten Hai«, sagte der Polizist und verteilte ein Dutzend Farbfotographien, von denen er eine jede aus einer Hülle zog, über die noch freie Fläche des Tisches. Slatin bemühte bloß seinen Kopf in Richtung der Abbildungen, schien es aber für überflüssig zu halten, gleich den ganzen Körper zu bewegen.
Einige der Aufnahmen zeigten den Toten in der Totale, sowohl im Wasser des Bassins als auch auf der weißen Plane. Andere waren allein den Bißverletzungen und der blanken Öffnung eines abgetrennten Beines gewidmet. Gestochen scharf.
Slatin schenkte den Fotos einen kurzen, emotionslosen Blick und fragte: »Was soll das?«
»Diese Bilder wurden heute früh aufgenommen.«
»In Australien?«
»Nicht ganz. In einem Schwimmbecken auf dem Dach eines Wohnhauses. Hier in Wien.«
»Und Sie möchten, daß ich das glaube«, sagte Slatin und machte ein Gesicht, als habe er einen schlechten Geschmack im Mund.
»Ja, das müssen Sie wohl. Auch wenn es grotesk erscheinen mag. Aber der Tote wurde nun mal an diesem Ort, in diesem Pool aufgefunden.«
»Wenn das so ist«, meinte Slatin, der jetzt doch einen Schritt näher getreten war, die Hände in den Hosentaschen, »hat sich jemand einen mehr als schlechten Scherz erlaubt.«
»Ja. Und diese Person gab sich auch noch alle Mühe, die tödliche Attacke so authentisch wie möglich aussehen zu lassen.« Lukastik nahm die Hülse aus seiner Sakkotasche und reichte sie Slatin. »Dr. Paul hat diese Fragmente aus dem Körper des Toten gezogen. Zahnsplitter und Hautzähnchen. Es würde mich interessieren, was Sie dazu sagen.«
»Ich würde Ihnen lieber meine Graphiksammlung zeigen«, äußerte Slatin.
»Ich dachte, Sie schwärmen für Haie.«
»Für Haie ja, nicht für schwachsinnige Inszenierungen.«
»Trotzdem. Seien Sie so nett und sehen sich die Teile einmal an.«
Slatin machte ein Geräusch, als zerbeiße er einen Wurm. Dann stellte er die Hülse ab, rieb sich die Hände an seiner Hose und öffnete mehrere Laden eines unter dem Tisch montierten Stahlschrankes, worin er seine graphischen Blätter verwahrte. Er hantierte mit der größten Sorgfalt. Nicht minder sorgfältig fuhr er mit einem weichen Tuch über die nun freie Fläche und legte ein weißes Blatt Papier auf, auf das er den Inhalt der Hülse leerte. Er klemmte sich eine kleine Lupe, die an ein kurzes Stück dunkler Wurst erinnerte, ins linke Auge und beugte sich über die Ansammlung der Fragmente. Hin und wieder hob er das Blatt an den Rändern an, wodurch sich eine neue Verteilung der Bruchstücke ergab. Es sah aus, als bediene er ein Spielzeug und versuche, die Gebilde in bestimmte Anordnungen zu manövrieren. Seine anfänglich so glatte Stirn zerbrach in Falten. Die Schweißtropfen standen jetzt dichter beieinander. Es war unangenehm warm im Zimmer. Die Hitze der letzten beiden Wochen staute sich dank verschlossener Fenster. Ohne zu fragen, machte Lukastik sich daran, eines zu öffnen.
»Lassen Sie das!« herrschte Slatin ihn an, behielt sein Auge aber an der Lupe und seinen Blick an den zu untersuchenden Objekten.
»Es ist heiß hier«, bemerkte der Chefinspektor.
»Ich kann jetzt keinen Windzug gebrauchen«, erklärte Slatin. Auf dem Rücken seines Hemds zeichnete sich eine dunkle, feuchte Stelle ab, ein Rorschach-Test von Schweißfleck. Der aber nicht allein von der Wärme herrührte. Eine Fiebrigkeit hatte den Mann erfaßt. Dennoch schien er nicht kopflos, im Gegenteil. Sein Fieber entsprang einem Übermaß an Konzentration, welches seinen Kopf geradezu plombierte.
Lukastik hätte gerne etwas eingewandt, schwieg aber und fuhr sich mit einem Tuch über die Stirn. Er trat von den Fenstern weg und begann sich für die gerahmten Fotographien an den Wänden zu interessieren. Erst jetzt realisierte er, daß es sich dabei nicht um verschleierte Burgen und im Dunst verlorene Alleen handelte, sondern passenderweise um Aufnahmen von Haifischen, auch wenn er eine Weile brauchte, bis er die Gestalt einzelner Tiere aus der diffusen Umgebung herausgefiltert hatte. Zumeist konnte er bloß die charakteristische Form einer Rückenflosse oder den scharfen Bug einer Schnauze erkennen. Mitunter war eigentlich nicht mehr zu sehen als die Kontur eines Riffs, so daß der Hai nur noch in der Erwartung des Betrachters existierte.
Haie im Stil der Fotographie des späten neunzehnten Jahrhunderts, eingebunden in eine verklärte Romanze zwischen Licht und Schatten. Solcherart entsprachen diese Fische nun tatsächlich jener von Dr. Paul angesprochenen »Melancholie mancher Lebendgebärer«. Darüber hinaus vermittelten die Bilder allerdings einen Horror, der sich dadurch ergab, etwas nicht zu sehen. Denn entgegen der Deutlichkeit, mit der fiktive und dokumentarische Filme »fletschende« Haie zeigen und deren elegante Beweglichkeit im Licht der Kameras oder in einem sonnendurchfluteten Schönwettermeer herausstellen, besteht ja wohl der eigentliche Schrecken, der von einem jeden natürlichen Wasser und erst recht von einem jeden Lebewesen in einem solchen Wasser ausgeht, für den Menschen darin, wenig bis gar nichts zu erkennen.
Jenes Zwielicht war es, das diese Fotographien zum Thema hatten. Jene unhaltbare Sphäre, in der die Gegenstände der Beobachtung sich kaum von ihrer Umgebung unterschieden und man als Betrachter das Gefühl bekam, selbst im Visier einer Beobachtung zu stehen.
Lukastik, der natürlich ein ausgeprägtes Gefühl für horrible Momente besaß, erschien diese Fotoserie wahrhaftiger als die übliche ausgeleuchtete Farbenpracht, die den meisten Unterwasserwelten das Flair von Vergnügungsparks verlieh.
Merkwürdig daran war allerdings, daß selbst bei genauerem Hinsehen der Eindruck erhalten blieb, es handle sich um historische Aufnahmen, was schier unmöglich war. Denn obgleich die Machart und Qualität der Bilder auf eine Zeit verwies, als die Fotographie noch in Konkurrenz zur Malerei gestanden hatte, stellte sich natürlich die Frage, wie eine solch frühe Lichtbildnerei den Weg ins Meer gefunden haben sollte.
»Aus welcher Zeit stammen diese Aufnahmen?« erkundigte sich Lukastik.
Ohne seinen Blick zu heben, antwortete Slatin: »Aus dem letzten Jahrhundert.«
Lukastik drückte sich auf den Fußballen ein wenig in die Höhe und fragte: »Welches letzte Jahrhundert meinen Sie?«
Die meisten Leute hatten noch immer ein Problem, das zwanzigste als das vergangene Jahrhundert anzusehen. Erst recht Menschen wie Lukastik, die wußten, niemals so viele gute Jahre in diesem neuen Jahrhundert ansammeln zu können, wie sie im gewesenen zurückgelassen hatten.
»Ich rede davon«, sagte Slatin, »daß diese Bilder etwa 1995 entstanden sind. Was dachten Sie denn? Daß die Pioniere der Fotographie unter Wasser gehen konnten?«
»Es hätte sich um frühe Studioaufnahmen handeln können«, gab Lukastik zu bedenken.
»Nein«, sagte Slatin, »die Bilder stammen von einem Freund. Er hat mir nicht erklärt, warum er seinen kleinen Kunstwerken einen altertümlichen Anstrich verliehen hat. Daß diese Bilder hier hängen, bedeutet mehr eine Höflichkeit meinerseits. Damit sie überhaupt irgendwo hängen. Und jetzt wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich in Ruhe ließen. Sie können ja draußen warten, wenn Sie wollen. Ich meine, wegen der Hitze hier.«
»Gute Idee«, parierte Lukastik die Unfreundlichkeit Slatins und verließ nicht nur den Raum, sondern auch gleich die Wohnung hinunter in den Hof, wo er unter dem hohen, dunklen, vom Wind bewegten Baum wartete. Nicht anders als ein Hai am Rande eines großen Schwarms kleiner Fische.
Wie bereits am Morgen, gab er sich auch jetzt der Kühle hin, welche nun allerdings in einem schwülen Korsett steckte. Lukastik entledigte sich seiner Jacke, rieb sich den Nacken und sah hinauf in den Wirbel der Blätter, welcher so dicht war, daß das wenige Licht wie Wasser durch ein Gestein sickerte.
Lukastik mochte solche Hinterhöfe, die er als typisch für diese Stadt empfand, schachtartig enge Plätze, in denen einzelne Bäume standen, deren Äste an die Fenster heranwuchsen und an sonnigen Tagen lockere Schatten in die Wohnungen warfen. Während natürlich zu bewölkten Zeiten diese sommerlichen Hinterhofbäume eine massive Dunkelheit hervorriefen, wie nicht einmal der Winter sie zustande brachte. Diese spezielle Nacht am Tage besaß etwas von einer in Schwarzweiß gefilmten Sonnenfinsternis und erzeugte eine ebensolche Stille. Die Leute in diesen Wohnungen und in diesen Hinterhöfen bewegten sich dann mit einer größeren Vorsicht oder tendierten überhaupt dazu, sich wenig oder gar nicht zu bewegen. Weshalb solche Räume völlig ungeeignet waren, jene Wendigkeit zeitgenössischen Privat- und Berufslebens zu entfalten.
In diesen Momenten großer Ruhe fühlte sich Lukastik mit dieser seiner Stadt versöhnt. So wie man sich mit einem Menschen versöhnt fühlt, der endlich tot auf der Bahre liegt und außerstande ist, zurückzureden. Was nicht heißen soll, Lukastiks Verhältnis zu Wien sei ein primär belastetes gewesen. Das nun wirklich nicht. Der Chefinspektor war keiner von denen, welche die Atmosphäre eines Ortes für das eigene Unglück verantwortlich machten und in jedem Häufchen Hundedreck, über das sie steigen mußten, ein Bild persönlichen Elends sahen. Auch litt er wenig an den politischen Verhältnissen der Stadt und des ganzen Landes. Er war allein darauf bedacht, sich aus allem Politischen herauszuhalten, sich am Politischen, ob verführerisch oder schändlich oder beides, vorbeizuwinden. Er stellte sich, wenn es nötig war, blind und taub und verwies auf das rein Faktische seiner Arbeit, wobei sein Vorgesetzter, jener Major, eine Art von Schutzschild bildete. Den Spruch, »nur seine Arbeit zu tun«, setzte Lukastik nicht bloß nach unten hin ein, um die eine oder andere Unhöflichkeit gegen Verdächtige, Zeugen oder Mitarbeiter zu begründen, sondern auch, um sich gegen Ansprüche von oben zu wehren. Neben der »Freiheit der Kunst« existierte für ihn auch eine »Freiheit der Polizei«, und damit meinte er im Grunde sich selbst. Was nicht bedeutete, daß er ausgesprochen ungesetzliche Handlungen vollzog, aber er war nun einmal extrem zielorientiert. Ein Verbrechen, vor allem die vermeintliche Exklusivität eines Verbrechens, schien ihn persönlich zu beleidigen, so daß er alles unternahm, um aus dem Besonderen einer kriminellen Handlung das Allgemeine wie das Alltägliche herauszuschälen. Das war sein großer Antrieb: Entmystifizierung.
Ende der Leseprobe