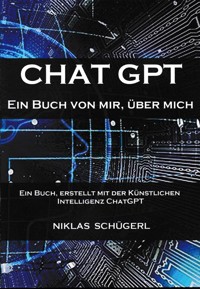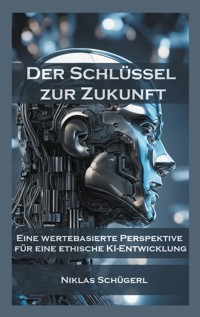
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
In einer Welt, die zunehmend von "Künstlicher Intelligenz" geprägt ist, stellen sich Fragen von existenzieller Bedeutung. Dieses Buch entführt Sie in die faszinierende und zugleich beunruhigende Welt der KI-Ethik. Es beleuchtet die ethischen Herausforderungen, die sich durch den rasanten Fortschritt der "Künstlichen Intelligenz" ergeben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Widmung
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1: Einleitung
Die Dringlichkeit ethischer KI
Der Weg zu einer wertebasierten KI
Buchstruktur und Zielsetzung
Kapitel 2: Grundlagen Künstlicher Intelligenz
Definitionen und Grundbegriffe
Historische Entwicklung von KI
KI-Arten
Kapitel 3: Das Zusammenspiel der 3 Dimensionen
Ein kommunikationswissenschaftliches Prinzip
Input, Informationsverarbeitung und Output
Das bedingte Zusammenspiel der 3 Dimensionen
Kapitel 4: Operationalisierungsmöglichkeiten ethischer Daten und Prozesse
Von der Quelle bis zur Indikatorbildung
Operationalisierung der Input- und Output-Daten
Operationalisierung der Informationsverarbeitungsprozesse
Kapitel 5: Regulierung AI Act
Der AI Act
Chancen des AI Acts
Risiken des AI Acts
Kapitel 6: Datenschutz und Privatsphäre in der KI-Ära
Datenschutzrechtliche Herausforderungen
Technologische Ansätze zum Schutz der Privatsphäre
Die Balance zwischen Datennutzung und individuellen Datenschutzrechten
Kapitel 7: Verantwortlichkeit und Haftung
Verantwortungszuweisung
Haftungsprinzipien
Schadensersatzansprüche
Kapitel 8: KI und Menschenrechte
Auswirkungen von KI auf Menschenrechte und Auswirkungen von Menschenrechte auf KI
Potenziale von KI für die Förderung der Menschenrechte
Risiken von KI für die Menschenrechte
Kapitel 9: Ethische Grundprinzipien und die 3 Dimensionen
Input
Informationsverarbeitung
Output
Kapitel 10: Bewusstseinsbildung ethischer KI
Sensibilisierung für ethische Herausforderungen
Herausforderungen und Erfolgsfaktoren
Methoden und Ansätze für Bewusstseinsbildung
Kapitel 11: Kulturelle Differenzen der Ethik
Das Dilemma partizipativer Systeme
Kulturelle Differenzen der Ethik
Interdisziplinäre Zusammenarbeit für wertebasierte KI-Entwicklung am Beispiel UNESCO
Kapitel 12: Ethische KI-Regelungen umsetzen
In der Theorie
In der Empirie
In der Praxis
Kapitel 13: Ethik in der Medienlandschaft
Die mediale Verantwortung
Auswirkungen auf den Journalismus
Zukunft der Medien
Kapitel 14: Ersetzbarkeit in der Arbeitswelt
Menschliche Fähigkeit vs. KI-Kompetenz
Ökonomische Folgen
Soziologische Folgen
Kapitel 15: Ethisch korrekte und inkorrekte Beispiele
Von der Vergangenheit lernen
KI-Systeme mit Merkmalen für ethisch korrekte KI
KI-Systeme mit Merkmalen für ethisch inkorrekte KI
Kapitel 16: Die Erschaffung einer harmonischen Mensch-Technologie-Beziehung
Voraussetzungen und Hürden
Beteiligung einzelner Akteure
Kollaborative Gestaltung
Kapitel 17: Superintelligenz
Eine Begriffsabgrenzung
Entstehung einer Superintelligenz
Wahrscheinlichkeit, Expertenmeinungen und Auswirkungen
Kapitel 18: Handlungsempfehlungen
KI-Entwickler und Forschung
Politik und Gesetzgebung
Gesellschaft
Kapitel 19: Zukunftsperspektiven
Rolle „Künstlicher Intelligenz“
KI-Fähigkeiten
Prognosen
Kapitel 20: Offene Fragen
Praktisches
Rechtliches
Ethisches
Anhang
Ein Worst-Case-Szenario
Ein Best-Case-Szenario
Abbildungsverzeichnis
Auch empfehlenswert:
Über den Autor
VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
spätestens seit 2022/2023 ist „Künstliche Intelligenz“ nicht nur medial, sondern auch gesellschaftlich omnipräsent. Trotzdem wissen selbst Interessenten, die sich immer wieder mit „KI“, so die Abkürzung, beschäftigen, nicht richtig, wie KI-Systeme eigentlich entstehen, wer dahintersteckt und wofür sie eigentlich eingesetzt werden. Denn auch wenn „Chat GPT“, ein bekanntes KI-Tool, welches in aller Munde ist, sich durch genau diese mediale Omnipräsenz fest in den Köpfen eines großen Teils der Bevölkerung manifestiert hat, so muss man bei genauerer Betrachtung feststellen, dass genau dieses fast schon berühmte KI-Tool nicht gerade zu den fortschrittlichsten KI-Systemen zählt.
Je fortschrittlicher die KI, desto ausführlichere und vor allem strengere Regulierungen zur Vermeidung möglicher ethischer Implikationen sind notwendig, was jedoch nicht heißen mag, dass die „nicht fortschrittliche KI“ Chat GPT nur der Selbstregulierung unterlegen sein sollte. Gesetzliche Ansätze sollen in diesem Buch hinterfragt, aber auch gelobt werden und durch Nennung zahlreicher Vor- und Nachteile den Leser zur kritischen Auseinandersetzung mit jenen Gesetzen auffordern.
Auch die Meinungen unterschiedlicher KIs (Chat GPT, Gemini…), sofern eine KI überhaupt eine Meinung haben kann, eine Thematik, die im Buch ebenfalls diskutiert wird, werden dargestellt.
Inhalte, die mit KI-Einsatz generiert wurden, werden im folgenden Buch kursiv und eingerückt dargestellt.
Ein interdisziplinärer Zugang zu KI soll vermittelt werden, um sich kritisch mit diesen zukunftsrelevanten Technologien auseinandersetzen zu können. Ordnung in sämtliche Zugänge bringt das folgende Buch durch seine 4 Teile (Einführendes, Rechtliches, Menschliches, Abschließendes), wobei der dritte Teil „Menschliches“ am ausführlichsten dargestellt wird, ein Hinweis, der auf die Wichtigkeit der Menschen im Bereich der KI-Ethik verweisen soll. Die alleinige Auseinandersetzung mit der aktuellen KI-Thematik ist selbst für den Laien der erste wichtige, große Schritt in die richtige Richtung, wenn die richtige Richtung eine Zukunft mit KI und nicht gegen KI sein soll.
„Der Schlüssel zur Zukunft – Eine wertebasierte Perspektive für eine ethische KI-Entwicklung“ soll wie der Titel bereits verrät, eine Anleitung sein, wie selbst noch fortschrittlichere KI-Technologien wie wir sie heute kennen, zu verwenden sind, damit auch in Zukunft die Vorteile dieser Technologien klar überwiegen. Die gesellschaftlichen Auswirkungen sollen durch die ausgewogene Balance zwischen „Angst machen“ und „Angst nehmen“ klar werden und zu einem objektiveren Diskurs über „Künstliche Intelligenz“ führen. Denn es gibt nichts Objektiveres als KI selbst. Begeben wir uns in eine bessere Welt, in der sowohl „künstliche“ als auch „menschliche“ Intelligenz eine bedeutende Rolle einnimmt.
Herzlichst,
Niklas Schügerl
Teil 1
Einführendes
Kapitel 1-4
KAPITEL 1 : EINLEITUNG
Künstliche Intelligenz, eingebettet in die heutige moderne Gesellschaft, war wohl das Thema im Jahr 2023. Daraufhin kürte das Wissenschaftsjournal „Nature“ den KI-Chatbot „Chat GPT“, kurz für „Chat Generative Pre-Trained Transformer“, zu den Top-Forschern des Jahres, wobei man bedenken muss, dass statt den normalen, jährlichen 10 Plätzen für die KI-Technologie ein 11. Platz erschaffen wurde. Dass KI-Systeme einen wichtigen Platz als Forschungsgebiet, aber auch als Forschungsinstrument einnehmen, ist wohl kaum zu leugnen. Doch wenn man beachtet, dass mit dem Prinzip der Wissenschaftlichkeit bedingt ein neuer Aspekt zum Vorschein kommen muss, damit man überhaupt von „wissenschaftlich“ reden kann, so ist der Titel „Top-Forscher“ für Chat GPT nicht gerechtfertigt und verbreitet nicht nur falsche Informationen, sondern auch Angst in der Bevölkerung. Hierbei handelt es sich nur um ein verhältnismäßig harmloses Beispiel, wenn es um „ethisch nicht korrekte KI“ gehen soll, und damit ist keineswegs der Chatbot Chat GPT gemeint. Doch was ist an der Kürung zum Top-Forscher so fatal? Genau diesen und anderen Fragen werden im Buch nachgegangen und durch die objektive Darstellung von Pro, Contra und dem größten Teil, jener, der genau zwischen Pro und Contra liegt, ein Überblick über grundlegende, rechtliche und ethische KI-Fakten gegeben.
Die Dringlichkeit ethischer KI
Wissen ist exponentiell. Diese Aussage legt nahe, dass der Erwerb von neuem Wissen einen sich selbst verstärkenden Prozess in Gang setzt. Recht ähnlich ist es auch bei der Erfindung neuer Technologien, Technologien wie beispielsweise „Künstliche Intelligenz“. „Durch Regulierungen dämmt man das exponentielle Wissenswachstum ein, bis es linear ist oder sich umkehrt.“ Dieser Satz entspricht nicht der Wirklichkeit. Die folgenden recht philosophischen Ansätze sollen dies durch die Auseinandersetzung mit den Begriffen „Regel“ und „Einschränkung“ aufzeigen.
„Eine Regel ist keine Einschränkung.“ Dies sagte der österreichische Universitätsprofessor Dr. Ernst Leo Marboe und machte klar, dass es sich bei jenen beiden Wörtern nicht um Synonyme handelt. Eine Regel versteht sich als etwas meist Bindendes, einzuhalten zwischen einer abgegrenzten Gruppe von Personen, Institutionen und Organisationen. Eine Einschränkung wird als etwas Begrenzendes definiert, um eine Handlung bewusst zu verhindern. Eine Regel kann also sehr wohl eine Einschränkung sein, aber nur, wenn das bewusst gewollte Handeln einer Person nicht mit der Regel übereinstimmt. Zur Verdeutlichung können 2 unterschiedliche Personen mit denselben Regelbedingungen aufgezeigt werden. Die Regel in diesem Beispiel ist ein Gesetz, welches den Mord an Personen verbieten und bestrafen soll. Person A ist aufgrund eines Konflikts gewollt, jemanden zu töten. Das Gesetz verbietet es und ist für die Person eine klare Einschränkung. Person B, mit denselben Regeln, will niemanden umbringen und ist daher im Handeln nicht eingeschränkt. Gleiche Regel, unterschiedlicher Einschränkungsgrad.
Ein weiteres Beispiel kann im Straßenverkehr aufgezeigt werden, diesmal mit 3 Personen in 3 Fahrzeugen, die vor derselben Kreuzung stehen. Person A will nach rechts, darf dies auch. Person B will gerade aus, darf dies nicht aufgrund des Schildes „Verbot der Einfahrt“. Person C will nach links, darf dies auch, allerdings ist die Durchfahrt wegen des Schildes „Spielstraße“ verboten, die Person muss zwischendurch das Fahrzeug abstellen. Die Straßenverkehrsordnung, die Regeln, sind für alle gleich und trotzdem kommt es mal zu einer totalen Einschränkung, mal zu einer kleineren, mal zu gar keiner.
Auf die KI-Thematik projiziert bedeutet dies, dass eine Regulierung durch ein Gesetz für viele wohl keine Einschränkung sein muss, sofern ihr bewusstes Handeln „ethisch korrekt“ ist, ein Begriff, der im folgenden Buch noch weiter operationalisiert wird. Sollte die Regulierung ein ethisch nicht korrektes Handeln verbieten, so ist dies für Personen, die bemüht im ethischen Umgang mit KI-Technologien sind, nicht nur keine Einschränkung, sondern sogar ein klarer Gewinn an Freiheit. Durch KI-Gesetze und Regeln wird es dem Menschen erst ermöglicht zu handeln.
Genau diese Ermöglichung des individuellen Handelns macht ein funktionierendes System, welches wie schon erwähnt ohne Einschränkungen nicht existieren könnte, aus. Sinn der Straßenverkehrsordnung ist es, Unfälle, also sachlichen, besonders aber menschlichen Schaden, so gut wie möglich zu verhindern. Besonders bei Geschwindigkeitsbegrenzungen wird dieser Grundsatz deutlich. Der Sinn von KI-Regulierungen ist es ebenso, Recht, Wohlbefinden und Existenz zu sichern, im besten Falle sogar zu verbessern. Die wirkliche Dringlichkeit ethischer KI in Verbindung mit KI-Regulierungen wird in den folgenden Kapiteln mit Sicherheit bewusst. Bewusst werden sollte sich jedoch jeder KI-Nutzer, dass es theoretisch möglich ist, dass eine KI (1) diskriminiert, denn beim ethisch nicht korrekten zur Verfügung stellen von Daten kann zwischen Religion, Geschlecht und anderen Merkmalen klar unterschieden und bewertet werden, (2) die Privatsphäre verletzt durch die Sammlung und Verbreitung sensibler Daten, (3) Fehlinformationen bewusst verbreitet, um politische Prozesse zu beeinflussen oder (4) für autonome Waffensysteme in Kriegen strategisch eingesetzt werden kann. Hierbei handelt es sich nur um eine kleine Liste spontan ausgewählter Fälle, die ewig weitergeführt werden könnte. Von weniger tragischen Fehlern bis hin zu dramatischen Szenarien ist theoretisch alles möglich. Die Dringlichkeit ethischer KI-Regeln ist somit durchaus hoch.
Der Weg zu einer wertebasierten KI
Am Anfang jeder Regel, egal ob Einschränkung oder nicht, steht ein bestimmter Sinn, der mit einem Wert verbunden ist. Menschen zeichnen sich durch ihre Werte aus und werden so zu einem Individuum. Problematisch ist jedoch die unterschiedliche Bewertung dieser Werte von Mensch zu Mensch auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Ausprägung jener Werte. Unterschiedliche Bewertungen meint, dass für unterschiedliche Personen dieselbe Tatsache ethisch korrekt oder ethisch inkorrekt sein kann. Ausschlaggebend dafür sind sowohl kulturelle als auch persönliche Unterschiede. Ein Rind zu töten kann für einen Christen ethisch vertretbarer sein, als für einen Hindu, um ein kulturelles Beispiel auf der Makroebene zu nennen. Ein persönlicher Unterschied, auf der Mikroebene, kann noch individueller ausfallen. Der eine mag die Farbe Blau, der andere mag sie nicht. Für den einen ist es vertretbar bei Orange über die Ampel zu fahren, der andere findet es schon bei „Dunkelgrün“ verantwortungslos aufs Gaspedal zu steigen.
Ethische Grundregeln für den Umgang mit KI zu definieren, ist somit keine einfache Aufgabe. Alleine die Operationalisierung, also der Versuch Aspekte in messbare Daten zu übersetzen, ist ein komplexer Vorgang, da es sich bei ethischen Grundüberlegungen meist um „weiche“ Daten handelt. Weiche Daten sind Fakten, die aus meist sozialwissenschaftlichen oder geisteswissenschaftlichen Überlegungen, um im Bereich der Ethik zu bleiben, hervorgehen. Hierbei handelt es sich oft um Gefühle, Emotionen oder Verhaltensweisen. Im Gegensatz zu den weichen Daten existiert auch der Begriff der „harten“ Fakten. Hierbei handelt es sich oft um naturwissenschaftliche Daten, wie die Tatsache, dass Wasser bei 0 Grad Celsius gefriert. Die Messbarkeit harter Daten gestaltet sich immer leichter und ist auch ohne Operationalisierung möglich, im Gegensatz zu weichen Daten, also ethischen Fragen. Um den Weg zu einer wertebasierten KI-Entwicklung zu beschreiten, muss somit ganz zu Beginn dieses Weges das Wort „Wert“ definiert und messbar gemacht werden.
Im Folgenden werden die zuvor genannten zwei Problematiken, die unterschiedliche Bewertung von Werten und die Ausprägung dieser Werte, genauer definiert und messbar gemacht. Eines muss jedoch klar sein: Die Tatsache, dass eine verallgemeinerte Zuordnung vieler Werte für alle Menschen wohl kaum möglich sein wird, eben durch persönliche und kulturelle Unterschiede. Auch der Ansatz „Tue selbst niemanden etwas an, was du nicht wollen würdest, dass es jemand anders dir antut“ verliert in dieser Überlegung seine Gültigkeit, auch wenn der Ansatz nicht zu den Schlechtesten gehört. Zu unterschiedlich handeln und vor allem empfinden wir Menschen, um diese Regel als valide abstempeln zu können. Um ethische Richtlinien überhaupt festlegen zu können, ist dies jedoch unbedingt notwendig. Genau dafür benötigt es wiederum Regeln, die verbindlich gelten, am besten global.
Werte müssen für alle Menschen verbindlich sein, unabhängig von ihren individuellen Überzeugungen.
Die zweite Problematik beschäftigt sich mit der Ausprägung dieser Werte, also die Tatsache, dass für den einen ein Wert wichtiger ist, für den anderen unwichtiger. Trotzdem muss ein Gesetz alle Meinungen auf einen Nenner bringen und für alle gelten.
Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, wäre die Entwicklung einer globalen Ethik-Charta für KI. Diese Charta würde klare Definitionen von ethischen Begriffen wie "Gerechtigkeit", "Würde" und "Sicherheit" enthalten. Sie würde auch konkrete Richtlinien für den Umgang mit KI-Systemen festlegen. Eine solche Charta würde es ermöglichen, KI-Systeme in einer ethisch vertretbaren Weise zu entwickeln und zu nutzen. Sie würde auch dazu beitragen, die Akzeptanz von KI in der Gesellschaft zu erhöhen.
Der Weg zur wertebasierten KI-Entwicklung ist daher geprägt von einer Reihe an grundsätzlich nicht messbaren Gefühlen, Ansätzen und Meinungen, die jedoch durch möglichst genaue Definitionen messbar gemacht werden müssen und anschließend im besten Fall global und verbindlich ihre Wirkung entfalten können.
Buchstruktur und Zielsetzung
Die Dringlichkeit global verbindlicher KI-Regulierungen zur Vermeidung von Diskriminierung, Eingrenzung von Privatsphärenverletzungen und Verhinderung von Fehlinformationen sollte als besonders wichtig eingestuft werden.
Um die Buchstruktur sinnvoll zu erläutern, muss zunächst die berühmte Bedürfnispyramide, auch Bedürfnishierarchie genannt, vom Psychologen Abraham Maslow (1908-1970) erläutert werden. Es handelt sich hierbei um eine grafische Darstellung der menschlichen Bedürfnisse, unterteilt in deren Wichtigkeit. An unterster Stelle stehen die wichtigsten Bedürfnisse, die als Grundbaustein gelten. Werden jene Bedürfnisse, Maslow nennt sie physiologische Bedürfnisse, also Essen, Trinken usw., nicht erfüllt, so ist der Mensch eingeschränkt, die nächste Stufe der Pyramide zu erreichen, in Maslows Pyramide das sogenannte Sicherheitsbedürfnis. An oberster Stelle nennt er die Selbstverwirklichung. Werden alle unteren Bedürfnisse nicht erfüllt, so kann sich, laut Maslow, ein Mensch also nicht selbstverwirklichen, ein Vorgang, der jedoch das Ziel eines jeden Individuums ist. Das Ziel steht somit an der Spitze der Pyramide.
Abbildung 1 Pyramide zur Buchstruktur
Die Struktur des vorliegenden Buches ist ähnlich zu betrachten. In Teil 1 werden allgemeine KI-Fakten präsentiert, Grundlagen erklärt und die Operationalisierung weiter ausgeführt. In Teil 2 werden rechtliche Grundlagen erklärt, mit einem Schwerpunkt auf Datenschutz und Privatsphäre unter Berücksichtigung der Menschenrechte. Nach einer Erläuterung der rechtlichen Situation wird in Teil 3 auf die menschlichen Aspekte Rücksicht genommen. Die Dringlichkeit ethischer KI-Regulierungen wird noch deutlicher werden. Gegen Ende des Buches sollen im 4. Teil „Abschließendes“ Handlungsempfehlungen und Zukunftsperspektiven aufgezeigt werden. Ziel ist es nicht nur ein besseres Verständnis für KI zu schaffen, sondern auch aktiv das Gelernte in täglichen Situationen anwenden zu können, um das übergeordnete Ziel zu erreichen. Eine ethisch korrekte und gewinnbringende Zusammenarbeit mit KI und nicht gegen KI muss gewährleistet werden.
KAPITEL 2 : GRUNDLAGEN KÜNSTLICHER INTELLIGENZ
Um einen Diskurs über ethisch korrekte oder inkorrekte Verhaltensweisen in Bezug auf KI überhaupt führen zu können, sind klare Definitionen und Begriffsabgrenzungen zu Beginn das A und O. Alleine die Erklärung des Begriffs „Intelligenz“ kann sich als recht schwierigen Prozess erweisen – niemand kann sie sehen, was für den einen als intelligent gilt, bezeichnet der nächste als unintelligent. Die Debatte über KI-Technologien ist außerdem von englischen Fachbegriffen übersät, die leicht zu Verwechslungen führen können. Was ist eigentlich ein Chatbot? Kann ein Computer oder ein Algorithmus überhaupt intelligent sein? Wofür stehen die Buchstabenkombinationen AI, ML, DL und NLP? Welche Arten von KI sind überhaupt zu unterscheiden und welche Unternehmen stecken dahinter? All diesen Fragen wird im folgenden Kapitel auf den Grund gegangen, um ein grundlegendes Verständnis für „Künstliche Intelligenz“ bilden zu können. Genau wie bei Maslows Bedürfnispyramide ist das Wissen des Grundlegenden der Grundbaustein für das Spezifische.
Definitionen und Grundbegriffe
Eine allgemeingültige Definition von KI gibt es nicht. Einige der zahlreichen Definitionen kommen jedoch auf ähnliche Aspekte zurück. An vorderster Stelle steht meist das Wort „Technologie“, die von Menschen erschaffen wurde. Die Association for the Advancement of Artificial Intelligence definiert KI als Fähigkeit eines Systems, welches sich an seine Umwelt anpassen kann und Aufgaben auf intelligente Weise erledigen kann. Problematisch an dieser Definition für „Künstliche Intelligenz“ ist das Wort „intelligent“. Eine weitere Definition beschreibt KI als System, welches sich selbst organisieren und entwickeln kann. Doch eine intelligente Person sollte mehr können, als sich nur selbst zu organisieren, oder nicht? Ob eine KI überhaupt intelligent sein kann, ist eine komplexe Frage, die bis heute nicht mit einem klaren „Ja“ oder „Nein“ beantwortbar ist, so wie es bei den meisten sozialwissenschaftlichen oder geisteswissenschaftlichen Fragen der Fall ist. Dafür spricht die Tatsache, dass KI in der Lage ist, komplexe Aufgaben zu lösen, die teilweise ein großer Teil der Bevölkerung nicht hätte lösen können. Dagegen spricht jedoch die Tatsache, dass eine KI keine Eigenschaften des menschlichen Geistes aufweisen kann und somit auch nicht fähig ist zu fühlen oder zu denken. Doch wie kann eine KI in so kurzer Zeit so viel Wissen abrufen, ohne dabei richtig nachdenken zu müssen? Tatsache ist, dass eine KI nicht denken kann. Bei Chatbots, wie Chat GPT oder Gemini, handelt es sich lediglich um computergestützte Textalgorithmen.
Vorstellen kann man sich das folgendermaßen: Man schickt einen Prompt (englisches Wort für Befehl) in schriftlicher Form dem Algorithmus, im Fall eines Chatbots ist dies die Eingabezeile. Der Algorithmus analysiert Buchstabe für Buchstabe und berechnet probabilistisch die Buchstaben, die auf die Frage die richtige Antwort geben. Ein Beispiel: Eine Person tippt die Frage: „Mein Auto hat die Farbe …“ ein. Der Algorithmus erkennt, dass drei aufeinanderfolgende Punkte für ein fehlendes Wort stehen und durchsucht seine Daten nach der Buchstabenkombination „Mein Auto hat die Farbe“. Nun berechnet der Algorithmus die Buchstaben, die am wahrscheinlichsten, also am meisten im Netz vorkommend, nach dem Satz einen Sinn ergeben. Der Algorithmus, also die KI, hat jedoch weder eine Ahnung, was die Wörter „Auto“ oder „Farbe“, noch „Blau“, „Grün“ oder „Orange“ bedeuten. Es handelt sich lediglich um eine statistische Wahrscheinlichkeitsberechnung einzelner Buchstaben, die Wörter, Sätze oder ganze Aufsätze bilden. Einfach formuliert könnte man meinen, dass ein Chatbot zwar ein unglaubliches Wissen von sich gibt, jedoch keine Ahnung hat, was diese Buchstaben und Sätze bedeuten. Betrachtet man nun die vorhergehende Frage „Ist KI überhaupt intelligent?“ erneut, so wird man wohl erkennen müssen, dass ein vom Menschen entwickelter Wahrscheinlichkeitsrechner eher als unintelligent gilt und die allgegenwärtige Bezeichnung „Künstliche Intelligenz“ irreführend ist.
Mein Auto hat die Farbe „Blau“.
Als grundlegender Begriff muss auch das US-amerikanische Unternehmen „OpenAI“ erwähnt werden, Erfinder von Chat GPT. Die Frage, warum das Unternehmen „OpenAI“ und nicht „OpenKI“ genannt wurde, ist einfacher als die Definitionsfrage von Intelligenz zu beantworten. AI steht für „Artificial Intelligence“ und ist einfach das englische Wort für „Künstliche Intelligenz“.
ML, Machine Learning, befasst sich mit der Entwicklung genau dieser Algorithmen. Durch ML-Technologien ist es möglich, Algorithmen Daten zur Verfügung zu stellen. Ein Teilbereich des ML ist das Deep Learning, auch DL genannt. Hierbei geht es nicht um die Entwicklung eines Algorithmus, sondern viel eher um die korrekte Verarbeitung der zur Verfügung gestellten Daten. Zuständig dafür sind künstlich hergestellte neuronale Netzwerke, die in Folge dieses Kapitels ebenfalls noch behandelt werden.
Mittels Machine Learning entsteht ein Algorithmus und durch Deep Learning werden die Daten verarbeitet, die der Algorithmus benötigt. So kann der Algorithmus die Wörter und Sätze generieren, die am wahrscheinlichsten zur richtigen Antwort führen. Doch woher kennt der Algorithmus unsere Sprache und kann grammatikalisch korrekte Sätze formulieren? Dafür sind Natural Language Processing-Systeme notwendig, kurz NLP. Sie sind Teil des Algorithmus und machen eine Interaktion zwischen Mensch und Maschine möglich. All diese Algorithmen und Systeme bilden den Grundbaustein für die Funktionsweise vieler KI-Systeme.
Die letzte essenzielle Abkürzung, von der schon jeder etwas gehört hat, aber kaum jemand die tatsächliche Bedeutung und Übersetzung kennt, ist „Chat GPT“. GPT steht für „Generative Pre-Trained Transformer“. Das Wort „generative“ ist wohl noch am selbstverständlichsten. „Generative“ bedeutet so viel wie „erzeugend“. Das Wort weist darauf hin, dass der Chatbot etwas erzeugt, in diesem Fall einen Text. Das „P“ in Chat GPT steht für Pre-Trained und bedeutet vortrainiert. Damit soll klar werden, dass ohne vorher zur Verfügung gestellte Daten auch keine Daten verarbeitet werden können. Der letzte Buchstabe in GPT steht für „Transformer“. Hierbei handelt es sich um eine Technologie, die zuständig für die Herstellung künstlicher neuronaler Netzwerke ist. Betont muss hierbei das Wort „künstlich“ werden. Wäre es kein künstliches neuronales Netzwerk, sondern ein „echtes neuronales Netzwerk“, also ein biologisches, dann würde es sich um ein menschliches Gehirn handeln. Auch wenn die Aufgaben dieser zwei Netzwerke die gleichen sind, so sind die Unterschiede umso größer. Das Gehirn ist biologisch und besteht aus Nervenzellen, der Transformer ist eine Kombination aus Nullen und Einsen, dem Binärcode. GPT bedeutet somit lediglich, dass die Transformer-Technologie vortrainierte Daten verarbeitet und basierend auf diesen Daten etwas erzeugt.
Historische Entwicklung von KI
„Künstliche Intelligenz“, das Thema des 21. Jahrhunderts, zum Top-Forscher gekürt im Jahr 2023, ist historisch gesehen eigentlich gar nicht die jüngste aller Technologien und verwurzelt in den 60er Jahren. Doch warum erst jetzt die massive Euphorie um KI, wenn dessen Existenz eigentlich einige Jahrzehnte in die Vergangenheit reicht? Grundsätzlich kann die Entwicklung von KI-Systemen in vier Phasen unterteilt werden, auch wenn die Übergänge recht fließend verlaufen.
Alles begann in der Anfangsphase (1950-1960), in der die ersten Algorithmen entwickelt wurden. Die Fähigkeit eines Computers menschenähnliche Aufgaben lösen zu können war das Ziel und faszinierte Forscher global. Die ersten künstlichen neuronalen Netzwerke wurden erfunden, waren jedoch nicht zu vergleichen mit den heutigen Netzwerken, die stets immer verbessert wurden. Für damalige Verhältnisse galten die Versuche ein biologisches, menschliches neuronales Netzwerk zu imitieren als großer Erfolg und es dauerte nicht lange, bis sich die Forschung auch den künstlichen neuronalen Netzwerken widmete, die im Grunde der Grundbaustein vieler KI-Systeme sind.
Daraufhin folgte eine richtige KI-Euphorie (1960-1970), die auch als zweite Phase bezeichnet wird. Die Motivation der Forscher neue bahnbrechende technologische Fortschritte zu machen, war kaum zu bremsen, was zur Entstehung einiger Computerprogramme führte, darunter auch der allererste Chatbot. Das US-amerikanische Computergenie Joseph Weizenbaum entwickelte im Jahr 1964 ELIZA, ein Computerprogramm, welches Antworten auf schriftlich gestellte Fragen geben konnte, für damalige Zeiten ein großer Erfolg. Weizenbaums Technologie analysierte eingegebene Daten und versuchte danach Muster zu erkennen. Der Chatbot agierte als Psychotherapeut und gab meist passende Antworten, wie es im folgenden Beispiel dargestellt wird:
Benutzer: Ich fühle mich traurig.
ELIZA: Es tut mir leid, dass du dich traurig fühlst. Möchtest du darüber reden?
Benutzer: Ich habe Angst.
ELIZA: Es ist normal, Angst zu haben. Angst ist ein natürlicher Schutzmechanismus.
Benutzer: Ich bin wütend.
ELIZA: Es ist wichtig, deine Wut auszudrücken. Es ist aber auch wichtig, sie auf eine gesunde Weise auszudrücken.
Der Chatbot war geboren und der Grundbaustein, gleichzusetzen mit den physiologischen Grundbedürfnissen der Maslowschen Bedürfnispyramide, war gelegt. Und wer glaubt, es würde in diesem Entwicklungstempo weiter gehen, der irrt sich, denn die dritte Phase, der KI-Winter, fand seinen Platz.
Zwischen 1970 und 1980 war von jener Euphorie keine Spur mehr und eine pessimistische Grundeinstellung prägte die nächsten Jahre. Die übertriebenen Erwartungen der vorherigen Phase führten zu dieser Einstellung. Es mangelte an neuen bahnbrechenden Technologien, aber auch an ethischen Richtlinien. Investoren zogen sich zurück, Forschungstalente gingen verloren, mit ihnen einige Forschungsergebnisse. Doch es sollte so nicht lange bleiben.
Die letzte Phase, beginnend im Jahr 1980, brachte wieder neuen Schwung in die Forschung, der fast ausnahmslos bis heute noch für die Begeisterung an der KI-Thematik Schuld ist. Man konnte aus der Sackgasse der letzten Jahre entkommen und durch neue Technologien, beispielsweise durch die Erfindung des Mikroprozessors, wieder neue Erkenntnisse gewinnen, die wie ein Dominoeffekt wirkten.
Der Turing-Test wurde vorgestellt, ein Test, der voraussagen soll, ob ein Computer „Intelligenz“ besitzt. Jährliche KI-Konferenzen wurden einberufen und ein Algorithmus, der Schach spielen konnte, vorgestellt. Bücher wurden publiziert, die sich nun auch mit ethischen Problematiken auseinandersetzen, darunter das Buch “Perceptrons“. Die Mustererkennung vieler neuronaler Netzwerke wurde verbessert und schließlich konnte sogar eine KI die Quiz-Show „Jeopardy“ gewinnen. Tausende Experimente und Anpassungen später, stellte schließlich das Unternehmen OpenAI im Jahr 2019 Chat GPT 1 vor, den berühmten Chatbot der in der damaligen Version nur einen Bruchteil an Daten verarbeiten konnte, im Vergleich zur Nachfolgeversion Chat GPT 2, die wiederum von Chat GPT 3 verdrängt wurde. Und genau diese letzte Verdrängung könnte als fünfte Phase bezeichnet werden.
Durch die mediale Omnipräsenz, beginnend im Jahr 2022, rückte die KI-Thematik noch einmal mehr in die Öffentlichkeit und ist bis heute in jeder Zeitung präsent. KI-Fachvorträge wurden angeboten, Bildungstage initiiert und KI-Workshops veranstaltet. Bis heute zählt Chat GPT wohl zu den bekanntesten KI-Systemen, auch wenn es sich mit Abstand nicht um die innovativste oder fortschrittlichste KI handelt.
KI-Arten
Unterteilungs- möglichkeit 1
schwache KI
starke KI
Unterteilungs- möglichkeit 2
reaktive KI
lernende KI
bewusste KI
Unterteilungs- möglichkeit 3
symbolische KI
neuronale KI
Im folgenden Teil werden drei der aussagekräftigsten und bekanntesten Unterscheidungsmöglichkeiten aufgezeigt. Welche Möglichkeit am besten geeignet ist, kann pauschal nicht gesagt werden und ist abhängig vom Inhalt des Diskurses über KI.
Die erste Variante, KI-Systeme voneinander zu unterscheiden, ist die Trennung zwischen „schwacher“ und „starker“ KI. Schwache KI, im fachwissenschaftlichen Diskurs auch als „Narrow AI“ bezeichnet, wird darauf trainiert, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Diese Aufgaben können beispielsweise die Erkennung von Bildern, das Erkennen von Sprache oder die Analyse von Finanzdaten sein. Meist handelt es sich um Aufgaben, die ein Algorithmus schneller und mit geringerer Irrtumswahrscheinlichkeit als der Mensch erfüllen kann. Zu beachten ist hierbei vor allem das Wort „schneller“. Denn grundsätzlich ist der Mensch auch alleine in der Lage, diese Tätigkeiten auszuführen. Der Sinn schwacher KI-Technologien ist die Fähigkeit, mit höherer Effizienz Daten zu verarbeiten und diese Daten dem Menschen zur Verfügung zu stellen. Grundlegende neue Daten oder Erkenntnisse werden dabei nicht generiert. Ein Beispiel für schwache KI wäre der Chatbot „Chat GPT“.
Im Gegensatz zu schwacher KI ist starke KI in der Lage nicht nur eine Vielzahl von Aufgaben zu erledigen, sondern dies