
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der große historische Roman von Elisabeth Zöller Um 1630: Als Maras Mutter auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird, bleibt dem sechzehnjährigen Mädchen nur die Flucht. Ihr einziger Besitz ist ein geheimnisvolles Bild, das jedem Betrachter etwas anderes zu zeigen scheint. Doch was zeigt es? Die Vergangenheit? Oder deuten die schemenhaften Gestalten hinter dem schwarzen Vorhang gar auf die Zukunft hin? Maras abenteuerliche Reise führt sie in die blühende Handelsstadt Amsterdam, wo sie auf der Suche nach einem Hinweis die Werkstätten des Künstlerviertels abklappert. Doch irgendjemand will mit allen Mitteln verhindern, dass sie mehr über das Bild und dessen Maler erfährt … Ein opulenter Roman mit farbenprächtigen Szenen, ein spannendes Kunstabenteuer und die Geschichte einer großen Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Elisabeth Zöller
Der schwarze Vorhang
Über dieses Buch
Der große historische Roman von Elisabeth Zöller
Um 1630: Als Maras Mutter auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird, bleibt dem sechzehnjährigen Mädchen nur die Flucht. Ihr einziger Besitz ist ein geheimnisvolles Bild, das jedem Betrachter etwas anderes zu zeigen scheint. Doch was zeigt es? Die Vergangenheit? Oder deuten die schemenhaften Gestalten hinter dem schwarzen Vorhang gar auf die Zukunft hin? Maras abenteuerliche Reise führt sie in die blühende Handelsstadt Amsterdam, wo sie auf der Suche nach einem Hinweis die Werkstätten des Künstlerviertels abklappert. Doch irgendjemand will mit allen Mitteln verhindern, dass sie mehr über das Bild und dessen Maler erfährt …
Ein opulenter Roman mit farbenprächtigen Szenen, ein spannendes Kunstabenteuer und die Geschichte einer großen Liebe.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: Buchholz/Hinsch/Hensinger/
Coverabbildung: Henriette Sauvant
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2010
Lektorat: Frank Griesheimer
Das erste Motto ist dem Buch ›Fluchtstücke‹ von Anne Michaels, © 1996 BV Berlin Verlag GmbH, entnommen.
Die übrigen Motti sind dem Buch ›Offene Unruh‹ von Michael Lentz, © S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2010, entnommen.
Nach den Regeln der neuen Rechtschreibung
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401210-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für Anne, Brigitte und [...]
Niemand wird nur einmal [...]
Die Sonne des späten [...]
Erster Teil Feuertod
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Zweiter Teil Die Stadt der Künstler
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dritter Teil Jenseits des schwarzen Vorhangs
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
Sechsunddreißigstes Kapitel
Epilog
Glossar
Nachwort
Verwendete Literatur (Auswahl)
Für Anne, Brigitte und Peter
Niemand wird nur einmal geboren. Hat man Glück,
erblickt man im Arm eines anderen erneut das Licht;
hat man Unglück, erwacht man, wenn der lange Schweif
des Entsetzens das Innere des eigenen Schädels streift.
Anne Michaels
Die Sonne des späten Nachmittags tauchte den Raum in ein blutrotes Licht. Töpfe, Tiegel und Gerätschaften, die auf den ersten Blick wild durcheinander auf den Tischen und Regalen standen, warfen bizarre Schatten an die kahlen Wände. Sie wurden länger, zogen Fratzen, umarmten sich wie zum Tanz, wanderten gespenstisch durch den Raum bis zur Decke. Doch der Mann, der mit dem Rücken zu ihnen saß, bemerkte ihren sonderbaren geisterhaften Reigen nicht.
Mit dem Licht verschwand auch die Wärme. Durch die Türritzen drang kühle, feuchte Luft, doch auch das spürte der Mann kaum. Vielmehr lag sein Blick auf dem Porträt, das unvollendet vor ihm auf einer der Staffeleien stand.
In den Augen des Mannes lag ein fiebriger Glanz, und die schweißnassen langen, schwarzen Haare fielen ihm immer wieder ins Gesicht. Er sprang auf, eilte zu den Töpfen, veränderte die Zutaten, mischte die Farben neu. Zurück an der Staffelei, hatte die Dämmerung das Licht endgültig vertrieben. Schatten legten sich auf alles. Resigniert ließ der Mann den Pinsel sinken.
Es war der siebte Tag, das siebte unfertige Porträt.
Warum gehorchten ihm die Farben nicht? Dabei malte er mit den Farben der Leidenschaft, des Zornes, mit der ganzen Kraft seines Herzens! Und doch blieben die Augen auf seinem Gemälde tot und das Lächeln steinern.
Warum gelang ihm nicht, was dem anderen mit Leichtigkeit von der Hand ging? Der Mann spürte die Demütigung, den alles zerfressenden Neid, den abgrundtiefen Hass auf den anderen, der alles besaß, wonach er selbst sich sehnte.
Teuflische Gedanken drängten sich in sein Bewusstsein. Das Böse? Hatte es von ihm Besitz ergriffen? Erschrocken rannte er aus der Hütte, schrie seine Verzweiflung hinaus in den einsamen Wald und atmete tief die kühle Abendluft ein.
Doch es half nichts. Längst legten sich die dunklen Gedanken wie ein schwarzer, undurchdringlicher Vorhang über alles, was ihm einmal lieb und wichtig gewesen war. Ein böser Plan war in ihm gereift und drängte zur Tat.
Erster TeilFeuertod
im dämmer drängt alles zusammen
ein riss geht auf
und zeigt nur noch riss
Michael Lentz
Erstes Kapitel
Im Jahre 1636
»Mara, nimm das Bild, pass auf, dass es nicht in falsche Hände gerät! Hab keine Angst, flieh nach Amsterdam. Dort wirst du Leute finden, die dir helfen. Frag in der Prinsengracht nach …«
»Maul zu!« Sie schlugen meiner Mutter ins Gesicht, hielten ihr den Mund zu, stießen sie zu Boden.
Ich lief zu ihr, stellte mich schützend vor sie.
»Weg da, Bastard!« Sie zerrten mich von ihr fort.
Amsterdam? Das Bild? Was sollte ich? Welche Leute? Wie hießen sie? Wobei sollten sie mir helfen? Die Fragen sprangen in meinem Kopf herum. Eine Antwort fanden sie nicht.
Am Morgen waren sie gekommen … Lautes Schlagen an die Tür, mit Stiefeltritten und Fäusten. Immer lauter und bedrohlicher wurden die Schläge. Sofort saß ich aufrecht, noch schlaftrunken und verwirrt. Wer war da? Ich wollte rufen, aber meine Stimme versagte. Nur wenig Licht kroch durch die mit Tierhäuten bespannten Luken.
»Tür auf! Los, macht die Tür auf! Wird’s bald?« Immer lauter wurde das Gebrüll, und mit großem Lärm zerbarst die kaum Schutz bietende Tür aus dünnem Holz. Vier bewaffnete Männer stürzten in den Raum, allen voran der Büttel, und mit ihnen krochen Kälte und Nebel herein. Der Büttel? Was wollte der? Bei meiner Mutter und mir?
Ich schlang sitzend die wollene Decke um mich.
Mutter zog ihr Hemd herunter, ein verzweifelter Versuch, sich vor den Blicken und der Kälte zu schützen.
»Was wollt ihr?« Die wilden Locken fielen ihr immer wieder ins Gesicht, umrahmten es wie ein leuchtender Schein. Wut und Angst ließen sie nur noch schöner aussehen. Engelgleich.
»Fertigmachen, mitkommen!« Als Antwort gab es nur harsche Befehle.
»Was wollt ihr?« Die Stimme meiner Mutter wiederholte die Frage, klar und deutlich. Woher nahm sie die Kraft?
»So sieht also eine Hexe aus!«, rief einer der vier Eindringlinge hämisch. »Los, mitnehmen!«
»Das könnt ihr nicht machen!« Entsetzen kroch in mir hoch, ließ mich schreien und aufspringen. Die Decke entglitt mir, und sofort spürte ich den lüsternen Blick des Wortführers auf meinem schmalen Körper, wie er an den vor Schreck wippenden Brustspitzen unter meinem Hemd hängenblieb.
»Halt die Klappe, kleine Göre!«, brüllte er mich an, streckte seinen Arm begierig aus, flüsterte: »Vögelchen …«, stieß mich dann aber unter den Blicken der anderen Männer grob zurück.
»Ruhig, Mara«, flüsterte Mutter und strich mir über den Kopf.
»Finger weg! Ihr bleibt, wo ihr seid. Fesseln!« Und schon schlangen die Knechte einen Strick um Mutters Handgelenke und zurrten ihn fest.
»Nein!« Ich schrie laut auf. »Lasst sie doch wenigstens etwas anziehen!«
»Hältst du nicht die Klappe, ergeht es dir genauso, Göre. Im Kerker braucht sie keine Kleider – und für uns auch nicht.« Boshaftes Gelächter.
»Hexe!«, feixte einer der Knechte und klappte die Truhe auf, warf Tücher und Gewänder auf den Boden, riss getrocknete Kräuter von den dunklen Balken der Hütte, sammelte alles in einem schmutzigen Kartoffelsack. Als Letztes warf er unsere Bibel hinein, eines unserer wenigen Bücher. Mit dieser Bibel hatte ich lesen gelernt, Buchstaben, die eine ganze Welt füllen konnten.
»Mitnehmen, abführen!« Gebellte Befehle.
»Bitte, tut das nicht!« Mein verzweifelter Schrei prallte an ihnen ab.
»Mara, nimm das Bild, pass auf, dass es nicht in falsche Hände gerät. Hab keine Angst, flieh nach Amsterdam! Dort wirst du Leute finden, die dir helfen. Frag in der Prinsengracht nach …« Leise und klar hatte Mutter es mir zuflüstern wollen, dann schlug man ihr auf den Mund, brachte sie zum Schweigen.
Das war das Letzte, was ich von meiner Mutter hörte. Alles, was mir blieb, waren die Worte: Bild – Amsterdam – Prinsengracht. Die Worte tanzten in meinem Kopf. Und tausend Fragen, die ich meiner Mutter stellen wollte. Hatte sie mir noch einen Namen nennen wollen? Aber die vier Männer hatten sich bedrohlich groß zwischen uns gedrängt. Der Anführer, der Büttel, war ein Hüne. Ich kannte ihn aus dem Dorf. Der zweite Kerl hatte keine Finger an der rechten Hand und eine schwarze Klappe vor dem rechten Auge. Mit dem anderen glotzte er von Mutter zu mir und schien zu überlegen, ob er mich nicht auch gleich abführen sollte. Der Anführer zerrte meine Mutter am Strick zur Tür.
»Mama, Mama!«, schrie ich und versuchte, mich an ihr Hemd zu hängen. »Ihr könnt sie doch nicht einfach mitnehmen!«
»Sei froh, dass wir dich verschonen«, schnauzte er und stieß mich zurück in die Hütte. Ich sah noch, wie ihre Lippen einen Namen formten, bevor ihr der Anführer wieder ins Gesicht schlug, so grob, dass sie stürzte. Ich hörte nichts mehr. Sie traten nach ihr, dann schleppten sie sie fort, in Richtung Isterberg.
»Kein Wort mehr, Weib! Uns wirst du nicht verhexen.«
Ich stürzte hinterher, schrie verzweifelt und ohne Hoffnung: »Wohin soll ich? Wen soll ich fragen?«
Doch meine Worte verhallten im Nebel des frühen Aprilmorgens, sie wurden von der Feuchtigkeit verschluckt. Man ließ mich völlig allein zurück.
Angst kroch in das Dunkel der Hütte, in der ich mich auf den Boden hockte – mit hängendem Kopf. Eine große schwarze Angst.
Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß. Wahrscheinlich holte die Kälte des frühen Morgens mich endlich wieder zurück. Ich musste etwas tun. Ich konnte doch Mutter nicht einfach so in den Händen dieser Männer lassen. Sie hatten meine Mutter geholt auf richterlichen Befehl. Hexe!, so hatten sie gerufen. Das Wort und dessen Bedeutung drangen erst jetzt langsam in mein Bewusstsein. Hexe!
Und plötzlich, als wäre jemand hinter mir her und hetzte und jagte mich, öffnete ich die Truhe, durchwühlte alles, ließ die Bodenluke aufspringen, kletterte hinauf und kroch zwischen Mäusekot und Spinnenbeinen mit den Händen tastend über die Dachbodenbretter.
Nimm das Bild … flieh nach Amsterdam!
Ich suchte das Bild. Doch welches Bild? Ich fand nichts. Weinend setzte ich mich auf den Boden. Ich wusste ja nicht einmal, was ich suchte. Suchte ich eine Leinwand? Suchte ich einen Rahmen? Suchte ich Papier? Verwirrt und verzweifelt kroch ich weiter. Ich drehte alles um, wendete Leinenbeutel und Kräuterbündel, sogar die Alraunen. Ich suchte – aber auch der Spitzboden gab nichts her, sosehr ich auch mit den Fingern bis in die entferntesten und dunkelsten Winkel grub.
Wieder flossen meine Tränen. Mutter war weg, verschleppt wie eine Verbrecherin. Ich saß allein in unserer Hütte am Rand des Dorfes. Flieh, hatte Mama gesagt, flieh nach Amsterdam … Aber sie hatte mir keinen Namen genannt. Die Faust des Büttels hatte sie daran gehindert.
Vielleicht meinte sie ihre Verwandten oder Verwandte meines Vaters? So oft hatte ich Mutter nach Vaters Namen gefragt. Immer und immer wieder. Und jedes Mal wurde ihr Blick dunkel und traurig und sie sagte: »Später, Mara, später werde ich dir von ihm erzählen. Wenn du groß bist.«
Und – war ich jetzt groß? War man groß, wenn man fünfzehn, bald sechzehn war?
War man groß, wenn sich plötzlich die Wut eines Dorfes gegen einen wandte, wenn die Mutter, als Hexe abgeholt, nur Schreie des Entsetzens zurückließ? War man groß, wenn man plötzlich mutterseelenallein auf dem Boden einer Hütte hockte und nichts blieb als Warten, Angst und elende Flucht?
»Mama«, schluchzte ich. »Mama«, schrie ich. Aber keiner antwortete. Die Holzwände der Hütte, wabernder Morgennebel über dem Garten, dicke efeuumrankte Eichen- und Buchenstämme schluckten die Schreie und Worte, warfen sie höchstens für Bruchteile von Sekunden wie beißenden Spott zurück.
Ich war allein.
Ich starrte in die fast stumpfe Spiegelscherbe an der Wand. Große grüne Augen sahen mich an. »Sternenaugen«, hatte Mama immer gesagt und sie mir am Abend mit einem liebevollen Schlaflied geschlossen, mit einem Lied, das unsere Hütte so oft mit wohliger Wärme erfüllt hatte. Mutters Augen dagegen waren dunkel und goldbraun. Waren die Sternenaugen die Augen meines Vaters?
Ich, Mara. Da hockte ich. Mara bedeutete die Strahlende, die Leuchtende, die Perle. Mara war der Glanz, der Sonnenstrahl, aber auch die Bitterkeit! Mein Vater soll diesen Namen gewählt haben. Das war das Einzige, was Mutter mir von ihm erzählt hatte. Meinte er die Perlen? Oder meinte er den Glanz? Oder gar die Bitterkeit?
Oder dachte er an das Leuchten der Farben? Ich lachte rau auf. Ja, meine Mutter hatte mir das Farbenmischen beigebracht. Ich kannte mich aus mit Farben! Wir hatten sie auf dem Markt oder an fahrende Händler verkauft. Doch für meine Mutter mussten die Farben noch eine tiefere Bedeutung haben. Sie erzählte mir nie, von wem sie all ihr Wissen hatte, und wenn ich sie fragte, antwortete sie nur geheimnisvoll: »Später, mein Schatz. Jetzt hör einfach nur zu: Vor dem Jaspisgrün flieht der Teufel. Das Malachitgrün schützt gegen böse Geister …« Der Stein wurde fein gerieben. Der Mörser stand auf dem Bord. Und wenn ich ihn zerstampft hatte, so gab ich das Pulver in einen Topf mit klarem Wasser und Eigelb und ließ es dann in Bröckchen wieder trocknen. Der Stein war schwer zu finden und glänzte schwarz und dunkel. Schreckstein nannten die Dörfler ihn. Doch mit dem Grün konnte man wunderbar das Wogen der Blätter malen, und gemischt mit Verdaccio wurden Gesichter lebendig. Verdaccio war ein wunderbarer Malgrund, um darauf die anderen Farben aufzubauen und zum Leuchten zu bringen. Das Lackrot kauften wir auf dem Markt im Nachbarort. Auch den Safran zur Herstellung von Ocker, aus dem ich mit sehr starker Lauge ein kräftiges Gelb herstellte. Doch wo war ich mit den Gedanken?
Die Spiegelscherbe zeigte meinen Lockenschopf, blond und wirr, so wie Mamas Schopf auch. Tagsüber versteckten wir ihn züchtig unter der Haube. Ich sah mein schmales, sommersprossiges Gesicht. Wie oft hatten mich die Dorfkinder wegen der Sommersprossen ausgelacht. »Hexenpunkte«, spotteten sie. Und jetzt sollte meine Mutter eine Hexe sein. Die Tränen kamen. Ich versuchte ein Lächeln, schob trotzig die Unterlippe vor.
Mit einem Ruck wischte ich alles beiseite. Das Bild. Wo war das Bild, von dem Mutter gesprochen hatte? Ich musste es finden.
Ich wühlte noch einmal in Mutters Truhe. Da entdeckte ich unter dem Deckel eine kaum sichtbar eingefasste Klappe. Merkwürdig, dass ich sie früher nie gesehen hatte. Vorsichtig versuchte ich, den Mechanismus zu öffnen, und heraus fielen ein Beutel mit Münzen, ein Buch und eine eingerollte Leinwand. Das musste es sein! Das Bild, von dem Mutter gesprochen hatte!
Das Buch war mehr ein Heft, und mit raschem Blick stellte ich fest, dass sich darin handschriftliche Notizen über Farben befanden und darüber, wie man sie mischt.
Sorgsam und mit zitternden Fingern entrollte ich die Leinwand. Auf das, was nun geschah, war ich nicht vorbereitet: Die Hitze des Feuers auf der linken Bildseite traf mich so unvermittelt, dass mir vor Schreck das Gemälde aus den Händen fiel. Wer hatte dieses glühende Gelb gemalt? Das Bild rollte sich langsam wieder ein, als wäre es erbost, dass ich es aus seinem Versteck geholt hatte. Mit klopfendem Herzen entrollte ich es wieder. Erneut umfingen mich Wärme und Licht. Doch jetzt hielt ich die Leinwand fest in den Händen, fast hatte ich das Gefühl, das Bild hielte mich in der Hand. Es zog mich in sich hinein, schien zu rufen, zu locken: Schau, Mara! Schau genau hin …!
Doch ich konnte nichts sehen, nur das helle Feuer und einen Vorhang. Ein schwerer, schwarzer Vorhang, der die rechte Bildseite bedeckte. Undurchdringlich schien er zu sein, und er bewegte sich leicht. Da! Da war noch etwas! Sosehr ich meine Augen auch anstrengte: Ich sah nur Schatten in der tiefen Schwärze. Ein drohendes Gesicht? Nein, ein trauriges Gesicht. Ein Kind daneben. Eine Frau? Ein breiter Rücken? Ja, der war ganz sicher zu erkennen. Wer war das? Ich bohrte meine Augen in das Bild, ging zum Fenster, um mehr Licht zu haben. Da schimmerte etwas durch eine obere Farbschicht, mehr konnte ich nicht erkennen.
Ich ließ die Leinwand sinken, rollte sie ein. Die Einsamkeit umfing mich wieder, und die Angst kam zurück.
Wer war meine Mutter wirklich? Jedenfalls keine Hexe? Hexen wurden gevierteilt, gefoltert, verbrannt. Verbrannt? War das das Feuer auf dem Bild?
Und was hatte Mutter mit diesem Gemälde zu tun? Warum hatte sie es mir nie gezeigt? Sie wusste so viel über Malerei, und auch wenn sie selbst nicht malte, liebte sie es, mir beim Malen über die Schulter zu sehen. Wenn wir Farben hergestellt hatten, wollte sie immer, dass ich sie ausprobierte …
Aber warum sollte ich mit diesem Gemälde nach Amsterdam gehen? Und wen dort aufsuchen? Eine kleine Signatur war unten rechts auf dem Bild zu sehen. Verschlungene Buchstaben. Doch sie sagten mir nichts.
Ich würde also nach Amsterdam gehen. Mutter hatte so oft und immer voll Bewunderung und Sehnsucht von »ihrer« Stadt gesprochen. Und ich wusste genau, ich musste fliehen. Wenn sie Mutter als Hexe verurteilten, würden sie auch mich holen, die Tochter der Hexe! Also musste ich verschwinden.
Aber erst musste ich wissen, was mit Mutter geschähe. Ich würde nach Isterberg schleichen. Doch bevor ich mich im Schatten der Dunkelheit ins Dorf schleichen könnte, müsste ich mich verstecken. Der Büttel und seine Männer würden sicher noch einmal wiederkommen. Früh am Morgen, wenn ich schliefe, um die Verwirrung und Wehrlosigkeit der Schlafenden auszunutzen …
Es gab im Fußboden eine kleine Luke. Zusammengerollt wie ein Igel würde ich hineinpassen. Mutter hatte manchmal giftige Arzneien darin versteckt, damit sie nicht versehentlich in falsche Hände gerieten. Die Luke war mit dem bloßen Auge kaum erkennbar. Nur winzige Einschnitte waren im Boden zu ahnen, wenn sie geschlossen war. Ich öffnete voll zitternder Ungewissheit die Lukenklappe und zwängte mich in die Luke hinein. Krachend fiel die Klappe über mir zu.
Zweites Kapitel
Ich hockte still in der dunklen Luke. Mein Schweigen war wie ein Gebet: »Gott, hilf mir«, murmelte ich und hielt Farbenbuch und Bild fest in meinen Armen. Und die Schwärze wäre bis in meine Seele gekrochen, wäre da nicht Mutters Stimme gewesen: Mara, hab keine Angst …
»Wir sind geborgener, als wir denken«, hatte Mutter häufig gesagt und eines ihrer stillen Gebete hinter verschlossenen Lippen geflüstert. Mutter war eine gottesfürchtige Frau. Sie brachte mir in ihrer schlichten Art bei, auf Gott zu vertrauen in jeder noch so irrwitzigen Situation. Er hielte uns alle in seiner sicheren Hand. Und kämpften auch Katholiken gegen Lutheraner, marodierten grausame Söldner in deren Auftrag durch Dörfer und Städte, so sagte sie schlicht: »Es ist Wahnsinn. Es ist für alle der gleiche Gott.«
Diesen tiefen Glauben und diese Hoffnung hatte sie mir eingepflanzt und mir aus ihrer kleinen Bibel, die sie als Schatz verwahrte, wunderbare Geschichten vorgelesen. Aber auch Lesen und Schreiben hatte sie mir damit beigebracht. Die Bibel hatten die Häscher mitgenommen, sie wie Dreck in den Sack gesteckt, aber die Hoffnung konnten sie mir nicht nehmen.
Und plötzlich drängten sich Sätze der Bibel in meinen Kopf. Stückwerk ist unser Erkennen. Das hatte Mama immer vorgelesen. Hatte sie mir deshalb das Gemälde auf der Leinwand nie gezeigt und erklärt? Hatte sie Angst vor dem Stückwerk, den winzigen Splittern unserer Erkenntnis? Ich starrte vor mich hin. Bestand das Leben aus Stücken und Splittern, die sich spitz in unsere Seelen bohrten und wehtaten und in denen man trotz allem fast gar nichts erkennen konnte? Ich weinte und war allein. Mutter konnte ich nicht mehr fragen.
Und wenn Mutter doch eine Hexe wäre? Ich sträubte mich dagegen, wollte diesen Gedanken nicht zulassen. Ich bekreuzigte mich und betete leise: »Jesus, Maria …« und drehte meine Locken über den Finger.
Vielleicht würde Mutter morgen schon wieder frei vor mir stehen – oder einfach so in die Hütte kommen und Mara rufen, und ich würde aus der Luke steigen und ihr um den Hals fallen. Ich träumte, hoffte und bangte. Hilfe würde ich im Dorf sicher nicht bekommen. Wir waren schon immer Außenseiter gewesen und lebten in dieser Hütte am Ortsrand, seit ich denken konnte. Freunde hatte ich immer nur für kurze Zeit. Bis die Eltern meinen Freunden verboten, sich mit mir abzugeben. Mit manchen traf ich mich danach noch heimlich. Aber die unweigerliche Tracht Prügel, die meine Freunde bekamen, wenn wir trotz Verbot zusammen erwischt wurden, beendete auch das.
Ich dachte in meiner Einsamkeit an die alte Sophia. Ihr hatte diese Hütte gehört. Sie war es gewesen, die Mutter im Wald hochschwanger und halbtot vor Erschöpfung gefunden hatte. Mutter trug das farbige Kleid der Huren, als Sophia sie fand. Aber Sophia wusste sofort: Diese Frau war keine Hure, wer immer sie in das Kleid gesteckt hatte. Mutter sah zerlumpt und schmutzig aus, ja. Aber sie war trotzdem wunderschön, ihr Gang aufrecht, ihre Zähne weiß und ihre Sprache nicht die der Huren.
Die alte Sophia war froh, jemanden bei sich zu haben. Als Kräuterfrau war sie eine Außenseiterin und – einsam. Sie brachte Mutter alles bei: das Wissen um Geburt und Tod, die Schmerzen der Liebe und ihre Freuden. Alles über Krankheit, Fieber und Wundbehandlung. Und Sophias Wissen fügte sich mit Mutters Kenntnissen zu einem wunderbaren Ganzen. Sophia hatte mir mehr über Mutter erzählt als Mutter selbst. Sie fand es nicht richtig, dass Mutter mir so viel verschwieg.
Als hätte sie den heutigen Tag erahnt, sagte sie immer: »Irgendwann holt es dich ein, Katrijn. Und dann ist niemand vorbereitet.«
Sophia starb, als ich acht war, und Mutter setzte Sophias Arbeit einfach fort. Jetzt betreute sie die Kranken und holte die Kinder auf die Welt. Doch irgendwann begann das Gerede. Da war der Apotheker des Dorfes. Er war neidisch und redete. Dann hatte der Nächste etwas gehört. Und obschon die Menschen im ganzen Land vor marodierenden Soldaten Angst hatten, die plünderten, töteten und Häuser in Brand steckten, ließen sie doch nicht ab von diesen kleinen Neidattacken.
Dabei hatten die Soldaten das Nachbardorf heimgesucht, die Menschen dort aufgespießt und verbluten lassen. Jeder hatte Angst. Plündernde und gierige Söldnerheere überzogen mit brutaler Gewalt viele Landstriche, und die Menschen konnten nur noch fliehen. Kaiserliche gegen Evangelische. Evangelische und Schweden gegen Kaiserliche. Dieser Krieg* begann schon vor meiner Geburt.
»Gibt es nicht schon genug Elend in der Welt?«, hatte meine Mutter gefragt, als sie mithalf, das Nachbardorf nach Lebenden abzusuchen. »Warum lassen die Menschen nicht ab von kleinlichem Neid und Missgunst?«
Dort war der große Krieg – hier der kleine.
»Lass die Leute reden«, sagte Mama, wenn Neid und Missgunst uns entgegenschlugen. Sie mischte weiter Salben, Kräuter, Farben und ging manchmal zum Markt im nächsten Dorf, um Farben, Pinsel und Salben zu kaufen und zu verkaufen. Sie ahnte nicht, wie schnell man sie der Hexerei bezichtigen würde. Oder ahnte sie es? Nein, dann hätte sie mir sicher mehr erzählt, wenigstens Vaters Namen. Und selbst wenn sie es geahnt hätte, wohin hätten wir denn gehen können?
Vor drei Tagen starb dann plötzlich die kleine Marie, die Tochter des größten Bauern unseres Dorfes. Mutter hatte ihr am Tag zuvor Medizin gemischt. Marie war schön gewesen wie ein Engel, und nur der Teufel oder Hexen konnten einem solchen Engel so etwas antun. Die Stimmung uns gegenüber schlug um, und schon standen sie vor unserer Tür und holten meine Mutter. Schließlich hatte es das ganze Dorf ja immer gewusst, dass mit uns etwas nicht stimmte.
Lärm riss mich aus meinen Gedanken. Jemand stapfte in die Hütte, noch einer, Fußtritte und unruhiges Scharren und Getrampel über mir. Ich zog den Kopf ein und lauschte, und mein Herz schlug so heftig, dass ich Angst hatte, sie könnten es hören. Schritte direkt über meinem Kopf.
»Wo ist das Balg?«, hörte ich.
»Wahrscheinlich vor lauter Angst geflohen«, antwortete eine andere Stimme. »Wir müssen noch mehr Beweise finden.« Sie durchsuchten die Hütte.
»Aber das Balg wäre auch ein guter Fang.« Sie stachen mit Schwertern in den Boden. Hoffentlich trafen sie mich nicht.
»Die Hexe hat kein Wort gesagt, selbst als sie ihr die Finger gebrochen haben«, lachte einer. »Morgen wird sie gestreckt, da singt jeder.« Spott schwang in der dunklen Stimme mit und Lust an Quälerei. Das war doch Heinrich, der alte Spökenkieker*, gerade der. Am liebsten hätte ich geschrien: Du Verräter! Doch ich musste schweigen. Ich lauschte, zitterte, rollte mich noch enger zusammen. Was taten die meiner Mutter an! Ich ertrug es nicht. Doch ich musste still bleiben. Ganz still. Kein Schluchzen, kein Schreien. Schwere Schritte direkt über mir. »Das Töchterchen muss schon geflohen sein, dabei wäre es ein nettes Täubchen gewesen …«
»Die Alte soll mit dem Teufel nächtliche Ritte gemacht und dazu kleine Kinder ausgekocht haben. Schau doch mal in all diese Töpfe und Tiegel.«
»Ja, da ist Fett drin. Riecht allerdings wie Gänseschmalz.«
»Das machen Hexen nur, um unsere Nasen zu täuschen«, sagte einer und lachte. »Fett ist das Elixier des Teufels und gut zum Fliegen. Wahrscheinlich ist das Töchterchen lange auf dem Besen davon.« Wieder raues und böses Gelächter.
Wie viele waren es? Drei? Vier? Auf jeden Fall waren es mehrere, denn vor lauter Getrappel über meinem Kopf konnte ich selbst mit spitzen Ohren nur Fetzen verstehen.
»Der Richter will ein Exempel statuieren und kurzen Prozess machen«, sagte jetzt einer. »Wenn die Hexe gesteht, wird sie morgen verbrannt. Und wenn sie nicht gesteht, findet morgen die Wasserprobe* hinten am Mühlbach statt, und sie wird einen Tag später verbrannt.«
Da lachte der Spökenkieker und rieb sich wahrscheinlich bei dem Gedanken die Hände.
»He, schaut mal her. Pinsel und Farben! Und Tiegel mit Farben und Kräutern.«
»Nimm mit, das ist alles Beweismaterial.«
Mir stockte das Herz.
»Ich verstehe nicht, dass der Herr Pfarrer sich für sie eingesetzt hat. Der behauptet, sie sei immer eine gute, gottesfürchtige Frau gewesen, die allen im Dorf geholfen hätte.«
»Wahrscheinlich hat sie den auch schon verhext!«, erwiderte einer.
»Dem haben sie aber schnell das Maul gestopft. Sie haben ihn einfach gefragt, ob er etwa glaube, dass Gott selbst dieses engelgleiche Kind aus dem Leben gerissen habe. Und diese Frage sollte er vor Marias Vater und Mutter beantworten und ihnen dabei in die Augen sehen. Natürlich musste er verneinen.«
»Eine kleine Frage, und schon fällt jede Verteidigung zusammen.«
»Sonst wäre er selbst dran gewesen. Schon manchen Pfarrer hat es ereilt.«
Die Stimmen wurden dünner. Sie entfernten sich wohl. Ich blieb starr vor Schreck, starr vor Entsetzen. Sie quälten meine Mutter, folterten und schlugen sie! Mutter würde brennen. Meine Mama. Ich schluckte die Tränen. Ich weinte leise, bis ich keine Tränen mehr hatte. Dann merkte ich, wie still es auf einmal war. So still und schwer.
Als ich vorsichtig aus der Luke kroch, stand ich in einem völlig verwüsteten Raum. Decken, Felle, Töpfe und Tiegel lagen zerstochen oder zerbrochen am Boden. Vorhang und Laken waren abgerissen, Tisch und Bank umgeworfen, Regale von der Wand gerissen.
Im Schutz der Morgendämmerung schlich ich ins Dorf.
Doch schon am Dorfanger blieb ich vor Schreck stehen. Sie hatten auf dem äußeren Dorfplatz einen Pfahl aufgerichtet und schichteten rundherum Brennholz auf. Mit welchem Eifer sie dabei waren! Da geiferten die Mäuler, da flogen hässliche Worte, da wagte man übelste Beschimpfungen.
»Hier, nimm das trockene Reisig, das brennt wie Zunder«, rief einer und rieb sich die Hände.
»Die Hexe wird um Erbarmen schreien.« War das nicht die Stimme des alten Adolf, der noch vor zwei Tagen krumm zu unserer Hütte geschlichen und von Mutter eingerenkt und gesalbt worden war?
Für mich war hier kein Platz mehr. Oder es war nie mein Platz gewesen. Ich schlich zurück zur Hütte, schnürte mein Bündel, nahm die Münzen aus der Truhe, band mir Bild und Farbenbuch unter mein Kleid, nahm Brot und Käse und floh in den Wald am Dorfrand. Dort wollte ich in einem Baum versteckt abwarten, was geschehen würde. Ob sie am nächsten oder übernächsten Morgen meine Mutter als Hexe verbrennen würden – oder ob ein Wunder geschah, das sie retten würde.
Drittes Kapitel
In der Frühe des nächsten Tages versammelten sich die Menschen auf dem äußeren Dorfplatz. Ich saß in »meinem« Baum, einer alten Eiche. Vor langer Zeit schon hatte ich mir dort Bretter in den Zweigen eingerichtet. Das war mein Versteck. Nun hockte ich dort, geschützt von Zweigen und Blattwerk, und konnte doch alles beobachten. Auch wenn ich es kaum ertragen konnte, wollte ich bei Mutter sein – egal was nun geschehen würde.
Meine Angst und meine Trauer waren unter der Wucht der Schrecklichkeiten erstarrt und versteinert. Es war, als wollten sie erst langsam herankriechen, um mich später dann umso mehr zu packen.
»Ruhig«, flüsterte ich. Im Augenblick war ich nur Beobachterin, sonst hätte der Schmerz mich zerrissen, als sie meine Mutter auf einem Eselskarren unter den Rufen einer brodelnden Menge herbeischafften. Ihr wunderschönes Gesicht – blutig geschlagen. Ihre Augen weit und schreckensstarr. Und doch suchend. Sie suchte mich! Hier bin ich!, wollte ich rufen, doch ich schwieg es in mich hinein. Ob sie froh war, mich nicht zu sehen? Sie wusste ja von der Gefahr auch für mich.
Ich schaute wieder hin: ihre zarten geschickten Hände – voller Blut und verstümmelt. Der schmale Körper – geschunden, ein Fleischklumpen, den sie jetzt zum Scheiterhaufen zerrten, wo Priester und Henker warteten, der eine mit gebeugtem Haupt, der andere fast begierig triumphierend. Das Urteil – so deutete ich diese Gesten – war also schon gefallen. Die Schaulustigen drängten, ihre Augen glänzten und geiferten vor Begeisterung. Hier die Guten, da die Bösen! So gefiel es ihnen. Und jeder, der neu hinzukam, wurde hineingezogen in diesen mörderischen Sog, der sich am Schmerz des andern ergötzte.
Der Richter sprach. Er forderte die Menschen auf, wachsam zu sein, sich der Fäulnis des Bösen, dem Verrat und dem Atem der Hölle, egal ob Teufel oder Hexe, entgegenzustellen. Der Pöbel klatschte, als könne er durch diesen Anblick alles Schlechte von sich fernhalten und für immer ausmerzen.
Da trat der Priester vor, der alte Pfarrer Johannes. Er flüsterte meiner Mutter etwas zu und plötzlich umarmte er sie und hielt sie – jetzt schluchzend – im Arm. Allen stockte der Atem. Nun weinte auch ich, weinte mit den beiden. Lautlos liefen die Tränen über mein Gesicht. Der alte Johannes hatte die Mauer in mir eingerissen, die mich bisher vor der Übermacht der Tränen geschützt hatte. Der Henker zog meine Mutter grob an sich, fort aus Johannes’ Armen. Fackelträger beleuchteten die Szene, denn der Morgen war noch grau. Der Triumph über das Böse sollte wie ein Fest begangen werden.
Der Henker schleifte meine Mutter an den Pfahl und fesselte sie daran. Ich sah all das nur durch einen Tränenschleier. Fern von mir geschah es: Sie verbrannten meine Mutter. Und doch war alles so nah! Das Feuer und der letzte Schrei, der sich in die Luft pflanzte und das schmutzige Licht dieses Morgens wie ein Blitz zerteilte.
Still für mich schwor ich Mutter in dieser letzten Stunde, dass ich tun würde, was sie mich geheißen hatte: aufbrechen nach Amsterdam! Eine dunkle Ahnung stieg in mir hoch, ein Rätsel, das weit, weit entfernt auf mich wartete, in dessen Mitte das Gemälde stand, vielleicht auch das Farbenbuch, vielleicht sogar mein Vater. Ich zog die Leinwand unter meinem Kleid hervor, und fast wäre ich vom Baum in die Tiefe gestürzt: Das Bild hatte sich verändert, und wieder nahmen mir die Helligkeit und das Licht den Atem. Ganz deutlich war nun eine Frau zu sehen, die in den Flammen den Tod fand. Sie stand aufrecht, und ihre schönen sanften Augen zeigten keine Angst, sondern sahen mich direkt an und schienen zu lächeln. Frieden war in ihnen, und dieses friedliche Gefühl durchströmte jetzt auch mich. Der schwere Vorhang bewegte sich und auch der breite Rücken.
Viertes Kapitel
»Bei Tagesanbruch musst du mit der Sonne im Rücken laufen. Am Mittag wärmt sie deine linke Seite, und gegen Abend läufst du ihr entgegen. Immer nach Westen – da ist Amsterdam.«
»Und nachts?«, hatte ich gefragt.
Mutter hatte gelacht: »Nachts ist die Zeit der Wölfe und Räuber. Nachts ist es in den Wäldern gefährlich. Da muss man an einem sicheren Ort sein.«
Wenn Mutter so sprach, hörte ich ihre Sehnsucht, als wäre sie diesen Weg in Gedanken schon tausendmal gegangen. Und doch hätte sie nie wieder dorthin zurückkehren können. Amsterdam war, aus einem mir unbekannten Grund, für sie eine verbotene Stadt. Etwas Schreckliches musste dort geschehen sein, und je mehr ich darüber nachdachte, umso sicherer wurde ich: Das Bild auf der Leinwand war der Schlüssel zu ihrer Vergangenheit und damit vielleicht die einzige Spur zu meinem Vater.
Außerdem hatte ich überhaupt keine Wahl. Ich musste Isterberg, den einzigen Ort, den ich in meinem Leben bisher gesehen hatte, verlassen, oder sie würden auch mich holen. Ich kletterte aus dem Baum, schlug den Vlieger*, einen alten Mantel meiner Mutter, eng um mich, denn noch war der Aprilmorgen kühl und feucht. Bild und Buch waren unter meinem Kleid sicher und trocken aufbewahrt. In meinem Beutel trug ich die Münzen aus der Truhe und alles Essbare, was ich in der Hütte hatte finden können: Brot, Käse, getrocknetes Fleisch und einen Schlauch mit Wasser. Alles andere hatte ich zurückgelassen, denn es war mir nach dem Tod meiner Mutter nicht mehr wichtig.
Ich betrachtete die Baumreihen, die den Waldrand begrenzten. Die Wälder waren gefährlich. Wölfe, wilde Eber, Räuber, marodierende Banden, ohne Sold entlassene Soldaten, plündernde Heere, die sich auch noch das Letzte holen würden. Wie viele Tagesmärsche wären es bis Amsterdam? Zehn? Zwanzig? Und was, wenn ich nichts mehr zu essen hatte? Von der Jagd hatte ich keine Ahnung!
Auf der anderen Seite von Isterberg waren die Wälder dicht und ausgedehnt, das bedeutete Schutz vor möglichen Verfolgern. Und die waren im Moment die größere Bedrohung für mich. Gespenstisch starrte der Wald mir entgegen.
Ein letzter Blick zurück: Eine zweite schwarze Rauchsäule verdunkelte den Himmel. Sie leisteten ganze Arbeit und hatten unser Zuhause angezündet. Hütte, Kräutergarten, alles brannten sie nieder. Nichts sollte mehr von uns übrig bleiben.
Ein warmer morgendlicher Sonnenstrahl traf meinen Rücken, und als wäre das mein Zeichen, lief ich los. Ich überschritt die Grenze unseres Dorfes, stolperte über Baumwurzeln, stieg durch unwegsames Unterholz, vermied ausgetretene Wege. Die dichten Zweige schlugen mir ins Gesicht, Büsche krallten sich in meinen Mantel und hielten mich fest. Doch ich riss mich los und lief und lief. Rehe schreckten auf, Hasen und Kaninchen schlugen Haken. Wie schnell sie waren im Gegensatz zu mir. Eine Weile folgte ich einem schmalen Wildbach, dessen klares Wasser sich vorbei an glitschigen Steinen und abgebrochenen Ästen seinen Weg suchte. Waren vier Stunden vergangen? Oder fünf? Ich wusste es nicht. Die Sonne stand mittlerweile links von mir. Stimmte die Richtung noch?
Gegen Mittag erreichte ich eine kleine Lichtung, sonnendurchflutet inmitten der dunklen, uralten Bäume. Eine kleine Oase, übersät mit den ersten Frühlingsblumen. Doch ich hatte kein Auge für diese Schönheit, hockte mich lieber wieder in eine Baumkrone, aß Brot und Käse. Gerade genug, um meinen knurrenden Magen zu beruhigen. Als wollte ich Gewissheit, dass ich das Richtige tat, entrollte ich in der Baumkrone von neuem das Bild. Der Blick in die sanften Augen genügte, und doch durchlief mich ein Zittern: Der Vorhang schien sich für einen Augenblick öffnen zu wollen. »Ein Gesicht! Bitte zeig mir ein Gesicht!«, flehte ich. Doch dieses Bild ließ sich nicht erweichen – der Vorhang schloss sich vor meinen Augen! Ich begann mit mir selbst zu schimpfen: »Du fängst ja langsam an zu spinnen. Das ist doch alles Unsinn. Kaum findest du eine Leinwand, schon deutest du Unmögliches hinein. Das hier ist ein Bild. Nicht mehr und nicht weniger. Basta!« Für die Dinge, die auf dem Gemälde passierten, musste es einen logischen Grund geben, alles andere war doch Unfug!
Ich rollte die Leinwand wieder ein und band sie unter mein Kleid. Gerade wollte ich aufbrechen, da hörte ich plötzlich Stimmen. Ich lugte von oben aus dem Schutz der dichtbelaubten Baumkrone, konnte aber niemanden entdecken. Wieder Stimmen, und nun erkannte ich sie. Es waren die Männer, die meine Mutter geholt hatten. Nie würde ich diese Stimmen vergessen können. Sie suchten mich also tatsächlich noch! Ich drehte vor Aufregung an meinen Locken. Genügte ihnen eine Tote denn nicht?
Fünftes Kapitel
Die Männer verschwanden bald, aber ich wollte lieber noch warten. Das Warten ließ mich ruhiger werden, und ich nutzte die Zeit, um in dem Farbenbuch zu blättern. Ich entdeckte vertraute Farbrezepturen, aber auch unbekannte.
Das Buch war sehr sorgfältig angelegt, alle Farbproben beschriftet, der Text in gleichmäßiger Schrift auf schwerem Papier verteilt. War das Mutters Schrift? Nein, der Bogen des M war anders. Auch das große F oder das K erkannte ich nicht wieder. Nein, das war ganz sicher nicht ihre Schrift. Ich wollte das Buch schon schließen, da entdeckte ich vorne einen winzigen Schriftzug: Für Katrijn. Ich starrte ungläubig darauf. Das Farbenbuch war für meine Mutter. Warum hatte sie es mir nie gezeigt, und warum hatte sie die Rezepte nie genutzt? Oder hatte sie sie im Kopf oder gar nachts, wenn ich schlief, darin gelesen? Nein. Wir hatten so oft Farben hergestellt, aber diese Rezepte waren es nicht gewesen. Für Katrijn. Ich starrte auf die Widmung. Von wem war dieser Schriftzug? Ich blätterte weiter und las über die Farben Gold und Silber, Anleitungen, die ich noch nie gehört hatte. So hieß es:
Auf welche Weise man Gold und Silber vermahlt und wie man Tempera zu Kräutern und Ornamenten macht, wie man Verdeterra firnissen kann: Wenn du auf der Tafel oder auf Papier oder auf der Wand oder wo du willst mit Gold arbeiten willst, nur nicht ganze Flächen gleich einem Goldgrund; oder wenn du irgendeinen Baum machen willst, dass er den Bäumen im Paradiese gleich sehen soll, so nimm Stücke feines Gold, in entsprechender Menge je nach deiner Arbeit, die du machen willst, oder wie wenn du damit schreiben wolltest, nämlich zehn oder zwanzig Stück. Lege sie auf den Porphyrstein, und vermahle das Gold tüchtig mit wohlgerührter Eikläre und gib es dann in ein glasirtes Gefäß. Mische so viel bei, dass es flüssig von der Feder oder vom Pinsel laufe, und so kannst du damit jegliche Arbeit ausführen, die du willst. Du kannst es ferner auf Papier auch noch mit Arabischem Gummi vermahlen. Und wenn du Baumblätter machst, so mische zu diesem Golde ein wenig Grün, sehr fein gerieben, für das dunkle Laub. Und durch Mischungen mit anderen Farben kannst du sie nach deinem Geschmacke schillernd machen. Auf solche Weise wird geriebenes Gold, Silber oder halbechtes Gold gemacht, du kannst damit auch noch Gewänder nach antiker Weise flaumig machen und gewisse Ornamente bilden, welche bei den Andern nicht stark in Gebrauch sind und dir Ehre bereiten. Aber obgleich ich dir das zeige, musst du durch eigene Begabung bei der Anwendung und Ausführung Geschmack dreinzulegen wissen.
C. Cennini
Der Name Cennini* kam mir bekannt vor. Mutter hatte ihn oft erwähnt. Sie hatte mir erklärt, er habe die Malerei der Italiener stark geprägt. Cennini war der Maler, den man in eine Gefängniszelle gesteckt hatte, damit er endlich das Geheimnis seiner Farben zu Papier brächte. Also waren die Menschen überall grausam. Wie gerne hätte ich jetzt mit meiner Mutter darüber gesprochen …
Und dann, als hätte sie mir eine Locke aus der Stirn gestrichen, fühlte ich sie auf einmal ganz nah bei mir. Meine Mutter. Sie wanderte an meinen Armen entlang, berührte meine Ohrmuscheln, tupfte meine Augenlider, strich mir zart über die Lippen. Mama. Sie wollte sich verabschieden und drückte sich dabei an mich. Und ich musste sie loslassen, durfte sie nicht umklammern und festhalten. Es war Sünde, Tote festhalten zu wollen. Man durfte sie nicht am Gehen hindern. Ich zerrte an meinem Haar, zog an meinen Kleidern. Sie war fort. Sie war gegangen, und mein eigener schneller Atem passte sich unmerklich dem Rhythmus ihrer schon fernen, fast nur noch geahnten Schritte an. Jetzt war ich ganz allein. Mein Kopf zwischen den Ästen, die wie stachelige Borsten waren.
Doch bald hob ich den Kopf, musste weiter. Ich wollte schon vom Baum springen. Nein, besser am Abend, da wäre ich vor Verfolgern sicherer.
Als ich gegen Abend hinabstieg, stand die Sonne im Westen, und das war meine Richtung. Ich müsste ihr genau entgegenlaufen. Der Gedanke beruhigte mich. Ich hatte mir vorgenommen, jetzt immer am Abend zu laufen, um mir dann am frühen Morgen einen Schlafplatz zu suchen. Während ich lief, wurde der Wald stiller. Das Vogelgezwitscher verstummte. Die Dämmerung fiel auf mich herab. Der Wind hatte sich gelegt und die einzigen Geräusche waren meine Schritte im Unterholz, zersplitternde Zweige, raschelndes Laub. Langsam tröpfelte die Einsamkeit in mich ein.
Ich lief und lief und verlor immer mehr das Maß der Zeit, lief in die Nächte hinein, rollte mich am Tag in Blätterlagen, kletterte wie ein Wiesel in Baumkronen, schlich um die wenigen Dörfer in weitem Bogen herum, bis schließlich Regen einsetzte, der mich langsam bis auf die Knochen durchnässte. Ich spürte das Bild auf der Haut. Alles klebte an mir. Ich musste das Bild retten. Ebenso das Farbenbuch und – mich.
Und dann sah ich es: den Widerschein eines Feuers, Licht, Wärme, und ich hörte Stimmen. Dann waren sie auf einmal still, doch kurz darauf wildes Gelächter. In meiner Angst, entdeckt zu werden, sprang ich sofort in ein Gebüsch und blieb dort, mucksmäuschenstill. Ich wartete, bis nur noch die Geräusche des Waldes an mein Ohr drangen. Dann kroch ich näher an das Feuer heran. Es wirkte so einladend, so verlockend! Wie sehr sehnte ich mich nach seiner Wärme, nach menschlichen Stimmen.
Doch ich durfte jetzt nicht unvorsichtig werden. Auch wenn ich nicht glaubte, dass diese Menschen hier noch auf der Suche nach mir waren, konnten es doch gefährliche Räuber oder Soldaten sein. Aus meinem Versteck heraus wollte ich alles erst mal näher anschauen.
Eine Höhle bot den Männern Schutz vor Regen und Kälte. Ich zählte die Pferde, die rechts auf einer kleinen Lichtung grasten. Fünfzehn Pferde, also fünfzehn Männer? Vor der Höhle brannte ein Feuer, und drei Männer schienen Wache zu halten, während die anderen schliefen. Zwei der Männer waren derb und dreckig, mit Augenklappe und Narben im Gesicht. Im unwirklichen Feuerschein sahen sie gefährlich und grob aus. Schmutzige Witze und gehässiges Lachen kamen über ihre Lippen. Doch es war der dritte Mann, dessen Anblick mich fesselte. Seine Augen schienen groß und verträumt, seine Locken umrahmten ein ebenmäßiges, durch keine Narbe entstelltes Gesicht. Über seine Lippen kamen keine schmutzigen Worte und sein Lachen war eher in sich gekehrt. Seine Haare schimmerten im Schein des Feuers golden. Nun stand er auf und verschwand aus meinem Blickfeld.
Aufwachen! Aufwachen! Gefahr! Obschon ich fror und nass war bis auf die Knochen, musste ich hier weg. Ich hatte genug gesehen, diese fünfzehn Männer waren keine gute Gesellschaft für mich, und wenn sie mich packten, dann gnade mir Gott! Langsam schob ich mich rückwärts zurück in das Dunkel des Waldes. Meine kalten, steifen Gliedmaßen wollten kaum noch gehorchen und sehnten sich nach einem trockenen Unterschlupf für die Nacht.
Zu spät! In dem Augenblick wurde ich von hinten gepackt, es gab keine Möglichkeit zu entkommen. Es war der mit den Locken, der mit den großen Augen, und er hielt mich sehr grob fest. Während ich mich nach der Wärme des Feuers gesehnt hatte, musste er mich entdeckt haben. Noch hielt er seine Hand in meinem Nacken. Doch als er mich näher ansah, lockerte sich sein Griff. Ein Mädchen!, schien sein erstaunter Blick zu sagen. Den zwei anderen, die nach seinem Pfiff näher gekommen waren, schien ich eine willkommene Abwechslung zu sein, und sie lachten über meine schwache Gegenwehr, mein Kratzen und Beißen. Wovon hatte ich eigentlich geträumt? Dass ich es schaffen könnte, Amsterdam zu erreichen?
Ein erbarmungsloser Griff hielt jetzt meine Hände auf dem Rücken zusammen, band sie mit einem derben Strick, der in die Gelenke einschnitt. Mit einem stinkenden Tuch wurden mir die Augen verbunden. Jemand packte mich an den Haaren, schleifte mich an einen trockenen Ort. Wenigstens das. Es war so dunkel, dass ich vor Angst schrie. Sie warfen mich zu Boden und banden mich zu allem Überfluss an einem Balken fest – wie ein Stück Vieh. Wenn sie wenigstens den Strick an meinen Händen gelöst hätten! Wenn ich wenigstens hätte sehen können, wo ich gefangen war!
Ich wartete und wartete. Doch es blieb dunkel. Und in die Ritzen dieser Dunkelheit drängte sich der Ärger über mich selbst. Was war ich für ein dummes Huhn. Warum hatte ich mich von Licht und Wärme locken lassen! Und während ich noch einmal vor Ärger über mich selbst schnaubte – ich war denen ja fast freiwillig in die Arme gelaufen! –, drängten sich Mutters Worte in meinen Kopf: Mara, hab keine Angst. Aber ich hatte Angst! Verflixte Angst!
Ich weinte, die Zeit schmolz zu einem Punkt. Und während sich die Stille wie ein schützender Mantel langsam um mich legte, kamen plötzlich Bilder. Nein, ich konnte mich nicht mehr gegen sie wehren. Bilder, die ich zuvor bei Flucht und Angst nicht hatte aufkommen lassen. Bilder von einem Feuer, von einem Pfahl, an dem eine Frau hing. Bilder von meiner Mutter, die sich in Schmerzen wand und aufschrie.
Ich musste hinschauen, jetzt in der unbarmherzigen Dunkelheit war alles da. Ein lichterloh brennendes Feuer, die vor Angst weit aufgerissenen dunklen Augen, die Schreie in Verlassenheit und grellem Schmerz. Das waren nicht die sanften Augen von der Leinwand. Diese Bilder brannten sich für immer in meinen Kopf.
»Mutter!« Ich wollte alles wegschieben. »Mutter!«, schrie ich in das Dunkel hinein. »Mutter, du musst mir helfen!«
Welch irrwitzige Bitte! Mein Kopf zersprang wie im Fieber, ich konnte brennende Haare riechen. Und dann rückte alles wieder weg von mir. Tage und Nächte krochen langsam zwischen Mutter und mich. Und doch schrie ich um Hilfe. Aber wie sollte sie helfen? Ein Wunsch außerhalb jeder Wirklichkeit, und doch gab mir dieser lang gezogene Hilfeschrei ein winziges Stück meiner Zuversicht zurück. Als hätten ihr Schrei und mein Schrei sich ineinander verwoben und als könnte mein Schmerz damit besiegt werden. Ich fühlte eine tiefe Verbundenheit mit meiner Mutter. Sie gab mir Kraft – und half mir. Ich setzte mich auf und lauschte den letzten Worten nach, die sie an mich gerichtet hatte. Ja, ich würde es schaffen! Ich würde tun, was sie mir aufgetragen hatte, und nach Amsterdam gehen. Ich rief weiter nach ihr, als könnte ich dadurch die Verbundenheit mit ihr für immer besiegeln.




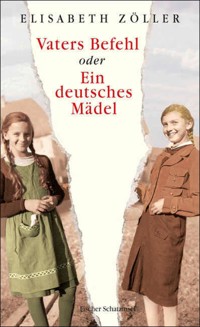














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









