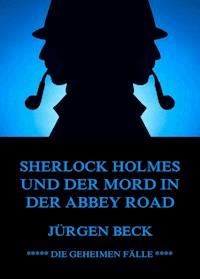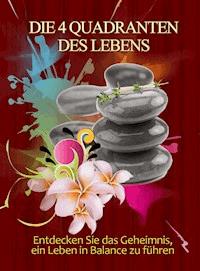Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Viele Generationen nach uns hat die Menschheit den einzigen Planeten zerstört, der ihr als Lebensraum dient. Eine Naturkatastrophe, deren Entstehung und Verlauf noch nicht einmal den wenigen übrig gebliebenen Gelehrten gänzlich bekannt ist, hat nicht nur für Zerstörung gesorgt, sondern auch dafür, dass sich die Natur die Fläche zurückerobern konnte, die der Mensch ihr genommen hat. Riesige Wälder sind entstanden, domestizierte Tiere haben sich mit den wilden Artgenossen gepaart und neue Rassen geschaffen und der Rest des Menschheit hat einen Rückfall in die Barbarei erlebt. In Norddeutschland hat sich ein riesiger See gebildet, der von der Elbmündung bis an den Fläming reicht. In der Entstehung des Sees ist Hamburg untergegangen und dank der dort verbliebenen industriellen Überbleibsel nur noch ein giftiger, stinkender und gefährlicher Sumpf. Den See nutzen nord- und osteuropäische Völker, um die dort entstandenen Siedlungen zu plündern und brandzuschatzen. In dieser Welt lebt Felix von Aschenbach, der im Gegensatz zu seinem Bruder Oliver kein Krieger, sondern ein belesener und erfinderischer Feingeist ist. Er hat keinen Rang unter seinesgleichen, will aber seine Angebetete Aurora von Theissenberg für sich gewinnen und beschließt, sie mit einer Reise um den See zu beeindrucken. Mit seinem selbstgebauten Kanu sticht er in See und begibt sich damit nicht nur auf eine Reise in unbekannte Gefahren, sondern es eröffnen sich ihm auch vollkommen neue Welten. Reisen Sie mit Felix und werden Sie Teil seiner unglaublichen Erlebnisse ....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DER SEE
JÜRGEN BECK
nach einer Geschichte von Thomas Jefferies
Gewidmet der Menschheit, die im Jahr 2019 dabei ist, den einzigen Planeten zu zerstören, den sie als Lebensraum hat.
Der See, J. Beck
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849653675
www.jazzybee-verlag.de
Inhalt:
TEIL I.1
KAPITEL 1. Der große Wald. 2
KAPITEL 2. Wilde Tiere. 10
KAPITEL 3. Waldmenschen. 14
KAPITEL 4. Eindringlinge. 23
KAPITEL 5. Der See. 31
TEIL II39
KAPITEL 1. Herr Felix. 40
KAPITEL 2. Das Haus derer von Aschenbach. 46
KAPITEL 3. Die Einpfählung. 53
KAPITEL 4. Das Kanu. 59
KAPITEL 5. Baron von Aschenbach. 66
KAPITEL 6. Der Waldpfad. 72
KAPITEL 7. Weiter auf dem Waldpfad. 79
KAPITEL 8. Burg von Theissenberg. 84
KAPITEL 9. Aberglaube. 91
KAPITEL 10. Das Fest97
KAPITEL 11. Aurora. 102
KAPITEL 12. Nacht in den Wäldern. 106
KAPITEL 13. Abschied. 112
KAPITEL 14. Die Straße der weißen Pferde. 118
KAPITEL 15. Die Reise geht weiter123
KAPITEL 16. Die Stadt129
KAPITEL 17. Das Lager135
KAPITEL 18. Das Gefolge des Königs. 142
KAPITEL 19. Die Kämpfe. 147
KAPITEL 20. In Gefahr153
KAPITEL 21. Unterwegs. 160
KAPITEL 22. Entdeckungen. 167
KAPITEL 23. Seltsame Dinge. 173
KAPITEL 24. Feuerdämpfe. 178
KAPITEL 25. Die Schafhirten. 184
KAPITEL 24. Pfeil und Bogen. 191
KAPITEL 27. Überrascht196
KAPITEL 28. Für Aurora. 202
EPILOG... 208
TEIL I.
DER RÜCKFALL IN DIE BARBAREI
KAPITEL 1. Der große Wald
Die alten Männer erzählen oft davon, wie ihnen ihre Väter von der ersten Veränderung berichteten, die sichtbar wurde, kurz nachdem die Felder sich selbst überlassen worden waren. Im ersten Frühjahr, nach dem Untergang Hamburgs, wurde es überall grün, so dass das Land einheitlich gleich aussah.
Die Wiesen waren grün, ebenso wie der wachsende Weizen, der ausgesät worden war, aber weder weitere Pflege erfahren hatte, noch diese jemals erhalten würde. Ackerflächen, auf denen die letzten Stoppeln umgepflügt, aber kein Saatgut ausgebracht worden war, wurden von der Quecke überwuchert, und dort, wo die kurzen Stoppeln noch standen, bedeckte das Unkraut sie. Es gab keinen Ort, der nicht mehr oder weniger grün war; die Wege waren die grünsten von allen, denn so ist nun mal die Natur des Grases, wenn es einmal irgendwo angewachsen war; und nach und nach, als der Sommer kam, waren alle ehemaligen Straßen dünn mit dem Gras bedeckt, das sich vom Rand her ausgebreitet hatte.
Im Herbst, als die Wiesen nicht gemäht wurden, verwelkte das hohe Gras, und die Halme legten sich in die Richtung, in die der Wind gerade blies; die Samen fielen, die Nelkenwurze wurden grau-weiß, oder, wo der Ampfer und der Sauerklee wuchsen, bräunlich-rot. Der Weizen, nachdem er reif und niemand da war, der ihn ernten konnte, blieb ebenfalls stehen und wurde von Unmengen von Sperlingen, Saatkrähen und Tauben gefressen, die sich ungestört über ihn hermachten und nach Belieben speisten. Als der Winter anbrach, wurde das Getreide von den Stürmen umgeknickt, von Regen durchtränkt und von Tierherden niedergetrampelt.
Im nächsten Sommer wurde das Stroh des Vorjahres durch den jungen, grünen Weizen und die Gerste verdeckt, die aus den Saatkörnern entstanden waren, die die Ähren fallen gelassen hatten; ebenso durch Unmengen von Ampfer, Disteln, Wiesen-Margeriten und ähnlichen Pflanzen. Diese verfilzte Masse wuchs durch das gebleichte Stroh hindurch. Auch der Ackersenf versteckte die verrottenden Wurzeln auf den Feldern unter einem Meer leuchtend gelber Blüten. Das junge Frühlingswiesengras konnte sich kaum durch das lange tote Gras und die Nelkenwurze des Vorjahres nach oben schieben, während Ampfer, Disteln, Sauerklee, Wildkarotten und Brennnesseln solche Schwierigkeiten nicht hatten.
Im zweiten Jahr waren auch die Wege ganz verschwunden; Straßen konnte man noch erkennen, wenn sie auch so grün waren wie der Rasen, und auf ihnen konnte man immer noch am besten vorwärtskommen In dem miteinander verwobenen Weizen und Unkraut, sowie dem langen Gras auf den Wiesen, verfingen sich die Füße derer, die versuchten, hindurch zu gehen. Jahr für Jahr behaupteten die ursprünglichen Saaten von Weizen, Gerste, Hafer und Bohnen ihre Präsenz und schossen hoch, wenn auch mit allmählich abnehmender Kraft, da sich Brennnesseln und gröbere Pflanzen, wie wilde Pastinaken, aus den Gräben auf die Felder ausbreiteten und sie erstickten.
Wassergräser aus den Furchen und kleineren Bachläufen erstreckten sich auf die Wiesen und schafften es in Verbindung mit den Binsen, die Kräuter zu zerstören oder zu ersetzen. Unterdessen hatten die Brombeersträucher, die sehr schnell wuchsen, ihre stacheligen Ausläufer immer weiter aus den Hecken herausgeschoben, bis sie nun zehn oder fünfzehn Meter Länge erreicht hatten. Die Dornsträucher taten es ihnen gleich, und die Hecken wuchsen auf das Dreifache oder Vierfache ihrer ursprünglichen Breite an, womit sie die Felder entsprechend einengten. Selbst auf den größten Feldern trafen sich im Laufe von zwanzig Jahren diese Brombeer- und Dornsträucher, die von allen Seiten in die Mitte wuchsen.
Unter ihnen sprangen Weißdornsträucher auf, durch die Dornen geschützt vor grasenden Tieren, und die Schösslinge der Ulmen blühten auf. Eschen, Eichen, Bergahorn und Rosskastanien erhoben ihre Köpfe. Früher hätten die Rinder die Jungpflanzen mit dem Gras gefressen, sobald diese dem Boden entwachsen waren, aber jetzt schlugen die meisten Eicheln, die von Vögeln fallen gelassen wurden, und die Sämlinge, die der Wind her geweht hatte, Wurzeln und wurden zu Bäumen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Dornen und Brombeeren auch die ehemaligen Straßen, die so unpassierbar waren wie die Felder, verstopft und blockiert.
Es waren keine Felder mehr übrig, denn wo der Boden trocken war, füllten die bereits erwähnten Brombeeren, Dornsträucher und Schösslinge den Raum, und dieses Dickicht und die jungen Bäume hatten den größten Teil des Landes in einen riesigen Wald verwandelt. Wo der Boden von Natur aus feucht und die Abflüsse mit Weidenwurzeln verstopft waren, die aussahen wie ein Fuchsschwanz, wenn sie in Kanälen eingeengt wurden, bedeckten ihn Seggen, Schwertlilien und Binsen. Auch Dornsträucher wuchsen dort, aber bei Weitem nicht so hoch; sie waren mit Flechten bedeckt. Neben den Lilien und dem Schilf erhoben sich Unmengen von Herkulesstauden, die fast zwei Meter hoch wurden, und das Weidenkraut mit seinem kräftigen Stiel, fast so holzig wie ein Strauch, füllte jede Lücke aus.
Im dreißigsten Jahr gab es keinen einzigen offenen Ort mehr, die Hügel ausgenommen, wo ein Mensch gehen konnte – es sei denn, er folgte den Spuren wilder Kreaturen oder bahnte sich einen Weg. Die Gräben waren schon längst voll mit Blättern und toten Ästen, so dass das Wasser, das durch sie abfließen sollte, stehenblieb und sich bald in die Hohlräume und über die Ecken der vormaligen Felder ausbreitete und Sumpfgebiete bildete, in denen die Schachtelhalme, Binsen und Seggen das Wasser bedeckten.
Da sich niemand um die Bäche kümmerte, verrotteten die Wehre allmählich, und die kräftigen Winterregen schwemmten die schwachen Hölzer weg und überschwemmten die umliegenden Flächen, die zu Sümpfen größeren Ausmaßes wurden. Die Dämme wurden von Wasserratten unterhöhlt, und die durchströmenden Bäche vergrößerten langsam die Größe dieser Tunnels, bis die Struktur aufplatzte, die Strömung weiterfloss und die Überschwemmungen nur noch größer machte. Die mächtigeren Bauwerke in den Flüssen standen etwas länger, aber als die Teiche verschlammten, floss der Strom um sie herum und sogar durch die Bauwerke hindurch, die nach und nach verrotteten und in einigen Fällen unterspült wurden, bis sie einstürzten.
Überall waren die an die Bäche und Flüsse angrenzenden, tieferen Landstriche zu Sümpfen geworden, von denen sich einige kilometerweit in gewundener Linie erstreckten und sich gelegentlich bis zu zwei Kilometern Breite ausweiteten. Dies war insbesondere der Fall, wo kleinere Bäche und Flüsse sich in die Ströme ergossen, deren Lauf ebenfalls blockiert und versperrt wurde, und die überquellenden Ströme das Land bedeckten; denn die einströmenden Flüsse führten Bäume und Äste, vom Ufer abgebrochene Hölzer und alle möglichen ähnlichen Materialien mit sich, die in den Untiefen auf Grund gingen oder sich in den Stromschnellen verfingen, und dort riesige Stapel bildeten, wo vorher Wehre gewesen waren.
Manchmal, nach großen Regenfällen, rissen diese Stapel, getrieben von der unwiderstehlichen Kraft des Wassers, die Hölzer und Balken der Wehre mit sich, die dann im weiteren Verlauf von der Flut wie Rammböcke vor sich her getragen wurden und selbst die Brücken aus massivem Stein, die die Ältesten gebaut hatten, aufbrachen und einstürzen ließen. Diese und die Eisenbrücken brachen zusammen und waren bald ganz verschwunden, da die Fundamente mit Sand und Kies verschlämmt wurden.
So wurden auch die Standorte vieler Dörfer und Städte, die einst entlang der Flüsse oder in den angrenzenden Niederungen existierten, durch das Wasser und den damit einströmenden Schlamm verdeckt. Die schnell wachsenden Seggen und Schilfpflanzen erledigten den Rest und ließen nichts mehr sichtbar, so dass die mächtigen Gebäude von einst nach und nach regelrecht begraben wurden. Wie von denjenigen, die nach Schätzen gegraben haben, bewiesen wurde, befinden sich die Fundamente heutzutage tief unter der Erde und sind nicht mehr erreichbar, denn das Wasser strömt sofort in die Schächte, die man versuchshalber durch die Sand- und Schlammbänke getrieben hat.
Aus der Höhe war also nichts mehr zu sehen außer endlosen Wäldern und Marschen. Auf dem flachen Land und in den Ebenen beschränkte sich die Sichtweite wegen des Dickichts und der Schösslinge, die mittlerweile zu Jungbäumen gewachsen waren, auf sehr kurze Distanz. Die Hügelländer waren nur noch teilweise begehbar, aber auch dort konnte man, außer auf den Pfaden der Tiere, nicht gut vorwärtskommen, da das lange Gras, das man früher regelmäßig mit Schafen beweidet hatte, jetzt verfilzt und verworren war. Stechginster und Heidekraut bedeckten die Hänge und an einigen Stellen wuchsen riesige Mengen an Farn. Es hatte schon immer Gehölze mit Tannen, Buchen und Nussbäumen gegeben, und diese wurden immer größer und breiteten sich aus, während sich um sie herum Brombeeren, Dornsträucher und Weißdorn vermehrten.
Nach und nach schienen die Bäume aus den Mulden vorzudringen und die Hügel hinaufzuklettern, und, wie wir in unserer Zeit sehen, sind vielerorts die Hügelländer mit einem verkümmerten Wald bedeckt. Aber all das geschah in der Zeit der ersten Generation. Abgesehen von diesen Dingen fand eine große physische Veränderung statt; aber bevor ich davon spreche, sollte ich zuerst davon erzählen, welche Auswirkungen das Ganze auf Tiere und Menschen hatte.
In den ersten Jahren, nachdem die Felder sich selbst überlassen worden waren, wurden die abgeknickten und überreifen Getreidekulturen zum Rückzugsort unzähliger Mäuse. Sie fielen in unglaublichen Scharen über die Felder her und verschlangen nicht nur das Getreide auf den nie geschnittenen Halmen, sondern räumten auch jede einzelne Ähre in den Getreideschobern aus, die überall im Land standen. In diesen Schobern blieb nichts als Stroh zurück, durchbohrt von Tunneln und Gängen, zur Heimat und Brutstätte der Mäuse geworden, die von dort auf die Felder strömten. Das Getreide, das in Scheunen und Getreidespeichern, in Mühlen und in Lagerhäusern der verlassenen Städte zurückgelassen worden war, verschwand auf die gleiche Weise.
Als die Menschen versuchten, in kleinen Gärten und Einzäunungen Getreide für ihren Lebensunterhalt anzubauen, stürmten diese Legionen von Mäusen herein und zerstörten die Früchte ihrer Arbeit. Nichts konnte sie aufhalten, und wenn einige getötet wurden, nahmen hundert weitere ihren Platz ein. Diese Mäuse wurden von Turmfalken, Eulen und Wieseln gejagt; aber das machte am Anfang wenig oder gar keinen Unterschied. In einigen Jahren hatte sich jedoch die Zahl der Wiesel, die eine solche Fülle an Nahrung vorfanden, verdreifacht, und ebenso nahmen die Falken, Eulen und Füchse zu. Seither spürt man eine gewisse Entspannung der Lage, aber selbst heute werden immer wieder ganze Bezirke überfallen, und die Getreidespeicher und der stehende Mais leiden unter diesen Verwüstungen.
Dies geschieht nicht jedes Jahr, sondern nur in Abständen, denn man kann festzustellen, dass es in einigen Jahreszeiten deutlich mehr Mäuse gibt als in anderen. Die außerordentliche Vermehrung dieser Tiere war auch die Grundlage der Nahrung für die Katzen, die in den Städten verlassen worden waren und in Scharen aufs Land wanderten. Sie ernährten sich von den Mäusen und verwilderten in kürzester Zeit, und ihre Nachkommen durchstreifen nun die Wälder.
In unseren Häusern finden sich noch einige Arten der Hauskatze, wie z.B. die dreifarbige Glückskatze, die am meisten geschätzt wird, aber als die oben genannten Katzen wild wurden, verschwanden nach einer Weile die verschiedenen Sorten und hinterließen nur eine einzige, wilde Art. Diejenigen, die jetzt so oft im Wald anzutreffen sind und in Häusern und Gehegen so viel Unheil anrichten, sind fast alle gräulich, einige gestreift, und haben auch viel längere Körper als die zahmen Exemplare. Einige wenige sind tiefschwarz; wegen ihrem Fell auch von den Jägern bevorzugt.
Obwohl sich die Waldkatze so gut es geht aus dem Blickfeld des Menschen fernhält, ist sie doch äußerst leidenschaftlich in der Verteidigung ihrer Jungen, und es sind Fälle bekannt, in denen Reisende, die sich unwissentlich ihren Bauten genähert hatten, im Wald angegriffen wurden. Das Tier springt von den Ästen eines Baumes auf die Schultern, attackiert das Gesicht und verursacht tiefe Kratzer und Bisse, die überaus schmerzhaft und manchmal auch gefährlich sind, da sie dazu tendieren, zu eitern. Aber solche Fälle sind selten, und der Grund, warum die Waldkatze so gehasst wird, ist, dass sie Geflügel und Federvieh nachstellt, da sie mit Leichtigkeit die Bäume oder Orte, an denen dieses schläft, hochklettern kann.
Fast noch schlimmer als die Mäuse waren die Ratten, die in so großer Zahl aus den alten Städten kamen, dass die Menschen, die überlebt hatten und sie sahen angeblich vor lauter Angst geflohen sind. Dieser Terror dauerte jedoch nicht so lange wie das Übel der Mäuse, denn die Ratten, die wahrscheinlich nicht genügend Nahrung fanden, wenn sie zusammen waren, verstreuten sich im Land, und wurden von den Katzen und Hunden, die sie zu Tausenden töteten, einzeln vernichtet – weitaus mehr, als sie hinterher essen konnten, so dass die Leichen der Verrottung preisgegeben wurden. Es ist überliefert, dass diese Armeen von Ratten, die vom Hunger gepeinigt wurden, in einigen Fällen über ihre eigenen Artgenossen herfielen und sich von ihrer eigenen Art ernährten. Sie sind immer noch zahlreich vorhanden, scheinen aber nicht so viel Schaden anzurichten, wie gelegentlich von den Mäusen verursacht wird, wenn diese in das kultivierte Land eindringen.
Auch die Hunde wurden, wie die Katzen, vom Hunger auf die Felder getrieben, wo sie in unglaublicher Zahl verstarben. Von vielen Hundearten, von denen behauptet wird, dass sie unter unseren Vorfahren reichlich vorhanden waren, kennen wir heute nur noch die Namen. Der Pudel ist ausgestorben, der Malteser, der Spitz, das italienische Windspiel, und man nimmt an, dass eine große Anzahl von Kreuzungen und Mischlingen ebenfalls völlig verschwunden sind. Es gab niemanden, der sie fütterte, und sie konnten weder auf sich allein gestellt Nahrung finden, noch die Strenge des Winters ertragen, wenn sie im Freien dem Frost ausgesetzt waren.
Einige Arten, die robuster und von Natur aus für die Jagd geeignet waren, verwilderten, und ihre Nachkommen sind heute im Wald zu finden. Darunter gibt es drei Arten, die sich deutlich voneinander unterscheiden und von denen man annimmt, dass sie sich nicht vermischen. Die zahlreichsten sind die Schwarzen. Der schwarze Waldhund ist kurz und kräftig gebaut, hat zottiges Haar und trägt manchmal weiße Flecken.
Es besteht kein Zweifel, dass er der Nachkomme des einstigen Schäferhundes ist, denn es ist bekannt, dass dieser denselben Charakter hatte; und es wird erzählt, dass diejenigen, die früher Schafe hielten, bald bemerkten, dass ihre Hunde den Schafspferch verließen und sich den wilden Rudeln anschlossen, die die Schafe angriffen. Die schwarzen Waldhunde jagen in Rudeln von zehn oder mehr Exemplaren (bis zu vierzig wurden einmal gezählt) und sind die größte Plage des Bauern, denn wenn seine Herden nachts nicht in Palisaden oder Gehegen geschützt sind, werden sie mit tödlicher Sicherheit attackiert. Diese Hunde, die sich nicht damit zufriedengeben, genug zu töten, um ihren Hunger zu stillen, zerreißen und zerfleischen aus schierer Blutrünstigkeit zwanzigmal so viele Tiere, wie sie fressen können, und lassen die jämmerlich zerrissenen Kadaver auf den Feldern zurück. Auch tagsüber sind die Schafe nicht immer sicher, wenn die Waldhunde zufällig Hunger haben. Der Hirte wird daher in der Regel von zwei oder drei englischen Doggen begleitet, von deren Größe und Stärke die anderen ehrfürchtig zurückweichen. Nachts, wenn die Hunde im Schnee Hunger leiden und in großen Rudeln angreifen, können nicht einmal die Doggen etwas ausrichten.
Von keinem Waldhund gleich welcher Art wurde jemals berichtet, dass er Menschen angegriffen hätte, und der Jäger hört im Wald sein aus allen Richtungen kommendes Bellen ohne Angst. Nichtsdestotrotz ist es am besten, ihnen aus dem Weg zu gehen, wenn sie in Rudeln Schafe jagen, denn dann scheinen sie von blinder Wut gepackt zu sein, und einige, die sich bemüht haben, sie zu bekämpfen, wurden niedergeworfen und schwer gebissen. Aber das war immer der Blindheit ihres Ansturms geschuldet; es ist noch nie von einer absichtlichen Attacke auf Menschen gehört worden.
Diese schwarzen Waldhunde jagten und rissen auch Rinder, wenn sie in die Gehege gelangen konnten, und selbst Pferde sind Opfer ihres unermüdlichen Durstes nach Blut geworden. Nicht einmal die wilden Rinder konnten trotz ihrer Stärke immer entkommen, und die Hunde waren auch dafür bekannt, dass sie Hirsche vor sich hergetrieben haben, wenn dieses auch nicht ihre übliche Beute waren.
Die nächste Art von wilden Waldhunden ist der Gelbe, ein kleineres Tier mit glattem Fell, das hauptsächlich von Wild lebt und alles jagt, vom Hasen bis zum Hirsch. Er ist so schnell – oder zumindest fast – wie der Windhund, besitzt aber eine größere Ausdauer. Bei der Hasenjagd kommt es nicht selten vor, dass diese Hunde in den Dorngestrüppen lauern und den Hasen, wenn er fast erschöpft ist, den Jagdhunden vor der Nase klauen. Auf die gleiche Weise folgen sie auch einem Hirsch, der von den Jägern fast gestellt wurde, und treiben ihn in die Enge, obwohl sie in diesem Fall ihre Beute verlieren, weil sie ihre Beute aus Angst vor dem Menschen aufgeben, wenn die Jäger gemeinsam auftauchen.
Aber ihr Hang zur Jagd ist so groß, dass sie sich schon beim fernen Klang des Horns vor ihren Bauten versammeln, und während die Jäger durch den Wald reiten, sehen sie oft die gelben Hunde, die Seite an Seite mit ihnen durch Busch und Farn hetzen. Diese Tiere jagen manchmal einzeln, manchmal zu zweit, und wenn das Jahr fortschreitet und sich der Winter nähert, in Rudeln von acht oder zwölf Tieren. Sie greifen nie Schafe oder Rinder an und meiden den Menschen, es sei denn, sie bemerken, dass er sich an der Jagd beteiligt. Es besteht kein Zweifel, dass sie die Nachkommen der Hunde sind, die die Vorfahren Lurcher nannten, und die sich vermutlich mit dem Windhund und möglicherweise auch anderen Rassen gekreuzt haben. Als die verschiedenen Hunderassen auf sich selbst gestellt waren, hielten nur diese der Belastung und den Schwierigkeiten stand, die von Natur aus abgehärtet waren und eine natürliche Begabung für die Jagd besaßen.
Die dritte Art der Waldhunde ist der Weiße. Sie haben kurze Beine, sind von einer schmutzig-weißen Farbe und viel kleiner als die beiden anderen Arten. Sie greifen weder Rinder noch Wild an, obwohl sie gerne Kaninchen jagen. Dieser Hund ist tatsächlich ein Aasfresser, der von den Kadavern toter Schafe und anderer Tiere lebt, die er nachts sauber ausgeweidet. Zu diesem Zweck treibt er sich in der Nachbarschaft von Siedlungen herum und streift abends um die Abfallhaufen, wobei er beim kleinsten Laut abhaut, da er äußerst scheu ist.
Er ist völlig harmlos, selbst Geflügel fürchtet ihn nicht, und er wird es nicht einmal mit einer zahmen Katze aufnehmen, wenn sich die beiden zufällig treffen sollten. Er wird nur selten weit entfernt von Siedlungen angetroffen, obwohl er eine marschierende Armee begleiten kann. Man kann sagen, dass er immer in einem Bezirk bleibt. Die schwarzen und gelben Hunde hingegen wandern scheinbar ohne Zuhause durch den Wald. An einem Tag sieht der Jäger Anzeichen ihrer Anwesenheit und hört dann vielleicht für den nächsten Monat noch nicht einmal ein Bellen.
Diese Unsicherheit in Bezug auf die schwarzen Hunde ist der Fluch der Hirten; denn, nachdem sie monatelang nichts vom Feind gesehen oder gehört haben, lässt oft trotz früherer Erfahrungen ihre Wachsamkeit nach, und plötzlich, während sie schlafen, werden ihre Herden überfallen. Unter den zahmen Hunden gibt es noch immer Doggen, Terrier, Spaniel, Hirsch- und Windhunde, die alle dem Menschen so treu sind wie eh und je.
KAPITEL 2. Wilde Tiere
Als die Zivilisation unserer Vorfahren unterging, starben auch viele ihrer Rinder. Es war nicht so sehr der Mangel an Nahrung, sondern die Unfähigkeit, die Belastungen zu ertragen, die ihren Tod verursachte; es ist überliefert, dass einige Winter ihre Bestände so reduziert zu haben, dass sie zu Hunderten gestorben sind, viele übel zugerichtet durch Hunde. Die Widerstandsfähigsten, die übrig geblieben sind, wurden wild, und heute ist es schwerer, sich an Waldrinder anzunähern als an Rehe.
Es gibt zwei Arten, die Weißen und die Schwarzen. Die Weißen (manchmal auch Graubraunen) gelten als die Überlebenden der heimischen rötlichgrauen und weißen Sorte, denn die Rinder in unseren Gehegen sind heute von dieser Farbe. Die Schwarzen sind kleiner und zweifellos wenig verändert von ihrem Aussehen in den alten Tagen, außer dass sie wild sind. Diese sind scheu, es sei denn, sie werden von einem Kalb begleitet, und sind kaum dafür bekannt, sich gegen ihre Angreifer zu wenden. Die Weißen sind dagegen immer kämpferisch; sie greifen den Menschen normalerweise nicht an, laufen aber meist auch nicht vor ihm davon, und es ist nicht immer sicher, ihre Lieblingsplätze zu durchqueren.
Die Bullen sind zu bestimmten Jahreszeiten unfassbar wild. Wenn sie Menschen aus der Ferne sehen, ziehen sie sich zurück; wenn sie unerwartet und von Angesicht zu Angesicht auf sie treffen, greifen sie an. Diese Eigenschaft ermöglicht es denjenigen, die durch Bezirke reisen, die bekanntermaßen von weißen Rindern bewohnt werden, sich vor einer Begegnung zu schützen, denn durch gelegentliches Betätigen eines Horns wird die Herde, die sich eventuell in der Nähe befindet, verstreut. Es befinden sich selten mehr als zwanzig Tiere in einer Herde. Die Häute der graubraunen Exemplare sind hoch begehrt, sowohl wegen ihres eigentlichen Wertes, als auch als Beweis für Geschicklichkeit und Mut; dies geht so weit, dass man kaum ein Fell kaufen kann, selbst, wenn man dafür alles Geld bietet, das man besitzt; die Hörner sind ebenfalls Trophäen. Der weiße oder graubraune Stier ist der Monarch unserer Wälder.
Es gibt vier Arten von wilden Schweinen. Das zahlreichste, oder zumindest das am häufigsten gesehene, wie es um unsere Gehege schleicht, ist das gewöhnliche Dornenschwein. Es ist das größte der wilden Schweine, mit einem langen Körper und kurzen Beinen, von der Farbe her ähnlich dem Ton des Schlamms, in dem es sich suhlt. Für den Landwirt ist es die größte Plage, denn es zerstört oder beschädigt alle Arten von Nutzpflanzen und durchquert die Gärten. Es ist schwierig, es durch Palisaden fernzuhalten, denn wenn es auch nur eine Schwachstelle in der hölzernen Umzäunung gibt, wird die starke Schnauze des Tieres diese sicher untergraben und sich hindurcharbeiten.
Da sich immer viele dieser Schweine rund um Siedlungen und bewirtschaftete Felder befinden, ist ständige Achtsamkeit erforderlich, denn sie entdecken sofort jede Öffnung. Aus ihrer Gewohnheit, das Dickicht und die Büsche zu nutzen, die sich bis an die Ränder der Gehege erstrecken, gab man ihnen den Namen 'Dornenschweine'. Einige erreichen eine enorme Größe, und da sie sehr fruchtbar sind, ist es unmöglich, sie auszurotten. Die Eber sind zu einer bestimmten Jahreszeit kampflustig, greifen aber nie an, wenn sie nicht provoziert werden. Aber wenn sie in die Enge getrieben werden, sind sie wegen ihrer Größe und ihres Gewichts die gefährlichsten Wildschweine. Sie sind eher träge veranlagt und kommen normalerweise nicht aus ihren Höhlen, wenn sie nicht dazu gezwungen werden.
Die nächste Art ist das weiße Schwein, das die gleichen Gewohnheiten hat wie das erste, außer dass es normalerweise an feuchten Orten, also in der Nähe von Seen und Flüssen zu finden ist und oft auch als Sumpfschwein bezeichnet wird. Die dritte Art ist komplett schwarz, viel kleiner, sehr aktiv, bietet sich perfekt für die Jagd an und schmeckt auch am besten. Da sie in den Hügeln leben, wo das Land etwas offener ist, können Pferde gut folgen, und es ergibt sich meist eine spannende Jagd. Manche nennen es auch das Hügelschwein, nach der Örtlichkeit, die es bevorzugt. Die kleinen Stoßzähne des schwarzen Ebers werden für viele dekorative Zwecke verwendet.
Diese drei Arten gelten als Nachkommen der verschiedenen Hausschweine der Vorfahren; die vierte aber, die von grauer Farbe ist, wird als das wahre Wildschwein angesehen. Man trifft diese Art selten, am häufigsten ist sie aber in den südwestlichen Wäldern zu finden, wo sie wegen der Menge des dort wachsenden Farnes als 'Farnschwein' bezeichnet wird. Man nimmt an, dass diese Art das wahre Wildschwein repräsentiert, das ausgestorben oder im Hausschwein der Ältesten verschmolzen war, außer in den Gegenden, in denen der Stamm erhalten blieb.
Mit den wilden Zeiten sind auch die wilden Gewohnheiten zurückgekehrt, und der graue Keiler ist nicht nur der am schwierigsten zu findende, sondern auch der kampfeslustigste was Hunde oder Menschen angeht. Obwohl das erstgenannte Dornenschwein dem Landwirt wegen seiner Anzahl und seiner Gewohnheit, die Umgegend der Einzäunungen heimzusuchen, den größten Schaden zufügt, sind die anderen ebenso verwüstend, wenn sie die Möglichkeit haben, auf kultivierte Felder zu gelangen.
Die drei wichtigsten Arten von wilden Schafen sind das Hornschaf, das Thymianschaf und das Wiesenschaf. Die Thymianschafe sind die kleinsten und in den Höhen der südlichen Mittelgebirge unterwegs, wo ihr Fleisch, genährt von den süßen Kräutern auf den Bergrücken, einen Geschmack von wildem Thymian entwickelt. Sie bewegen sich in kleinen Herden von nicht mehr als dreißig Tieren und sind am schwierigsten zu sichten, da sie weitaus vorsichtiger sind als Rehe, weil sie ständig von den Waldhunden gejagt werden. Die Hornschafe sind größer und bilden Herden mit weitaus mehr Tieren; bis zu zweihundert werden manchmal zusammen gesehen.
Man findet sie auf den tieferen Hängen, in den Ebenen, sowie in den Wäldern. Die Wiesenschafe haben eine lange, zottelige Wolle, die zu verschiedenen Kleidungsstücken verarbeitet wird, sind aber nicht sehr zahlreich vertreten. Sie leben an den Flussböschungen und den Ufern von Seen und Teichen. Auch diese beiden Arten sind wegen der Waldhunde kaum zu erwischen; die Widder der Hornschafe sollen sich allerdings manchmal gegen das jagende Rudel wenden und mit ihren Hörnern Tiere zu Tode stoßen. Im Zustand des größten Schreckens sind schon ganze Herden von Wildschafen über Steilhänge in Moraste und Wildbäche getrieben worden.
Daneben gibt es noch einige Arten mehr, deren Lebensraum lokal ist. Vor allem auf den Inseln findet man andere Rassen. Bei ruhigem Wetter schwimmen die Waldhunde manchmal zu einer Insel hinaus und töten alle Schafe darauf.
Die beiden heute lebenden Art von wilden Pferden stammen von den Tieren ab, die unsere Vorfahren benutzt haben, was durch ihre offensichtliche Ähnlichkeit mit den Pferden, die wir selbst heute noch besitzen, bestätigt wird. Das größte Wildpferd ist fast schwarz oder von einer ähnlich dunklen Färbung, etwas kleiner als unsere heutigen Zugpferde, aber von der gleichen, schweren Statur. Es ist jedoch viel schneller, weil es die Freiheit schon so lange genossen hat. Es wird auch als Buschpferd bezeichnet und lebt im Allgemeinen in den Dickichten und wiesenähnlichen Flächen am Wasser.
Die andere Art wird wegen ihres Lebensraums als Hügelpony bezeichnet und ist etwas kleiner als unser Reitpferd. Letzteres ist kurz und untersetzt, so dass es von kleinen Menschen nicht ohne hohe Steigbügel geritten werden kann. Beide Wildpferdrassen sind weder zahlreich noch selten. Sie leben völlig voneinander getrennt. Bis zu dreißig Stuten werden manchmal zusammen gesehen, aber es gibt Bezirke, in denen der Reisende wochenlang keine einzige sieht.
Die Überlieferung besagt, dass es in alten Zeiten Pferde mit einem so schlanken Körperbau gab, dass sie schneller waren als der Wind, aber von der Rasse dieser berühmten Rennpferde ist kein einziges Tier mehr übrig. Ob sie zu empfindlich waren, um der Belastung standzuhalten, oder ob die wilden Hunde sie jagten, ist ungewiss, auf jeden Fall sind sie verschwunden. Gäbe es nur ein einziges davon, wie begierig würde man es suchen, denn in diesen Tagen wäre er sein Gewicht in Gold wert; es sei denn, es wäre tatsächlich so, dass es diese Geschwindigkeit nur ein paar Kilometer halten konnte, wie einige behaupten.
Da wir uns nun so intensiv mit den Tieren beschäftigt haben, ist es nicht notwendig, etwas über die Vögel des Waldes zu sagen, von denen jeder weiß, dass sie nicht immer wild waren, und die man in der Tat mit dem Geflügel vergleichen kann, das in unseren Gehegen gehalten wird. Dazu gehören die Rallen, die Truthühner, die Pfauen, die weißen Enten und Gänse, die alle, obwohl sie heute so wild wie der Falke sind, einst zahm gewesen waren.
In alten Zeiten gab es in den Parks und zoologischen Gärten Rot- und Damhirsche, und diese haben sich, nachdem sie einmal frei waren und unbehelligt über gigantische Flächen streifen konnten, so sehr vermehrt, dass sie nicht mehr zählbar sind; ich selbst habe tausend oder mehr zusammen gesehen. Wie ich erfahren habe, sind in diesen vierzig Jahren auch Rehe aus dem äußersten Norden eingewandert, so dass es heute drei Arten in den Wäldern gibt. Vor ihnen kamen schon die Baummarder aus der gleichen Richtung, und obwohl diese noch nicht verbreitet sind, glaubt man, dass ihre Zahl zunimmt. Die ersten Jahre nach der Verwandlung bestand auch die Gefahr, dass sich die wilden Tiere, die als seltene Exemplare in Zoos eingesperrt worden waren, in den Wäldern vermehren und dortbleiben würden. Aber das ist nicht passiert.
Einige wenige Löwen, Tiger, Bären und andere Tiere sind tatsächlich entkommen, zusammen mit vielen weniger gefährlichen Wesen, und es ist überliefert, dass sie lange Zeit auf den Feldern herumgezogen sind. Sie wurden selten angetroffen, da sie eine so große Landfläche hatten, über die sie wandern konnten, und verschwanden nach einer Weile völlig. Wenn irgendwelche Nachkommen geboren wurden, müssen die Winterfröste diese vernichtet haben, und das gleiche Schicksal erwartete die monströsen Schlangen, die zu Ausstellungszwecken gesammelt worden waren. Es gibt nur noch ein einziges Tier, von dem bekannt ist, dass es seine Existenz den Exemplaren verdankt, die aus den Verliesen der Vorfahren entkommen sind. Es handelt sich um den Biber, dessen Dämme heute gelegentlich an den Bächen von denen gefunden werden, die durch die Wälder streifen. Auch einige der Wasservögel, die an den Seen leben, sollen ursprünglich von denen abstammen, die früher als Raritäten gehalten wurden.
Im Hof von Schloss Bückeburg sind noch die Knochen eines Elefanten zu sehen, der im Wald in der Nähe gestorben ist.
KAPITEL 3. Waldmenschen
Bis hierher ist alles, was ich gesagt habe, klar, und es besteht kein Zweifel, dass das, was von Mund zu Mund weitergegeben wurde, größtenteils wahr und richtig ist. Wenn ich jedoch von Bäumen und Tieren zu Menschen komme, liegen die Dinge etwas anders, denn nichts ist sicher und alles ziemlich verwirrt. Weder stimmt ein einziger Bericht mit einem anderen überein, noch lässt er sich mit den gegenwärtigen Fakten oder vernünftigen Annahmen oder Schlüssen in Einklang bringen; und doch ist es noch nicht so lange her, dass nicht ein paar Erinnerungen, die miteinander verknüpft werden, die Zeit überbrücken könnten, und noch einige schriftliche Aufzeichnungen, wenn auch sicher nicht viele, noch gefunden werden. Ich führe diese Unstimmigkeiten auf die Kriege und die Feindschaften zurück, die entstanden sind und die Völker entzweiten, was zur Folge hatte, dass man nicht auf das hörte, was die anderen erzählen wollten, und die Wahrheit verloren ging.
Außerdem wurden bei den Feuersbrünsten, die die Städte verwüsteten, die meisten Aufzeichnungen zerstört, so dass auf diese kein Bezug mehr genommen werden kann. Und es könnte sein, dass die Ursachen für die Veränderung selbst im weiteren Lauf der Zeit überhaupt nicht verstanden wurden. Deshalb ist das, was ich jetzt beschreiben werde, nicht als die ultimative Wahrheit zu betrachten, sondern als diejenige, die ich nach dem Vergleich verschiedener Überlieferungen für am wahrscheinlichsten halte. Einige sind der Meinung, dass die Veränderung tatsächlich damit begann, dass das Meer die Eingänge zu den großen Häfen verschlammte und versandete und dadurch den ausgedehnten Handel unterbunden hat, der einst betrieben wurde. Es trifft ganz sicher zu, dass viele der Häfen verschlammt und heute als solche nutzlos sind, aber ob diese Verschlammung dem Verschwinden der Bevölkerung vorausging, oder ob das Verschwinden der Bevölkerung und die daraus resultierende fehlende Wartung der Fahrrinnen die Verschlammung verursacht hat, kann ich nicht eindeutig behaupten.
Es gibt Anzeichen dafür, dass der Meeresspiegel an einigen Stellen gesunken ist, und Anzeichen dafür, dass er an anderen gestiegen ist, so dass der vernünftige Historiker einfach nur die Fakten darlegen und davon absehen wird, sie mit seiner eigenen Theorie einzufärben. Andere behaupten wiederum, dass es große Unruhen gab, als die Versorgung mit Nahrungsmitteln aus den Ländern jenseits des Meeres plötzlich aufhörte, und dass die Menschen sich an Bord aller möglichen Schiffe drängten, um dem Hunger zu entkommen, und wegfuhren, ohne dass man je wieder von ihnen gehört hätte.
Es wurde auch behauptet, dass die Erde von einer enormen Anziehungskraft, die durch den Transit eines riesigen, dunklen Körpers im Weltraum ausgeübt wurde, kippte oder sich in ihrer Umlaufbahn neigte, und dass diese kurze Phase den Fluss der magnetischen Ströme veränderte, die in unmerklicher Weise den Geist der Menschen beeinflussen. Bis dahin hatte sich der Strom des menschlichen Lebens immer nach Westen gerichtet, aber als diese Umkehrung des Magnetismus eintrat, entstand der allgemeine Wunsch, nach Osten zu fliehen. Diejenigen, deren Betätigungsfeld die Theologie ist, haben darauf hingewiesen, dass die Bosheit jener Zeiten jedes Verständnis überstieg und dass eine Veränderung und Vernichtung des menschlichen Übels, das sich angesammelt hatte, notwendig war und mit übernatürlichen Mitteln bewirkt wurde. Wie sie darauf gekommen sind, muss ihnen überlassen werden, denn es ist nicht die Aufgabe des Philosophen, sich in solche Dinge einzumischen.
Sicher scheint nur, dass zum Zeitpunkt des Ereignisses die gigantischen Menschenmassen in den Städten am stärksten betroffen waren und dass die Reicheren und die Oberschicht ihr Geld zur Flucht nutzten. Diejenigen, die zurückgelassen wurden, waren vor allem die sozial Schwächeren und Ungebildeten, zumindest was die Künste betraf; ebenso diejenigen, die in fernen und abgelegenen Orten wohnten, und diejenigen, die von der Landwirtschaft lebten. Besonders die zuletzt Genannten waren zu diesem Zeitpunkt in eine solche Bedrängnis geraten, dass sie keine Fahrzeuge auftreiben konnten, um zu flüchten. Die genaue Anzahl der Zurückgelassenen kann natürlich nicht benannt werden, aber in Aufzeichnungen steht geschrieben, dass jemand hundert Kilometer fahren und dennoch keinen anderen Menschen treffen konnte, als die Felder aufgegeben wurden (wie ich bereits beschrieben habe). Diese Menschen waren nicht nur wenige, sondern überall verstreut und hatten sich nicht wie heute zusammengefunden und Städte gegründet.
Was aus den unzähligen Menschen geworden ist, die das Land verließen, ist nie herausgefunden worden, und es wurden auch keine Nachrichten von ihnen empfangen. Aus diesem Grund glaube ich, dass sie entweder nach Westen oder nach Süden geflohen sein müssen, wo die größten Meeresflächen zu finden sind, und nicht nach Osten, wie es einige Theoretiker in Werken über den dunklen Körper, der im Weltraum vorbeiflog und auf den ich bereits verwiesen habe, behauptet haben. Heute wagt es keines unserer Schiffe, sich in diese riesigen Meeresgebiete oder gar außer Sichtweite der Landfläche zu wagen, es sei denn, man weiß, dass man sie bald wiedersehen wird, sobald man den Horizont erreicht und überwunden hat. Wären die Menschen damals nur auf dem Festland geflohen, hätten wir höchstwahrscheinlich davon aus einigen Ländern erfahren.
Es stimmt, dass immer noch Schiffe kommen, selten und nur zu zwei Häfen, und dass die Männer auf ihnen sagen (soweit sie sich verständlich machen können), dass ihr Land mittlerweile ebenfalls verlassen ist und seine Bevölkerung verloren hat. Dennoch ist es fast sicher, wenn Menschen mit Menschen sprechen und damit Wissen über weite Teile des Landes verbreiten, dass ein gewisses Echo ihrer Schritte immer noch zu uns zurückkommen würde, wenn sie dorthin geflohen wären. Da diese Theorie damit unhaltbar ist, habe ich nochmals unterstrichen, dass die Vorfahren wirklich mit Schiffen nach Westen oder Süden geflohen sein müssen.
Da die Zurückgelassenen größtenteils unwissend, unkundig und ungebildet waren, geschah es in der Folge, dass viele der wunderbaren Dinge, die die Vorfahren besaßen und erfunden hatten, und die Geheimnisse ihrer Wissenschaft, uns nur dem Namen nach bekannt sind – und selbst das nicht immer. Es ist uns genauso passiert, wie es auch den Vorfahren passiert ist. Diese wussten, dass schon vor ihrer eigenen Zeit die Kunst entdeckt worden war, Glas formbar zu machen, damit es wie Kupfer geschmiedet werden konnte. Aber die Art und Weise, wie man das anstellte, war ihnen völlig unbekannt; der Sachverhalt war unbestreitbar, aber die Methode war verloren. Heute wissen wir, dass diejenigen, die wir als die Vorfahren bezeichnen, die Technik besaßen, Diamanten und Edelsteine aus schwarzer und glanzloser Holzkohle herzustellen – eine Tatsache, die nahezu unglaublich ist. Dennoch zweifeln wir nicht daran, obwohl wir uns nicht vorstellen können, mit welchen Mitteln diese Kunst durchgeführt wurde.
Sie konnten auch ihr Wissen und Nachrichten zu den äußersten Teilen der Erde über Wellen senden, die nicht sichtbar oder materiell waren und daher eigentlich keinen Ton übertragen konnten; und doch konnte die Person, die die Botschaft empfing, die Stimme des Senders in tausenden Kilometern Entfernung hören und erkennen. Mit gewissen Maschinen, die mit Treibstoffen befeuert wurden, durchquerten sie die Welt so schnell, wie die Schwalbe durch den Himmel gleitet, auf der Erde und in der Luft; aber von diesen Dingen blieb uns kein Relikt. Was auch immer an metallischen Gerätschaften, Rädern oder Gittern übriggeblieben war und uns vielleicht einen Hinweis gegeben hätte, wurde zerbrochen und eingeschmolzen, um auf andere Weise wiederverwendet zu werden, als das Metall knapp wurde.
Es heißt, dass es in den Wäldern, in denen ursprünglich die Straßen und Geleise für diese Maschinen verliefen, noch Überbleibsel davon gibt, aber diese sind jetzt so mit Dickicht bedeckt, dass man nichts mehr aus ihnen lernen kann; und obwohl ich von ihrer Existenz gehört habe, habe ich nie etwas Derartiges gesehen. Durch die Berge wurden große Löcher für die Passage der fahrenden Maschinen getrieben, aber diese sind heute durch die herabgefallenen Decken blockiert, und niemand würde es wagen, die noch zugänglichen Teile zu erkunden. Wo sind die wunderbaren Gebilde, mit denen die damaligen Menschen in den Himmel gehoben wurden, hoch über die Wolken? Diese fantastischen Dinge sind für uns kaum mehr als die Märchen von Riesen und alten Göttern, die auf Erden wandelten, und die bereits für diejenigen, die wir die Vorfahren nennen, Märchen waren.
Tatsächlich wissen wir mehr über diese sehr alten Zeiten als über die Menschen, die uns unmittelbar vorausgingen, und die Römer und Griechen sind uns vertrauter als die Menschen, die in den eisernen Wagen fuhren und am Himmel flogen. Der Grund, warum so viele Künste und Wissenschaften verloren gingen, lag darin, dass, wie ich bereits sagte, die meisten derjenigen, die dageblieben waren, unwissend, unkundig und ungebildet waren. Sie hatten die eisernen Wagen gesehen, verstanden aber nicht, wie man diese baute, und konnten entsprechend das Wissen, das sie selbst nicht besaßen, nicht weitergeben. Die magischen Wellen der Kommunikation gab es auch in ihren Dörfern, aber sie wussten nicht, wie man sie nutzen konnte.
Die geschickten Erbauer der Städte zogen alle fort, und der Rest verfiel schnell der Barbarei; auch das war nicht verwunderlich, denn die wenigen und verstreuten Menschen jener Tage hatten genug damit zu tun, ihr eigenes Leben zu retten. Die Kommunikation zwischen verschiedenen Orten war absolut tot, und wenn sich jemand an etwas erinnerte, das vielleicht von Nutzen gewesen wäre, konnte er sich nicht mit einem anderen beraten, der vielleicht den dazu passenden, anderen Teil kannte, und so gemeinsam eine Maschine wieder aufbauen. In der zweiten Generation gingen selbst diese unzusammenhängenden Erinnerungen verloren.
Man nimmt an, dass diejenigen, die zurückblieben, zuerst von dem Getreide in den Lagern existierten, und von dem, was sie mit dem Schlegel aus den Ernten dreschen konnten, die auf den Feldern vergessen worden waren. Aber als die Vorräte in den Lagern aufgebraucht oder verdorben waren, jagten sie die Tiere, die nicht mehr ganz zahm, aber auch noch nicht ganz wild waren. Da diese immer weniger wurden und schwer zu fangen waren, machten sie sich an die Arbeit, erneut den Boden zu bebauen, und trugen kleine Schichten der Erde ab, die bereits mit Brombeeren und Disteln bewachsen waren. Einige bauten Getreide an, andere kümmerten sich um die Schafe. So wurden mit der Zeit weit voneinander entfernte Orte besiedelt und Städte gebaut; Städte, ja, so nennen wie sie, um sie vom flachen Land zu unterscheiden, aber sie sind dieses Namens im Vergleich zu den mächtigen Städten vergangener Zeiten nicht würdig.
Es gibt viele, die nicht mehr als fünfzig Häuser umfassen, und vielleicht keine andere Siedlung im Umkreis von einer Tagesreise haben, und die größten sind nur Dörfer, wenn man die Maßstäbe des Altertums anlegt. Meistens haben sie ihre eigene Regierung, oder hatten sie bis vor kurzem, und so wuchsen viele Provinzen und Königreiche im Umkreis dessen auf, was ursprünglich nur ein Verwaltungsbezirk war. So getrennt und verstreut entstanden auch wieder viele Rassen, wo es früher nur ein Volk gab. Ich gehe nun kurz auf die wichtigsten Unterteilungen der Menschen ein und beginne mit denen, die überall als die niedrigsten gelten. Das sind die Buschmänner, die ganz in den Wäldern leben.
Selbst unter den Vorfahren, als jeder Mann, jede Frau und jedes Kind jene Kunstfertigkeiten ausüben konnte, die heute ein besonderes Merkmal des Adelstandes sind, nämlich Lesen und Schreiben, gab es eine degradierte Klasse von Menschen, die sich weigerten, die Vorteile der Zivilisation zu nutzen. Sie erhielten ihre Nahrung durch Betteln, wanderten entlang der Autobahnen, hockten an Feuern, die sie im Freien entzündeten, kleideten sich in Lumpen und in ihren Gesichtern war jede Spur von Selbstachtung verschwunden. Dies waren die Vorfahren der heutigen Buschmenschen.
Es zog sie zu den aufgegebenen Feldern, wo sie "Lager" bildeten, wie sie ihre Stämme, oder besser gesagt Familien, nennen, die hin und her wanderten und sich von Wurzeln und gefangenem Wild ernährten. So leben sie bis heute, da sie äußerst geschickt darin sind, alle Arten von Vögeln und Tieren, sowie die Fische in den Bächen zu fangen. Letztere vergiften sie manchmal mit einer Droge oder einer Pflanze (es ist nicht bekannt, welche). Dieses Wissen ist ihnen seit den Tagen der Vorfahren erhalten geblieben. Das Gift tötet die Fische und bringt sie an die Oberfläche, wo sie zu Hunderten gesammelt werden können, macht sie aber nicht unverzehrbar.
Wie die schwarzen Waldhunde töten die Buschmänner oft in Anfällen wilder Raserei dreimal so viel Tiere, wie sie essen können, indem sie Hirsche in Fallgruben fangen und die armseligen Tiere im Blutrausch in Stücke schneiden. Die Ochsen und Rinder in den Einzäunungen werden gelegentlich auf die gleiche Weise auf grässliche Weise von diesen Schurken verstümmelt, manchmal zum Vergnügen und manchmal aus Rache für ihnen zugefügte Verletzungen. Buschmänner sind nicht sesshaft, bauen kein Getreide oder Gemüse an, halten keine Tiere, nicht einmal Hunde, besitzen keine Häuser oder Hütten, keine Boote oder Kanus – nichts, was die geringste Intelligenz oder Kraftaufwand zum Bauen erfordern würde.
Ohne erkennbares Ziel, ohne Grund oder nachvollziehbare Route, ziehen sie umher; sie bauen ihr Lager für ein paar Tage auf, wo immer es ihnen passt, und ziehen dann wieder weiter, kein Mensch weiß warum oder wohin. Es ist dieses nicht vorhersehbare Nomadentum, das sie so gefährlich macht. Heute gibt es vielleicht nicht das geringste Anzeichen von ihnen innerhalb eines Kilometer großen Umkreises um ein Gehege. In der Nacht zieht ein "Lager" vorbei, metzelt die Rinder nieder, die außerhalb des Palisadenzaunes geblieben sind, oder tötet den unglücklichen Hirten, der es nicht in die Eingrenzungen geschafft hat, und am Morgen sind sie nirgendwo mehr zu sehen, da sie wie Ungeziefer verschwunden sind. Von Angesicht zu Angesicht muss man den Buschmann nie fürchten; selbst ein ganzes "Lager" oder eine Stammesfamilie wird sich auflösen, wenn ein Reisender in ihre Mitte gerät. Er versetzt seinen mörderischen Schlag von hinter einem Baum oder unter dem Deckmantel der Nacht.
Ein "Lager" kann aus zehn oder zwanzig Individuen bestehen, manchmal auch sogar vierzig oder fünfzig unterschiedlicher Altersgruppen, und wird vom Ältesten befehligt, der auch gleichzeitig der Vater ist. Er ist absoluter Herr über sein "Lagers", besitzt aber jenseits davon keine Macht oder Anerkennung, so dass es nicht einmal möglich ist, zu erraten, wie viele Führer es unter ihnen geben mag. Weder ist der Anführer als König oder Herzog bekannt, noch trägt er einen sonstigen Titel; er ist einfach der Älteste oder Gründer der Familie. Das "Lager" kennt kein Gesetz, keine festen Bräuche; Ereignisse geschehen einfach, und selbst der Anführer kann nicht als Herrscher in diesem Sinne bezeichnet werden. Wenn er schwach wird, lassen sie ihn einfach sterben.
Sie sind verkommen und schamlos, und, wenn überhaupt, in Schaffelle oder Kleidung, die sie gestohlen haben, gekleidet. Sie haben überhaupt keine Zeremonien. Die Zahl dieser "Lager" muss beträchtlich sein, und doch wird der Buschmann selten gesehen, noch hören wir sehr oft von ihren Verwüstungen, was auf das Ausmaß des Landes zurückzuführen ist, das sie durchwandern. In strengen Wintern besteht die meiste Gefahr; sie leiden dann unter Hunger und Kälte und es treibt sie in die Nachbarschaft der Gehege, um dort zu stehlen. So geschickt sind sie, wenn sie durch die Büsche schleichen und zwischen Schilf und Weiden hindurchschlüpfen, dass sie in einer Entfernung von nur wenigen Metern passieren, ohne ihre Anwesenheit zu verraten; oft können die Zeichen ihrer Anwesenheit nur von erfahrenen Jägern erkannt werden, und oft nicht einmal von ihnen.
Man sollte hier anmerken, dass der Buschmann, egal welches Unheil er gerade anstellt, niemals Heuschober oder Gebäude in Brand setzt; der Grund dafür ist, dass seine Veranlagung ihn vom Schauplatz seiner Verwüstungen wegschleichen lässt, und Flammen ziehen sofort Menschen an so einen Ort. Zweimal haben bemerkenswert strenge Winter dazu geführt, dass sich die Buschmänner zusammenscharten und einen gemeinsamen Angriff auf Gehege starteten. Die Buschmänner des Südens, die noch wilder und brutaler waren, kamen damals herauf und wurden nur mit Mühe von den ummauerten Städten zurückgeschlagen. Für gewöhnlich sehen wir sehr wenig von ihnen. Sie sind die Diebe, das menschliche Ungeziefer der Wälder.
Die Vorfahren der Roshanti waren den Vorfahren unter dem Namen 'Zigeuner' wohlbekannt. Obwohl der Name bald einen schlechten Klang hatte, wurde er bis zum Schluss verwendet, und soll hier respektvoll und in aller Ehre weiterverwendet werden. In der Tat rühmt dieses Volk sich, dass seine Abstammung so viel weiter zurückreicht als unsere eigene, sodass selbst die Vorfahren für sie kaum neuzeitlich waren. Sie sagen (und daran besteht kein Zweifel), dass sie selbst im Zeitalter der höchsten Zivilisation, das der heutigen Zeit unmittelbar vorausging, das Blut ihrer Rasse rein und unbefleckt bewahrt haben, nie unter festen Dächern wohnten und ihre Knie nie vor der vorherrschenden Religion beugten. Sie bleiben für sich und machen nach dem Verschwinden der Zivilisation genauso weiter, wie zu ihrem Beginn.
Seit der Veränderung haben ihre Zahlen stark zugenommen, und würden sie nicht ständig Krieg miteinander führen, wäre es möglich, dass sogar die Hausbewohner aus dem Land vertreiben könnten. Aber es gibt so viele Stämme, jeder mit seinem eigenen König, seiner Königin oder seinem Herzog, dass ihre Macht verstreut ist und ihre Kraft schmilzt. Der Anführer einer Buschmann-Familie ist immer ein Mann, aber unter den Roshanti üben oft eine Frau oder sogar ein junges Mädchen höchste Autorität aus, wenn sie vom heiligen Blut sind. Diese Könige und Herzöge sind absolute Alleinherrscher in ihrem Stamm und können durch ein Nicken die Vernichtung derer anordnen, die sie beleidigt haben. Da die Tugend des absoluten Gehorsams Mitgliedern eines solchen Stammes von frühester Kindheit an anerzogen wird, sind solche Hinrichtungen selten, aber das Recht, sie anzuordnen, wird nicht für einen Moment in Frage gestellt.
Jeder hat schon von den Zauberern, und insbesondere den Zauberinnen unter ihnen, gehört, und die Orte, an denen sie wohnen, scheinen voller Geheimnis und Magie zu sein. Sie leben in Zelten, und obwohl sie ständig von Bezirk zu Bezirk ziehen, kommt ein Stamm nie einem anderen in die Quere, denn alle haben ihre eigenen Routen, die niemals verletzt werden. Sie betreiben ein bisschen Landwirtschaft, halten etwas Kleinvieh und ein paar Herden, aber die Arbeit wird ausschließlich von den Frauen erledigt. Die Männer sitzen immer auf dem Rücken eines Pferdes oder schlafen in ihren Zelten.
Jeder Stamm hat seinen zentralen Lagerplatz, zu dem er immer wieder zurückkehrt, nachdem er manchmal monatelang unterwegs war. Eine bestimmte Anzahl von Personen wird immer zu seiner Verteidigung zurückgelassen. Diese Lager befinden sich oft an unzugänglichen Stellen und sind gut durch Palisaden, die als Einfriedungen dienen, geschützt. Das Gebiet, das als Teil eines solchen Lagers anerkannt ist, ist äußerst begrenzt; nur seine bloße Umgebung gilt als Eigentum des Stammes, und ein zweiter Stamm kann seine Zelte in bereits einigen hundert Metern Entfernung aufschlagen. Diese Einfriedungen sind tatsächlich eher Lager- als Wohnhäuser; jede ist eigentlich nur ein Treffpunkt.
Roshanti gibt es überall, aber ihre Einfriedungen sind am zahlreichsten im Süden, entlang der Flanken der grünen Hügel und Ebenen, und vor allem rund um den Teutoburger Wald, wo sie zwischen den Externsteinen seltsame Zeremonien und Beschwörungen durchführen. Sie greifen jeden Reisenden, jede Karawane und jeden Wagenzug an, den sie ihrer Meinung nach besiegen können, aber sie ermorden weder den einsamen, schlafenden Jäger, noch den Schafhirten, wie es die Buschmänner tun. Sie werden ihn zwar bestehlen, aber nicht töten, außer im Kampf. Ab und zu haben sie den Weg in die Städte gefunden, worauf meist schreckliche Massaker gefolgt sind, denn einmal in Rage weiß der Wilde nicht, wie er sich zurückhalten soll.
Rache ist ihr Leitbild. Wenn eine Sippe sie einmal verletzt oder beleidigt hat, hören sie nie auf, Vergeltung zu suchen, und werden noch spätere Generationen mit Feuer und Blut auslöschen. Es gibt Städte, die deswegen plötzlich verwüstet wurden, obwohl die Bürger vergessen hatten, dass es überhaupt eine Ursache für Feindschaft gab. Rache ist ihre Religion und ihr Sozialrecht und bestimmt alle ihre Handlungen untereinander. Aus diesem Grund befinden sie sich ständig im Krieg, Herzog mit Herzog und König mit König. Es gab auch bereits eine tödliche Fehde mit den Buschmännern, weit über die Erinnerung der Menschen hinaus. Der Roshanti hält den Buschmann für einen Hund und schlachtet ihn als solchen ab. Der verachtete, menschliche Hund wiederum schleicht in der Dunkelheit der Nacht in das Zelt des Roshanti und sticht dessen Tochter oder Frau ab, denn der Buschmann ist so feige und niederträchtig, dass er immer lieber eine Frau als einen Mann tötet.