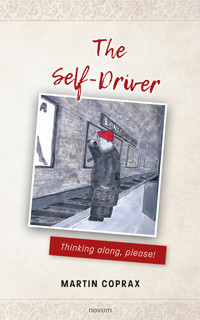15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Einsamkeit ist nur ein Wort", flüsterte sie fast unhörbar, als sie meine Hand losließ und ihren Kopf senkte, aber ich habe es gehört. Theo Baldauf lebt in einer betreuten Einrichtung in Wien. Er ist 66 Jahre alt und wurde mit Down-Syndrom geboren. Seinen Tag bestreitet er, indem er in einer betreuten Werkstatt Schlüsselanhänger fertigt. Aber seine Bestimmung gilt der U-Bahn. Ausgestattet mit Kapperl und Lautsprecher (zwei Klopapierrollen) ist er der eigentliche Bahnhofsvorsteher der Station Längenfeldgasse. Mit im Schlepptau immer sein imaginärer Freund James Bond. Theo könnte nicht klagen, wenn da nicht seine Lisi wäre … "Der Selbstfahrer" beschreibt die Welt aus der Sicht des Herrn Baldauf. Lustige Begebenheiten und Skurrilitäten treffen auf einfühlsame Passagen zum Nach- und Mitdenken. Die Titelmusik zum Buch wurde vom Autor komponiert und auf youtube für Sie bereitgestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum 3
Widmung 4
Vorwort 5
1. Von Brieftauben und Fleischfliegen 7
2. Donnerstag war Pflegetag 11
3. Protokoll der Liebe 17
4. Der Herr Pfarrer und weshalb es so wichtig war, mitzudenken 22
5. Können wir das so stehen lassen? 27
6. Es wär dann wegen der Hosen 39
7. K. b. V. – Keine besonderen Vorkommnisse 46
8. Etwas zum Aufwarten 56
9. Zug 73 66
10. Ausnahmezustand 78
11. Weil sie das gerade jetzt brauchte 93
12. Das Päckchen aus der Schweiz und Fischlaibchen sogar 108
13. Sie war ja gar nicht da 125
14. Eine Chance oder zwei Lobe 137
15. Grauschleier 152
16. Können wir das so stehen lassen 2? 164
17. Frühling in Wien 175
18. Wer war Rosemarie Engelbrecht? 187
19. Check-in in Down Under 199
19.1 „One to make her happy“ 213
19.2 Genau hier, genau jetzt! 227
19.3 The Untold Story 238
19.4 Die großen Drei 252
19.5 Der Neue 266
20. Teamsitzung vom 30.5.2011 280
21. Der Pakt 294
22. Zug fährt ab 305
23. Eine Käsekrainer habe ich dich gefragt 316
Encyclopedia vulgaris 322
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2022 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99131-466-0
ISBN e-book: 978-3-99131-467-7
Lektorat: Carmen Reitinger
Umschlagfoto: Martin Coprax, Clearviewstock | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Widmung
Zur Erinnerung an Leo B.,
einen bemerkenswerten Menschen.
Und für meinen Freund
Mag. Markus A., einen ebensolchen.
Die für das Buch komponierten Musikstücke „Der Selbstfahrer – Titellied“,
„Theos Thema“, „Down Under“ und „This feeling“,
auf die das Buch verweist, sind aufYoutubeabrufbar,
Alle anderen angeführten Lieder ebenso.
Vorwort
(Musik:Der Selbstfahrer – Titellied, leise im Hintergrund)
Liebe Frau Leserin, lieber Herr Leser!
Es dauerte lange, bis ich mich endlich dazu entschlossen hatte, Ihnen von mir und meinem Leben zu erzählen. Davor war es mir einfach nicht möglich, wie Sie gleich erfahren werden. Sie haben mich sicher schon gesehen, wenn Sie einmal bei der U-Bahn-Station Längenfeldgasse in Wien Meidling um die Mittagszeit aus der U-Bahn gestiegen sind. Ich bin der Herr mit rotem Selbstfahrerkapperl, ohne den die U-Bahnen nicht fahren und deren Türen nicht schließen würden. Und dann müssten Sie zu Fuß gehen! Na bitte, auch nicht schön! Mitdenken bitte, es geht schon los!
Eigentlich hätteDer Selbstfahrerein Kinofilm werden sollen. Mit echten Schauspielern und Drehorten in Wien und in der Schweiz, mit Kamera und Filmmusik wie in einem guten Peter- Alexander-Film. Aufgrund finanzieller Aufwendungen, die den Rahmen des Machbaren jedoch bei Weitem überstiegen hätten, sind Sie zum aktiven Mitmachen aufgefordert, sich Orte, Schauspieler und Filmmusik (wird angeführt) selbst vorzustellen. Vor allem aber zum Mitdenken möchte ich Sie ermuntern. Es obliegt selbstverständlich Ihnen, wie Sie dieses Buch lesen möchten, ob mit oder ohne Vorstellung, Musik oder Denken. Sie können es ja gerne so machen, wie der Georg Beranek. Dem ist alles egal, der macht, was er will. Da können Sie reden, was Sie wollen. Vielleicht tun Sie es aber auch Frau Gerlinde gleich und sagen einfach, Sie wären gar nicht da, obwohl Sie es sehr wohl sind. Oder Sie machen es so wie ich, legen sich einen Finger auf die Nasenspitze und schalten das Mitdenken ein. Sie werden gleich sehen, wie das geht.
Auf den letzten Seiten finden Sie das umfassende Nachschlagewerk der gängigen Wörter und Redewendungen unseres Hauses. Nur für alle Fälle. Sie reisen ja auch nicht in ein fernes Land, ohne die wichtigsten Wörter zu kennen, und wo Ihnen nur die landesüblichen Schimpfwörter geläufig sind.
Wie immer Sie das Buch auch lesen möchten – wenn Sie es überhaupt lesen – vergessen Sie am besten alles, was Sie über unsichtbare Freunde zu wissen glauben, und verraten Sie keine der angeführten Blödheiten unserem Wohnhausleiter, dem Herrn Mayerling! Sonst gibt es wieder so eine lästige Vereinbarung oder ein neues IEP-Ziel.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr Theo!
TEO
1. Von Brieftauben und Fleischfliegen
Ein Selbstfahrer war jemand, dem von den Aufsichtspersonen einer betreuten WG zugetraut wurde, seinen täglichen Weg zur Arbeit und von dort wieder zurück alleine und ohne fremde Hilfe zu bewältigen. Dass dem nicht so war, war jedem der Verantwortlichen klar. Übergriffe auf andere Fahrgäste, lautes Pöbeln in den Verkehrsmitteln, meist aber das Gar-nicht-erst-dort-Ankommen und wenn, dann viel zu spät, wurde von ihnen bereitwillig hingenommen und unter dem VorwandIntegration verlangt der Gesellschaft Opfer abknallhart durchgezogen. Auch über die Veruntreuung von Fahrgeld, das statt für Fahrscheine meist für in Fett gebackene Fast-Food-Imbisse ausgegeben wurde, sahen die Diensthabenden gütig hinweg, weil sie entweder zu sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt waren, keine Lust hatten, da zu sein, wo sie gerade waren, oder es ihnen einfach egal war. Ich bin so ein Selbstfahrer, und mein Name ist Theo. Theo Baldauf aus der Schweiz mit eigenem Fahrausweis, rotem Selbstfahrerkapperl und einem unsichtbaren Freund.
Vergessen Sie alles, was Sie bisher über unsichtbare Freunde gehört haben oder gar zu wissen glauben, denn es gibt sie.
Sie heißen meist Herbie, Bunny oder einfach nur unsichtbarer Freund. Meiner hieß James Bond und er wohnte mit mir in einer betreuten Wohneinheit, Nähe Wienfluss in Wien Penzing an der Grenze zum viel nobleren Hietzing. „Ein betreutes Wohnhaus?“, fragen Sie sich jetzt sicher. Ja, ist der Theo denn nicht ganz klar im Kopf? Ist er sehr wohl, doch habe ich vor einigen Jahren meinen Verstand abgegeben, um ein betreutes Leben ohne Sorgen und vor allem ohne Verantwortung führen zu können. Verloren hab’ ich ihn nicht, sondern ihn bei meinem Einzug ins WH14 gegen einen unsichtbaren Freund eingetauscht. Zur Auswahl standen damals James Bond, Hans Orsolics, Roy Black, ein Schäferhund oder Chris Lohner. Da war mir 007 von allen am liebsten, und bis heute habe ich meine Entscheidung keinen Tag bereut. Meine Arbeitstage verbrachte ich zu einem beträchtlichen Teil am U-Bahnsteig Wien Längenfeldgasse, wo Sie mich bis vor Kurzem noch um die Mittagszeit antreffen konnten. „Alles einsteigen! Zug fährt ab!“, rief ich durch meine beiden Mikrofone, die mir mein Wohnheim zur Verfügung stellte. Manch einer behauptete, es seien bloß die Kartonröllchen zweier Klopapierrollen. Da sehen Sie wieder, wie ahnungslos manche Menschen sind. Ohne James hätte ich am Bahnsteig nur die Hälfte von dem, was hier gesprochen wurde, verstanden. Er erklärte mir die Wörter, die ich nicht kannte. Sie müssen wissen, ich bin nicht in Wien, sondern in der Schweiz aufgewachsen. In der schönen Schweiz! Darum verstand ich so manches Wort nicht, das man in Wien Meidling verwendete. James kannte sie alle und nahm sich immer die Zeit, sie mir zu erklären. Manchmal sogar auf Schwyzerdütsch. Dann kicherten wir beide und hielten uns die Hände vor unsere Gesichter. Seine Anwesenheit gab mir Mut und Kraft, meiner täglichen Aufgabe gewissenhaft und zur Zufriedenheit aller nachzukommen. Ich sah mich als eine Art U-Bahn-Coach. Ein Therapeut hätte ich sein können, ein guter Zuhörer war ich allemal. Ich hätte mich auch nach Ottakring oder nach Liesing stellen können, doch war mir die Klientel der Längenfeldgasse lieber. Da waren zunächst die Schüler und Schülerinnen der großen Berufsschule und deren Oberlehrer und Oberlehrerinnen, die immer sehr laut und meist schon betrunken ihren Arbeitstag begannen. Die Schüler waren nur laut und rauchten Zigaretten, die sie hinter ihren Rücken versteckten, um sie dann an ihre Mitschüler weiterzureichen. Weiters traf man hier auf Menschen, deren Sprache weder ich noch James verstand, auf Menschen, die es immer sehr eilig hatten, auf schöne Frauen und auf Frauen, die Kinderwägen vor sich herschoben, Stoppeln in den Ohren hatten und dabei auf ihr Telefon starrten, auf Geschäftsmänner und auf Frauen mit kleinen Hunden. Manche Menschen waren immer hier. Sie wohnten, schliefen, aßen und betranken sich hier. Die meisten ignorierten mich, wenige grüßten mich. Meist die, die hier in der Gegend wohnten und die mich schon jahrelang kannten. Die merkte ich mir dann und versuchte, sie das nächste Mal zuerst zu grüßen. Das war so ein Spiel von mir. Ein sogenanntesMerkspiel zum Mitdenken, ein Service der Längenfeldgasse. Einige von ihnen sah ich in letzter Zeit gar nicht mehr. Wahrscheinlich waren sie verstorben oder machten Urlaub in der Schweiz, ich wusste es auch nicht. In meinem Wohnhaus lebten sehr außergewöhnliche Menschen, und stets war ein Zivildiener anwesend, der meist langes Haar trug, immer zu spät kam und zum ersten Mal in seinem Leben eine Waschmaschine bedienen musste, ein Oberbetreuer oder eine Oberbetreuerin, der/die dann die Nacht über blieb, und ein/-e Betreuer/-in, der/die verschwand, bevor die Abendshow im Fernsehen begann. Meine Erlebnisse, die ich tagsüber mit James hatte, interessierten hier niemanden. Anfangs habe ich noch versucht, Geschichten, die mir der Herr mit dem dicken Wintermantel von Bahnsteig 2 erzählte, den Betreuern mitzuteilen, habe aber rasch bemerkt, dass das zu nichts führte. Enttäuscht habe ich es mir irgendwann einmal angewöhnt, nur noch Sätze wie „Da rein und da wieder raus“ oder „Des waß I a net“ von mir zu geben. Viel mehr erwartete hier niemand von mir. Anschließend setzte ich mich dann meist vor das TV-Gerät in unserem Gemeinschaftsraum, zerrte an meinen Hosenbeinen, bis sie rissen und der Betreuer mir neue kaufen musste und gab dumme Kommentare zu dummen Fernsehsendungen von mir.
Nun war ich zugegeben nicht mehr der Jüngste, trotzdem kerngesund und fühlte mich auch so, war lebensfroh und recht umgänglich, mochte kleine Kinder, Katzen, Brieftauben, Bienen wegen der Sache mit dem Honig, Hunde, alle anderen Menschen, vor allem aber Singvögel und Wölfe. Fleischfliegen mochte ich nicht. Seit meinem Einzug ins Wohnheim Wien 14 ging es mir merklich besser als zuvor. Ich aß wieder regelmäßig und schlief zumindest sechs Stunden am Stück. Nach dem Aufwachen blieb ich meist noch im warmen Bett liegen, wälzte mich von links nach rechts und wieder zurück, spielte an mir selbst herum und dachte dabei an die Werkstättenleiterin, die Frau Ladstätter, die ich an diesem Tag noch sehen würde, bis der völlig übermüdete Nachtdiensthabende unfreundlich mein Zimmer betrat und mich anschrie, weil ich wieder einmal ins Bett und auf den Boden gepinkelt hatte. Im Stehen, wohlgemerkt. So viel verrate ich Ihnen. Im Stehen und mit voller Absicht, weil ich den Betreuer Speer Roman nicht leiden konnte. Er schlief in jedem seiner Nachtdienste im Wohnraum, 1. Stock, gleich neben meinem Zimmer, obwohl es im Erdgeschoss einen eigenen Betreuerraum gab, der ihm zur Verfügung stand. Er war stets schlecht gelaunt, rauchte in einem Nachtdienst zwei Schachteln Zigaretten und verputzte eine 300 Gramm Tafel Milka Schokolade, die für alle gedacht war, ganz alleine. Sehr gierig und rücksichtslos, Herr Speer Roman! Ich hörte ihn immer, wenn er onanierte und leise stöhnte, bevor er sich schlafen legte. Seine schlechte Laune, die von seiner Unzufriedenheit gegenüber sich selbst und seinem ichbezogenen Leben herrührte, ließ er ungeniert an seiner Freundin und Kollegin, der Sabine Krämer, seinen anderen Kollegen oder an uns Bewohnern aus. Oft mit üblen Schimpfwörtern sogar, die ich Ihnen ersparen möchte. Ich mochte ihn nicht, hätte ihm am liebsten ins Gesicht gepinkelt, wenn er noch schlief, und wäre dann schnell in mein Zimmer abgetaucht, aber das traute ich mich damals nicht.
Ich versuchte, einen beschämten Eindruck zu machen, wenn er mein Bett frisch überziehen und den Boden aufwischen musste, bevor ich mich anzog, mein rotes Käppchen aufsetzte, mir zwei Klopapierrollen in meine abgenutzte Aktentasche steckte und mit James das Haus verließ. 1:0 für mich, Herr Speer!
2. Donnerstag war Pflegetag
Wie jeden Tag fuhr ich auch heute wieder drei Stationen in der fast leeren U-Bahn zur Längenfeldgasse. Wenn die Waggons so voll waren, dass immer jemand an mich anstieß, ließ ich die U-Bahn fahren und wartete auf die nächste. Manchmal dauerte das den ganzen Vormittag. Zu meinem Glück war heute nicht so viel los. Am Bahnsteig Längenfeldgasse angekommen, bezog ich umgehend meinen Arbeitsplatz, wie ich den Platz zwischen den beiden Säulen neben einer U-Bahn-Stahlbank, auf der ich meine Aktentasche abstellte, nannte. Gleich dort, wo sich die Mistkübel befanden. Als ich gerade dabei war, meine Kartonröllchen zum Einsatz zu bringen, kam ein Mann mittleren Alters auf James und mich zu. Er erinnerte mich an Roland, einen meiner Mitbewohner, nur war er viel gepflegter und viel besser gekleidet. Ein richtiger Gentleman und besser in allem gegenüber Roland. Sie müssen wissen, in unserer Wohngemeinschaft war jeden Donnerstag Pflegetag, doch hielten sich manche Bewohner nicht an diese Regel. Hielten sich nicht an das, was ausgemacht war und eingefordert werden konnte. Machten frech ihre eigenen Pläne, anstatt sich an ihre individuellen Entwicklungs- und Förderkonzepte zu halten. Eigentlich mussten am Donnerstag alle duschen, Haare waschen und Fingernägel schneiden. Immer donnerstags, weil da Frau Maria, die Fußpflegerin kam, um uns die Zehennägel zu schneiden. Und, wenn man aus der Badewanne kommend, sich zu Frau Maria setzte, ging das gleich in einem Aufwaschen, wie uns das unser Wohnhausleiter, Herr Johannes Mayerling, einst beigebracht hatte. Wie beim Schlachten der Kühe in St. Marx. Einer nach dem anderen und niemand kam davon. Gut durchdacht, Herr Mayerling! Er war einer der wenigen Menschen, der großes Interesse daran hatte, dass wir stets sauber gewaschen waren und einen gepflegten Eindruck machten. Die Bewohner wären die Visitenkarten unseres Hauses, und er müsste dafür geradestehen, erklärte er bei so manchem Gespräch mit einem seiner Kollegen. Spätestens bei der jährlichen Zahnkontrolle merkte dann auch er, dass es seine Kollegen mit seinem Konzept der Sauberkeit nicht so genau nahmen wie er. Von den Bewohnern selbst ganz zu schweigen. Die Frau Gerlinde dagegen war immer sauber und roch stets nach frischen Veilchen. Wie einst Kaiserin Sisi. Sie nahm den Pflegetag ebenso ernst wie ich. Sie roch viel besser und erschien mir viel gepflegter als der Speer Roman. Der hätte auch einmal einen Pflegetag einlegen können, so wie der manchmal gerochen hat. Jeden Donnerstag, wenn Frau Gerlinde von ihrer Werkstätte heimkam, lief sie durch das Wohnheim und rief: „Donnerstag ist Pflegetag!“ Und das so lange, bis die Fußpflegerin ihren Platz bezog und auf den ersten Fuß wartete. Die beiden verstanden sich ausgezeichnet und manchmal verplauderten sie sich sogar. Frau Maria packte dann ganz schnell ihre Scheren und Schaber, ihre Raspeln und Schäler, ihre Zwicker und Ausstecher in ihre große Tasche und fuhr nach Hause. Sie wollte die Show sicher auch nicht verpassen oder einfach nur schnell weg von da. Frau Gerlinde und ich waren so etwas wie ein Paar. So wie Mann und Frau, wie man sie auf der Straße oft sieht, aber nicht so, wie Sie jetzt denken. Nein, nein, geküsst wurde nicht! Wir tanzten gerne zu Silvester den Donauwalzer und hatten eine Vorliebe für Süßspeisen, Mehlspeisen, Nachspeisen und Torten jeder Art. Frau Gerlinde war auch Selbstfahrerin. Das verband uns. Und was glauben Sie, was der Beranek Georg jeden Donnerstag machte? Ganz genau! Er drückte sich so lange vor der Fußpflege, bis ihn der Mayerling aus seinem Zimmer holte, wo er sich am liebsten unter seiner Decke versteckte, er dann als Letzter bei der Fußpflege antreten musste und den Anfang der Fernsehshow verpasste. Eine Show war alles, was um 20:15 auf ORF 2 im Fernsehen lief. Und wer nach Beginn der Sendung einen Platz auf dem Sofa vor dem Fernsehgerät ergattern wollte, hatte meist kein Glück und musste sich die Heimatmusik im Stehen ansehen. Kam immer zu spät, lernte nichts dazu. Dein Problem, Beranek! Und ausgeschimpft wurdest du auch noch. Selbst eingebrockt, lieber Georg! Dein Versteckspiel hatte sich ja wieder einmal ausgezahlt. Pech gehabt, Herr Forcher! Sie mussten wieder einmal ohne den Herrn Beranek anfangen. Mir war das nur recht. Nach einem harten Arbeitstag und der anschließenden Körperpflege konnte ich auf sein nervöses Herumgehopse ohnehin gut verzichten und in Ruhe dem Singverein Hermagor zuhören.
Zum Glück hatte der Mayerling heute Nachtdienst und nicht der Roman! Da war nicht so ein Durcheinander, und zu essen gab es auch etwas Gutes. Der Mayerling war der Oberste von den Betreuern. Er war der Chef von allem, war für alles verantwortlich, baute ständig irgendetwas um, kannte sich mit der Verrohrung des Hauses ebenso gut aus wie mit Metroeinkäufen und Zehnerschraubenziehern. Er überwachte die aufgestellten Regeln und forderte ständig irgendetwas ein, wie er immer sagte. Die meisten Regeln, an die wir uns hier halten mussten, waren ganz akzeptabel. Nur wenige, wie zum BeispielKüchendienst, hielt ich für übertrieben und befolgte sie auch nicht. Nicht, weil sich an diese Regel keiner unserer Bewohner hielt, vielmehr sah ich nicht ein, dass ich die Küche in einer betreuten Wohngemeinschaft selbst putzen sollte. In einem guten Restaurant spülen Sie ja auch nicht Ihr Geschirr selbst, wenn Sie mit dem Essen fertig sind. Und sagen Sie jetzt bitte nicht: „Ein Wohnheim kann man nicht mit einem guten Restaurant vergleichen.“ Ich müsste Ihnen antworten: „Sie wissen ja gar nicht, wie recht Sie haben.“ Nicht einmal mit irgendeinem Restaurant. Um ehrlich zu sein, konnte man die Küche in unserer WG mit nichts vergleichen, was auch nur im Entferntesten mit Speisen im eigentlichen Sinn zu tun hatte. Vielleicht gab es im unentdeckten südasiatischen Raum Regionen, wo ähnlich gekocht wurde wie in unserem Wohnheim, mein Mitleid gälte den dort lebenden Menschen. Vor allem, wenn Roman Speer Dienst hatte. Lange hatte ich keine Ahnung, was ich da immer runterwürgte, wenn der kochte. Es schmeckte nach nichts mit einem besonders ekelerregenden Nachgeschmack. Ich habe mir dann einmal etwas von dem Zeug absichtlich auf mein Hemd gepatzt und dieses dann am nächsten Tag in die Werkstatt angezogen, um herauszufinden, was für ein ekelhaftes Zeug das war. Die Ladstätter entdeckte mich als Erste. „Hallo, Theo! Wie siehst denn du aus? Hat es bei euch gestern wieder Letscho gegeben?“ Letscho! So hieß das Dreckszeug also. Diese Pampe mit Romans Kochkünsten zubereitet kam einer gustatorischen Schändung gleich. Nie zuvor wurde die Kulinarik mit solch einem Armageddon konfrontiert und so erbarmungslos mit Füßen getreten. Eine Verhöhnung jedes einzelnen Geschmacksnervs, eine schier unbezwingbare Herausforderung für den menschlichen Magen. Für jeden Magen. Jeder Thailänder, jeder Chinese, jeder Russe und jeder fettleibige Amerikaner, der mehr Ungenießbares und Unverdauliches in seinem Leben zu sich genommen hatte als ein Wasserbüffel, jeder Inuit hätte das Weite gesucht. Lieber hätte ich bei jeder Mutprobe egal was mit verbundenen Augen gegessen, als noch einmal dieses Teufelszeug. Ich war mir sicher, dass auch Tiere Abstand von Romans Saufraß gehalten hätten, auch Säue. Was um Himmels willen konnte man beim Auftauen eines gefrorenen Gemüseriegels falsch machen, du Pfeife? Bisschen Wasser in den Topf, kleine Stufe, Letscho rein, Deckel drauf und eine halbe Stunde später essen. Roman verzichtete auf das Wasser, drehte den Herd auf Stufe zwölf, warf den gefrorenen Letschoblock in den Kochtopf und ging dann auf die Terrasse rauchen. Wenn der Gestank von verbrannten Tomaten und verkohlten Paprika das Dachgeschoss erreicht hatte, kam dann meist der Roland die Stiegen herab, streichelte verlegen seinen Bart und meldete dem Roman, dass er da oben am Ersticken sei, er seine Hand vor Augen nicht mehr sehen könnte, er nur noch schwer Luft bekäme und ob der Roman vielleicht das Letscho vom Herd nehmen könnte. Ob er das denn nicht gleich selbst tun könnte, wenn er es eh schon sehen würde, bekam der Roland dann zur Antwort und hörte dann noch, wie der Roman ungeniert meinte: „Der ist immer noch so unselbstständig. Ich weiß nicht, ob der so bald eine Trainingsküche bekommen sollte.“ Der Roland nahm dann den glühend heißen Topf vom Herd und verbrannte sich dabei regelmäßig die Finger.
Der Roland war ein besonders anständiger und liebenswerter Mitbewohner. Nicht so wie der Georg Beranek oder der Walter. Er hielt sich immer an die Regeln. Das freute den Mayerling, weil er ihn besonders gern mochte. Ein super Kerl, der Roland! Ich könnte Ihnen ganz genau sagen, wer die Regeln am häufigsten brach und sich an gar keine Vereinbarung hielt und wer diese Regelbrecher waren, tue es aber nicht. Ich verpetze niemanden. Aber nur so viel, es waren immer dieselben.
Das hieß Walter, Rainer und Georg Beranek. Immer dasselbe mit denen. Da könnte ich Ihnen Sachen erzählen. Das waren drei Lausbuben. Machten immer das, was sie nicht sollten, und was sie sollten, machten sie nicht. Der Beranek Georg war der Allerschlimmste. Was glauben Sie, was der wohl machte? Kaffee, Kaffee, Kaffee! Sonst hatte der Kerl nichts im Kopf. Von früh bis spät trank er ganz starken Bohnenkaffee, der ihm nicht guttat. Überhaupt nicht. Machte ihn ganz hibbelig, das Zeug. Und dann ging er allen auf die Nerven. Das ging so lange, bis er es übertrieb und einer weinte oder, wie wir sagten,auszuckte. Und Pflegetag war für den Herrn Beranek ohnehin ein Fremdwort.
Dieser Mann am Bahnsteig hingegen duschte sicher jeden Tag. Rasiert war er auch. Er sah mich an, dann lächelte er und ich tat es ihm gleich.
„Sie sind immer da, stimmt’s?“, wollte der Herr mit alkoholgetränkter Stimme von mir wissen.
„Jo, jo“, antwortete ich ihm höflich, wobei ich das zweite „Jo“ in höherer Tonlage als das erste aussprach. Das macht man so in der Schweiz. In der schönen Schweiz! Ich zwinkerte James zu.
„Ich seh’ Sie jeden Tag, wenn Sie da stehen und durch ihre Klopapierrollen ‚Achtung, Achtung! Zug fährt ab!‘ rufen. Sie san lustig!“
„Jo“, antwortete ich ihm kurz und lächelte. Manche meiner Bezugspersonen behaupteten, ich hätte ein Lächeln, das sie an das von Stan Laurel erinnerte. Sollte mir recht sein.
„Wissen Sie …“, fuhr er angetrunken fort, während er auf einer Bank neben mir Platz nahm.
Er öffnete seine schwarze Aktentasche, nahm eine Flasche Schnaps heraus und nahm einen kräftigen Schluck.
„Wissen Sie, werter Herr, was die größte Lüge der Menschheit ist?“ Er starrte auf die gegenüberliegende Reklametafel, und es schien, als würde er sich in Gedanken verlieren. „Die Liebe, werter Herr, und glauben Sie mir, ich muss es wissen. Ich hab’ mir als Scheidungsanwalt in kürzester Zeit ein Haus mit Garten im Vierzehnten, einenPorsche Carreraund ein Motorboot für meine Kroatien-Inselrundfahrten erstritten. Schuldenfrei, wohlgemerkt.“
Ich sah ihn fragend an.
„Schuldenfrei bedeutet, dass es ihm gehört, dass er sich von niemandem Geld leihen musste, um sich das alles zu finanzieren“, erklärte mir James, der unbemerkt neben dem Herrn auf der U-Bahn-Bank saß.
„Jeder glaubt, sie ist das erstrebenswerteste Ziel im Leben. Soll ich Ihnen etwas verraten? Beim Arsch, Herr Karl! Ein Wirtschaftsfaktor und vieles andere ist sie, aber sicher nicht das erstrebenswerteste Ziel im Leben. Und nächste Woche wirdmeineEhe geschieden. Ich arbeite zu viel, sagt sie. Dabei waren die Kinder und sie der einzige Grund weshalb ich so viel …“
Er redete noch bis nach Mittag auf mich ein, und als er seine Flasche leer getrunken hatte, schlief er auf der Bank ein. „Armer, trauriger Mann“, flüsterte ich James zu. „Komm, Theo“, meinte der und lächelte sanft. „Lass uns nach Hause gehen.“ „Wollen wir dem netten Herrn nicht helfen?“, wollte ich verwundert von meinem Freund wissen. „Wenn es um die Liebe geht, kannst du niemandem helfen, mein Freund. Damit muss jeder selbst klarkommen.“ Ich sah ihm in die Augen und wusste, dass er es ernst meinte.
Wir sprachen nicht viel, als wir den Heimweg antraten. Nur, dass es wieder einmal spät geworden war und er mit mir noch über etwas sprechen wollte.
3. Protokoll der Liebe
„Lass mich dir etwas über die Liebe erzählen, mein Freund“, begann James, als er sich zu mir an mein Bett setzte. Ich war gerade dabei, dem Mond, der in mein Zimmer schien, gute Nacht zu sagen. „Ist die Liebe nicht das Schönste, das es auf der Welt gibt?“, glaubte ich zu wissen. 007 schmunzelte und nippte an seinem Martini, den er sich jeden Abend schüttelte. „Ich habe bemerkt, wie sehr dich die Geschichte des netten Mannes heute mitgenommen hat.“ „Er schien so hilflos und schwach, obwohl er so gepflegt und schön anzusehen war“, antwortete ich. „Gebrochennennt man das, Theo. Er war gebrochen. Das kann nur die Liebe. Sie kann dich zum stärksten Menschen machen, der je auf Erden gelebt hat, oder zum bemitleidenswertesten Lebewesen, das die Welt je gesehen hat“, fuhr er fort.
„Sie ist das ewige Rätsel. Energiespender, Retter aus dem dunklen Tal der Einsamkeit, alles leicht und unbeschwert, sorgen- und angstfrei, ein unbeschreibliches Gefühl. Ein lebensverändernder Einfluss, ein Fluss, in dem manche wohlig baden, andere hilflos absaufen, und wieder andere gehen erst gar nicht hinein, aus Angst vor den Folgen, oder weil sie nicht schwimmen können. Anfangs passt es immer. Juhu! Endlich jemanden gefunden, der dich gern hat, so wie du bist, und der Himmel hängt voller Geigen. Alle sind glücklich, freuen sich, sprechen laut, haben rote Wangen und es gibt Torte und belegte Brötchen, weiße Tauben fliegen herum, Reis auch, lachende Gesichter und die Verwandtschaft kommt zu Besuch und tanzt. Die Zukunft wird geplant, ein neues Zuhause gesucht, die Samstagnachmittage in Einrichtungshäusern verbracht, meist in der Küchenabteilung, dort auch erste Unstimmigkeiten wegen einer Eismaschine, die du gerne hättest, sie nicht, aber gleich wieder alles gut, dann eben nicht, schnell ein Bussi. Eure Freunde lernen sich kennen, Silvester gemeinsam und eine Woche im Sommer-Pärchenurlaub – so schön!
Meist aber steckt etwas ganz anderes hinter dem ewigen Liebesschwur, wie, den Hund als Kind verloren (weggelaufen, nicht wiedergekommen – leb wohl, Hund!) und nie darüber hinweggekommen, wiedergefundene Mutterliebe, kleinstes gemeinsames Übel, Sex, der nach Jahren des Kennenlernens auch nur noch einer lästigen, feuchten Nebensache gleichkommt, aufgrund von Trieben, Gelüsten und Vorlieben (hierzu zählen u. a. Verkleidungen, sehr beliebt der Postbote, der Installateur, der Arzt, die Hure, die Oberstufenlehrerin, die Haushälterin, Rollenspiele, Sich-weh-Tun oder Latex-Bondage-Schaukeln, bei gebildeten Schichten oft indische und orientalische Einflüsse), aber trotzdem vollzogen wird. Als Regel gilt: Je gebildeter die Liebenden, desto ferner das Land, dessen Sexpraktiken angewendet werden. Finanzielle Vorteile, Nicht-alleine-Sein/Nicht-kochen-Können, angekommen sein oder ein unerfüllter Kinderwunsch, den sie seit ihrem zweiten Lebensjahr hat, als sie damals die Puppe zu Weihnachten geschenkt bekam.
Aber keiner sieht die Schattenseiten der Liebe! Niemand warnt einen vor den Gefahren, die mit ihr einhergehen. So warnt mittlerweile jede Zigarettenpackung vor den Auswirkungen des Nikotinkonsums, niemand aber fragt, warum der Abhängige überhaupt zu rauchen begonnen hat. Wahrscheinlich trug es sich so zu, dass er seine erste Zigarette vor dem anstehenden ersten Date rauchte, um seine Nerven zu beruhigen, bis schließlich die Zigarette das Einzige war, woran er sich nach Jahren der Liebe festhalten konnte. Die berühmte Zigarette danach. ‚Liebe erhöht das Risiko für Schlaganfälle. Fangen Sie erst gar nicht damit an!‘, müsste auf den Packungen stehen.
Bei Drogen und Alkohol fehlt meist die Verpackung, daher auch kein abschreckendes Bild, doch wären die Suchtkranken ohne Liebeskummer wohl nie auf die Idee gekommen, das Zeug jemals anzugreifen, das sie heute langsam umbringt. Verkehrsunfälle, weil der Lenker noch schnell eine Liebes-SMS an seine Geliebte schreiben wollte … wollte. Morde aus Eifersucht, Rachsucht oder welcher Sucht auch immer, die ohne die Liebe nie passiert wären. Sie schlägt meist dann zu, wenn du nicht mit ihr rechnest, wie einer der Halunken, die ich immer ausschalten musste. Schleicht sich feige von hinten an dich heran und streichelt zärtlich deinen Nacken, bevor sie zupackt und du dich nicht mehr wehren kannst. Meist erwischt es nur einen der beiden und anfangs bemerkst du nichts.“ „Nichts?“, fragte ich mit offenem Mund nach. „Gar nichts, wie Frau Dvorsky sagen würde“, antwortete 007. „Erst, wenn es zu spät ist und du hilflos wie ein Karpfen am Ufer des idyllischen Sees zappelst, wird dir klar, dass es keinen Sinn mehr macht, sich zu wehren und du ihr hilflos ausgeliefert bist. Wie nach dem Biss eines Komodowarans. Der Unterschied ist nur, dass der dich anschließend auffrisst, wenn du mit Blutvergiftung darniederliegst, kaum noch atmen kannst und nur noch ein Funke Leben in dir ist. Die Liebe frisst dich auf, bisdunur noch der Funke Leben bist.
Bediente sie sich in früheren Zeiten großer Kriege, die hunderttausenden unschuldigen Menschen das Leben kostete (siehe auch J. Cäsar vs. Cleopatra, Trojanischer Krieg, Indianer, div. Eingeborenenstämme auf Papua-Neuguinea oder Bandenkriege wie zum Beispiel der in der Westside-Story), bis nicht etwa eine Armee über die liebesberauschten Feldherren siegte, sondern der Verstand.
Nein. Die Liebe arbeitet heute anders, raffinierter, differenzierter, zielsicherer.
Herzinfarkte, denen ein gebrochenes Herz zugrunde liegt, das man sich einmal geholt hat und nun sein Leben lang mit sich rumschleppen muss, Krebsgeschwüre aufgrund unbehandelter Entzündungen im Magen-Darm-Trakt oder sonst wo, die man ohne die Nebenwirkungen der Liebe erst gar nicht hätte. Ganz zu schweigen von den Erinnerungen, die alte Wunden immer und immer wieder aufreißen, wieder bluten lassen, schmerzen. Wie zum Beispiel das eine Lied. Das eine Lied, das dich immer noch zu Tränen rührt. Das eine Lied! Immer noch, nach all den vielen, vielen Jahren. Und obwohl … ‚jetzt eh alles gut läuft‘ und ‚eh alles wieder passt‘, es immer noch ein Gefühl von Geborgenheit und Unbesiegbarkeit in dir auslöst, dich immer noch verstummen und so ganz anders werden lässt, immer noch … Wahnsinn! … Rums! … Auffahrunfall! … Schädelbasisbruch, sofort tot. Und im Radio läuftThe long and winding road.
Geschlechtskrankheiten und Selbstmorde, von denen man ohne die Liebe verschont geblieben wäre. Hierzu zählen auch Selbstmorde, die aus falsch verstandener und fehlgeleiteter Liebe zu Gott passieren und die von der Verteilung eines Selbst auf belebten Plätzen bis hin zu Flugzeuglandungen in bewohnten Türmen reicht.
Liebe ist nicht schön. Sie verletzt, blendet und macht uns schwach. Sie lässt uns nicht essen, nicht schlafen und nicht klar denken. Sie macht uns zu Lügnern. Nichts mitewiges Rätseloderstärker als der Tod. Nichts mitbis dass der Tod euch scheidet, das machen die blauäugig Verliebten schon selbst und früher, viel früher, als ihnen lieb ist und sie es sich vorstellen können.
Ein paar fehlgeleitete Endorphine, die uns immer wieder eine falsche Realität vorgaukeln, ähnlich einem Drogenrausch, das ist Liebe. So lange, bis man sich mit dem abgefunden hat, was man hat. Besser als alleine zu sein, besser als wieder suchen oder selbst kochen zu müssen, ganz zu schweigen von dem gemeinsamen Bankkonto, dem Kredit, dem Auto, dem Hund und den Kindern. Da lobe ich mir die stinknormale Freundschaft ohneausgreifm(vonausgreifenvgl. dazuDer Ausgriff – pubertärer Lustgewinn oder Mittel zum Abbau innerer Konflikte).
Einer sang vor langer ZeitAll you need is love, undLove of my lifeein anderer. Beide tot. So wie dieser Romeo.“
„Aber wieso soll ich dann ein guter Mensch sein, wenn nicht wegen der Liebe?“, wollte ich verwundert von meinem Freund wissen. „Ein guter Mensch zu sein, ist völlig überbewertet“, antwortete er und sah nachdenklich aus dem Fenster.
„Gutes zu tun macht keinen Spaß“, fuhr er fort. „Es mag dein Leben erfüllen oder deinen Selbstwert steigern. Spaß haben gute Menschen selten. Eine Bank auszurauben birgt von vorne herein ein gewisses Maß an Spannung, Unterhaltung und die Möglichkeit auf Reichtum, mit dem man ja in späterer Folge auch Gutes tun kann. In Aktien investieren oder in einer Stiftung parken und den Gewinn dann zu den hungernden Kindern schicken. Immer noch besser, als den gut versicherten Banken das Geld zu überlassen, die es ohnehin nur auf Kosten der Kunden verspekulieren und ihren Managern überhöhte Provisionen auszahlen. Selbst der Diebstahl eines gehobenen Mittelklassewagens erfreut das menschliche Gemüt mehr, als Gaumenspalten in Kenia zu operieren. Wie befriedigend erst müssen Banküberfälle sein, deren Erlös dem gaumenspaltenoperierenden Arzt in Kenia zufließt.
Gutes zu tun, völlig selbstlos, verträumt und, wenn es geht, mit einem Lächeln im Gesicht kostet Zeit, Geld und viel Kraft. Kraft, die dir dann anderswo fehlt. Warum also ist es dir ein so großes Bedürfnis als guter Mensch anerkannt zu werden? Wegen der Sehnsucht nach Liebe, mein lieber Theo. Du strebst nach Anerkennung, Geborgenheit und Selbstbestätigung. Durchwegs plausible, wenn auch rein egoistische Gründe. ‚Das ist ein großartiger Mensch‘ soll man über dich sagen, oder ‚Sie haben aber ein großes Herz, Herr Theo‘. Und dann freust du dich und fühlst dich gut.“
„So, so“, nickte ich. „Wollen wir jetzt etwa eine Bank ausrauben?“
„Darüber sprechen wir ein anderes Mal“, antwortete James.
„Und jetzt mach deine Augen zu und schlaf. Morgen ist Freitag und da triffst du wieder den Herrn Pfarrer. Gute Nacht, mein Freund!“
Wir lächelten uns noch einmal zu, bevor mir die Augen zufielen und ich einschlief. Das machten wir schon immer so.
4. Der Herr Pfarrer und weshalb es so wichtig war, mitzudenken
Da kam er auch schon. Der Herr Pfarrer. Gut sah er aus. Er hatte zwar schon eine Glatze und einen dicken Ziegenbart mitten im Gesicht, aber das stand ihm gut, machte ihn erhaben über uns Sünder. Seinem Akzent nach zu schließen, kam er aus einem baltischen Land oder aus Polen. Die meisten Pfarrer, die ich kannte, kamen aus Polen. Entweder waren die Polen so gläubig, oder sie reisten für ihr Leben gerne in andere Länder, um von Gott zu erzählen. Alles, was mit der Kirche zu tun hatte, erfüllte mich mit großer Ehrfurcht. Weil der da oben alles sieht. Alles! Sie wissen, was das heißt. Auch die Blödheiten. Und derer hatte ich in meinem Leben wahrlich genug angestellt. Darum war ich zu Mitarbeitern der Kirche besonders freundlich. Ob Klosterschwestern oder Pfarrer, selbst zu den schön gekleideten Männern und Frauen mit den bunten Bibelheftchen, die immer fragten: „Kennen Sie die Heilige Schrift?“ Ich begrüßte sie alle besonders höflich, wenn sie mir begegneten. Man wusste ja nie. Wenn der Papst im Fernsehen auftrat, stand ich aus meinem Ohrensessel auf und faltete bedächtig die Hände. Er war der Oberste von allen Pfarrern und von allen Klosterschwestern und von allen überhaupt. Er durfte in einem schönen, weißen, kugelsicheren Auto mitfahren und sprach vor sehr vielen Menschen sehr wichtige Worte. Meist auf Lateinisch mit polnischem Akzent.
Der Herr Pfarrer hatte einen nicht so direkten Draht zum Lieben Gott wie der Papst, aber schon auch, weil er den ganzen Tag betete. Ich sah ihn immer nur freitags. „Grüß Gott!“ Ich verbeugte mich. „Grüß Gott!“, antwortete er, und ging stumm an mir vorbei. So ein netter Mann! Er erinnerte mich an den Pfarrer aus dem kleinen Schweizer Ort, in dem ich aufgewachsen war. Wissen Sie, ich konnte mich nur noch schwer an Sachen und Dinge meiner Kindheit erinnern. Fast alles weg. Oft wünschte ich mir nichts sehnlicher, als mich an mehr erinnern zu können. Das machte mich dann sehr traurig und das sah man mir auch an. Manchmal sah ich im Fernsehen Dinge, die mich an früher erinnerten. An die Zeit in der Schweiz. Die … schöne … Schweiz. Und dann war ich plötzlich wieder ganz jung, spielte am Heuboden Winnetou, wurde von der Hedi und der Tante Gerti von vorne bis hinten bedient und es roch nach frisch gebackenen Krapfen. Die Speisen wurden mit echtem Schweineschmalz zubereitet und zu essen gab es … Kennen Sie die Schweizer Küche? Ich sage nur Zogglä, Capuns, Meitschibei. Soll ich Ihnen mehr sagen? Na bitte! Ich darf gar nicht daran denken. „Iss, mein Theo, iss! Es ist genug da“, hat die Hedi immer gesagt, und ich hab gefolgt. Daher rührte auch mein Übergewicht.
An den Herrn Pfarrer aus dem kleinen Örtchen (fragen Sie mich bitte nicht nach dessen Namen), konnte ich mich sehr gut erinnern. Und an die sonntägigen Kirchenbesuche mit meiner Ziehmutter, der Hedi. Wir mussten dafür jedes Mal über eine Stunde in das nächstgelegene Dorf wandern. Egal bei welchem Wetter. Sommer und Winter. Oft waren wir völlig durchnässt, als wir dann endlich in der Kirche ankamen, aber die Hedi und ihre Schwester, die Gerti, schien das nicht weiter zu stören. Es war mir fast so, als hätten sie sogar Gefallen daran, frierend und zitternd vor Kälte dem Gottesdienst beizuwohnen. Als ob das alles dann besser wirken würde, wenn man sich unwohl fühlte. Ein bisschen so wie … Er.
Der Herr Pfarrer stand immer ganz vorne auf einem kleinen Schemel, damit ihn die wenigen Anwesenden besser verstehen und vor allem sehen konnten. „Derherrseimiteuch!“ – „Und mit deinem Geiste!“, hallte es dann durch das Gotteshaus. Ich stand meistens hinten links, weil man sich dort bequem an den Beichtstuhl anlehnen konnte. Man musste nur achtgeben, ihn nicht umzuwerfen, weil er eher einem Paravent glich als einem Beichtstuhl. Vier zusammengenagelte Holzplatten, mit Trennwand und Holzgitter, damit der Herr Pfarrer beim Abnehmen der Beichte den Sünder nicht so gut sehen und objektiver über dessen Strafmaß entscheiden konnte. Er wäre sonstbefangengewesen wie ein Richter und hätte zum Beispiel sagen können: „Tut mir leid, Eva Adamski (Ich kenn’ gar keine Eva Adamski, nur als Beispiel, und weil der Name so gut in die Kirche passt.). Ich habe dich erkannt und möchte nichts von deinen Ehebrüchen und Garstigkeiten wissen, weil ich morgen deinem Mann, dem Adam (auch frei erfunden), beim Abstechen der Sau helfen muss. Und vielleicht kann ich nicht dichthalten. Befangenheit!“ Das hätte der Herr Pfarrer sagen können. Und wenn die arme Frau jetzt das Zeitliche gesegnet hätte, wäre sie als garstige Ehebrecherin vor den Schöpfer getreten, und das wünschte ich nicht einmal dem Georg, dem Beranek. Ewige Verdammnis, Höllenfeuer, heiß ist es dort auch in der Nacht, das konnte ich schon gar nicht leiden. Schlechtes Essen, wahrscheinlich kocht der Roman und es gibt jeden Tag Letscho. Probleme, nichts als Probleme.
Obwohl ohnehin jeder wusste, wer wer war, und was, wer, wann, wo gemacht hatte. Aufgrund der Bauweise hörte man auch durch die dünnen Holzwände jedes Wort. Man hätte den Beichtstuhl also getrost verheizen und die Schandtaten nach der Kommunion dem Herrn Pfarrer zurufen können. Es wäre sich gleichgeblieben. Wenn er dann sagte: „Gebt nun einander zum Zeichen des Friedens die Hände!“, dann wusste ich, gleich war es geschafft. Das war mir der liebste Teil an der ganzen Messe. Das freundliche Grüßen. Mit Handschlag. Und das Der-Friede-sei-mit-dir-Sagen. Wie schön das klang.
Einmal ist der Herr Pfarrer zu uns auf den Hof gekommen, um eine Kuh zu segnen. Ich wurde an diesem Tag schon sehr früh von Tante Gerti geweckt, gründlich gebadet, schön frisiert und bekam meine erste Trachtenlederhose angezogen. Was eine Tracht ist, wissen Sie? Wissen Sie! Gut!
In der Schweiz war eine Tracht etwas Besonderes. Die zog man nur zu besonderen Feierlichkeiten an. Und dann besoff man sich, tanzte und jodelte und machte Musik mit zwei Akkorden. Alles in der Tracht. In der Tracht empfingen wir auch den Herrn Pfarrer und sein Gefolge. Gerade, als er das Tor öffnete, lief die Kuh an mir vorbei und ich gab ihr einen Klaps auf den Hintern. Blödheiten, wie gesagt. Der Kuh war das völlig gleich, nur hat der Herr Pfarrer alles gesehen. Fast wie der da oben. „Theo! Komm doch einmal zu mir, mein lieber Theo“, sagte er mit sanfter Stimme. Ich folgte artig. „Warum hast du die Kuh geschlagen? Glaubst du denn, die Kuh spürt das nicht?“ Ich wusste die Antwort, sah ihn aber nur schuldbewusst an und sagte kein Wort. Ich hatte ohnehin schon verloren, war ohnehin schon alles egal. „Tu niemandem weh, Theo. Keinem Menschen und auch keinem Tier.“
„Aber es war doch nur ein kleiner Klaps, Herr Pfarrer“, bemerkte ich kleinlaut. „Wenn die Kuh jetzt ausgebrochen wäre und jemanden verletzt hätte, wie stark wäre dann dein kleiner Klaps gewesen?“ Er sah mir in die Augen. Sein Blick hatte etwas Sanftes, etwas Beschützendes, etwas Starkes. „Immer mitdenken Theo, immer mitdenken!“, er zwickte mich mit seinen dicken, weichen Fingern ganz vorsichtig in meine kleine Nase, bevor er sich der Kuh zuwandte, Gott für die Kuh, im Namen der Kuh Gott dankte und sie schließlich segnete. Ich dachte damals, wenn man sich ganz leicht in die Nasenspitze zwickt, schaltet man das Mitdenken ein. Und weil mir nie jemand das Gegenteil beweisen konnte, tu ich das bis heute.
Zwei Monate später wurde die Kuh verkauft, geschlachtet und aufgegessen.
Mitdenken, darum ging es also im Leben. Wenn man mit-denkt, denkt man, während man handelt. Man handelt also nicht unbedacht, nicht fahrlässig, weil voll bei der Sache, und bekommt alles in vollen Zügen mit. Mit allen Sinnen. Man erspart sich dadurch dasVor-denkenund, viel wichtiger, dasNach-denken, weil man im Jetzt ist und sofort die hoffentlich richtige Handlung setzt. Mitdenken! Danke, Herr Pfarrer, bis heute bin ich Ihnen für dieses Lehrstück dankbar. Es hat mich mein Leben lang begleitet und ich habe das Mitdenken mittlerweile so gut trainiert, dass ich viele meiner Pläne einfach verwarf, um ohne ihnen keinerlei Erfolgsdruck mehr zu unterliegen, geschweige denn Gefahr zu laufen, an irgendetwas zu scheitern.
Nachdenken ist das Allerschlimmste. Vergessen Sie es. Habe es ausprobiert. Völlig sinnlos, bringt nichts. „Gar nichts“, wie meine Freundin, die Frau Gerlinde, sagen würde. Machte nur traurig und ändern konnte man es ohnehin nicht mehr. Und wenn, dann nur durch Mitdenken.
Ob der Herr Pfarrer wohl den Pfarrer aus meinem kleinen Schweizer Dorf kannte?
6. Es wär dann wegen der Hosen
Um es kurz zu machen und es ihnen gleich zu sagen, aus dem Hosenkauf wurde nichts.
Haben Sie sich schon gedacht, nicht wahr? Zugegeben, in manchen Dingen war ich sehr berechenbar. Vor allem, wenn man mich kannte und sich ein bisschen mit mir beschäftigte. Und wenn man mich kannte, kam man erst gar nicht auf die Idee, mit mir Hosen einkaufen zu gehen. Das ständige An- und Ausziehen, das Anprobieren, das Warten, die Verkäuferin, die es nie lassen konnte, sich über mein Breiten-Größen-Verhältnis zu wundern, und das alles wegen drei Stück bequemer Jogginghosen. Im Falle vonC&Anur Jogginghosen. BeiC&Akaufte man ein, wenn man eine Hosebrauchte. Nicht, weil man einewollte. Man kaufte dort keine schöne Hose, man kaufte eine Hose. Auch kaufte man dort keine modische Winterjacke, man kaufte eine Winterjacke. Mütter gingen gerne mit ihren Kindern dort einkaufen, wenn sie ihre Kinder nicht mehr mochten, der Meinung waren, es wäre ohnehin egal, wie sie gekleidet wären, und dass ein Markenprodukt es auch nicht besser machen würde. Es gab Modehäuser, deren Sinn es zu sein schien, kein Modehaus, sondern ein Haus zu sein.
Jetzt könnten Sie glauben, der Thomas, mein Bezugsbetreuer, mochte mich nicht, weil er mir den jährlichen, beschwerlichen Gang zuC&A