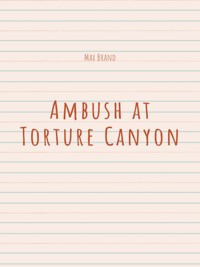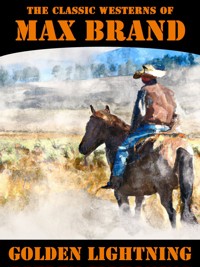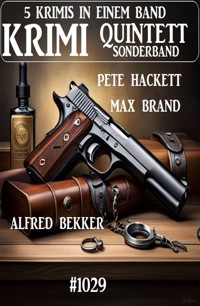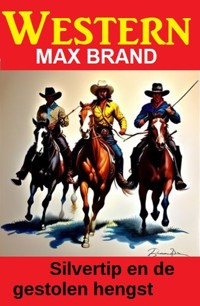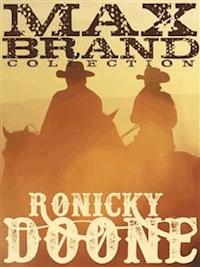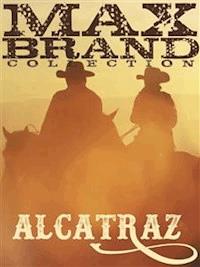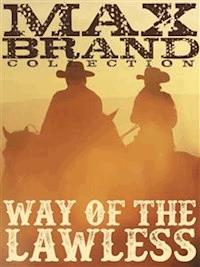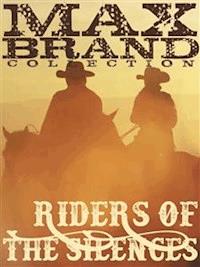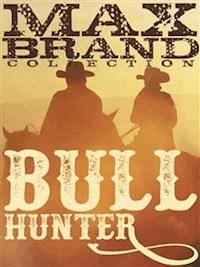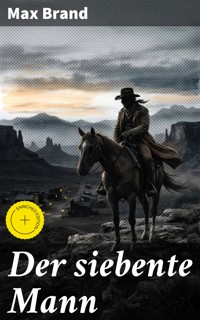
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In "Der siebente Mann" entfaltet Max Brand eine packende Erzählung, die in die Tiefen der menschlichen Psyche eindringt und die komplexen Verstrickungen menschlicher Beziehungen untersucht. Mit seinem meisterhaften literarischen Stil schafft Brand eine dichte Atmosphäre, die sowohl dramatisch als auch introspektiv ist. Der Leser wird in eine Welt hineingezogen, in der die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen und die Charaktere mit ihren inneren Dämonen ringen. Die Erzählung ist geprägt von einem ausgeprägten Sinn für Spannung und einer eleganten Prosa, die den Leser dazu zwingt, die Motivation und die dunklen Geheimnisse der Figuren zu hinterfragen. Max Brand, bekannt als einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, war ein Meister der Erzählkunst, der sich intensiv mit Themen wie Identität, Moral und menschlichen Fehlern auseinandersetzte. Seine vielfältigen Erfahrungen als Journalist und Abenteurer prägten seinen scharfen Blick auf die menschliche Natur und flossen in die lebendigen Charaktere und fesselnden Plots seiner Werke ein. Brands persönlicher Hintergrund und seine Leidenschaft für das Geschichtenerzählen machen ihn zu einem einzigartigen Chronisten der menschlichen Erfahrung. "Der siebente Mann" ist ein unverzichtbares Werk für Leser, die sich für psychologische Dramen und tiefgründige Charakterstudien interessieren. Es bietet nicht nur eine fesselnde Erzählung, sondern regt auch zur Reflexion über die eigenen moralischen Entscheidungen und die Natur der menschlichen Beziehungen an. Entdecken Sie ein Buch, das sowohl unterhält als auch zum Nachdenken anregt – ein echter Klassiker der Literatur. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Der siebente Mann
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Zwischen dem einsamen Gesetz des Einzelnen und der unerbittlichen Ordnung einer rauen Gemeinschaft spannt sich ein unsichtbares Seil, an dem in diesem Roman jede Entscheidung zerrt, bis Mut, Schuld, Loyalität und die verführerische Freiheit der offenen Landschaft zu einer Spannung verwoben sind, die sich nicht in einer simplen Wahl auflösen lässt, sondern mit jedem Schritt, jedem Blick über die endlose Ebene und jeder Begegnung an der Grenze zwischen Zivilisation und Wildnis stärker wird und die Figuren zwingt, ihr Innerstes offenzulegen, ohne dass die Welt ihnen den Trost klarer Antworten gewährt, und die Leserinnen und Leser zugleich herausfordert, die feinen Verschiebungen von Recht, Rache und Verantwortung in einer schönen Weite mitzuvollziehen.
Der siebente Mann ist ein Westernroman von Max Brand, dem Pseudonym des amerikanischen Autors Frederick Schiller Faust, und verortet seine Handlung im mythisch überhöhten, zugleich konkret geschilderten amerikanischen Westen. Das Buch entstammt der Ära der Pulpliteratur und erschien in den frühen 1920er Jahren im Umfeld populärer US-Magazine, bevor es in Buchform publiziert wurde. Diese Herkunft prägt Tempo, Fokus und Bildsprache, ohne die erzählerische Feinheit zu mindern. Weite Ebenen, karge Bergketten und kleine Siedlungen bilden die Bühne, auf der Gesetzeshüter, Siedler und Grenzgänger agieren – eine Welt, in der die Grenze zwischen Ordnung und Eigenmacht porös bleibt.
Zu Beginn zeichnet der Roman ein Gemeinwesen, das wachsam und verletzlich zugleich ist: Gerüchte, unausgesprochene Drohungen und die Erinnerung an frühere Gewalt liegen in der Luft. In diese gespannte Atmosphäre tritt eine einzelne, schwer zu fassende Gestalt, deren Auftauchen Erwartungen weckt und alte Ängste aufruft. Ein Vorfall, scheinbar klein, hat weitreichende Folgen und setzt Bewegungen in Gang, die Männer aufsatteln, Freundschaften prüfen und die Landschaft in eine Karte aus Möglichkeiten und Fallen verwandeln. Ohne auf plumpe Überraschungen zu zielen, entfaltet Brand die Ausgangslage so, dass Neugier und Beklemmung von Seite zu Seite zunehmen.
Die Erzählstimme bleibt nah an Blicken und Gesten, lässt aber stets genug Raum, damit Leserinnen und Leser die unausgesprochenen Motive selbst erfühlen. Der Stil ist knapp, rhythmisch und von einer bildkräftigen Schlichtheit, die Szenen wie in grellem Sonnenlicht konturiert. Dialoge sind zugespitzt, doch nie manieriert; die Landschaft wirkt wie ein Resonanzraum der Seelenzustände. Im Ton verbindet sich Härte mit leiser Melancholie, Action mit meditativen Passagen. Das Leseerlebnis ist folglich zweigleisig: rasch forttreibend durch äußere Ereignisse und zugleich verlangsamend durch Beobachtung, Atmosphäre und jene moralischen Schattierungen, die erst im Nachhall ihr Gewicht offenbaren.
Im Zentrum stehen Fragen nach persönlichem Rechtsempfinden und der Macht sozialer Regeln: Wer darf handeln, wenn das Gesetz zu spät kommt, und zu welchem Preis? Der Roman verhandelt Loyalität und Verrat, die Trunkenheit der Rache und die Kostbarkeit von Selbstbeherrschung. Er zeigt, wie Ruhm, Gerüchte und Angst Figuren formen, noch ehe sie handeln, und wie die Natur sowohl Zuflucht als auch Richterin sein kann. Das Motiv des einsamen Reiters wird nicht verklärt, sondern in seinen Konsequenzen beleuchtet: Freiheit lockt, doch sie isoliert, und Unabhängigkeit verlangt eine Verantwortung, die niemand delegieren kann.
Darin liegt die fortdauernde Aktualität des Buches: Es untersucht Mechanismen, die jede Gemeinschaft kennt – wie sich Erzählungen verselbstständigen, wie Misstrauen Institutionen überlagern kann und wie schnell Schwarz-Weiß-Denken Konflikte verhärtet. Heutige Leserinnen und Leser begegnen Fragen nach Zivilcourage, Grenzen legitimer Gewalt und dem Preis charismatischer Führung, die über den historischen Rahmen hinausweisen. Gleichzeitig lädt der Roman dazu ein, gängige Vorstellungen von Männlichkeit, Stärke und Ehre zu überprüfen. Die Konfrontation mit einer offenen, riskanten Welt erweist sich als Spiegel unserer Gegenwart, in der Freiheit und Sicherheit ständig neu austariert werden müssen.
Wer zu Der siebente Mann greift, findet keinen musealen Klassiker, sondern eine lebendige, präzise kompositionierte Erzählung, die Spannung ohne Effekthascherei erzeugt und die Komplexität des Handelns ernst nimmt. Ohne auf Vorwissen angewiesen zu sein, öffnet das Buch einen Zugang zur Tradition des Westerns, zugleich zugänglich und vielschichtig. Es bietet gestochen scharfe Szenen, überraschende Ruheinseln und Figuren, die über ihre Rollen hinauswachsen. Gerade diese Mischung macht die Lektüre lohnend: Sie unterhält, fordert und bleibt nachhallend im Gedächtnis, weil sie die alte Frage stellt, wer wir sind, wenn niemand außer uns die Grenze zieht.
Synopsis
Max Brands Roman Der siebente Mann entfaltet eine Westernhandlung, in der die Legende eines nahezu übermenschlichen Einzelgängers auf die verletzliche Ordnung einer Grenzgemeinde trifft. Zu Beginn zeichnet die Erzählung ein Milieu aus Ranches, Weideland und provisorischem Gesetz, in dem Prestige, Mut und schnelle Entscheidungen über Ansehen und Sicherheit bestimmen. Der Protagonist wird als ruhiger, schwer greifbarer Reiter eingeführt, dessen Präsenz sowohl Anziehung als auch Unruhe erzeugt. Mit knappen Bildern und stetiger Bewegung bereitet der Text den Grundkonflikt vor: persönlicher Freiheitsdrang kollidiert mit den Bedürfnissen einer Gemeinschaft, die nach Verlässlichkeit, Schutz und klarer Verantwortlichkeit verlangt.
Der auslösende Vorfall entspringt keinem großen Plan, sondern einem Moment verletzten Stolzes und eines Missverständnisses, das in Gewalt umschlägt. Ein Schuss fällt, und plötzlich wird aus einem privaten Zwist ein öffentliches Ereignis, das die Region elektrisiert. Der Mann, der nicht gesucht hatte, im Mittelpunkt zu stehen, wird zur Zielscheibe: Für manche ist er Bedrohung, für andere Projektionsfläche von Mut, Freiheit und Unbedingtheit. Die Gemeinschaft reagiert mit Wachsamkeit, Misstrauen und Hast; eilige Bündnisse entstehen, während gesetzliche Autoritäten versuchen, Kontrolle zu behaupten und ein Zeichen gegen eigenmächtige Vergeltung zu setzen. Gleichzeitig sickern Geschichten über frühere Taten durch, die das Bild zusätzlich zuspitzen.
Die darauf folgende Jagd treibt Figuren und Landschaft gegeneinander: Reitertrupps durchkämmen Ebenen und Pässe, Spuren werden gelesen, Falschfährten gelegt. Perspektiven wechseln zwischen Verfolgern, die Beute machen wollen oder Gerechtigkeit suchen, und dem Gejagten, der Distanz wahrt und Begegnungen meidet. Persönliche Motive mischen sich in den Auftrag: Ehre, Reue, Groll und die Hoffnung auf Anerkennung. Eine Nebenfigur entwickelt Zweifel daran, ob der eingeschlagene Kurs das Richtige ist, und wird zum moralischen Seismografen. Zugleich zeigt der Protagonist eine Ambivalenz zwischen fast instinktiver Härte und stillen Regungen von Rücksicht, die seine Konturen schärfer, nicht einfacher macht.
Ein bedeutsamer Wendepunkt entsteht, als der Gejagte auf eine Verbindung aus seiner Vergangenheit trifft, die ein alternatives Leben in Aussicht stellt. Für kurze Zeit scheint es möglich, dass Bindung, Fürsorge und ein ruhigerer Alltag den zerstörerischen Kreis der Vergeltung unterbrechen könnten. Doch die Nachrichten holen die Beteiligten ein: Ein sichtlich überhitzter Gegenzug der Verfolger führt zu einer angespannten Pattsituation, die weder Triumph noch Frieden bringt. Diese Episode verschiebt Loyalitäten, stärkt unerwartete Allianzen und macht zugleich deutlich, wie brüchig sie sind. Die Legende nährt sich weiter von Gerüchten, die jede Geste überdehnen.
Je weiter die Verfolgung dauert, desto sichtbarer wird die Erosion beider Seiten. Erschöpfung, Wetter und Fehlentscheidungen treiben die Beteiligten in Grenzsituationen. Ein folgenschweres Missverständnis – die Erzählung bleibt nahe an den Wahrnehmungen der Figuren – verschärft die Lage und entzündet eine neue Runde von Vorwürfen. Zugleich schält sich der Kernkonflikt klarer heraus: Ist der Anspruch auf unbedingte Freiheit mit Verantwortung vereinbar, und wie weit darf persönliche Vergeltung reichen? Die Landschaft erscheint als Spiegel der inneren Zustände, weit und schön, jedoch unbarmherzig gegenüber jedem, der zaudert, weil jede Vertagung die Wucht des nächsten Zusammenstoßes nur erhöht.
Vor dem unausweichlichen Zusammenstoß versucht eine kleine Gruppe, den Kurs zu ändern, sei es durch Vermittlung, durch Umwege oder durch gezieltes Verzögern. Was als Ausweg gedacht ist, lässt jedoch die ohnehin dünnen Fäden des Vertrauens reißen. Die Figuren stehen an einem Punkt, an dem jede Entscheidung Verluste bedeutet: Schutz Unbeteiligter kollidiert mit Loyalität, das Festhalten am eigenen Kodex mit dem Eingeständnis, dass er andere in Gefahr bringt. Die Spannung kulminiert in der Vorbereitung auf ein Zusammentreffen, das Erwartungen bündelt, ohne bereits zu offenbaren, wessen Wille sich am Ende durchsetzen wird.
Der siebente Mann wirkt über seine Handlung hinaus, weil er den Mythos des einsamen Reiters gegen die Ansprüche einer sich ordnenden Welt stellt und beides ernst nimmt. Die Geschichte fragt danach, ob Gewalt sich je endgültig zähmen lässt und welche Kosten ein Leben nach dem eigenen Gesetz für andere bedeutet. Sie bleibt dabei nah an Figuren, Gesten und Landschaft, statt Thesen auszubuchstabieren. So entfaltet der Roman eine nachhaltige Ambivalenz: Er fasziniert durch Freiheitspathos und warnt vor seiner Konsequenz. Was bleibt, ist ein offener Nachklang über Gerechtigkeit, Verantwortung und den Preis der Unbedingtheit.
Historischer Kontext
Der siebente Mann erschien 1921 und ist im fiktiven amerikanischen Westen des späten 19. Jahrhunderts angesiedelt. Dieser Raum war historisch geprägt von County-Sheriffs, U.S. Marshals, territorialen Gerichten und improvisierten Bürgerwehren, daneben von Eisenbahngesellschaften, Viehzüchterverbänden und Bergbaucamps. Saloons und Zeitungen fungierten als soziale Knotenpunkte, Kirchen und Schulhäuser als Symbole der Sesshaftwerdung. Die Topografie – von Prärien und Hochländern bis zu Bergketten – rahmt Mobilität zu Pferd und das Nebeneinander von dünn besiedelten Weiten und aufstrebenden Kleinstädten. In dieser institutionalisierten, zugleich brüchigen Ordnung verortet der Roman seine Konflikte zwischen individueller Freiheit und gemeinschaftlicher Autorität.
Historisch bildete der „geschlossene“ Frontier den Hintergrund: 1890 erklärte das U.S. Census Bureau die Siedlungsgrenze für verschwunden, 1893 formulierte Frederick Jackson Turner seine Frontier-These, nach der diese Grenzerfahrung die US-Demokratie geprägt habe. In der Folge wuchs eine nostalgische Erinnerungskultur an das angeblich freie Grenzland. Westernromane des frühen 20. Jahrhunderts, darunter Max Brands Werke, reagierten auf diese Deutung, indem sie Räume zeigen, in denen staatliche Institutionen präsent, aber noch nicht allmächtig sind. Der Roman nutzt damit ein Setting, das historisch bereits in Transformation begriffen war und im kollektiven Gedächtnis als Epoche der Bewährung fortlebte.
Max Brand ist das bekannteste Pseudonym des US-Autors Frederick Schiller Faust (1892–1944), der ab den 1910er Jahren in großem Umfang für Pulpmagazine schrieb. Diese billigen Massenhefte – etwa Argosy und All-Story Weekly – prägten die Literaturmärkte der 1910er und 1920er Jahre. Der siebente Mann erschien 1921 in den USA und gehört zu Brands populären Western, die vielfach nachgedruckt und übersetzt wurden. Das Publikationsumfeld bestimmte Stil und Rhythmus: Fortsetzungsdramaturgie, kurze Kapitel, cliffhangerartige Zuspitzungen und klare Bildsprache. So spiegelt das Buch die kommerziellen Bedingungen einer expandierenden Unterhaltungsindustrie, die Leserinnen und Leser landesweit mit standardisierten Genreerwartungen versorgte.
Die im Roman erkennbare Spannung zwischen formeller und informeller Rechtspflege hat reale Wurzeln. Im historischen Westen agierten County-Sheriffs, Stadtmarshals und der U.S. Marshals Service nebeneinander; Territorialgerichte und Geschworenengerichte arbeiteten unter schwierigen Bedingungen. Gleichzeitig beriefen sich Gemeinden auf das Prinzip des posse comitatus, bildeten Verfolgungstrupps und griffen teils zu Lynchjustiz, was zeitgenössische Zeitungen dokumentierten. Zugleich expandierten Versicherungen, Detekteien und Eisenbahnsicherheitsdienste, die Eigentumsschutz betrieben. Diese Rechtsvielfalt lieferte dem Western die Motive von Fahndung, Flucht, Belagerung und Bewährungsprobe – Motive, die auch Der siebente Mann, ohne juristisches Traktat zu sein, in erzählerische Handlung übersetzt.
Ökonomische und technologische Umbrüche der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bilden weiteres Kontextwissen. Der Ausbau der transkontinentalen Eisenbahnen (ab 1860er Jahren) und das Telegrafennetz verdichteten Kommunikation und beschleunigten Waren- und Personenverkehr. Mit dem Homestead Act von 1862 förderte der Bund kleinbäuerliche Ansiedlungen; Stacheldraht, seit den 1870ern verbreitet, beförderte die Abgrenzung privaten Lands und schürte Konflikte zwischen Ranchern und Farmern. Cattle Drives verloren an Bedeutung, als Schienennetze sich ausweiteten. Westernromane inszenierten daraus resultierende Reibungen zwischen Mobilität und Sesshaftigkeit. Der siebente Mann knüpft an diese historisch gewachsene Ambivalenz von Weite, Eigentum und Kontrolle an, ohne konkrete Ereignisse zu bebildern.
Die Erzählmuster des Buches stehen in Tradition der Dime Novels des späten 19. Jahrhunderts und der frühen Filmwestern. Bereits 1903 popularisierte The Great Train Robbery das Genre im Kino; in den 1910er und 1920er Jahren prägten Stars wie Tom Mix das Bild des schnellen, moralisch geprüften Reiters. Aus dieser Kultur stammen Motive wie Prüfungen in Wildnis und Kleinstadt, die „Code of the West“-Ethik persönlicher Verpflichtung sowie musikalische und tierische Begleiter als Identitätsmarker. Max Brand bediente diese Konventionen literarisch, wobei sein energischer, bildhafter Stil dem damaligen Massenpublikum vertraute, visuell geprägte Dramaturgien aufgriff und verstärkte.
Das Erscheinungsdatum 1921 verankert das Werk in einer Übergangszeit der USA. Nach dem Ersten Weltkrieg intensivierten sich Urbanisierung, Massenkultur und technische Rationalisierung; zugleich begann die Prohibition (1920), die Debatten über Gesetz und Moral anfachte. Die Red Scare von 1919/20 und Arbeitskämpfe schärften das Sicherheitsbedürfnis. Western boten hier Gegenbilder: offene Landschaften, überschaubare Gemeinschaften und individuelle Handlungsfähigkeit. Leserinnen und Leser fanden in solchen Geschichten eine Projektionsfläche, um moderne Spannungen – zwischen Regelbindung und Selbstbestimmung, Gemeinschaftspflicht und persönlichem Ehrbegriff – zu verhandeln. Der siebente Mann adressiert diese Stimmungen, ohne explizite Zeitbezüge zu setzen.
Als Kommentar zu seiner Epoche fungiert Der siebente Mann, indem er das idealisierte Grenzland nutzt, um Fragen nach Legitimität von Gewalt, Loyalität und Recht zu stellen. Der Roman verbindet kommerziell geprägte Unterhaltung mit Themen, die seit der Frontier-Schließung den US-Diskurs strukturieren: die Grenzen des staatlichen Zugriffs, die Verantwortung des Einzelnen und die Kosten des Ruhms. Ohne den Ausgang zu verraten, zeigt die Handlung, wie fragile Ordnungen an charismatischen Figuren geprüft werden. Damit trägt das Buch zur interwar-zeitlichen Konsolidierung des Westernmythos bei und spiegelt zugleich die Sehnsucht nach Klarheit in einer beschleunigten, widersprüchlichen Moderne.
Der siebente Mann
Erstes Kapitel. Frühling
Ein Mann unter Dreißig braucht Verkehr. Es tut nicht gut, wenn das lebendige Strömen seines Lebens von einem langen Stillschweigen aufgestaut wird wie von einem Damm – es kommt der Tag, wo der Strom entweder den Damm durchbricht oder ihn überflutet, und je stärker das Hindernis war, desto verhängnisvoller und zerstörender ist schließlich der Augenblick, in dem die gestauten Wasser sich ihre Freiheit erkämpfen. Vic Gregg war noch auf der gefährlichen Seite der Dreißig und diesen ganzen Winter über hatte er allein oben in den Bergen leben müssen. Er wollte Betty Neal heiraten, aber zum Heiraten braucht man Geld und deshalb hatte Vic sich den Duncans als Goldgräber verdingt. Sie zahlten ihm fünfzehnhundert Dollar dafür. Aber anstatt sich einen Partner zu nehmen, wollte er das ganze Geld allein verdienen. Es muß schon ein Kerl von besonderem Schrot und Korn sein, der in ein paar Monaten für fünfzehnhundert Dollar Minenarbeit tut, ohne eine Hilfe zu haben, aber Gregg bildete tatsächlich eine von jenen Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Er erledigte die Probebohrungen an vierzehn Plätzen, wo die Duncans Schürfrechte erworben hatten, und war jetzt mit dem fünfzehnten »Claim[1]« auch beinahe zu Ende. Aber er zahlte auch dafür. Die Einsamkeit fraß sich in ihn wie eine Säure. Gewiß war ihm von klein auf das tiefe Schweigen der Einöde, die Stille inmitten der ragenden Gipfel vertraut, die nur manchmal von einem feierlich dahinrollenden Echo unterbrochen wird, aber trotzdem lastete gegen Ende dieser langen Einsiedlerzeit jeden Abend, wenn er von der Arbeit heimkehrte, das Gefühl der Beklemmung schwerer und schwerer auf ihm. Noch ein paar Tage und er war so weit, daß er anfing, mit sich selbst zu sprechen. Es ging ein Wandel mit ihm vor, aber so langsam und unmerklich, daß er sich selbst der Gefahr nicht bewußt wurde. Hätte er einen Spiegel besessen, so hätte er es an diesem Morgen sehen können. Er stand an der Tür seines selbst gezimmerten Unterschlupfs. Es war noch beinah Nacht, der Wind zerrte an dem Hemd, das faltig um seinen von der Arbeit ausgedörrten Körper hing. Seine Stirn war gerunzelt. Auch dieses angestrengte Zusammenziehen der Augenbrauen war ihm allmählich zur Gewohnheit geworden. Ein hageres Gesicht, Augen, die dicht beieinander saßen und eine zurückweichende Stirn, die davon sprach, daß man es mit einer einschichtigen Natur zu tun hatte, einem Mann, der immer nur einen einzigen Zweck im Leben kennt und der über hundertundachtzig Pfund eiserner Muskeln und stählerner Sehnen verfügt, die seinen Wünschen Nachdruck verleihen. So sah Vic Gregg aus, als er vor der Tür stand und wartete, bis der starke Kaffee, den er eben getrunken hatte, die letzten Spinnweben des Schlafs aus seinem Gehirn verjagt hatte.
In diesem Augenblick hörte er einen Adler schreien.
Der Ton schnitt wie ein Messer durch die Nacht der Schlucht. Vic fuhr zusammen und warf einen Blick hinter sich. Infolge der vielfältigen Echos hatte es geklungen, als schreie es dicht an seiner Seite. Dann aber blickte er auf und sah, wie dort oben, im ersten Morgenlicht, zwei Adler miteinander im Kampfe lagen. Er wußte, was es bedeutete. Die Paarungszeit begann und die Schlacht der beiden dort oben galt einer besonderen Beute. Sie schossen davon, sie stürmten gegeneinander mit gezückten Krallen und grimmig geöffneten Schnäbeln, sie stürzten in einem wilden Getümmel schlagender Flügel erdwärts, schwangen sich wieder zur Höhe und stießen oben erneut zusammen, bis einer plötzlich die Schwingen einzog und, wie ein Stein fallend, aus dem Morgenlicht dort oben in die Nacht hinunterschoß.
Der Sieger krächzte eine lange Beschimpfung ins Dunkel der Schlucht hinunter. Eine Weile noch kreiste er hoch oben, den kahlen Kopf auf die Seite gelegt, als erwarte er Beifall von dem einsamen Zuschauer dort unten, dann segelte er, ohne einen Flügelschlag, über die Gipfel davon. Eine Feder tanzte langsam durch die Luft und sank dicht vor Vic zu Boden.
Er starrte hin und rieb sich den steifen, schmerzenden Nacken. Er dehnte die Arme. Die von harter Arbeit verkrampften Muskeln lockerten sich. Das Blut floß wieder rasch und warm durch die Adern. Genießerisch schloß er die Augen und tat einen langen wollüstigen Atemzug. Er trat ins Freie hinaus. Jetzt trug er den Kopf höher, sein Herz schien leichter, und als sein schwer genagelter Schuh klirrend auf den Hammer traf, der dort im Grase lag, gab er dem altvertrauten Werkzeug einen Tritt, daß es trotz seines Gewichts sich überschlagend davonflog. Darüber lächelte er still vor sich hin. Er schlenderte an den Rand des kleinen Plateaus und blickte in die tiefeingerissene Schlucht hinab, in der der Asper floß.
In der gähnenden Tiefe fluteten noch blauschwarze Schatten wie ein Meer, obwohl um Vic herum bereits alles im Morgenlicht erglänzte. Zweitausend Fuß tief blickte man hinab, wo in dem Blockhaus eines Trappers ein einsames Licht durch die Nacht blinkte. Aber rasch hielt jetzt die Morgendämmerung auch dort unten ihren Einzug. Noch während Gregg hinunter starrte, verfärbte sich das Blauschwarz, wurde dünner, violett und purpurn. Gregg sah scharfe, schwarze Spitzen daraus auftauchen und er wußte, daß es die Wipfel der Fichten waren. Schließlich sah er auch noch einen Streifen Grasland im Morgenlicht erglänzen.
Auf ihm lag die Stille wie ein dickes Tuch; das Schweigen der Nacht reichte noch weit hinein in den jungen Tag. Trotzdem warf er plötzlich einen Blick über die Schulter, als höre er einen Schritt, auf den er schon lang gewartet hatte. Doch die Resignation kam fast zugleich mit der Erwartung. Es war nichts als sein Heimweh, oder er wußte nicht Bescheid mit sich.
»Ach, der Teufel«, sagte Vic Gregg. »Es ist Frühling!«
Das Echo gab ihm die Worte in dröhnendem Baß zurück und rollte dann dreimal widerhallend die Wände der Schlucht entlang.
»Frühling!« wiederholte Gregg, diesmal leiser, als fürchte er das Echo noch einmal zu wecken. »Verdammt will ich sein, wenn's nicht Frühling ist!«
Seine Gedanken und Wünsche waren in diesem Augenblick anderswo. Sie galoppierten auf Grey Mollys Rücken an den grasigen Ufern des Asper hinunter. Es kostete ihn bitteren Zwang, sich wieder in die Stimmung des geduldigen Goldschürfers zurückzufinden. Er blickte in die Hütte. Da lagen noch seine Decken, zerwühlt, braun von Schmutz. Ihn schauderte, als sein Blick darauf fiel; die Nacht war bitter kalt gewesen. Ehe er einschlief, hatte er das Magazin, in dem er las, in eine Ecke geschleudert. Jetzt spielte der Wind mit den zerfetzten, vergilbten Blättern, und ihr Flüstern sprach zu Gregg von den zehnmal gelesenen Abenteurergeschichten, die sie enthielten. Er sah die Spielhöllen vor sich, in denen der Rauch in dicken Schwaden hing, er hörte den Singsang des Croupiers hinter der Roulette, tiefe Männerstimmen, das Lachen hübscher Mädchen, den Trommelwirbel galoppierender Hufe, Gebrüll, wie es nur der brennende Whisky des Westens auslösen kann. Er schnüffelte, die Luft in seinem Verschlag war nur vom Geruch verbrannten Specks und eben gebrauten Kaffees erfüllt. Er blickte rechts hinüber und sah seine außer Dienst gestellten ausgefransten Arbeitshosen mit den Löchern an den Knien. Er blickte nach links und starrte seinem verrosteten alten Wecker ins Gesicht. Das rasche, leise Ticken verursachte ihm ein plötzliches Gefühl des Überdrusses und der Müdigkeit, das ihm wie ein Schmerz durch die Glieder schoß.
»Was ist bloß mit mir los?« murmelte er. Selbst diese leisen Worte dröhnten gespenstisch laut durch die Hütte und ein neuer Schauer überlief ihn. »Ich glaube, bei mir geht bald 'ne Schraube los.«
Als müsse er seinen eigenen Gedanken entrinnen, trat er wieder in die Sonne hinaus. Das warme Licht war nach der eisigen Dunkelheit der Baracke so wohltuend, daß er lächelnd zum Himmel hinaufblickte. Ein Westwind wehte und trieb geschäftig eine zersprengte Herde dicker weißer Wolken über die Gipfel herein, geballte Kissen, deren Ränder wie durchsichtiges Silber leuchteten und hinter denen lange, weiße Dunstschleier den Weg bezeichneten, den sie gekommen waren. So tauchten sie weißschimmernd tief unten am blauen Himmel auf und zogen in lockerer Formation ins Tal des Asper hinunter, wo ein Teil von ihnen liegenblieb, wie mächtige Eisgipfel emporragend, während andere Wolken sich wie Vorberge um ihren Fuß gruppierten. Die Hauptmasse des Wolkengebirges aber wich dem Tale aus und entschwand langsam seinem Blick, ostwärts, wo – wie er wußte – das Städtchen Alder lag.
Für Vic Gregg war Alder Athen und Rom zugleich, das Schulhaus war seine Akropolis und Captain Lorrimers Kneipe sein Forum. Mochten andere Leute von größeren Städten zu erzählen haben, Alder genügte, um Vics Phantasie zu beflügeln; außerdem war Grey Molly jetzt dort unten beim Grobschmied auf der Weide, und Betty Neal gab Unterricht in der Schule. Sein Blick folgte den Gebirgszügen, die dort hinüberliefen, folgte den Wolken, die nach Alder hintrieben. Und die lang angestaute Flut in ihm rüttelte am Damm, sprengte ihn in Stücke und brauste in die Freiheit hinaus. Er mußte ganz einfach nach Alder hinunter, endlich einmal einen Schluck trinken, einem Freund die Hand schütteln, Betty Neal küssen! Dann konnte er wieder zurückkommen! Zwei Tage hinunter, zwei Tage herauf und drei Tage, um sich auszutoben – es kostete ihn schließlich nur eine einzige Woche.
Nicht zwei Stunden vergingen, da hatte Vic Gregg seine gewichtigeren Ausrüstungsgegenstände sorgfältig versteckt, das Allernotwendigste auf einen Esel geladen und war unterwegs.
Um Mittag war er bereits unterhalb der Schneelinie und in den Randbergen. Hinter ihm stiegen die Gipfel fast bis zum Firmament, in kaltes, winterliches Weiß gekleidet, aber hier unten war es nicht mehr zu bezweifeln, daß der Frühling gekommen war. Hier und da mußte er über geschwätzige kleine Wasserläufe, die den größten Teil des Jahres über trocken lagen, jetzt aber von der Schneeschmelze gespeist wurden. Wo das Wasser kleine ruhige Kessel bildete oder wo eine flachere Stelle war, streckte frischgrüne Wasserkresse lange Zungen bis in die Strömung vor, und manchmal entdeckte Vic auf dem feuchten Grund, unter einer schützenden Erdwelle, Rasenflecke, die dick mit Veilchen übersät waren.
»Voran, Mame,« rief er, »'s ist höchste Zeit, daß wir nach Alder kommen.« Er packte seinen Knüttel und versetzte dem Esel in überströmender guter Laune ein paar Klapse. Mame, der Esel, bewegte unwillig den Schwanz und legte eins seiner langen Ohren zurück, um zu hören, was sein Herr ihm zu sagen hatte, aber er beschleunigte sein Tempo nicht. Er hatte von je nur eine einzige Gangart gekannt, und wenn Vic ihm Püffe versetzte, so war es mehr, um eine Art gemeinsamer Unterhaltung zustande zu bringen, als in der Erwartung, die Reise zu beschleunigen.
Zweites Kapitel. Grey Molly
Wenn Mame, der Esel, irgendwie für Enthusiasmus empfänglich gewesen wäre, hätte er die Reise pünktlich und fahrplanmäßig zurücklegen können, aber Mame war eben nur ein Esel und höchstens dazu fähig, einen Packen zu schleppen, der gut halb so schwer war wie er selbst, von einer Handvoll Futter zu leben, bei dem selbst eine Geiß verhungert wäre, und in Zeiten der Dürre auf fünfzehn Meilen Entfernung Wasser zu wittern. Eile dagegen war ein Wort, das er nicht kannte, und infolgedessen war es nicht Morgen, sondern bereits Spätnachmittag, als Gregg mit ihm Murphys Pass passierte und hoch über Alder aus den Gebirgen herauskam. Wie auf Verabredung machten sie beide halt, und Mame klappte eins seiner langen Ohren vorwärts, als lausche er dem Rauschen des Doanefluss[2]es. Zu ihren Füßen beschrieb das schäumende braune Wasser einen weiten Bogen, und an dieser Stelle, planlos hingestreut, hier ein riesiger Felsblock, dort zur Abwechslung ein Haus, lag das Städtchen Alder. Es bestand aus erstaunlich gebrechlichen Gebäuden. Man wunderte sich, daß sie nicht unter den Schneelasten des Winters zusammengebrochen waren, daß der Doanefluß nicht eine lange gierige Zunge ausgestreckt und das ganze Nest krachend in die Strömung hinabgefegt hatte. Ein Haus glich dem andern wie ein Ei, aber Vics Blick drang durch die altvertrauten Dächer. Er sah in Witwe Sullivans wacklige Hütte, in Hezekiah Whittlebys in feierliches Schweigen gehüllte »Gute Stube« hinein, er sah sogar den ewig feuchten, schmutzigen Fußboden in Captain Lorrimers Kneipe, aber sein erster und letzter Blick galt der kleinen Flagge, die in leuchtenden Farben über dem Dach des Schulhauses knatterte; die bedeutete etwas für Vic. Sie sprach: »Dies ist deine Heimat!«
Mame ließ sich zu einem ganz ordentlichen Zuckeltrab herbei, als es den letzten Abhang hinunterging. Im Zuckeltrab und mit einem protestierenden Schnaufen bei jedem Schritt ging es durch die einzige lange, gewundene Straße des Orts. Pfeifend kam Vic hinterher. Wenn er in der Stadt war, wohnte er bei seinem Freund Dug Pym, der eine Bodenkammer für ihn reserviert hielt. Und so ging's jetzt geradeswegs nach Dug Pyms Haus.
Der alte Garrigan war in seinem Gemüsegarten und gackerte hinter ihm her, doch Vic begnügte sich damit, ihm zuzuwinken und eilte weiter. Vorbei auch an Gertie Vincent, die ihm sehnsüchtig nachrief (Gertie Vincent war »sein Mädel« gewesen, ehe Betty Neal nach Alder gekommen war); vorbei auch mit heldischer Entschlossenheit an der Veranda von Captain Lorrimers Kneipe, obwohl Lorrimer selbst einen Gruß herunterbrüllte und »Chick« Stewart vielsagend über die Schulter hinweg mit dem Daumen nach der offenen Kneipentür deutete. Er machte erst halt, als er die Schmiede erreicht hatte und sah zu Dug hinein, der sich gerade abmühte, Simpsons unruhigem Rotschimmel ein rotglühendes Eisen anzupassen.
»He, Dug!«
Pym hob die berußte, schweißbedeckte Stirn.
»Du bist's? Still, verdammtes Biest! Hallo, Vic!« Er stemmte den Hinterhuf des unruhigen Tieres gegen seinen Schenkel und streckte Vic die Hand entgegen.
»Laß dich nicht stören, Dug, ich kann jetzt doch nicht bleiben; 's einzige, was ich will, ist ein Lasso. Ich will Grey Molly einfangen.«
»Verdammter roter Teufel!« – dies galt dem Pferd – »Da drüben hängt ein Lasso, Vic. Du wirst nicht viel Arbeit haben, um Molly einzufangen. Die ist jetzt zahm wie ein Lamm. Steh' doch still, verdammtes Vieh! Der ist von 'ner Rasse, die keine Spur von Verstand im Kopf hat! – Wohin so eilig, Vic? Zur Schule hinauf?«
Mit einem Grinsen auf dem schweißbedeckten Gesicht blickte er Vic nach, der mit dem Lasso auf der Schulter die Schmiede verließ. Als Vic nach dem Wohnhaus hinüberkam, drückte ihn Nelly Pym liebevoll an ihren umfangreichen Busen; bei ihrem Fett und ihren vierzig Jahren durfte sie sich dergleichen schon herausnehmen. Sie blieb auch unten an der Treppe stehen und unterrichtete ihn, nach der Dachkammer hinaufbrüllend, wo er sich in fieberhafter Hast rasierte und in seine besten Kleider zwängte, über alles, was man sich im Städtchen erzählte. Er antwortete höchst einsilbig und beinahe ohne hinzuhören.
»Bist du mit deiner Arbeit fertig, Vic?«
»Keine Spur.«
»Richtig dünn geworden bist du von der vielen Arbeit. Ich hoff nur, dein Leichnam ist damit einverstanden.« Sie kicherte. »Krank bist du nicht gewesen, was?«
»Keine Spur.«
»Weißt du schon, wen wir jetzt hier haben? Sheriff Glass!«
Er zerrte gerade wütend an einem Stiefel, der ihm gut anderthalb Nummern zu klein war, aber trotzdem war das eine Nachricht, die auch sein inneres Ohr erreichte.
»Pete Glass!« wiederholte er. Dann: »Hinter wem ist er her?«
»Keine Ahnung. Vic, er sieht gar nicht so bösartig aus, wie man sich vorstellt.«
»Er ist bösartig genug«, versicherte Gregg von oben. »Ah–h–h!«
Er hatte den Fuß glücklich in den Stiefel hineingezwängt, aber seine Zehen standen Folterqualen aus.
»Well«, rumpelte es von unten, – Mrs. Pym schien in philosophische Überlegungen vertieft –: »Denke, just die Burschen, die so ruhig aussehen, sind von der gefährlichen Sorte. Aber wenn du dir Glass ansiehst, würdest du dir's nie träumen lassen, daß er so vielen das Lebenslicht ausgeblasen haben soll. Weißt du schon von dem Ball?«
»Keine Spur.«
»Drunten bei Singer wird heute getanzt. Geht Betty mit dir?«
Er riß die Tür ganz auf und bellte zu ihr hinunter: »Mit wem soll sie sonst gehen?«
»Immer sachte mit die jungen Pferde«, sagte Mrs. Pym. »Ich weiß wirklich nicht, mit wem sie sonst gehen sollte. Tiptop siehst du aus mit dem roten Hemd, Vic!«
Er grinste halb besänftigt und halb beschämt und verschwand wieder in seiner Kammer. Gleich darauf humpelte er unbeholfen die Treppe hinunter. Seine Stirn war gerunzelt, er fragte sich, ob es ihm gelingen werde, in solchen Stiefeln zu tanzen.
»Ich fühl' mich so komisch in den ungewohnten Kleidern. Wie seh' ich aus, Nelly?« Er stand jetzt unten im Flur und drehte sich langsam um seine Achse, um sich bewundern zu lassen.
»Wie ein junger Prinz. Da kannst du Gift drauf nehmen.« Und als er durch die Haustür hinausschoß, brüllte sie ihm noch nach: »Gib ihr noch einen Kuß auf meine Rechnung, Vic.«
Vic stand schon im Mittelpunkt der kleinen Pferdekoppel und legte die Schlinge seines Lassos zurecht. Die drei Pferde, die hier gegrast hatten, fegten in federndem Galopp rundum, den Zaun entlang, als suchten sie nach einem Weg zur Flucht. Das ganze Doanetal hinauf und das Aspertal hinunter gab's kein Tier, das Grey Molly einholen konnte, wenn sie loslief wie jetzt. Vics Augen strahlten vor Stolz, als er ihr zusah. Er ließ den Lasso über dem Kopf kreisen, und während die anderen beiden Pferde weiter galoppierten und stumpfsinnig in die Gefahrzone hineinliefen, wirbelte Grey Molly herum, wie ein Fuchs, der einen Haken schlägt, und war mit einem Sprung außer Reichweite.
»Braves Tier!« rief Vic unwillkürlich. Er rannte ein paar Schritte. Wieder schoß der Lasso in die Luft, die Schlinge öffnete sich zu einem unregelmäßigen Kreis und schwirrte herab. Der Graue sah die Gefahr, aber es war schon zu spät. Noch ehe er kehrtmachte, glitt die Schlinge ihm über den Kopf. Das Pferd spreizte schleunigst alle Viere, stemmte die Hufe ins Gras und kam nach kurzem Gleiten schnaubend zum Halten. Das erste, was ein Pferd auf der Ranch draußen lernt, ist, daß man besser tut, einen Lasso nicht stramm zu ziehen, wenn die Schlinge um den Hals liegt.
Wenige Minuten später war Grey Molly dabei, sich nach Herzenslust auszubocken. Das muß jedes Cowboypferd, das etwas auf sich hält, wenn es lange Zeit auf der Weide war, ohne arbeiten zu müssen. Es gibt eine hohe Schule des Bockens, und Grey Molly wußte darin Bescheid. Mrs. Pym stand, mit einem breiten Schmunzeln der Bewunderung auf ihrem roten Gesicht, unter der Tür und sah zu. Sie wußte, was ein guter Reiter war, wenn sie ihn sah. Mit einemmal hörte das Toben auf und das Tier stand wie ein Standbild mit stolz erhobenem Kopf, bebend vor Energie, mit gespitzten Ohren. Gregg warf seinem Liebling mit halblauter Stimme ein paar zärtliche Flüche an den Kopf. Er verstand das Tier, er kannte es von den Fesseln bis zu den Zähnen.
Draußen kamen schrille Kinderstimmen die Straße herunter. Die Schule war aus. Vic mußte sich beeilen, wenn er mit Betty nach Hause reiten wollte. Er winkte Mrs. Pym einen letzten Gruß zu und trabte davon. Seit zwei Tagen hatte er sich fieberhaft auf das Zusammentreffen mit Betty gefreut, den ganzen Winter über hatte er sich nach ihr gesehnt. Jetzt, wo der Augenblick näher und näher kam, wurde er schwach. Das war immer so, wenn er dem Mädchen in die Nähe kam. Nicht etwa, daß ihre Schönheit ihn überwältigt hätte, wenn sie auch mit ihrer strotzenden Gesundheit und ihrem netten, sommersprossigen Gesicht hübsch genug war. Aber er hatte Betty gewählt, wie ein Indianer sich einen Feuerstein zu seinem Stahl sucht. Aus Betty Neal ließen sich Funken schlagen. Wenn er weit von ihr entfernt war, liebte er sie, ohne zu zweifeln und ohne an ihr irre zu werden. Sein Vertrauen strömte zu ihr hin wie ein Fluß, der seinen Weg zum Weltmeer sucht. Er wußte, ihr Herz schlug so stark und treu für ihn wie das Herz keines anderen Wesens auf der Welt, Grey Molly ausgenommen. Aber in ihrem Benehmen war sie wetterwendisch, und wenn er ihr nahe kam, wurden Unbehagen und Mißtrauen immer wieder in ihm wach.
Drittes Kapitel. Streit
Auf dem Weg zur Schule begegnete er Miss Brewster – denn die Schule in Alder konnte sich zweier Lehrkräfte rühmen –, und ihr freundliches, ein wenig altjüngferliches Lächeln löste in ihm ein beinah überwältigendes Bedürfnis aus, abzusteigen und sie ins Vertrauen zu ziehen, sie zu fragen, was Betty Neal die langen Wintermonate über getrieben habe. Statt es zu tun, gab er jedoch Grey Molly die Sporen. Das Tier schoß dahin wie ein Pfeil, der von der Sehne geschnellt wird[1q]. Als Vic so dahingaloppierte und den Wind um seine Schläfen sausen spürte, besserte sich seine Laune wieder, ja sogar so weit, daß er ein Liedchen vor sich hinträllerte, und als er vor der Schule aus dem Sattel schnellte, rief er ein fröhliches »Holla, Betty!« zu den Fenstern hinauf.
Mit einem Satz hatte er die Stufen der Treppe genommen, die in einem scharfen Knick nach oben führte, und war an der Tür: »Holla, Betty!«
Seine Stimme dröhnte durch das Zimmer und löste ein dumpfes, verdrossenes Echo aus. Da saß Betty an ihrem Katheder[3] und starrte ihn entgeistert an. Neben ihr stand Blondy Hansen, großmächtig und schmuck wie immer und beinahe ebenso fassungslos wie Betty. Vic Gregg blickte schnell von den beiden weg. Er fürchtete den nächsten Augenblick. Er sah lieber nach dem kleinen Tommy Aiken hin, der vor der Schultafel stand und eine Rechenaufgabe hinkritzelte – anscheinend mußte er nachsitzen, weil er während des Unterrichts mit seinem Nachbarn geflüstert oder sonst ein tödliches Verbrechen begangen hatte. Tommys Mundwinkel waren bedenklich nach unten gezogen, denn er hörte von draußen die fröhlichen Stimmen der Klassenkameraden, die auf dem Heimweg waren.
Vic machte halt, um seine Fassung halbwegs wiederzugewinnen. Er faßte an seinen Gürtel und schob den Pistolenhalfter an eine Stelle, wo er bequemer zu erreichen war, dann riß er den Sombrero vom Kopf und stolzierte den Gang hinauf, der zwischen den Bänken zum Katheder führte. Jedes Gefühl in ihm, jede Fiber war zu Eis erstarrt. Die Luft selbst schien voll von irgendeinem Geheimnis, das Betty und diesen jungen Hansen miteinander verband. Betty war aufgesprungen. Sie lief ihm jetzt entgegen. Sie nahm seine Hand. Ihre plötzliche Nähe verschlug ihm den Atem. Etwas schmolz in ihm.
»Na, Vic, bist du jetzt mit allem fertig?«
Vic wurde steif und zurückhaltend. Er mußte doch Hansen und Tommy Aiken imponieren.
»So ziemlich bin ich fertig«, sagte er beiläufig. »Dachte mir, ich komme auf ein, zwei Tage nach Alder hinunter und verpuste mich ein bißchen. Holla, Blondy! Tag, Tommy!«
Der kleine Tommy Aiken antwortete mit einem Grinsen, das aber blitzschnell wieder erlosch. Er war nicht ganz sicher, ob die Schulgesetze ihm das Sprechen erlaubten, selbst wenn es sich um eine so außerordentliche Gelegenheit handelte wie die Rückkehr Vic Greggs. Blondy dagegen erwiderte Vics Gruß nur, um sogleich selbst nach seinem Hut zu greifen.
»Denke, ich muß jetzt weg«, sagte er und hüstelte, wie um zu zeigen, daß er sich keineswegs befangen fühle, aber Vic fand, daß es Blondy schwer fiel, ihm gerade ins Auge zu sehen, als sie sich nun beide die Hände schüttelten.
»Betty, wir sehn uns ja noch«, sagte Hansen.
»Allright.« Ihr Lächeln blitzte zu Vic hinüber. Gleich darauf war sie in Haltung und Stimme ganz und gar Respektsperson: »Du kannst dich jetzt trollen, Tommy.«
Aber die Würde fiel rasch genug von ihr ab, als Tommy mit einem hastigen Griff sein Buch und seine Kappe nahm und wie ein Pfeil auf die Tür losschoß, durch die eben Hansen verschwunden war. An der Schwelle machte er noch einmal halt, wippte sich auf den Zehenspitzen und piepste, die beiden verständnisvoll anblinzelnd: »Gute Nacht, Miss Neal. Viel Vergnügen, Vic.«
Sie hörten ihn in zwei Sätzen draußen die Stufen hinuntersausen und das Trippeln seiner eiligen Füße den Weg hinunter.
»Der kleine Kobold!« sagte Betty, die dunkelrot geworden war. »Es ist wirklich nicht mehr zu sagen, Vic. Ganz Alder tut, als ob über die Sache kein Wort mehr zu verlieren wäre.«
Jetzt, wo sie den Kleinen weggeschickt hatte, hätte er sie in die Arme nehmen und küssen sollen. Aber bei Vic stand das Nächstliegende immer zu allerletzt auf dem Programm.
»Warum soll auch noch viel darüber zu reden sein?« antwortete er. »Es ist gar nicht mehr so lang, bis es so weit ist.«
Ihre Augen funkelten kriegerisch. Aber die Freude darüber, ihn zu sehen, brachte den Zornesfunken rasch genug wieder zum Erlöschen.
»Oh, Vic, bist du wirklich bald fertig mit deiner Arbeit? Du bist so lang weggewesen und ich ...« Sie unterbrach sich. Betty war kein Mensch, der sich überschwengliche Gefühlsausbrüche leistete.
»Kann sein, es war ein richtiger Narrenstreich von mir, auf einmal so die Arbeit einfach hinzuschmeißen,« meinte Vic, »aber ich kann dir sagen, es war mir so verdammt einsam dort oben, daß ich's nicht mehr aushielt.«
Sie musterte ihn mit einem zufriedenen Blick, von den harten, sonngebräunten Händen bis zu der Falte, die angestrengte Arbeit mitten in seine Stirn gegraben hatte. In Bettys Augen war er ein ganzer Kerl.
»Komm mit«, sagte er. Er plante, sie auf dem Weg zur Tür mit einem Kuß zu überrumpeln. »Komm mit, draußen ist schon richtige Frühlingsluft. Ich hab' mich schon ordentlich vollgepumpt damit. Was wir miteinander zu reden haben, können wir auch heute abend beim Tanz besprechen. Jetzt wollen wir reiten.«
»Beim Tanz?«
»Na gewiß, heut abend bei Singer unten.«
»Ich weiß nicht recht, wie ich's machen soll. Ich habe Blondy zugesagt, daß ich mit ihm ginge. Er hat mich darum gebeten.«
»Und du hast zugesagt?«
»Warum braust du gleich so auf?«
»Hör' mal, wie lang hast du dich schon mit Blondy Hansen herumgedrückt?«
Er sah, wie ihre herabhängende Hand sich zornig zur Faust zusammenpreßte, aber er mißachtete die Warnung, die darin lag. Es machte ihm eher Spaß, genau so, wie es ihn kitzelte, wenn Grey Molly bockend die Ohren zurücklegte.
»Was hast du an Blondy Hansen auszusetzen?«
»Was findest du denn Besonderes an ihm?« parierte er.
Das war nicht sehr klug.
Ihre Stimme bekam einen Anflug von Gereiztheit. »Blondy ist ein Gentleman, das merk' dir nur!«
»Ach nein, wirklich?«
»Mache dich nicht über mich lustig, Victor Gregg. Ich lasse es mir nicht gefallen.«
»Du läßt dir's nicht gefallen, was?«
Er spürte genau, daß er die Situation auf eine gefährliche Spitze trieb, aber gerade im Zorn war sie so prachtvoll und vollkommen schön; es bereitete ihm ein prickelndes Vergnügen, sie noch ein wenig zu reizen.
»Nein, ich lasse mir's nicht gefallen«, wiederholte sie. Sie wollte noch etwas hinzufügen, unterdrückte es aber noch rechtzeitig. Er konnte sehen, wie gewaltsam es in ihr arbeitete. Jetzt wurde ihm angst.
»Du mußt nicht gleich wegen einer Kleinigkeit in Zorn geraten«, mahnte er. »Aber ich kann dir sagen, mir ist die Galle gestiegen, wie ich Blondy mit seinem Kalbsgesicht bei dir stehen sah.«
»Wer hat ein Kalbsgesicht? Er ist ein tausendmal angenehmerer Anblick, als du jemals sein wirst!«