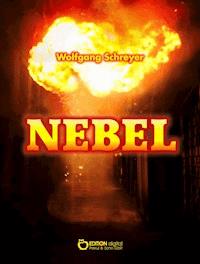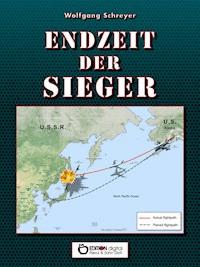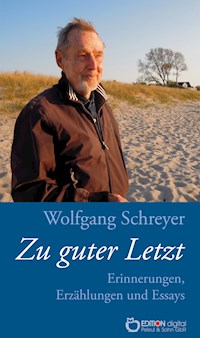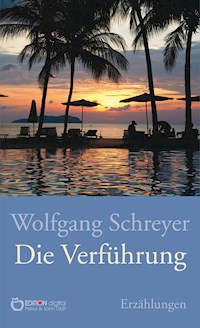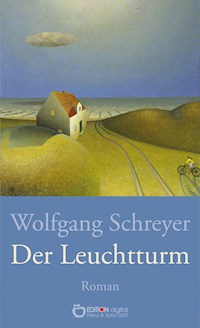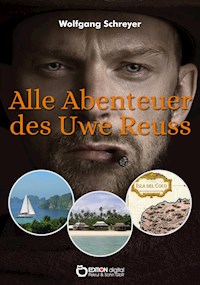6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
August 1956: Der Reserveleutnant Roger Anderson aus Liverpool, im zivilen Leben Mitarbeiter der Zollfahndung, wird zur 16. Fallschirmjägerbrigade nach Zypern eingezogen. Dort bekommt er von der britischen Abwehr den Auftrag, den amerikanischen Archäologen Walpole, der seine Ausgrabungen nur in der Nähe von geheimen militärischen Objekten durchführt, zu überwachen. Die britische Abwehr fängt Funksprüche mit Details der französischen und britischen Truppentransporte nach Zypern auf, aber Anderson verliebt sich in eine junge und auffällig hübsche Journalistin, die sich nur allzu oft in der Nähe von Walpole aufhält. Im Morgengrauen des 5. November stiegen von Zyperns Flugplätzen in rascher Folge schwere Transportflugzeuge auf, mit Fallschirmjägern, automatischen Waffen und Munition randvoll beladen. Anderson und seine Kameraden sollten den Flugplatz Gamil nordwestlich von Port Said erobern. Nach dem hundertstündigen , pausenlosen Luftbombardement auf Ägypten ein Kinderspiel? Das spannende Buch erschien erstmals 1957 beim Verlag des Ministeriums für Nationale Verteidigung in Berlin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Der Spion von Akrotiri
ISBN 978-3-86394-088-1 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1957 beim Verlag des Ministeriums für Nationale Verteidigung, Berlin
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Die Geschichte begann für mich mit einer schlichten Drucksache, durch die der Reserveleutnant Roger Anderson, wohnhaft zu Liverpool, Lime Street 207, aufgefordert wurde, binnen achtundvierzig Stunden in die Garnison zurückzukehren, die er fünf Jahre zuvor, nach Ableistung seiner Wehrpflicht, verlassen hatte.
Es war ein schöner Nachmittag Anfang August. Ich kehrte vom Dienst aus dem Hafengelände heim, als mir diese Karte in die Hände fiel. Es wäre übertrieben zu behaupten, sie hätte mich damals erschreckt oder besonders unangenehme Empfindungen in mir wachgerufen. Ich drehte sie zwischen Daumen und Zeigefinger und dachte nur, dass es ein bisschen schäbig vom Mobilisierungsamt sei, statt eines Telegramms diesen simplen Vordruck zu schicken, der obendrein, wie ich gleich entdeckte, etliche Anachronismen enthielt. Man schrieb mir nämlich unter anderem darin vor, meine Lebensmittelkarten mitzubringen; obwohl jedes Kind wusste, dass es seit 1954 in Großbritannien keine Rationierung mehr gab. Die Armeebürokraten hatten einfach uralte Formulare benutzt. Sie schienen im Kriegsministerium auf der ganzen Linie zu sparen.
Ich packte dennoch schleunigst meine Siebensachen, sagte in der Dienststelle Bescheid und fand mich pünktlich vor der Garnison Aldershot ein, dem Stammquartier der 16. Fallschirmjägerbrigade; sie ist in dieser Gegend besser bekannt unter dem berüchtigten Namen "Rote Teufel". Das war mein guter alter Haufen. Während ich das Kasernentor passierte, erinnerte ich mich all der tollen Streiche, die wir vor Jahren hier ausgeheckt hatten. Abgesehen von der Rekrutenzeit, die wohl in keiner Armee der Welt mit einer Badekur zu verwechseln ist, war mein Wehrdienst so erfreulich verlaufen, dass ich mich am Ende schriftlich bereit erklärt hatte, im Falle eines nationalen Notstandes, noch vor der eigentlichen Mobilmachung, freiwillig einzurücken. Möglich, dass dieser Entschluss in jugendlichem Überschwang gefasst worden war, unter dem Eindruck der wunderbaren Abschiedsfeier vielleicht – jedenfalls saß ich nun hier und harrte gespannt der Dinge, die kommen sollten. Erst sehr viel später wurde mir klar, dass ich mit jener Erklärung die größte Torheit meines Lebens begangen hatte.
Das erste, was kam, war die ordengeschmückte Brust meines alten Freundes Bill Shotover, der aktiv diente, sich in Kenia oder auf Malakka herumgeschlagen und es dabei zum Captain gebracht hatte. "Hallo, Roger", sagte er und schlug mir seine mächtige Pranke auf die Schulter. "Recht so! Das Vaterland ruft..."
"Und seine besten Söhne eilen zu den Fahnen", fügte ich bescheiden hinzu.
"Für dich ist noch Platz in meiner Kompanie", erklärte er, "rede heute Abend mit dem Colonel, das geht in Ordnung, alter Junge."
Nachdem wir einen Drink genommen, Erinnerungen ausgetauscht und mehrmals bekundet hatten, dass der heutige Nachwuchs kaum noch das darstelle, was unser Jahrgang gewesen sei, ging Bill dazu über, mir die militärische Situation des Commonwealth zu erläutern. Das war seit jeher sein Steckenpferd.
"Unsere Lage", sagte er, "ist bekanntlich hoffnungslos, aber nicht ernst. Das würde sie erst, wenn es uns nicht gelänge, diesen Burschen Nasser unterzukriegen. Das Beispiel könnte Schule machen, und all die anderen Hunde, die jetzt noch den Schwanz einziehen, würden dann den Respekt verlieren. Falls du ab und zu eine Zeitung liest, Roger, weißt du ja, was er nun wieder angestellt hat. Aber mit der Kanalgeschichte kommt er nicht durch. Wir sind dabei, ihn und seine erbarmungswürdigen neunzigtausend Mann auf kaltem Wege mattzusetzen. Pass auf", sagte er und trat zur Europakarte, die über der Musikbox an der Kasinowand hing. Sein breites Ledergesicht war fahlbraun mit einigen weißen Stellen, eine Folge von Pigmentstörungen, an denen er schon früher gelitten hatte; es glich im Farbton haargenau jenen Partien auf der Karte, die Gebirgszüge über dreitausend Meter darstellten, die hellen Flecke entsprachen den vergletscherten Gipfeln.
"Im Roten Meer", sagte Bill, "liegt unser Kreuzer 'Kenya', vor der levantinischen Küste der Kreuzer 'Jamaica'. In Malta ankert der Flugzeugträger 'Eagle', er hat mehrere Staffeln Jagdbomber an Bord. Hinzukommen sechzig 'Canberra'-Düsenbomber, die gestern nach Malta beordert worden sind. Hier in Jordanien steht das 10. Husarenregiment, verstärkt durch eine Kompanie des Infanterieregiments 'Middlesex', es ist mit 'Centurion'-Panzern ausgerüstet. In Libyen, nahe der ägyptischen Westgrenze, liegen die 10. Panzerdivision, das Infanterieregiment 'The King's Royal Rifle Corps' und das 3. Artillerieregiment 'Royal Horse Artillery', das während der Herbstmanöver 1951 unsere linke Flanke gedeckt hat. Na, wie gefällt dir das?" – "Nicht schlecht", sagte ich, "und wir?"
"Wir sind die Commonwealth-Feuerwehr", antwortete er. "Uns wird man dorthin werfen, wo's brennt."
"Ob sie den Reservisten wohl den Lohnausfall ersetzen?", fragte ich.
"Außerdem", fuhr Bill fort, ohne auf meine Sorgen einzugehen, "ziehen wir Teile der 2. Infanteriedivision aus Westdeutschland heraus. Die NATO-Chefs jammern zwar, besonders, weil Frankreich es ebenso macht, aber Sir Anthony hat den Gruenther schon breitgeschlagen. Wie es heißt, haben wir neunzig Zivilflugzeuge beschlagnahmt, bringen damit sogar Leibgarde in den Nahen Osten..."
"Wer nämlich – wie ich – ein paar Sachen auf Abzahlung gekauft hat, der kommt durch die Einberufung ganz schön in Druck."
"... Rechne dazu nun die Streitmacht der Franzosen. Vizeadmiral Barjot hat auf der Reede von Toulon das Schlachtschiff 'Jean Bart', den Kreuzer 'Georges Leygues', zwei Flugzeugträger und zehn Zerstörer versammelt. Recht hübsch, wie?"
"Ich möchte bloß wissen", wandte ich schüchtern ein, "was aus meinem Fernsehapparat wird, wenn ich die nächsten Raten nicht zahle, Bill."
"Lass das Ding schießen", antwortete er unwirsch. "Bei uns, alter Junge, brauchst du den Guckkasten nicht. Die Royal Army zeigt dir die Welt." – Bill war, bei Licht besehen, ein gemütsrohes Ungeheuer, aber in dieser Sache sollte er recht behalten.
2. Kapitel
Am folgenden Montag, es war der sechste August 1956, gingen wir bei strahlendem Sonnenschein im Hafen von Portsmouth an Bord. Unser Schiff, der Flugzeugträger "Theseus", war ein 13 000-Tonner, der gewöhnlich fünfunddreißig Jagdbomber, jetzt aber zweitausend Fallschirmjäger aufnahm. Wie mir Bill verriet, schiffte sich der Rest unserer Brigade in Devonport auf dem Schwesterschiff "Ocean" und dem 22 000-Tonnen-Träger "Bulwark" ein, die zwei Tage später in See stechen sollten.
Der ganze Hampshire-Strand wimmelte von Sommerfrischlern. Segeljachten und Motorboote tummelten sich vor der Küste, junge Leute vergnügten sich beim Wasserski. Am Kai jedoch standen Tausende Eltern, Ehefrauen und Bräute, denen fünfzig Fallschirmjäger stellvertretend für die übrigen Lebewohl sagen mussten, weil der Colonel uns verboten hatte, einzeln Abschied zu nehmen. Er war ein rotgesichtiger Mann mit schwefelgelbem Bärtchen, der solche Szenen zu hassen schien. Als ihm Captain Shotover den Wunsch seiner Männer vortrug, ihren Angehörigen die Hände zu schütteln, knurrte er nur: "Goddam, dazu war in der Garnison Zeit genug! Goddam." Bei diesen Worten versetzte er dem Regimentskater "Nasser", der es gewagt hatte, sich auf seinen Schuh zu setzen, einen Tritt in die Flanke. Mich traf es nicht, denn meine alte Mutter hatte wegen ihres Leidens nicht nach Portsmouth kommen können, und ich hatte zu dieser Zeit auch kein Mädel. So winkte mir niemand mit tränenfeuchtem Taschentuch nach, als unser Schiff an der Mole vorbei in die Kanalwellen glitt. Für die übrigen war es wohl bitter.
Die Armeeleitung zeigte sich aber nicht nur gefühlsarm, sondern auch geradeso geizig, wie ich es befürchtet hatte. Dass die meisten Reservisten ihre zivilen Arbeitsplätze aufgeben mussten, kümmerte sie wenig. Entschädigungen wurden nicht gewährt. "Wir haben Freiwillige einberufen, nicht Bettler", erklärte mir Bill Shotover, und er gab damit nur eine Äußerung unseres Brigadegenerals Mervyn Butler wieder, des allgemein verehrten Kommandeurs der "Roten Teufel". Wir standen an der Reling und sahen zu, wie die Sonne hinter der Küste von Cornwall versank. Es war ein wunderschöner Abend.
"Vierundzwanzig Knoten macht der Kasten", sagte Bill neben mir und spuckte in die blasige Hecksee. "Übermorgen schwimmen wir vor Lissabon, am Mittwoch schon im Mittelmeer, Freitag früh laufen wir La Valetta an. Wie's dann weitergeht, das wissen bloß Gott und Sir Anthony."
"Falls die Ägypter jemals von uns gehört haben, geben sie klein bei, sobald wir nur bei Malta aufkreuzen."
"Eine anständige Hauerei, Roger, wäre mir lieber."
Später las ich in der Zeitung, dass sich die Teilmobilisierung, der ich die schöne Schiffsreise verdankte, streng nach den Regeln unserer Verfassung abgespielt hatte. Da das Unterhaus einige Tage vor der Kanalverstaatlichung in Urlaub gegangen war – ein großer Teil der Parlamentarier befand sich auf Wildhuhnjagd in Schottland – und Königin Elisabeth gerade den Pferderennen in Goodwood beiwohnte, hatte der Premierminister Eden dortselbst einen Staatsrat abhalten lassen, der den Notstand verkündete und unseren Kriegsminister, "den hochehrenwerten Henry Head, feierlich ermächtigte, die Reserve einzuberufen", wie das Blatt es ausdrückte. Der Hochverehrte rief zunächst zwanzigtausend Mann zu den Waffen, darunter auch mich. Er verschaffte mir immerhin Genugtuung, aus der Presse zu erfahren, dass man alles so korrekt und in jener Ruhe abgewickelt hatte, die einer großen Nation so gut zu Gesicht steht.
3. Kapitel
Acht Tage danach landeten wir auf Zypern. Ich gehörte einem Vortrupp an, den mein Freund Bill befehligte. Wir fuhren in zwei Marinejeeps sechzig Kilometer landeinwärts durch eine blühende Ebene, wobei das Begleitpersonal die Maschinenpistolen schussbereit auf den Knien hielt. Ich schloss daraus, dass die Bevölkerung noch immer in ihrer Voreingenommenheit gegen die britische Krone verharrte; aber nichts geschah.
Als in der flirrenden Hitze die ersten Häuser der Inselhauptstadt Nicosia auftauchten, sagte Bill Shotover zu mir: "Hör zu, mein Bester, nun trennen sich unsere Wege. Das Luftwaffenkommando hat dich für einen Sonderauftrag angefordert... Nein, keine Ahnung, was es ist, aber auf alle Fälle eine Ehre. Roger, halt mir die Ohren steif! See you later, old boy." Damit versetzte er mir einen gewaltigen Prankenschlag, ließ den Wagen stoppen, warf mich kurzerhand hinaus und raste davon.
Ich befand mich vor einem flachen, ausgedehnten Gebäude, das von Stacheldrahtrollen umgeben war. Neben dem Posten, der den Stahlhelm aus der nass glänzenden Stirn geschoben hatte, stand ein grau überstaubtes Schild: MEAF-HQ, was "Hauptquartier der Middle East Air Force", der Luftflotte Mittel-Ost, bedeutete. Dies also war das Regionalkommando Levante der königlich-britischen Luftwaffe, dem sämtliche Flugfelder und Militärmaschinen im Irak, in Jordanien, auf Zypern, in Libyen – und bis vor einem halben Jahr auch noch in der Suezkanalzone – unterstanden. Beim Anblick des Stabsquartiers war mir keineswegs wohl zumute, und daran war nicht die Hitze schuld.
Wenn die Luftwaffe einen Fallschirmjäger zu einem Spezialzweck anforderte, hatte das niemals etwas Gutes zu bedeuten. Im Allgemeinen stank die Sache sehr. Ich zerbrach mir nicht lange den Kopf darüber, wieso man gerade auf mich, einen frisch ausgehobenen Reservisten, gekommen war, sondern beschloss augenblicklich, jedem Versuch, mich zu einem riskanten Einmannunternehmen zu verwenden, energisch zu widerstehen. Derartige Einsätze, bei denen man oft Kopf und Kragen wagte, weil es sich darum handelte, hinter den feindlichen Linien abzuspringen, erfolgten gewöhnlich auf freiwilliger Grundlage. Die beste Chance, heil davonzukommen, wird von jungen Offizieren meist dann schon verpasst, wenn sie es aus patriotischen oder anderen sehr ehrenhaften Beweggründen nicht über sich bringen, die Überredungskunst väterlicher Vorgesetzter durch ein Nein im rechten Moment zunichte zu machen.
"Zimmer einhundertachtzehn, Sir", sagte der wachhabende Sergeant. Unter den Achseln seines Uniformhemdes zeichneten sich große Schweißflecke ab. Er sah mich merkwürdig an, als er mir diese Auskunft erteilte; und mein instinktives Unbehagen wuchs. Die freundliche Aufschrift "Flugmedizinische Abteilung" an der Tür des Zimmers Nummer 118 war gleichfalls nicht geeignet, mein Misstrauen zu zerstreuen. Gegenüber Armeeärzten ist größte Skepsis angebracht.
Ich trat ein und nahm trotz der drückenden Wärme sofort Haltung an. Hinterm Schreibtisch stand ein grauhaariger, sehr schlanker Mann, der nicht gerade wie ein Arzt aussah. Er trug drei Silberstreifen auf der Schulterklappe und ebensoviel Ringe um den unteren Ärmel, war also ein Wing-Commander, was bei der Luftwaffe dasselbe ist wie ein Lieutenant-Colonel beim Heer. Über seinem Kopf zerschnitt ein waagerecht kreisender Ventilator die Luft, ich spürte den frischen Hauch auf meinem Gesicht.
"Nehmen Sie Platz, Leutnant", sagte der Wing-Commander mit angenehm heller Stimme. "Zigarette?" Er schien zu den fairen Vorgesetzten zu gehören; ich nahm mir vor, auf der Hut zu sein, mich vor seiner Liebenswürdigkeit in Acht zu nehmen. Zunächst einmal setzte ich mich und reichte ihm Feuer.
"Wenn ich recht unterrichtet bin, Leutnant Anderson", sagte er, während er schräg nach oben ins Leere blickte, dorthin, wo der Luftstrom des Ventilators den aufkräuselnden Zigarettenrauch abschnitt, "gingen Sie noch vor vierzehn Tagen in Liverpool Ihrer Zivilbeschäftigung nach."
"Ja, Sir."
"Welcher Art war diese Tätigkeit?"
"Ich bin Angehöriger des Zollfahndungsdienstes, Sir."
Der Wing-Commander nickte auf eine Weise, die mir verriet, dass ich ihm etwas mitgeteilt hatte, was er schon wusste. Übrigens hielt er ein Schriftstück in den Händen, das zweifellos ein Blatt aus meiner Personalakte war.
"Worin besteht Ihre Arbeit im Einzelnen?", fragte er. "Führen Sie Gepäckkontrollen durch, den üblichen Routinekram, oder hatten Sie es schon mit gut organisierten Schmugglerringen zu tun?"
Der geringschätzige Ton, in dem er vom "üblichen Routinekram" sprach, kränkte mich, und so bereitete es mir Genugtuung, ihm wahrheitsgemäß zu antworten, dass ich ein paar Semester Kriminalistik studiert und die gehobene Beamtenlaufbahn eingeschlagen hätte, demzufolge würde ich zur Aufklärung der meisten Bandenverbrechen herangezogen, die in den Aufgabenbereich meiner Dienststelle fielen. Zuletzt hätte ich die Ermittlungen in einer Rauschgiftschmuggleraffäre geführt, und nicht ganz ohne Erfolg... Ich sollte bald erkennen, dass ich besser daran getan hätte, mein Licht unter den Scheffel zu stellen, was nebenbei bemerkt in der Armee stets das gescheiteste ist.
"Rauschgift!", sagte der Wing-Commander herzlich. "Ich sehe, wir sind Kollegen, Mister Anderson, mein Name ist Tinwell. Vielleicht haben Sie früher einmal im Zusammenhang mit Scotland Yard von mir gehört; ich leitete dort jahrelang das Chefkommissariat 'Raub und räuberische Erpressung'. Ihnen brauche ich nicht auseinanderzusetzen, was für ein weites Feld dieser Komplex umschließt."
Er lächelte fein, und ich brachte es nicht fertig, ihm, die Freude zu verderben. Daher gab ich vor, mich tatsächlich seines Namens zu entsinnen, zumal ich wusste, dass nichts einem älteren Kriminalisten so wohltat, wie unverhofft ein Echo des Rufes zu spüren, den die großen Boulevardblätter einst um seine Erfolge gewoben haben. Wing-Commander Tinwell bewirtete mich daraufhin mit eisgekühltem Zitronensaft, verweilte eine Zeitlang bei hervorstechenden Straftaten der Ära der dreißiger Jahre, wechselte dann aber unmerklich von der englischen Kriminalgeschichte zur Polizeisituation auf der Insel Zypern über.
"Dies hier", eröffnete er mir beiläufig, "ist die Abteilung Spionageabwehr des Regionalkommandos Levante." Er begleitete seine Feststellung mit einer Handbewegung, die das Mobiliar des Zimmers bis zu den Jalousien, dem grün lackierten Panzerschrank und den Moskitonetzen einschloss. "Die Sicherheitslage auf Zypern, das müssen Sie mir glauben, ist alles andere als rosig. Ich habe viel zuwenig Leute. Meine besten Hilfskräfte sind mit den griechischen Partisanen beschäftigt; sie konzentrieren sich darauf, feindlichen Anschlägen zuvorzukommen, die gegen unsere Luftwaffenverbände gerichtet sind. Da kommen Sie mir, Mister Anderson, wie gerufen."
Zu spät erkannte ich, dass ich ihm in die Falle gegangen war. Nach all den Freundlichkeiten, die er mir als jungem Fachkollegen erwiesen hatte, war ich schlechterdings nicht mehr imstande, einen heiklen Auftrag mit Festigkeit zurückzuweisen. Es galt nunmehr, geschickt in die Defensive zu gehen. "Leider spreche ich weder Griechisch noch Türkisch", sagte ich also, "kenne Land und Leute nicht, Sir... Ich fürchte fast, Ihnen nicht wirklich von Nutzen zu sein."
"O nein", antwortete er schlau. "Für Sie habe ich etwas Besonderes. Die Wissenslücken, die Sie erwähnen, fallen da nicht so ins Gewicht. Sie sollen bei uns kein zweiter Lawrence werden. Hören Sie zu: Seit einiger Zeit streunt ein mysteriöser Ausländer auf dieser Insel umher, ein etwa fünfzigjähriger, recht wohlhabender Mann, über den wir uns Klarheit verschaffen müssen. Sein Steckenpferd ist das griechische Altertum. Er nennt sich Nathan F. Walpole, sein Pass weist ihn als amerikanischen Staatsbürger aus, was aber ebenso belanglos sein dürfte wie der Umstand, dass er Wert darauf legt, für einen Archäologen gehalten zu werden. Feststeht, er bevorzugt bei seinen Ausgrabungen Gegenden, in denen militärische Objekte liegen."
"Da sich unsere Truppen in Erfüllung ihrer Schutzaufgaben hier praktisch überall befinden, Sir", warf ich ein, "erlaubt diese Beobachtung vielleicht noch keine allzu weit reichenden Schlussfolgerungen."
Doch der Wing-Commander schüttelte den Kopf. "Seit einer Woche stochert er in Sichtweite unseres neuen Flugplatzes Akrotiri herum, Mister Anderson. Er hat sein Zelt auf einem vorgeschichtlichen Ruinenhügel aufgeschlagen, der zwar nicht mehr zur Sperrzone gehört – wir können diese Zonen ja nicht übermäßig ausdehnen –, von dem aus er jedoch den Flugbetrieb mit Fernglas und Teleobjektiv bequem überwachen oder gar im Bild festhalten kann. Das ist der Grund, weswegen wir uns mit ihm zu befassen haben."
"Haben Sie beim amerikanischen Konsulat Erkundigungen einziehen lassen, Sir?"
"Wozu? Walpoles Papiere sind in bester Ordnung."
Ich verstand, die US-Behörden sollten von der Sache nichts erfahren. Ich war lange genug Soldat gewesen, um zu wissen, dass zwischen den Abwehrdiensten befreundeter Nationen grundsätzlich keine Zusammenarbeit, dafür aber jene gehässige Rivalität bestand, die auch zwischen zivilen Sicherheitsdiensten – wie beispielsweise der Zollfahndung und der Kriminalpolizei – durchaus üblich ist, wo sie häufig zu Stänkereien führt. Übrigens haben die Spionagefachleute von den Fähigkeiten ihrer alliierten Berufskollegen meist eine ganz negative Vorstellung, während sie andererseits zur Überschätzung des Gegners neigen, dem sie gern die raffiniertesten Winkelzüge zuschreiben; das nämlich hebt ihr Selbstgefühl.