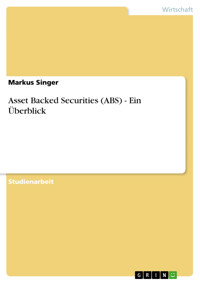Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nach Abschluß seines Studiums reist Mario Berger nach Lissabon; dort trifft er Dulce, die Frau seiner Träume. Doch aus dieser romantischen Begegnung wird eine wilde Jagd durch halb Europa. Mit Hilfe des undurchsichtigen Agenten Sanchez und seiner Begleiter machen sich die beiden auf den Weg nach Deutschland. Verfolgt von einem mächtigen Magier und seinen Häschern kommt es zur entscheidenden Schlacht auf den düsteren Höhen des Hunsrücks.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Singer
Der Stein
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Der Stein
33 n. Chr. Judäa Jerusalem
13. Oktober 1307 Paris
18. September 1690 Kerien im Nordwesten Frankreichs
12. Juni 1996 Idar-Oberstein in Deutschland
29. Juni 1996 Madrid
1. Juli
2. Juli
3. Juli
4. Juli
1999
Impressum neobooks
Der Stein
DerStein
Ein phantastischer Roman
von
Markus Singer
©1998 by Markus Singer
Alle Rechte vorbehalten
33 n. Chr. Judäa Jerusalem
Pontius Pilatus lief in seinem Gemach auf und ab. Es war nicht das erste Mal, dass er einen Mann aus politischen Gründen verurteilt und dem Tode überantwortet hatte. Aber diesmal war alles so anders. Was beunruhigte ihn nur so sehr?
Als er diesem Mann in die Augen gesehen hatte, wusste er, dass er unschuldig war. Er konnte seine eigene Reaktion nicht verstehen. Was hatte er nur getan?
Er lief zu der kleinen Wasserschale und wusch sich zum – ja zum wievielten Male wusch er sich eigentlich die Hände? – er konnte es nicht sagen. Aber in den letzten Stunden bestimmt schon zum zwanzigsten Male.
Als sie ihm den Mann brachten, hatte er bereits gewusst, dass er mit seinem Urteilsspruch die Gemüter einiger einflussreicher Männer beruhigen sollte. Er hatte, und zum ersten Mal war es ihm schwer gefallen, dies anzuordnen, den Mann geißeln lassen. Und er hoffte, dass die Rädelsführer dieser Verschwörung gegen den kleinen Prediger so besänftigt werden würden.
Aber das hatte ihnen nicht gereicht! Sie verlangten den Tod dieses Mannes.
Pilatus hatte zudem gehofft, als er nach alter Sitte zum Pessach-Fest einen Straftäter begnadigte, das Volk würde fordern, diesen Mann, welchen Sie Christus nannten, frei zu lassen. Aber als hätte sich das Schicksal gegen ihn verschworen. Das Volk, das sich vor seinem Palast versammelt hatte, rief lautstark den Namen eines stadtbekannten Räubers und Mörders. Sicher ein von Christus` Widersachern geschickt eingefädeltes Komplott, und in Sorge um die Ordnung und Sicherheit in seinem Herrschaftsbereich hatte er dem Druck der Massen nachgegeben.
Pilatus grübelte, einen Mörder begnadigt und einen unschuldigen Mann in den Tod geschickt? Nicht, dass Pilatus ein zimperlicher Mann war. Er hatte schon selbst Männer mit falschen Beschuldigungen aus dem Weg geräumt. Aber in jedem Fall hatte er irgendeine Begründung gehabt, die seine Tat vor seinem Gewissen gerechtfertigt hatte. Nicht so diesmal!
Wieder schritt er zu der Wasserschale. Wütend rief er nach einem seiner Dienstboten und ließ die Schale leeren und frisches Wasser bringen.
Seine Hände klebten. Sie klebten als würde warmes Blut auf seiner Haut langsam gerinnen.
Wieder wusch er seine Hände und streifte weiter durch das Zimmer, wie ein Tier in einem zu kleinen Käfig. Er brütete vor sich her. Suchte einen Weg, sich doch noch aus dieser Situation zu befreien, aber er fand keinen.
Die eigenen Götter waren Pilatus immer nur ein Mittel zum Zweck gewesen. Ein Trost für die Schwachen, ein Werkzeug, die Massen zu bändigen. Nachdem er sich wieder dabei ertappt hatte, wie er seine vermeidlich besudelten Hände in die Wasserschale tauchte, trat er aus dem Zimmer ins Freie, sah zum Himmel auf und bat den Gott dieses Mannes, den sie Christus nannten, die Hinrichtung möge nicht lange dauern.
An einer anderen Stelle Jerusalems kämpfte ein weniger bedeutender Mann, ein kleiner Soldat, mit ähnlichen Zweifeln.
Lucius schmerzte selbst jeder Schlag, mit dem er die Nägel durch Arme und Beine dieses Mannes trieb. Das Blut des Verurteilten lief ihm warm über die Fingerspitzen und er fühlte seine eigene schreckliche Schuld ebenso stark, wie die Unschuld des Mannes, den er ans Kreuz schlug. Der Körper des Mannes war mit vielen Wunden überzogen und sein Haupt trug eine Krone, welche aus Dorngestrüpp geflochten war. Hinter Lucius schrie und johlte eine Menschenmenge, die von den Wachen nur schwer unter Kontrolle zu halten war. Spottverse, lautes Klagen und verzweifelte Schreie hallten durch die Luft. Lucius war schweißgebadet als er den letzten Nagel durch die Beine des Mannes getrieben hatte. In Lucius Augen bildeten sich Tränen der Verzweiflung. Leise entschuldigte er sich in lateinischer Sprache bei dem Mann der vor ihm lag. Dieser konnte ihn sicher nicht verstehen, denn es war ein jüdischer Rabbi, den sie Jesus nannten. Dann geschah etwas Seltsames. Der Verurteilte sah ihn an und sprach zu ihm. Lucius war erst vor zwei Wochen hierher versetzt worden, die Sprache des Mannes kannte er nicht, und doch konnte er ihn verstehen. „Es sei Dir vergeben. Wir alle müssen unsere Bestimmung erfüllen. „
Obwohl die Sonne erst vor kurzem über den Horizont gestiegen war, wurde es bereits ungewöhnlich heiß und bis Mittag würde es noch schlimmer werden. Aber die Hitze war wohl nur in zweiter Linie für den Schweiß verantwortlich, der Lucius aus allen Poren trat.
Das Kreuz wurde aufgestellt. An dem senkrechten Balken des Kreuzes hatte ein Soldat ein Schild mit der Aufschrift: „Der König der Juden„ angebracht.
Lucius war verstört. Links und rechts des Rabbi wurden die Kreuze zweier weiterer Männer aufgestellt. Mit diesen empfand er kein Mitleid, denn es waren stadtbekannte Räuber und Mörder. Die Soldaten konnten die Menge, die nun noch stärker tobte, kaum im Zaum halten.
Lucius sah immer wieder zu dem Rabbi hinauf. Was ging von diesem Mann aus, was ihn so besonders erscheinen lies? Die Gewänder der beiden stadtbekannten Verbrecher lagen unbeachtet an der Stelle, an der man sie zur Kreuzigung entkleidet hatte. Wohingegen das Gewand des Rabbi, ein einfacher Überwurf mit Rissen an vielen Stellen, zum Hohn auf diesen Mann unter den Soldaten verlost wurde, wie eine überaus wertvolle Beute. Der Soldat, dem das Gewand zufiel, warf es über und zwei andere taten, als würden sie ihn anbeten. „ Heil Dir, König der Juden„, hörte Lucius sie rufen.
Die drei Gekreuzigten, die nackt an die Balken genagelt waren, riefen sich Worte zu. Trotz der tobenden Menge und der ihm eigentlich unbekannten Sprache verstand Lucius jedes Wort.
Der Mörder links des Rabbi sprach: „Bist Du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf Dir und uns! „
„ Hast Du immer noch keine Furcht vor Gott? Wir beide erhalten unsere gerechte Strafe. Aber er hat nichts unrechtes getan. „ , erwiderte der Mörder auf der anderen Seite und dann sprach er zu dem Rabbi: „ Erinnere Dich an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst !„
„Ich sage Dir, Du wirst noch heute mit mir im Paradies sein„ , hörte Lucius den Rabbi sagen.
Diese Worte trafen ihn tief ins Herz. Die seltsamen Ereignisse, die Schuldgefühle, das plötzliche Verstehen einer fremden Sprache und die feste Überzeugung der Errettung, die aus den Worten dieses Jesus sprachen, zogen ihn in den Bann. Die anderen Soldaten spotteten über Jesu, tränkten einen Schwamm mit Essig und hielten ihn Jesus mit einer Lanze hin, als wollten sie seinen Durst löschen.
Gegen Mittag, als die Sonne den höchsten Punkt erreicht hatte, überschlugen sich die Ereignisse. Jesus rief laut: „Vater. In deine Hände lege ich meinen Geist„ . Dann sackte er in sich tot zusammen. Im selben Augenblick wurde die Sonne schwarz und tauchte das ganze Land über Stunden in dunkelste Nacht. Es wurde innerhalb von wenigen Augenblicken kalt und die Menge verstreute sich in wilder Panik. Die Leute flohen in die Stadt. Der Hauptmann, der die Aufsicht über die Hinrichtung führte, schrie gellend:
„Was haben wir getan?„ Dann warf er sich zu Boden und bat den Gott der Juden um Vergebung. Lucius sah den toten Rabbi an und hatte wieder Tränen in den Augen.
Ein anderer Soldat zeigte sich von dem ganzen Geschehen unbeeindruckt. Er schnürte das Werkzeug, mit dem sie die Männer ans Kreuz geschlagen hatten, zu einem Bündel und räumte sein Geschirr zusammen. Da Kreuzigungen oft sehr lange dauerten, hatten viele Wachsoldaten etwas zu Essen dabei. Als der Mann mit dem Werkzeugbündel nach einer Brotschale aus Holz griff, stellte er fest, dass in diese Schale Blut getropft war. Angewidert warf er die Schale weg. Lucius hatte die Schale erst bemerkt als sein Kamerad sie wegwarf. Er wusste, dieses Blut stammte von dem Rabbi. Ohne genauer zu verstehen warum, starrte er lange Minuten darauf. Dann rissen ihn die Rufe der anderen Soldaten aus seiner Trance.
Nachdem die Soldaten den Tod Jesu überprüft hatten, wurde der Leichnam auf Befehl des Statthalters an einen Juden namens Josef übergeben. Nachdem die anderen Verurteilten ebenfalls verstorben waren, kehrte Lucius heim zu Frau und Kind. Nachts wurde er von schrecklichen Träumen gequält und es trieb ihn wieder hinaus zum Platz der Hinrichtung. Da er, wie die meisten Neulinge in den ersten Wochen, solche unangenehmen Aufgaben wie Wache stehen, Hinrichtungen und andere Bestrafungen ausführen musste, kannte er die Torwachen. Den Soldaten erzählte er, dass seine Frau ihm den Kopf abreißen würde, wenn er nicht das Bündel hole, welches er auf der Richtstätte zurückgelassen hatte. Daraufhin musste Lucius sich großen Spott gefallen lassen. Die Wachen bezeichneten ihn als Weichling und seine Frau als Cerberus, aber er wusste wofür er sich verspotten ließ. Er suchte die Schale, er musste sie einfach haben. Und er fand sie. Als er an diesem Morgen das Blut Jesu an den Fingern gespürt hatte, wusste er um die Kraft, die von diesem Mann ausging und nun konnte er fühlen, wie ein Teil dieser Kraft in dieser Schale war. Er steckte die Schale unter sein Gewand und kehrte in seine Unterkunft zurück.
Am anderen Morgen hörte Lucius, dass zur selben Zeit als sich der Himmel verfinstert hatte, im Tempel der Juden ein Vorhang gerissen und die jüdischen Gelehrten in große Verwirrung gestürzt seien. Zwei Tage später hieß es, der Leichnam Jesu sei verschwunden und lebendig auf der Straße nach Emmaus, einem kleinen Dorf vor Jerusalem, gesehen worden. Lucius begann Nachforschungen über Jesu anzustellen. Er hörte vom Leben und Wirken dieses Mannes, was ihm das Herz noch schwerer machte. Die Schale hütete er wie einen Schatz.
Ein Jahr bevor Lucius seinen Dienst in der Römischen Armee beendete, beging Pontius Pilatus Selbstmord. Es hieß, er sei durch Albträume in den Wahnsinn getrieben worden, Albträume in denen es um diesen Jesus ging. Bald nachdem Lucius aus dem Dienste des Militärs entlassen worden war, schloss sich er mit seiner Frau und seinen Kindern einer christlichen Gemeinde an.
Die Schale hütete Lucius jahrelang als Geheimnis vor der Gemeinde, aus Scham den Heiland hingerichtet zu haben. Als er starb, vermachte er sie seinem ältesten Sohn, der das Geheimnis weiter hüten sollte. Aber die Existenz und die Geschichte dieses Gefäßes kamen durch einen dummen Zufall ans Licht, und einige in der Gemeinde verfielen in eine heidnische Anbetung dieser Schale. Eines Tages umstellten römische Soldaten die Gemeinde und alle Männer, Frauen und Kinder wurden verhaftet und das wenige, was sie besaßen, beschlagnahmt. Wie viele andere bekennende Christen, wurden sie grausam hingerichtet. Nur wenige entkamen der Verfolgung und wurden zu den Gründern des Christentums.
13. Oktober 1307 Paris
Die Sonne hatte sich noch nicht erhoben, als ein schwarz gekleideter junger Mann aufgeregt an die Schlafstätte des Großmeisters trat und ihn mit hysterischem Gestammel aus dem Schlaf riss.
„ Was ist denn, .......Pierre?„, sagte der aus dem Schlaf Aufgefahrene, als er den Mann vor seinem Bett erkannte.
„ Die Männer des Königs stehen vor den Toren. Sie wollen uns alle verhaften! „
Jaques de Molay, der Großmeister, wirkte sichtlich bestürzt, war aber gefasst. Dann gab er dem verzweifelten jungen Mann den Schlüssel, den er an einer Kette, um den Hals trug und sagte zu ihm: „Das haben wir vermutet, aber das es so plötzlich geschieht ... Junge, das ist der Schlüssel zum Turm. Du wirst am Eingang der Schatzkammer ein fertig gepacktes Bündel finden. Nimm es und fliehe nach Kerien. Dort wirst Du einen der Unserigen treffen. Versteck das Bündel gut! Es enthält auch einen Brief, der Dich als königlichen Gesandten ausweist, falls Du unterwegs angehalten wirst. „
Der junge Mann sah den Großmeister mit weit aufgerissenen Augen an und sagte: „Aber....„
„Nichts aber. Geh und tu was ich dir sage. Niemals werden wir diese Gegenstände aus den Händen geben. Geh! Sie werden sich nicht lange aufhalten lassen. Louron wird sicher schon eine Kutsche und ein Gewand für Dich bereithalten, der Aufmarsch muss auch seinen Wachen aufgefallen sein.„
Louron, das wusste Pierre, lebte drei Straßen weiter. Da er dem Orden zu Dank verpflichtet war, hatten sie zu seinem Haus einen Gang angelegt, der es im Falle einer Belagerung erlauben würde, einen Boten an andere Ritter zu schicken.
Pierre eilte los. Den weiten Weg zur Schatzkammer hatte er zurückgelegt, bevor der erste Soldat das Tempelgelände betreten hatte. Er schloss die Türe auf und fand das Bündel. Es war unhandlich und nicht besonders leicht. Aber der junge Servient schaffte es, die Last bis in den Keller zu bringen und dort mit ihr durch eine Falltür in den Gang zu entkommen. Ein Bursche mit dem Pierre oft Wache stand, erwartete ihn und verschloss die Falltür hinter ihm, schob eine Steinplatte wieder in die Lücke über der Holzklappe. Dann wurden die Fugen im Boden mit Schmutz verschmiert und ein Teppich darüber gelegt. Nichts deutete mehr auf den geheimen Ausgang hin.
Pierre musste einen Moment innehalten, als er die Treppe in den unterirdischen Gang hinter sich hatte. Der junge Mann hatte Angst, entdeckt zu werden. Es war ihm klar, das auf eine Verhaftung die Verhöre der Inquisition folgen würden. Er wusste, zu welchen unmenschlichen Dingen die Inquisitoren und ihre Folterknechte fähig waren. Er wusste auch, dass er als Mitglied des Templerordens ganz bestimmt der Ketzerei bezichtigt werden würde. Er, ein Ketzer, ein Leugner des Herrn. Der Gedanke war ihm unerträglich, aber er wusste auch um die Worte Jesu. Wenn es sein müsste, würde er für seinen Glauben sterben. Aber zuerst würde er seinen Auftrag erfüllen und die heiligen Gegenstände vor den Schergen des Königs in Sicherheit bringen. Langsam beruhigte sich sein Atem. Er fragte sich, was wohl in dem Bündel sei. Aber er hatte nicht die Zeit es zu öffnen. Kaum dass er zu Atem kam setzte er seinen Weg fort. Der Gang führte etwa 300 m in östliche Richtung zu einem großen Haus mit einem Pferdestall.
Philipp Louron war ein angesehener Kaufmann, der durch die Verbindungen des Ordens reich geworden war. Er hatte den Aufmarsch der Soldaten bemerkt und wartete auf den Boten, der den Tempel durch den Geheimgang verlassen würde. Eine Kutsche war bereits angespannt und mehrere einfache und unauffällige Gewänder lagen bereit. Erstaunt stellte er fest, dass nur ein einziger junger Mann in schwarzen Rock aus dem Gang heraustrat. Pierre hielt sich nicht mit langen Reden auf, eine mehrtägige gefährliche Reise lag vor ihm. Er erklärte Louron nur, er müsste Paris im Auftrag des Großmeisters verlassen. Schnell wechselte er die Kleider, machte sich mit der Kutsche und dem Bündel auf den Weg, denn es bestand die Gefahr, dass der Geheimgang von den Soldaten entdeckt würde, sie auch Pierre gefangen nehmen und seine Fracht beschlagnahmen würden.
Auf dem Weg durch Paris wurde er zweimal von der Stadtwache gestoppt. Aber das Schreiben, welches dem Bündel beigelegt war, wies ihn als geheimen Gesandten des Königs aus, der eine wichtige Botschaft in die Bretagne zu bringen hatte. Jedes dem Orden angehörige Haus wurde durchsucht. Pierre wusste, dass es nicht lange dauern würde, bis jemand die Verbindung zwischen Louron und dem Orden bemerken oder die Entdeckung des Geheimganges die Soldaten zu dem Kaufmann führen würde. Pierre übernachtete unterwegs dreimal im Freien. Jedes Mal vergrub er vorher das Bündel. Er trug ein Schwert und einen Dolch bei sich, mit deren Umgang er zwar gut geübt war. Aber er wollte nicht, dass das Bündel im Falle seines Todes an Strauchdiebe fiel.
Am 16. Oktober erreichte er Kerien. Die Templer ließen in der kleinen Gemeinde eine Kirche bauen. Für die kleine Gemeinde war dieser Bau, der bereits bis auf die Grundsteine des Altars fertig gestellt war, viel zu groß.
Bruder Louis de Gonneville, der die Bauarbeiten überwachte war schnell gefunden. Hier in der Abgeschiedenheit des Dorfes nahm sich Pierre zum ersten Mal die Zeit das Bündel zu öffnen. In der Unterkunft von Bruder Gonneville erfuhr Pierre, dass das Bündel bereits seit Jahren für diese Kirche gedacht war, vielmehr wurde dieses Haus nur gebaut, um die mysteriöse Fracht zu verstecken. Louis de Gonneville weihte den jungen Servient in ein großes Geheimnis ein. Bereits am Tage darauf wurde der Inhalt des Beutels unter dem Altarstein in der Kirche eingemauert.
18. September 1690 Kerien im Nordwesten Frankreichs
Marcel Dermount, ein junger Geistlicher aus einer kleinen Stadt im Norden Frankreichs, war auf dem Weg seine Priesterstelle bei Kerien anzutreten. Sein Vorgänger, Pater Pierre Dymont, der über 20 Jahre in dieser kleinen Gemeinde für das Seelenheil der Menschen gesorgt hatte, war plötzlich und unerwartet gestorben.
Der lange, beschwerliche Weg in diesen abgelegenen Ort gab Marcel die Gelegenheit über seine neue Verantwortung nachzudenken. Würde er sich seiner Berufung würdig erweisen?
Der lange Marsch war anstrengend. Aber in Corlay meinte es das Glück gut mit ihm. Er traf einen Bauern, der ihn die letzten Kilometer auf seinem Eselskarren mitnahm. Ein Gespräch mit dem Bauern gab Marcel einen ersten Einblick in das Leben, das ihn erwartete.
Pater Dermount litt an einer Verletzung, die er sich in jungen Jahren zugezogen hatte. Seine Eltern hatten ihn sehr früh ins Kloster gegeben und der junge Marcel hatte versucht aus dem Kloster zu entkommen. Auf seiner Flucht war er so unglücklich gestürzt, dass er sich das Schienbein brach. Der Bruch war trotz der bemühten Pflege der Mönche schief verheilt. Deshalb hinkte er ein wenig, was ihm den Marsch zu seinem neuen Amt erschwerte. Marcel hatte diese gescheiterte Flucht immer als ein Zeichen gesehen, dass er zum Priester und Mönch berufen sei. Er hatte es nicht bereut. Im Kloster wurde ihm Schreiben und Lesen beigebracht und er hatte Zugang zu Büchern, worin er eine große Gnade sah.
Die 300 Seelengemeinde Kerien lag abgeschieden auf einem Hügel und die nächste Pfarrei befand sich in der, gut 12 Kilometer entfernt gelegenen, Gemeinde St. Péver. Bei seiner Ankunft im Dorf erregte Marcel viel Aufsehen, denn in der Abgeschiedenheit dieses Dorfes waren die Bewohner für Neuigkeiten besonders empfänglich. Die Dorfkirche war für die kleine Gemeinde unerwartet groß, aber in einem erbärmlichen Zustand. Das riesige Gebäude sah aus wie eine verkleinerte Nachbildung des Notre Dame in Paris, dass Marcel von einer Zeichnung in einem Buch kannte. Er fragte sich, wie der kleine Ort wohl zu diesem Bauwerk kam? Zur Kirche gehörte eine kleine Hütte, die ebenfalls in keinem besonders guten Zustand war. Das Dach leckte und eine der Seitenwände wies große Risse auf, weshalb sie außen mit großen Balken abgestützt war.
Als Marcel das Innere der Kirche betrat, löste sich ein Dachbalken und stürzte auf den Altar. Der Sockel, auf dem der gewaltige Altarstein thronte, brach daraufhin auf der linken Seite zusammen, Staub wirbelte auf und aus einem Hohlraum, der nun frei lag, schimmerte etwas Silbriges. Fasziniert von dieser Entdeckung trat Marcel, ohne an die Gefahr des baufälligen Daches zu denken, zum Altar. Er wusste, dass in jeder katholischen Kirche die Reliquie eines Heiligen gelagert wurde. Ein Fingerknochen, etwas Asche oder was immer man von dem jeweiligen Schutzpatron hatte. Neugierig kniete der Priester vor dem Sockel und konnte den silbernen Gegenstand unter dem Altar hervorziehen. Es war ein mit kunstvoll bearbeitetem Silberblech verzierter Holzkasten. In die silbernen Ornamente waren an einigen Stellen goldfarbene Blechstücke eingelassen. Auf der Oberseite war ein seltsamer grüner Stein in einer aufragenden Fassung angebracht. Marcel erhob sich mit dem Kasten. Dieser Prunk schien ihm ungewöhnlich. Selbst für die katholische Kirche. Aber die Faszination war so stark, dass er in diesem Moment nicht darüber nachdachte. Durch ein Loch in einem der verdreckten Seitenfenster fiel zufällig ein Lichtstrahl und erhellte den Stein. Als Marcel plötzlich in dem Stein das Gesicht seines Erlösers zu sehen glaubte, schrie er erschreckt auf.
Einige der Dorfbewohner, die sich neugierig vor der Kirche versammelt hatten, wagten nun ein paar Schritte in die Kirche und trauten ihren Augen nicht. Sie sahen in dem Halbdunkel einen starken Lichtstrahl, der durch ein Seitenfenster in Richtung des Altars, vor dem der Priester stand, einfiel. Sie sahen den Rücken des Priesters, um dessen Kopf sich der Raum zu erhellen schien. Ein dumpfes Rumpeln kam vom Altar her und die Wand über dem Marmorblock färbte sich grün. Der alte Verputz im Altarraum schien zu glühen, an manchen Stellen begann er abzubröckeln und es bildete sich ein Ring, etwa von der Breite zweier Handflächen mit dem Durchmesser eines großen Wagenrades, in dem das blanke Mauerwerk zu sehen war. In der Mitte des so entstandenen Kreises wirkte die Wand, als hätten die Handwerker sie gerade fertig gestellt. Eben an dieser Stelle über dem Opferstein, erschien der Schatten eines Kopfes, aus dem ein immer deutlicheres Bild entstand. Einzelheiten zeichneten sich ab. Augen waren zu sehen, ein Mund, eine Dornenkrone. Dieses Bild brannte sich in die Wand ein. Nach einer halben Minute, als der Lichtstrahl nicht mehr vor den Priester fiel, verdunkelte sich alles.
Pater Marcel kniete nieder, stellte den Kasten ab und hielt ein paar Sekunden inne. Dann sprang er auf, ging zum Eingang, wo er die Bauern, die wie angewurzelt in der Tür standen und sich bekreuzigten, hinaus schickte. Draußen schloss er die Kirche ab und hieß zwei Bauern die Türe zu bewachen. Dabei drohte er ihnen mit den schlimmsten Strafen der Hölle, wenn sie auch nur irgendjemanden durch die Tür ließen.
Dann begab er sich zu der kleinen Hütte, die einstmals Pater Piere als Wohnstätte gedient hatte, und suchte sich etwas zum Schreiben. Plötzlich fiel ihm auf, dass er nicht mehr hinkte. Eine starke Ehrfurcht erfasste ihn. Er verfasste einen Brief an seinen Bischof und schickte sofort einen jungen Burschen los, der den Brief überbringen sollte.
Pater Marcel bewachte die Tür der Kirche, bis der Junge drei Tage später mit zwei Abgesandten des Bischofs zurückkehrte. Die beiden Mönche fanden ihn auf Knien, in ein Gebet versunken, am Ende seiner Kräfte vor dem Eingang der Kirche. Die Tür des Gotteshauses wurde geöffnet und die beiden Männer sanken ehrfürchtig auf die Knie. Die beiden sollten die Vorgänge in Kerien überprüfen, aber es brauchte nicht lange die beiden Männer zu überzeugen: An der Wand gegenüber des Portals, über dem Altar, in der ansonsten dunklen Kirche, leuchtete eine helle weiße Stelle auf, in der man deutlich den mit Dornen gekrönten Kopf eines Mannes sah. Nachdem Pater Marcel mit den beiden Gesandten des Bischofs ein langes Gebet gesprochen hatte, führte er die Männer zu der edel verzierten Holzkiste, die noch so vor dem Altar lag, wie der Pater sie abgestellt hatte. Die Mönche untersuchten die Kiste vorsichtig. Sie sahen zwei Scharniere am oberen Rand und eine kreuzförmige Öffnung auf der gegenüberliegenden Seite, unter der eine Art Wappen angebracht war, offenbar das Zeichen eines Ritterordens. Pater Marcel verließ auf Geheiß der beiden Gesandten die Kirche. Er taumelte hinaus und wurde, als er sich vor der Kirche niedersetzte, vom Schlaf übermannt. Die beiden Männer setzten ihre Untersuchungen fort. Unter dem Altar, in dem kleinen Hohlraum, fanden sie ein zusammengerolltes Stück Kupferblech, das sich beim Ausrollen als Schriftstück erwies.
Der Lateinische Text der Kupferrolle erwies sich als Warnung an alle Ungläubigen, diesen Kasten zu öffnen. Er enthalte das Gefäß, mit dem das Blut Christi, der am Kreuz für die Sünden der Menschheit gestorben und am dritten Tage auferstanden sei, aufgefangen wurde. Die beiden Männer waren entsetzt. Sie waren ausgebildet alles in Frage zu stellen, in jedem Bericht über Erscheinungen Verrat und Ketzerei zu sehen. Aber dieser Umstand füllte die beiden mit einem derartigen Schrecken, dass ihnen zeitweise der Atem stockte. Als seien sie eins, stieg in ihnen das Verständnis um die Fehler der Inquisition auf, um die vielen Unschuldigen, die man dazu gebracht hatte, Christus zu verleugnen. Beiden war die Praxis der Machterhaltung, welcher sich die Kirche in den letzten Jahrhunderten bedient hatte, klar geworden. Wiederum wurde die Kirche verschlossen und ein Bote geschickt.
Pater Marcel wurde in die kleine Hütte neben der Kirche gebracht, wo man ihm ein Lager errichtete. Auch er wurde bewacht. Am nächsten Tag bereits traf der Bischof persönlich ein, in seinem Gefolge waren Soldaten und Gelehrte. Die Soldaten riegelten das Dorf ab und drohten den Dorfbewohnern ewige Verdammnis an, wenn sie über das Geschehene sprächen. Nach zwei Tagen, in denen die Kirche gründlich von einem Dutzend Gelehrter untersucht worden war, zog der ganze Tross ab. Die gezeichnete Stelle über dem Altar wurde abgemeißelt, während die Kupferrolle und der Silberkasten mit an den Bischofssitz genommen wurden. Auch Pater Marcel musste sich dem Zug des Bischofs anschließen. Seine Stelle besetzte ein Mönch, den der Bischof vom Mont St. Michel berief. Nach eingehender Prüfung des Vorfalls wurde Pater Marcel nach Rom, zu Papst Alexander VIII geschickt. Mit dem Kasten, der Kupferrolle und einem großen Aufgebot an Soldaten und Mönchen machte er sich auf die Reise.
Der Zug verließ San Bernadot am 1. März 1691, aber keiner der Männer erreichte Rom oder wurde je wieder gesehen.
12. Juni 1996 Idar-Oberstein in Deutschland
Urlaubsreif!?!
„Mir reicht es! „
Montag 7.30 h. Sein Arbeitsanzug ließ nur noch wenig von seiner ursprünglich blauen Farbe erkennen.
„Die Maschine gehört doch ins Deutsche Museum! „ , fluchte Mario und erntete damit nur ein lautes Lachen.
Sein Kollege von der benachbarten Schleifstraße amüsierte sich großartig.
Seit 6.00 h versuchte Mario diese vorsintflutliche Maschine wieder in Betrieb zu nehmen. Aber was er auch tat, die Maschine tat nichts. Und die beiden anderen Automaten, die er zu betreuen hatte, machten ihm heute ebenfalls das Leben schwer.
Also marschierte er zu seinem Vorarbeiter und ließ sich die Betriebsschlosser herbestellen.
Zurück an der Maschine überkam ihn der endgültige Frust. Die beiden anderen Bohrautomaten standen auf Störung und die Trockenstraße erreichte einfach nicht die richtige Temperatur.
Es waren noch zwei Wochen bis zum Urlaub und ihm kam mittlerweile jede Minute wie eine Ewigkeit vor.
Mario drehte sich zu seinem Kollegen und sagte:„ Wollie, es wird Zeit für den Urlaub.„
„Genau!„, stellte dieser in seiner wortkargen Art fest.
An diesem Tag ging Mario alles auf den Geist. Seit drei Monaten war er Single, die letzten zwei Wochen musste er Überstunden machen um zwei kranke Kollegen zu ersetzen und die Arbeit an diesen Maschinen, von denen keine weniger als zwanzig Jahre auf dem Buckel hatte, war die Hölle. Heute kamen noch andere Faktoren dazu. Seine Kollegin Tanja, die an der Trockenstraße die fertigen Teile in die Stapelboxen packte, war so aufreizend angezogen, dass es ihn total aus dem Konzept brachte. In dieser staubigen, dreckigen und alten Produktionshalle wirkte sie auf ihn mehr als die aufgehende Sonne, deren Strahlen sich langsam durch die grauschleierbehafteten Fenster der Halle kämpften.
Sie war 31, somit ganze fünf Jahre älter als er, aber sie wäre locker für 23 durchgegangen. Sie hatte ihre hüftlangen schwarzen Haare in ihre Kittelschürze gesteckt. Unter diesem offenen Kittel trug sie eine Jeans, die man ihr wohl angegossen hatte und ein Top in Flecktarnmuster. Diese Aufmachung wirkte wie in einem billigen Film und stand in völligem Kontrast zu ihrem Arbeitsplatz. Sie war eine sehr attraktive Person und für die Männer, die in der Halle arbeiteten, das Licht im Dunkel. An solchen Tagen wie diesem, an denen alles daneben lief, war es immer sehr schön mit ihr einen kleinen, wenn auch aussichtslosen Flirt anzufangen.
In den letzten drei Monaten, seit seine Freundin ihn verlassen hatte, machte es Mario umso mehr Spaß mit ihr zu flirten, wenn er samstags als Aushilfe hier arbeitete. Als Mario vor zwei Wochen seine Diplomarbeit abgegeben hatte, ergab es sich, dass er noch vier Wochen Vollzeit hier arbeiten konnte und er war nun mit Tanja in derselben Schicht. Leider hatte er an diesem Montag nur wenig Zeit für ein Gespräch, weil keine der Maschinen so richtig laufen wollte. Die erste Schicht in der Woche war immer am schlimmsten, denn bis die alten Maschinen richtig liefen, hatte man alle Hände voll zu tun. Am schönsten waren, vor allem im Sommer, die Nachtschichten.
Seltsamerweise erreichte man in der Nachtschicht dieselben Stückzahlen mit weniger Aufwand. Vielleicht weil man keinen ständig nörgelnden Meister um sich hatte. Marios Meister, dieser kleine Giftzwerg, zeichnete sich dadurch aus, dass er immer nur tobte. Er brüllte herum, ob man nun 8 oder 8.000 Teile in der Schicht fertigte.
Seine zwergenhafte Gestalt, die in den Nacken reichende Stirn und seine langen krausen Augenbrauen, welche sich aufzurichten schienen, wenn er herumbrüllte, ließen ihn eher lächerlich wirken. Mario wartete schon seit einer Stunde darauf, dass der Meister zu ihm käme, um ihn zur Schnecke zu machen, da seine Maschinen nicht richtig liefen.
Mario mochte die Nachtschichten. In den Nachtschichten hatte er meistens viel Zeit, weil die Automaten einfach liefen und er deshalb mit seinen Kollegen um die Wette mit Tanja flirten konnte. Aber leider war keine Nachtschicht und die Automaten wollten auch nicht richtig.
Also freute er sich umso mehr, dass der Urlaub in Reichweite lag. Er hatte sich noch keine Gedanken darüber gemacht was er mit seinem Urlaub anstellen wollte. Nur endlich mal wieder raus wollte er. Seine letzte Freundin hatte er in 4 ½ Jahren Beziehung nur einmal zu einem Urlaub bewegen können und der war eine absolute Katastrophe gewesen.
In den letzten Jahren, in denen er studiert hatte, arbeitete er jeden Sommer und manchmal im Frühjahr als Einrichter der Bohrstraßen der Europakupplungen GmbH. Hier hatte er nach der Ausbildung zum Werkzeugmacher in Festanstellung gearbeitet und nebenher in der Abendschule seine Fachhochschulreife gemacht. Und obwohl die Arbeit eine Katastrophe war, gefiel es ihm dort als Aushilfe, da er in der kurzen Zeit recht gut bezahlt wurde.
„Zwei Monate im Jahr in diesem Loch reichen aus!„, dachte Mario, während er seine Maschinen mit viel handwerklichem Geschick dazu bringen konnte wenigstens 3.000 Teile zu produzieren. Seine Gedanken kreisten immer wieder um den bevorstehenden Urlaub.
Mallorca? Seine Kollegen waren immer begeistert. Sonne, Wein, Weib und Gesang. Einerseits reizte ihn die Idee, aber auf der anderen Seite wollte er sich erholen.
Wieder nach Südfrankreich? Für einen Urlaub allein war dies nicht der richtige Ort.
Er fand keinen Urlaubsort, der ihm das versprach was er suchte.
Auch die längste Schicht geht einmal zu Ende. Während er sich im Waschraum den öligen Kunststoffstaub von der Haut schrubbte, unterhielt er sich mit seinem Kollegen Wollie über dessen letzten Urlaub an der Nordsee. Nun, auch dies schien ihm nicht ganz das richtige zu sein.
Auf dem Heimfahrt hielt er kurz vor dem Reisebüro, doch keines der angepriesenen Ziele im Schaufenster schien die ihm die nötige Erholung zu versprechen.
Mario saß bereits zu Hause, als es ihn plötzlich wie eine innere Stimme überkam: Lissabon.
Der Schwiegervater seiner Tante hatte eine Pension in der Nähe von Lissabon.
Nun, Ruhe würde Mario dort sicher finden und wenn es ihn nach Unterhaltung drängen sollte, war die Bahnlinie ins Zentrum von Lissabon nur 300 Meter entfernt.
Begeistert von dieser plötzlichen Eingebung machte er sich auf den Weg zu seiner Tante. Diese setzte sich mit ihrem Schwiegervater in Verbindung und schon hatte er ein Zimmer. Danach ging er ins nächste Reisebüro, um einen Flug nach Lissabon zu buchen.
Eine sehr nette junge Dame begrüßte ihn im Reisebüro. Sie war so höflich, dass es beinahe schon nicht mehr auszuhalten war. Mario fragte sich, was das sollte, bis er auf ihrem Namensschild den Zusatz „Auszubildende„ entdeckte. Nun verstand er ihr mehr als freundliches Getue, besonders als er die kritischen Blicke der anderen Angestellten bemerkte. Sie bot ihm mehrere Flüge an und er nahm den günstigsten, den Transport Airlines Portugal, kurz TAP, anbot.
„Wenn schon nach Portugal, dann auch mit einer portugiesischen Gesellschaft, vor allem wenn sie auch die günstigste ist.„, sagte er zu der „Azubine„ die ihm die Tickets für den nächsten Tag versprach.
Zufrieden verließ Mario das Reisebüro und freute sich schon auf den Flug.
Die folgenden Tage verliefen besser. Seine kurzen Flirts mit Tanja schienen manchmal sogar hoffnungsvoll zu werden und die Vorfreude auf den Urlaub ließ die Schichten nicht mehr so endlos erscheinen.
29. Juni 1996 Madrid
Dr. Alfonso Guerre saß nervös an dem Tisch im riesigen Konferenzraum des Verlages San Pablo. Der Verlag war nur eine der Tarnbezeichnungen des Ordens. Alfonso arbeitete seit etwa 10 Jahren für die Gesellschaft, als angesehener Experte für Altfranzösisch und Kirchengeschichte. Was er in diesen 10 Jahren gesehen hatte, war unglaublich.
Der Orden, wie er sich selbst nannte, hatte riesige vollklimatisierte Bibliotheken, in denen Bücher und Schriftrollen aus allen Epochen der Geschichte aufbewahrt wurden. Alfonso hatte in den letzten Jahren Schriften übersetzt, die offiziell überhaupt nicht existierten. Deshalb hatte ihn der Orden zur absoluten Geheimhaltung verpflichtet. Da er nicht sehr viel über seine Arbeitgeber wusste, hielt sich Alfonso auch daran.
Der Aufwand, der hier mit der Konservierung und Übersetzung der Schriften getrieben wurde, war enorm. Allein die Bibliothek mit den Schriften aus dem Besitz der französischen Tempelritter und der Katheter füllte einen Raum von der Größe einer Turnhalle. Ein weiterer noch größerer Raum war gefüllt mit Aufzeichnungen von Hexenprozessen während der spanischen Inquisition. Es musste noch andere Bibliotheken mit Schriftstücken geben, die in anderen Ländern lagen. In den letzten zwei Jahren hatte der Orden mit gewaltigem Aufwand von den meisten Schriften digitale Kopien angefertigt. Diese waren, zusammen mit den Übersetzungen in die meisten Weltsprachen und den Ergebnissen der Auswertungen, zentral abrufbar. Eine gewaltige Computeranlage in Madrid und eine weitere in Paris machten einigen Auserwählten diese Daten zugänglich. Die Anlage war mit den modernsten Methoden der Zugriffssicherung ausgestattet und hätte dem Pentagon zu Ehren gereicht.
Dr. Guerre konnte sich weder die Finanzierung noch die Ziele der Organisation erklären. Bis zum letzten Jahr hatte er noch geglaubt, er arbeite wirklich für einen großen Verlag. Er hatte im letzten Sommer freien Zugriff auf das System erhalten, nachdem man ihn und seine Vergangenheit durchleuchtete. Man hatte es ihn wissen lassen, indem man ihm Einsicht in seine Akten gewährte. Von der Geburtsurkunde bis hin zu Notizen seiner Professoren über ihn, fand sich alles. Sogar eine Aussage des Priesters in seinem Heimatort gab es in dieser Akte. Jeder Strafzettel war hier vermerkt. Über den Verlauf seiner schulischen Laufbahn gab es sogar Statistiken, welche die Entwicklungen seiner Noten und Beurteilungen zeigten. Wenn man ihm mit dieser Akte Ehrfurcht einflößen wollte, so war man damit erfolgreich. Alfonso war anfangs etwas verängstigt und keine 10 Pferde hätten ihn bewogen zu kündigen oder auch nur ein Wort über seine Arbeit nach außen dringen zu lassen.
Ein fast 600 Seiten starker Bericht beschrieb lückenlos seinen Lebenslauf und sein privates Umfeld. An dem Tag, als er den Zugriff auf das Zentralsystem erhielt, teilte man ihm auch einen neuen Arbeitsbereich zu. Zusammen mit den verschiedensten Spezialisten wertete er die Schriften des Nostradamus aus, ebenso bearbeitete er die Geschichte der Templer und die verschiedenen Schriften über den Heiligen Gral. Zu seiner Arbeitsgruppe gehörten zwei Computerspezialisten, deren Aufgabe es war die nötigen Datenbanken zu entwickeln, um die Ergebnisse mit anderen Gruppen der Organisation abzustimmen. Ebenso ein Kryptographieexperte, der direkt mit ihm zusammenarbeitete. Dann gab es noch einen Mann namens Müller, dessen Aufgabe es war, die Fortschritte des Projektes zu überwachen. Dr. Guerre selbst fiel die Aufgabe zu, die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zu bewerten und mit denen anderer Arbeitsgruppen zu verknüpfen. Er betrieb eine Art Recherche und gab neue Ideen einzelner Gruppen an andere weiter. Auch überwachte er Veröffentlichungen von Wissenschaftlern und Romanautoren, die nicht der Organisation angehörten. Manchmal brachte ein Roman oder die halb wissenschaftliche, halb spekulative Veröffentlichung eines Hobbyautors neue Ideen oder zeigte Quellen auf, die man bisher übersehen hatte. Die Arbeit im Team war angenehm und Geld schien keine Rolle zu spielen. Alfonsos Gehalt war nun beinahe fürstlich und alleine deshalb stellte er keine Fragen was die Organisation und ihre Geldgeber betrafen.
Aber in den letzten zwei Monaten schien sich die Entstehung des Ordens und die Zielrichtung vor ihm auszubreiten. Er bearbeitete die Geschichte der Templer, von der Ordensgründung im 11. Jahrhundert bis zur Bildung der Splittergruppen nach der offiziellen Auflösung des Ordens im 14. Jahrhundert. Es gab unter den nachfolgenden Organisationen zwei Hauptgruppen. Die eine wollte Rache an den Päpsten und Königen üben, während die zweite sich der Verbreitung der Lehre Christi widmete. Hingegen hatte die Kirche auch ihre eigenen Machterhaltungsinstrumente gestrickt und es waren weitere Organisationen gegründet worden, deren Aufgabe es war, die Macht des Papstes und der Kirche zu erhalten und zu stärken. Die Mitglieder dieser Verbindungen waren allesamt reiche, mächtige Leute, die einen Generalablass vom Papst erhielten, der ihnen einen Platz im Himmelreich versprach und den Erlass des Fegefeuers versicherte. Der Orden musste zu einer der ersteren Organisationen gehören. Da Alfonso keine enge Verbindung mit dem Vatikan feststellen konnte, musste die Organisation zu einer der Splittergruppen der Templernachfolger gehören.
Dr. Guerre hatte während seiner Zeit in dieser Stelle einige Dinge gesehen und erlebt, die noch seltsamer waren, als die Existenz der Schriften selbst, die er übersetzte. Es war in den letzten Jahren häufig unter den Mitarbeitern zum so genannten Jerusalem-Syndrom gekommen. Viele Pilger, die nach Jerusalem kommen und dort feststellen, dass es die vielen, in der Bibel erwähnten Plätze wirklich gibt, halten sich oft kurzzeitig für Johannes den Täufer oder den Messias selbst. Genau derselbe Effekt trat unter den Mitarbeitern auf, wenn sie authentische, vertrauenswürdige Schriften von Wundern fanden oder eine der wahren Reliquien, welche im Besitz des Ordens waren, untersuchten.
Alfonso selbst war beim Lesen eines Dokuments der Vorstellung verfallen, er sei ein französischer Dorfgeistlicher, der in seiner Kirche den heiligen Gral entdeckt habe. Die Vorfälle wurden in diesen Arbeitsgruppen besonders gehandhabt. Während die Pilger meist mit Medikamenten und psychologischer Hilfe möglichst schnell von ihren Visionen befreit wurden, gab es in der Organisation eine Spezialistengruppe, die diese Phänomene beobachtete und kontrollierte. Der Betroffene wurde befragt und alle seine Aussagen wurden detailliert protokolliert. Zwei Psychologen wachten Tag und Nacht über den Patienten und sorgten dafür, dass er sich nicht in seine Vision verrannte. Es hatte sich gezeigt, dass die Visionen oft erstaunlich real wirkten und sie traten nur auf, wenn die Wissenschaftler mit Originalen der Schriften oder Gegenständen zu tun hatten.
In Alfonsos Fall brachte die Vision sogar eine bisher neue Theorie über die Geschichte des Grals. In den früheren Berichten wird der Gral als Kelch des letzten Abendmahles dargestellt, während er in späteren Erzählungen ein Heiliger Stein gewesen sein soll. Alfonso beschrieb in seiner Vision eine silbern verkleidete Holzkiste mit einem Smaragd, der in einer Fassung auf der Oberseite befestigt war. Eine kupferne Schriftrolle hätte den Inhalt der Kiste als die hölzerne Schale ausgewiesen, die mit dem Blut Christi benetzt war. Obwohl die Schale angeblich über 1300 Jahre alt sein sollte, habe sie keine Anzeichen von Beschädigung aufgewiesen. War der Stein auf dieser Holzkiste der Gral, den Wolfram von Eschenbach in seinem Parzival beschrieben hat? Nun: der Verdacht lag nahe.
Nachdem man die Ortsangaben aus Guerres Vision überprüft hatte und nach ähnlichen Schilderungen in der Datenbank suchte, fand man das Geständnis eines jungen Servient des Templerordens, der aussagte, er habe die Schale mit dem Blut Christi gesehen. Trotz der Folter verriet er aber nicht das Versteck des Grals. Aber er lieferte eine gute Beschreibung eines Steines, mit dem Behälter der Schale geschmückt sei. Ein Smaragd, in dessen Inneren der Kopf des Heilands zu sehen sei.
Der Hinweis einer anderen Arbeitsgruppe führte ins Spanien des 20. Jahrhunderts. Mitte der sechziger Jahre wurde von einer Wunderheilung mit einem Stein berichtet, dessen Beschreibung auf den Smaragd aus Alfonsos Vision und auch auf die Schilderungen des jungen Templers passte. Der Stein sei von einem Mann namens Miguel Roca vor den Schergen der Franco-Diktatur nach Portugal gebracht worden. Die Schale und die Holzkiste wurden in diesem Bericht allerdings nicht erwähnt.
Alfonso, dessen Gedanken um diese Hinweise kreisten, fragte sich, was diese außerplanmäßige Konferenz sollte, denn er hatte ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Müller betrat den Raum, setzte sich aber nicht wie bei den Arbeitssitzungen an die Kopfseite des schweren Tisches, sondern nahm neben Dr. Guerre Platz. Der Kryptographie-Spezialist, Michael Halford, nahm sichtlich verwirrt gegenüber Alfonso Platz. Dann betraten zwei Herren den Raum, die Dr. Guerre noch nie gesehen hatte. Sie setzten sich neben Halford. Es herrschte gespannte Ruhe. Keiner der Anwesenden sprach etwas. Müllers Gesicht wirkte angespannt und Alfonso bemerkte zum ersten Mal, dass er nicht wusste wie Müller mit Vornamen hieß.
Durch eine bisher nicht sichtbare Tür, in einer der edel geschmückten Wände, trat ein großer Mann ein, der ein Gewand trug, welches Alfonso an die Figur des Kardinal Richelieu aus einem der alten Musketierfilme erinnerte. Ein Mann in einem Priestergewand trat ebenfalls aus der Tür, gefolgt von zwei Herren in schwarzen Anzügen, welche seltsame elektronische Apparaturen mit sich führten. Die beiden sahen aus wie Bodyguards aus einem billigen Kriminalfilm. Groß, kräftig und verwegen. Die beiden „Wachmänner“ liefen mit ihren technischen Spielzeugen durch den großen Raum, ohne die Anwesenden zu beachten. Einer zog den Stecker eines Telefons aus der Anschlussdose heraus, während der andere wieder durch die Geheimtür verschwand. Weder die beiden noch irgendjemand sonst sprach ein Wort. Der geheimnisvolle Bodyguard trat wieder aus der Tür heraus, und positionierte mehrere Radios, die er mitgebracht hatte, auf den Fensterbänken. Nachdem alle Radios eingeschaltet waren und jedes auf einen anderen Sender eingestellt war, gab er seinem Kollegen ein Zeichen. Dieser wiederum gab dem Herrn im Kardinalsgewand ein Zeichen, welcher sich daraufhin als Ordensmeister Enrique Duarte vorstellte. Er entschuldigte sich für die Vorsichtsmaßnahmen, aber eigentlich waren sie es gewohnt. Beim Betreten des Gebäudes wurde man auf seine Identität, auf Waffen oder Werkzeug untersucht. Ebenfalls durften Datenträger oder Dokumente nur mit Genehmigung aus dem Haus geführt werden. Durchaus verständliche Maßnahmen. Aber warum sollte jemand sie abhören?
„Was ich Ihnen heute zu sagen habe ist ebenso erfreulich wie unangenehm! „ , begann der Ordensmeister seine Ansprache. Die Spannung in den Gesichtern der Anwesenden stieg. Duarte fuhr fort:„Mister Halford hat, wie Sie wissen, mit Dr. Guerre einen Großteil der Prophezeiungen des Nostradamus entschlüsselt. In den letzten Tagen ist es uns auch gelungen die Zahlenangaben zu entschlüsseln. Der Gralsstein wird in den entschlüsselten Übersetzungen erwähnt. Die Zahlen zeigten sich als eine Kombination aus Orts- und Zeitangabe, wodurch wir annehmen können, dass sich der Gralsstein in einem Vorort von Lissabon befindet.
Soviel zum angenehmen Teil der Sache. Im Normalfall würden wir eine Gruppe von Forschern dorthin schicken, welche die Sache überprüft, aber durch Umstände, die ich ihnen hier nicht im Einzelnen erklären kann, ist uns dies bereits abgenommen. Wir können davon ausgehen, dass sich der Stein, wenn nicht sogar der Gral selber, in Lissabon befindet. Aber durch eben diese Umstände sind wir nicht die Einzigen, die davon wissen. Nach der beinahe zufälligen Entschlüsselung der Zahlen in den Prophezeiungen, hat ein Mitarbeiter die Daten weitergegeben.„
Alfonso fiel bei diesem Satz auf, dass keiner der Informatiker anwesend war. Die Rede des Ordensmeisters wurde für ihn immer interessanter.
„Der Betreffende hatte die Daten an gewisse Herren im Vatikan weitergeleitet, die ein Interesse daran haben, dass die Gegenstände verschwunden bleiben! Nach den Informationen unseres Geheimdienstes haben sie auch schon Leute nach Lissabon geschickt. Uns liegt der Name eines Mannes vor, der eventuell der momentane Besitzer des Steines ist: Fernando Rodrigues. Wir haben umfangreiche Nachforschungen über diesen Mann angeordnet. Es sieht im Moment leider so aus, als hätten sich unsere Gegenspieler bereits mit ihm in Verbindung gesetzt. „
Alfonso war entsetzt, Leute im Vatikan, die den Gral verschwinden lassen wollten. Geheimdienste und ein Ordensmeister der von einer Prophezeiung spricht, wie von einer Bedienungsanleitung. Obwohl er nach seiner Vision und der Reaktion des Ordens eigentlich an solche Sachen gewöhnt sein sollte, kam er sich wie in einem Film vor. Vor seinem inneren Auge sah er ein Kino, über dessen Eingang stand: „Alfonso Guerre und die Jäger des heiligen Grals„.
Die Prophezeiungen, die Halford und Alfonso übersetzt hatten, enthielten aber auch einen Abschnitt über einen Deutschen, der kommen würde, die Tochter des Gralshüters zu beschützen. Aufgeregt warf er die Frage nach diesem Abschnitt in die Runde. Als hätte er diese Frage bereits geahnt, antwortete Meister Duarte: „Die Daten ergeben, dass er morgen oder übermorgen aus Deutschland nach Lissabon kommen wird. „
Die Gruppe war erstaunt. Halford hatte Guerre zwar vor ein paar Stunden ganz aufgeregt angerufen und berichtet, dass ihr neues Entschlüsselungsprogramm völlig neue Ergebnisse liefert, aber eine solch genaue Angabe erstaunte ihn. Da er die Zahlen noch nicht gesehen hatte, fragte er: „Kann ich die neuen Daten der Prophezeiungen sehen? Eine solch genaue Angabe erscheint mir unwahrscheinlich! „
„In wenigen Minuten werden Sie noch viel mehr bekommen. Die Zeit- und Ortsangaben werden von unserem Computer noch mit historischen Ereignissen verglichen„ , antwortete der Ordensmeister. „Das kann doch nicht so lange dauern?„ , wandte Müller ein.
„Der Computer rechnet seit gestern Abend an diesen Daten. Die Zeit zu bestimmen ist leicht, aber die Position zu finden ist schwierig. Nostradamus benutzte Sternkarten, die nach einem anderen System eingeteilt waren. Aus den Angaben, die wir entschlüsselt haben, ergibt sich eine Planetenstellung, die man in ein Kartensystem einträgt. Dann muss man den Ort finden an dem zu exakt dieser Zeit die Planeten so zu sehen waren. Es ist mir ein Rätsel wie er das damals so genau berechnen konnte„ , gab Halford als Antwort.
„Ist denn anzunehmen, dass ihre Entschlüsselung zuverlässig ist?„ , fragte Müller weiter.
„Vor zwei Stunden konnten wir eine Deckungsquote von Ereignis, Ort und Prophezeiung von 93 % nachweisen, aber der Computer hatte erst 30 % der Vorhersagen berechnet. Wir konnten den exakten Termin für zwei Erdbeben nachweisen, den Ausbruch des 1. und 2. Weltkrieges zuordnen, den Untergang der Titanic und einiges mehr, es ist unglaublich„ , sagte Halford und wandte sich an Alfonso, „Dr. Guerre, wenn es stimmt, dass Nostradamus in einem seiner Bücher ein Heilmittel gegen Krebs erwähnt, dann sollten sie sich die Rezeptur patentieren lassen.„
Eine junge Dame, mit einem Stapel Papier unter dem Arm, betrat den Raum. Sie verteilte die Computerausdrucke an die Männer im Raum. Dr. Guerre betrachtete die Seiten vor sich mit einem immer stärker werdenden Ausdruck von Faszination und Entsetzen. Der Druck zeigte die Übereinstimmungen zwischen den Prophezeiungen und realen Ereignissen. Er hörte den Ordensmeister seinen Namen rufen und Alfonso tauchte langsam aus seiner Geistesabwesenheit auf.
„Dr., Sie werden sich noch heute auf den Weg nach Frankfurt machen, das Ticket werden wir ihnen sofort besorgen. Fahren sie nach Hause und packen sie ihre Koffer. Wenn ich die Daten richtig interpretiere, haben wir eine ernsthafte Krisensituation!„
Dr. Guerre brach der kalte Schweiß aus. Er litt unter einer ausgeprägten Flugangst.
Duarte bemerkte, was in Alfonso vorging und sprach: „Es tut mir leid. Dr.! Ihre Flugangst ist mir bekannt, aber in Anbetracht der Situation muss ich leider Sie einsetzen. Sie sind der Einzige, der den Smaragd bereits in einer Vision gesehen hat und Sie kennen die Gralsgeschichte, sowie die Prophezeiungen am besten.„
Alfonso schluckte und stand auf. „Dann werde ich wohl Packen.„
1. Juli
1
Es war 4:00 h morgens, Alberto Sanchez saß, in tiefe Nachdenklichkeit versunken, in einem unauffälligen Kleintransporter. Er observierte ein Gebäude in einem ruhigen Wohnviertel von Rom.
Die Ereignisse der letzten Tage hatten ihn in seiner Überzeugung bestärkt, dass es richtig gewesen war die Seiten zu wechseln. Ein Mann wie er, ein gut ausgebildeter Spion, ein trainierter Killer, ein Mann, der unter der Protektion einer weltweit sehr einflussreichen Organisation gedient hatte.
Alberto hatte eine miese Kindheit gehabt. Sein Vater hatte sich zu Tode gesoffen und seine Mutter, eine religiöse Fanatikerin hatte ihn in jungen Jahren in ein Priesterseminar gesteckt. Dort war er unter der Aufsicht von Mönchen gebrochen und geformt worden, um später als Priester ein Mann für ganz besondere Aufgaben zu werden. Er hatte in dieser schrecklichen Zeit einige Erlebnisse, deren Ausmaß ihm erst in den letzten Tagen bewusst wurde. Er hatte sich erinnert. Sanchez ahnte, die nächsten Wochen würden ihm die Gelegenheit geben, Buße zu tun.
Ein Mann betrat das überwachte Gebäude. Alberto schaltete die Überwachungsanlage vor ihm ein. Zwei Bildschirme leuchteten auf, ein Videorecorder begann zu surren. Die Monitore zeigten ein wirres Spiel von schwarz und weiß. Sanchez wusste, der Mann würde über seinen Computer mit seinem Vorgesetzten Kontakt aufnehmen. Alberto hatte in den letzten Tagen versucht, in die Verbindung der Computer einzudringen, aber die Verschlüsselung der Signale war von einer geradezu teuflischen Brillanz. Doch er war mit der modernsten Spionagetechnik aus Deutschland, Japan und den USA ausgestattet und umging dieses Problem, indem er einfach das schwache Signal zwischen Computer und Monitor aufzeichnete. Das neue System funktionierte recht gut. Der Vorläufer dieser Anlage war noch ziemlich störungsanfällig gewesen, aber die neue Anlage arbeitete einwandfrei, vor allem auf die kurze Entfernung, und durch eine so dünne Wand. Das Gewimmel auf den rechten Monitor verschwand, und der Startbildschirm eines bootenden Rechners war zu sehen. Sanchez grinste vergnügt, er liebte diese technischen Spielereien. Das Betriebssystem startete. Alberto öffnete ruhig und zufrieden eine Flasche Cola und nahm einen kräftigen Schluck. Ein Programm startete, es war der Internet-Browser. Die Bildqualität des Monitors vor Sanchez suggerierte fast das Gefühl, vor dem Bildschirm oben in der Wohnung zu sitzen. Er verfolgte die Geschehnisse auf dem Schirm mit Spannung. Bilder von nackten Frauen erschienen. Gefesselte Asiatinnen, halbe Kinder. „Sieh einer an„, sagte Sanchez und machte sich ein paar Notizen. Die Neigungen seiner Feinde zu kennen war oft von Vorteil. Dann folgten Darstellungen von nackten Kindern, die irgendwo am Strand aufgenommen waren. Alberto notierte die Internetadresse. Wenn er etwas hasste, dann diese Pädophilen. Er selbst hatte sich in seiner Jugend oft genug betatschen lassen müssen. In den nächsten Tagen würde er, anonym natürlich, die Sittenwächter des betreffenden Landes darauf aufmerksam machen, oder er würde selbst herausfinden, wo der Server steht und ihn eigenhändig vom Netz nehmen.