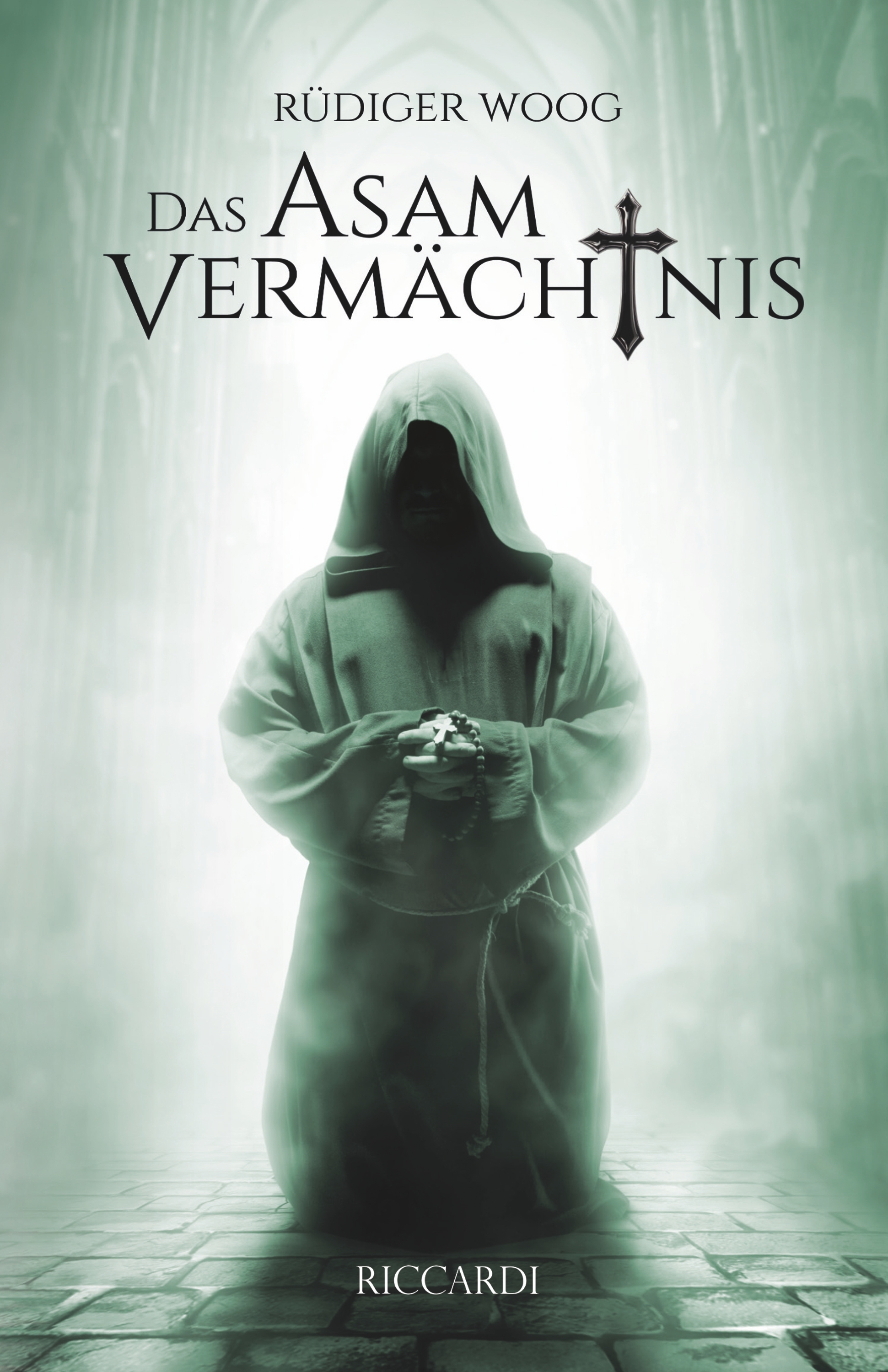Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: WOLFSTEIN
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gletscher sind Zeitmaschinen. Nun, da sie dahinschmelzen, geben sie ihre Geheimnisse preis und offenbaren uns eingefrorene, unendliche Jugend. Tris, ein junger Fischkopf von der Waterkant, begibt sich in den 80er Jahren auf einen Foottrip durch ein fremdes und aufregendes Deutschland, der ihn bis hinauf zum Zugspitzplatt führt; am Gürtel ein Walkman mit Springsteen-Songs, im Rucksack jede Menge Erbsensuppenbier und an der Hand ein bunter Schmetterling. In seinem neuen Roman nimmt uns Rüdiger Woog mit auf eine Zeitreise, die den Leser manchmal schmunzeln lässt und manchmal melancholisch stimmt, aber auf jeden Fall ein paar Schritte weit glücklich macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Zur Vorgeschichte gemachte Nachgeschichte
Das Land zwischen den Meeren
Jenseits der Meere
Den Steinen hinterher
Tom Petty und eine Karte voller Narben
Der steinerne Kompass
Aufbruch
Landgang
Durch die große Schlange getrennt
Wachsen drüben keine blauen Blumen?
Wölfe suchen und meiden die Menschen gleichermaßen
Der Schmetterling
Harinam
Am Morgen der Welt
Der steinerne Drache
Menschen im Tal
Und da waren’s drei
Weg
Der steinerne Mann
Zum Intermezzo gemachte Nachgeschichte
Herbsttage mit dem Puppenspieler
Das Ende der Achtziger
Alles außer nine to five
The walking man walks
Ein langer Weg hier herauf
Im Purpurregen
Tage wie Nummern
Weiß
In der Zeitschleife
Danksagung
Vollständige e-Book-Auflage 2024
Originalausgabe: »Der steinerne Kompass«
Copyright © 2024 WOLFSTEIN VERLAG
ein Imprint der Spielberg Verlagsgruppe, Neumarkt
Lektorat: Beate Brosig
Umschlaggestaltung: © Ria Raven, www.riaraven.de
Bildmaterial: © shutterstock.com
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
ISBN: 978-3-95452-128-9
www.spielberg-verlag.de
In treuer Erinnerung an meinen Freund, Grafiker und Wegbegleiter
James D. Beckett
und für
Bruce,
mit bestem Dank für den Soundtrack meines Lebens!
I have climbed highest mountains
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you
I have run
I have crawled
I have scaled these city walls
These city walls
Only to be with you
But I still haven‘t found what I‘m looking for
But I still haven‘t found what I‘m looking for
U2, 1987
Zur Vorgeschichte gemachte Nachgeschichte
Sollte es den lieben Gott wirklich geben, dann muss er einen recht schrägen Humor haben, denke ich mir, wie ich auf die grau gekränzten, kahlen Hinterköpfe vor mir starre. Denn sicherlich hat er diese glänzende Ödnis der männlichen Eitelkeit einer Stelle zugedacht, die naturgemäß für alle Anderen sichtbar ist, nur nicht für den leidtragenden Herrn selbst, in, nach oder im schlimmsten Falle noch vor seinen besten Jahren. In ihren schwarzen Anzügen und Winterjacken wirken sie von hinten alle wie geklont. Die Frauen haben sich hauptsächlich auf der linken Seite des offenen Grabes versammelt, während die Männer ihnen gegenüber auf der rechten stehen, getrennt durch eine unüberwindbare, 1,80 Meter tiefe Kluft. Es ist der 10. November und an den altehrwürdigen Bäumen auf dem Anger halten sich noch hartnäckig blassgelbe, orange und braun gefleckte oder auch wie in Ochsenblut getränkte, altbordeauxfarbene Blätter. Sie tanzen wie flimmernde Seelen im sich allmählich auflösenden Morgennebel, der hierzulande gerne mal bis in den späten Mittag Land und Mensch verschluckt, bestimmt, um sich über die kahlen Köpfe der Männer zu erheben und spöttisch auf sie niederzublicken, wie sie vor dem schwarzen Loch ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft stehen, in aufgeputzten Sonntagsschuhen, mit rosig klammen, faltigen Händen, die für fünfzig Cent das Sterbebild einer jungen Frau halten, die seltsamerweise genauso alt ist wie die meisten ergrauten oder unnatürlich kupfern gefärbten Trauergäste. Es ist ihre Generation, die anstelle des Mädchens in dem hellen Eichensarg alt geworden ist. Von denen, die zu ihren Lebzeiten schon alt waren, lebt, soweit mir bekannt ist, niemand mehr. Also blieb uns gar nichts anderes übrig, als diese Rolle zu übernehmen und für sie mit zu altern, eigentlich ganz logisch. Nein, ich korrigiere mich: eigentlich nur ganz konsequent. Denn wo bleibt die Logik, wenn Fünfzig- bis Sechzigjährige eine gleichaltrige Neunzehnjährige zu Grabe tragen?
Niemand weint. Die Tränen hätten früher fließen müssen, viel, viel früher …
Der klamme Friedhofsdunst packt mich an meinem alten Knieleiden und lässt mein linkes Bein wieder zittern, wie so oft, wenn ich lange stehen muss. Ich frage mich, wann es wohl ganz seinen Dienst quittieren wird.
Das Land zwischen den Meeren
Irgendwo zwischen den großen, dunkelgrauen, mit Feldspat, Quarz und Glimmer gemaserten Granitfindlingen in unserem Vorgarten, halb überwuchert von immergrünen Bodendeckern, buschigen Kiefern und krummen, kleinwüchsigen Zedern, da im hohen Norden nicht allzu viel von Frühlings- und Sommerblütlern zu erwarten war, irgendwo dort oben, im Hintergarten meiner Kindheit, im Schutze unseres roten Klinkerhauses, das sich , wie fast alle Häuser im Dorf, durch keinerlei Zaun, Hecke oder gar Mauer von der Nachbarschaft abgrenzte, irgendwo in jener kindlichen Zauberlandschaft erwuchsen die Urbilder. Die Urbilder meines Denkens. Ich meine damit keine politischen Einstellungen oder besonderen Denkweisen, sondern vielmehr die Prototypen irgendwelcher alltäglichen Dinge oder Örtlichkeiten, die einem sofort, wenn man das eine Wort nur hört, gewissermaßen als Urmuster, in den Kopf schießen.
Wenn ich noch heute an bestimmte Begriffe wie etwa zu Hause, Küche, Garten, Sommerabend oder Ähnliches denke, dann sehe ich vor mir eine schmiedeeiserne Reling. Ich weiß immer noch, wie glatt und ein bisschen grieselig sie sich anfühlte. Weiße und königsblaue Töpfertassen hingen daran, und unter der Reling ertaste ich blind eine von meinem Vater aus einer uralten Mooreiche selbst angefertigte Arbeitsplatte nebst Schränken und Regalen aus Kiefernholz, das, egal, wie alt es wurde, immer diesen harzigen Geruch behielt, als wäre es erst frisch geschlagen und geschnitten worden. Man vergisst im Laufe seines Lebens viele Dinge, aber niemals ihren Geruch. Es ist doch seltsam, dass sich unsere Nase besser an Dinge und Menschen zu erinnern vermag als unsere Augen, Ohren oder Fingerspitzen.
Nun, wenn ich in meiner Erinnerung noch ein wenig tiefer grabe, dann blicke ich durch das Küchenfenster an den das ganze Jahr über weißen Armen meiner Mutter vorbei, die mit ihren gehäkelten, dänischen Topfhandschuhen ein Blech mit allerhand heißen, eigentümlich klickenden und klappernden Gefäßen voller köstlicher Blaubeermarmelade aus dem alten Emailleherd holt. Im Garten zieht indes mein Vater in Gummistiefeln, graumeliertem Bart, Kaiser-Wilhelm-Mütze und blauem Arbeitskittel seine konstanten, einem ebenso strikten wie mysteriösen Muster folgenden Rasenmäherbahnen, obwohl es schon neun oder sogar zehn Uhr abends ist. Die Sommerabende waren lang und hell, hoch im Norden, im Land zwischen den Meeren, sodass sich das Alltagsgeschehen im diffusen, goldenen Sonnenlicht ausdehnte und all das nachholte oder vorwegnahm, was ihm die kurzen Wintertage wiederum verwehrten. Im ewigen Kreislauf von Licht und Dunkelheit gab es kein Vorher oder Nachher. Tag und Nacht, Wachsein und Traum verschmolzen zu einer einzigen Harmonie. Keiner der Nachbarn empfand da so etwas wie spätes Rasenmähen als Ruhestörung.
Endlose, weichgezeichnete Sommertage wie auf Polaroidfotos, gefühlte Dauernacht in den Wintermonaten, die so finster gar nicht waren, rote Klinkergebäude, die Höfe und Scheunen darunter fast alle mit Reet oder dunkelgrün gestrichenem Blech gedeckt, Findlinge, immergrüne Bäume, knorrig und verwachsen wie verzauberte Kobolde. Die mächtigsten dieser Koboldbäume umrandeten beschützend einen sanften Hügel mit dem Dorfanger, auf den tatsächlich die Bergstraße führte. Sie war ungefähr dreihundert Meter lang, doch man überwand auf dieser Strecke nur gerade mal drei knappe Höhenmeter. Auf und um den Hügel versammelten sich die Kirche mit Friedhof, dessen verwitterte Grabsteine aus dem hohen Gras zu wachsen schienen, der Kindergarten und die Grundschule, ein Bäcker, ein Fleischer und ein Tante-Emma-Laden.
All das sind die bunten Legosteine meiner Kindheit und Jugend. Und wenn ich so an die große Legokiste unter meinem Bett zurückdenke, dann bilde ich mir ein, dass jeder Stein, ob Vierer, Sechser oder Sechsereinreiher, und jede der vier Farben – die übrigens die gleichen waren, wie Berts Pullover aus der Sesamstraße – seinen eigenen Geruch hatte. Natürlich trägt meine Nase auch diesen Legogeruch immer noch überall mit sich herum.
Außerhalb unseres Dorfes aber gab es eine Welt aus Wiesen und Koppeln, allerhand bunte Schmetterlinge beherbergenden Knicks, kerzengeraden Straßen und Wanderwegen, schilfgesäumten Mooren, kleinen Birken- und Kiefernwäldern mit herrlichen Steinpilzen, flinken Blindschleichen und stoischen Störchen, die sich irgendwie zackig bewegten, wie die Ägypter in den Asterixheften, außerdem riesigen, schwarzweiß gefleckten Kühen, Pferden und freilaufenden Schweinen mit dichten, dunkelgrauen Borsten, aber auch Habichten, Falken, Bussarden und zuweilen sogar Adlern. Zwischen den Knicks, Wäldchen und Wiesen stieß man immer wieder auf Hünengräber, aufgeworfene Grabhügel oder Steingräber aus der Jungsteinzeit, die sich relativ unscheinbar, wie vergessen, in entlegenen Feldwinkeln verbargen. Wir Kinder nannten sie Hühnergräber und konnten uns lange nicht erklären, weshalb unsere Vorfahren nur so ein Aufhebens um ihr verstorbenes Federvieh gemacht hatten.
Wenn man das Dorf mit seinen Findlingen, immergrünen Bäumen und gepflegten Vorgärten also hinter sich ließ, über reichlich Wälle und Gatter kletterte und lange genug über Viehweiden zog, durch moosbedeckte Wälder streifte, um den alten, breiten, sandigen Wikingerwegen zu folgen, dann, ja dann wurde die Luft zunehmend salziger und auch ein wenig modrig, und man sah endlich das, was einem die Möwen, wenn es Abend wurde, hoch über den Reetdächern unseres Dorfes so sehnsuchtsvoll verhießen – man sah den Ursprung allen Lebens und den geheimnisvollsten und größten Ort der Welt, man sah das Meer.
Im Westen nahm es sich so ebenmäßig aus, dass man sich bei ruhigem Seegang einbilden mochte, am Horizont die Erdkrümmung ausmachen zu können; und doch wühlte es sich zuweilen so zornesmächtig auf, dass sich die Menschen seit Jahrhunderten mit Haus, Hof und Vieh hinter hohen Deichen verschanzten. Im rauen Osten aber tobte es noch viel ungestümer und schlug wütend an die zerklüftete Küste. So umfassten die Meere sanft und stürmisch das Wunderland meiner Kindheit.
Das Meer. Mit dem Meer ist es so eine Sache. Man kann sich gerade an dem schönsten Ort der Erde befinden, am Strand sitzen und hinaus auf die Dünung blicken, die das Sonnenlicht mit Milliarden Silberschuppen überzieht, die dann mit dem Abendhimmel zu flüssigem Rotgold verschmelzen, bevor sie ihren Glanz zurück nach oben an die Sterne schicken. Oder man lässt sich auf einer Klippe die Haare zerzausen, während sich tief unter einem die gischtenen Schimmel wieder und wieder an die felsigen Ufer werfen, und man fragt sich dabei, ob die wundersamen Fluggebilde der Seevögel eine geheime, kunstvolle Botschaft der Natur bedeuten möchten.
Ganz egal, wie beruhigend, aufbrausend, zurückgezogen oder allmächtig, einladend oder gefährlich sich das Meer den Gestaden der Menschen auch nähert, man verspürt immer ein und dasselbe Gefühl, und das ist unbändiges Fernweh.
Das Seltsame am Meer war für mich aber von jeher, dass man sich, egal von welcher Seite aus betrachtet, immer ausmalt, was wohl dahinter liegen mag, und sich immerzu wünscht, an jenseitige Küsten zu gelangen, als wären wir ruhelose Zugvögel, die eine instinktive Sehnsucht während eines endlos währenden Winters nach Süden zieht, wo immer dieser Süden auch liegen mag.
Jenseits der Meere
A cloud appears above your head
A beam of light comes shining down on you
Shining down on you
The cloud is moving nearer still
Aurora borealis comes in view
Aurora comes in view
And I ran, I ran so far away
I just ran, I ran all night and day
I couldn‘t get away
A Flock Of Seagulls, 1982
Ich habe irgendwann die roten Klinkerhäuser und runden Findlinge verlassen, um den einen oder anderen Berggipfel zu erklimmen – und ich spreche hier von richtigen Bergen, nicht etwa von unserer alten Bergstraße, die ich mich todesmutig mit Gokart oder knallgelben Rollschuhen hinabstürzte. Wenn ich echte, alpine Berge bestieg, begnügte ich mich jedes Mal damit, die Spitze mit dem Gipfelkreuz erreicht zu haben und hinunter ins Tal oder hinüber zu den anderen gezackten Giganten zu blicken. Aber das Meer, ja das Meer erfüllte mich nicht so leicht. Es lud mich stets mit seinem verführerischen Glitzern ein, wie eine alte Liebschaft, und ich glaube, auch jeden anderen Menschen, nicht um einfach nur staunend zu verweilen und den Augenblick zu genießen, sondern um das nächste Schiff, ein Boot oder irgendeine Nussschale zu besteigen und von Möwen geleitet aufzubrechen ins Ungewisse oder in eine unbekannte oder vergessene Heimat, von der die Wellen leise und geheimnisvoll murmeln, immer und immer wieder.
Kein Mensch kann diese überirdische Magie leugnen, die dasselbe und niemals gleiche Meer von jeher auf unsere Spezies ausübt. Vielleicht liegt es ja daran, dass alles Leben der Erde dem Meer entstammt und die Wellen, der Wind und die Möwen uns unaufhörlich Geschichten über unsere ursprüngliche Heimat und Herkunft erzählen.
Wahrscheinlich ist es diesem Meerweh geschuldet, dass ich mich mit dem druckfrischen Abitur in der Tasche im Sommer des Jahres 1989, unbedarft und voller Hoffnung, mit glühenden Ahnungen aufmachte, das Land zwischen den Meeren für eine Weile hinter mir zu lassen und auf gleichsam kontinentale Wanderschaft zu gehen.
Ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, ob und schon gar nicht, was ich studieren sollte. Studienberatung, Praktika und Jobmessen waren damals noch nicht einmal Science-Fiction. Tatsächlich liebäugelte ich, wie auch ein paar meiner Freunde, unter anderem mit einer Offizierslaufbahn bei der Marine, die unweit meines Klinkerdorfs stationiert war. Ja, ich gebe zu, dass Tom Cruise und vor allem die heiße Kelly McGillis in Top Gun ihren Teil zur Idee einer völlig romantisch verklärten Bundeswehrkarriere beigetragen hatten, aber ich war bereits vor den mündlichen Prüfungen bei der Musterung gewesen, die damals noch Pflicht war. Dort hatte man mich für uneingeschränkt tauglich befunden und mir gleich schon einmal alle notwendigen Unterlagen mitgegeben. Ich glaube, am liebsten hätten sie mich gleich geschoren und eingekleidet.
Obwohl die meisten Familien unseres roten Klinkerdorfes schon seit ein paar Jahren Farbfernsehgeräte besaßen, war die Welt in den 80ern immer noch so schwarzweiß wie in den alten Kinderfotos meiner Eltern. Ich war übrigens lange davon überzeugt, dass meine Eltern tatsächlich in einer schwarzweißen Welt aufgewachsen waren, die erst mit den Plastiksteinen von Lego und etwas später den Polizeiautos und Bauernhöfen von Playmobil bunt geworden war, was mir unendlich leid für sie tat.
Nicht, dass die Technik der 80er noch nicht so weit gewesen wäre, ich kannte, wie gesagt, niemanden im Ort, der nicht schon einen bleischweren Farbfernseher mit Fernbedienung besaß. Aber wenn Tom Cruise, Rocky oder Arni im Kino und auf VHS oder Beta ihre Muskeln spielen ließen, kämpften auf der gegnerischen Seite meist unfaire, hässliche, gedopte und gehirngewaschene Russen. Keinem Achtzehnjährigen wäre es damals in den Sinn gekommen, solche Hollywoodschemata zu hinterfragen, auch mir nicht. Amerika war eben cool und die Platte Born in the USA unsere Bibel – erst viele Jahre später erfuhr ich, dass der Boss mit dem Titellied eigentlich einen Protestsong gegen ein System schreiben wollte, das den kleinen Mann und insbesondere die Kriegsveteranen aus dem Vietnamkrieg vergessen hatte, die, die dort geblieben waren, und die, die in ein Amerika zurückkehrten, das ihnen fremd geworden war. Aber die Amis, und auch wir, indem wir den Text, den wir nur teilweise verstanden, mitgrölten, hatten Born in the USA viel lieber in eine Hymne umfunktioniert.
Amerika war Rock‘n‘roll, Amerika war Mode, Amerika war frei, groß und wild. Gewiss, die Sowjetunion war noch größer und vielleicht auch noch wilder, aber aus unserer Sicht standen die roten Fahnen für alles andere als Freiheit oder irgendeine Art von Trendsetting.
Gut, da gab es, wenn man den großen Teich auf der einen Seite meines Kinderzauberlandes überquerte, einen ehemaligen Westernschauspieler, der es tatsächlich von Hollywood ins Weiße Haus gebracht hatte und bis vor kurzem noch in Amt und Würden war; und wenn man das Meer auf der anderen Seite überquerte und noch ein paar Länder weiter reiste, regierte dort ein irgendwie gemütlicher Onkel mit einem dunklen Klecks auf der lichten Stirn, der ziemlich coolen Wind in den Kreml brachte. Beide, der Westernschauspieler und der Typ mit dem Klecks, schienen sich recht gut zu verstehen. Zumindest berichtete das die Sprecherin mit den Schulterpolstern und der ausladenden Föhnfrisur in der scheinbar einzigen Nachrichtensendung der Republik im Ersten.
Auf der Leinwand wurde der Kalte Krieg zwar noch regelrecht zelebriert, aber so langsam verlor er an Authentizität, und die Regisseure ersetzten immer mehr die stahlblauäugigen, pelzbemützten KGB-Agenten und Stasispitzel durch fiese, orientalische Terroristen oder Machthaber, die aus irgendeinem Grund ihr Erdöl nicht rausrücken wollten und sich bei Dr. Emmett Brown eine Atombombe bestellten, die er ihnen auch lieferte – randvoll mit Schrottteilen von ausgedienten Flippern. Aber das ist eine komplett andere Geschichte.
Den Steinen hinterher
Der Gral kann nicht gefunden werden, er findet dich.
Sir Thomas Malory – oder war es doch Indiana Jones?
Vielleicht war ein Job bei der Bundeswehr ja wirklich gar nicht so verkehrt. Gefährlich schien das jedenfalls nicht zu sein, nachdem der Kalte Krieg quasi ins Kino verbannt worden war. Ihrer scheinbar einzig verbliebenen Daseinsberechtigung lag der Bundeswehr seit ihrer Gründung der so genannte Ernstfall zugrunde. Aber wer sollte denn Deutschland 1989 noch angreifen? Wozu auch? Das politische Schachspiel der in die Tage gekommenen Weltmächte wurde, so nahmen wir alle an, weit über die Reetdächer in dem kleinen Land zwischen den Meeren hinweg gespielt, und für mich war das okay so, nicht mehr und nicht weniger.
Tatsächlich gab es neben der beruflichen Unentschlossenheit und dem Fernweh noch viele weitere, kleinere und größere, in jedem Fall aber sehr viel ältere Beweggründe von verschiedenem Gewicht für meine geplante Reise, und das waren – Steine. Ich interessierte mich von klein auf für Steine jeder Art, Form und Größe. Natürlich habe ich dieses Interesse ganz klar von meinem Großvater mütterlicherseits geerbt. Er war Professor der Geologie und hatte einen Lehrstuhl für Glaziologie inne. Immer wenn er uns im Land zwischen den Meeren besuchte, brachte er mir einen besonderen Stein mit, manchmal einen geschliffenen Halbedelstein, einen Amethyst oder ein Tigerauge an einem dünnen Lederbändchen, manchmal ein Stück Juraplattenkalk, der sich immer warm und weich anfühlte, mit einem fossilen Fischlein oder Belemniten, einen handtellergroßen, unglaublich schweren, grauen Ammoniten mit gleichmäßigen, schwarzen Kammern, auf der einen Seite rau, auf der anderen glattgeschliffen, oder ein in Bernstein eingeschlossenes Insekt, das so frisch aussah wie eine Mücke, die in ein Glas Honig gefallen ist, gleichsam einer in Gold schwimmender Urzeitmumie.
Einmal aber schenkte er mir etwas, das ich zuerst für ein abgebrochenes Stück einer Kanonenkugel hielt. Als mein Großvater mir jedoch erzählte, dass es sich um einen Meteoriten handelte, wurde der Stein sofort zum Heiligen Gral meiner kleinen Sammlung. Ich stellte mir vor, dass solch ein Stein, wenn auch ein wahrscheinlich weitaus größerer, in der Kaba zu Mekka gehütet wurde, und dachte mir den prächtigen Schweif, den ein ähnlicher Meteorit oder Meteoritenschauer womöglich vor zweitausend Jahren funkelnd über Bethlehem hinter sich her gezogen hatte.
Mein Großvater brachte mit den Steinen auch immer Geschichten mit, die dem Glanz und der Vielfalt der Steine in nichts nachstanden und sich so fantastisch anhörten, dass ich als Kind allesamt für völlig frei erfunden hielt, weil sie einfach meine Vorstellungskraft sprengten. Mir erschien es, als bürgen die Steine all diese Geschichten für immer in sich, was sie für mich so unendlich wertvoll machte. Er zeigte mir Fotos von Felslandschaften aus Kalkgestein, die vor Abermillionen Jahren als Riffe von tropischem Meerwasser umspült wurden, oder andere, auf denen unterirdische, von Stalagnitensäulen getragene Kathedralen zu sehen waren, die sich tröpfchenweise über tausende und tausende Jahre gebildet hatten, ohne dass sie in all der Zeit je ein Mensch, oder vielleicht sogar überhaupt irgendein Lebewesen, betreten hatte.
Aber am faszinierendsten war für mich ein altes Schwarzweißluftbild, auf dem gar keine Steine zu erkennen waren, sondern eine kreisrund angelegte Stadt, die in einem flachen Tal lag, das sich inmitten einiger Zeugenberge wie ein präzise geformter Suppenteller ausnahm. Von dort hatte mir mein Großvater auch die vermeintliche Kanonenkugel mitgebracht. Es habe schon einmal ein Ende der Welt gegeben, erklärte er mir dazu, die Apokalypse sei einst bereits da gewesen, just in unserem Land. Genau dort, wo in einem neuen Zeitalter und in einer neuen Welt das schwäbische Nördlingen mit seiner Stadtmauer, den Fachwerkhäusern und all den herrlichen Gaststätten entstand – mein Großvater liebte alte Gasthäuser und kleine Brauereien –, dort war, erzählte er, der größte Meteorit eingeschlagen, der je die Erde getroffen hatte. Einige Forscher vermuteten sogar, so mein Großvater, dass der Einschlag die Ursache für das Verschwinden der Dinosaurier gewesen sei. Er hatte im Umkreis vieler, vieler Kilometer sämtliches Leben ausgelöscht, ähnlich wie bei Hiroshima, nur war das von Menschenhand geschehen, sagte er dazu.
Ich wusste nicht, wer oder was die Apokalypse war und schon gar nicht, was dieses schön klingende, sanft anmutende Wort Hiroshima bedeutete. Aber wenn mein kleiner Meteorit für mich der Gral war, so musste dieses Nördlingen, die Stadt derNordlinge, zweifelsohne die Gralsburg sein.
Mein Großvater hatte übrigens den einzigen Blütenträger in unserem Garten und in der ganzen Straße gepflanzt, eine Eiche, deren knorrige Rinde ich ebenso noch an meinen Fingerkuppen spüre, wie ich den leicht bitteren Geschmack der geknackten Eicheln auf der Zunge habe. Mein Großvater hatte mir nämlich erzählt, dass in schlechten Zeiten – damals, als die Welt noch schwarzweiß war – daraus Kaffee gemahlen wurde, Muckefuck, wie er das nannte. Natürlich hatte ich das auch einmal ausprobieren müssen, indem ich eine fürchterlich stinkende Eichelpampe anbrannte und dabei beinahe unsere Küche abfackelte, übrigens Grund und Anlass für die neue Arbeitsplatte aus Mooreiche.
Angeblich hatte mein Großvater seinerzeit zur Erinnerung an einen anderen, sehr alten Garten eine Hand voll Eicheln in die Hosentasche gesteckt, bevor die Beneš treue Dorfmiliz ihn und vierzig oder fünfzig andere Deitsche binnen zweier Tageaus dem kleinen böhmischen Weiler jagte, in dem er in der Neujahrsnacht 1900 mit dem Zwölfuhrglockenschlag zur Welt gekommen war, irgendwo im ungewissen Drieben. Er war also 39 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, 45 Jahre, als Hitler sich mit einer heimlichen Kugel aus den Trümmern Berlins davonstahl und 46 Jahre und vier Monate, als die Partisanen mit ihren Gewehrkolben an seine Tür schlugen. Es war Mitte April und die Bäume hinter dem Haus, hinter seinem Haus, standen in prächtiger, weißer Blüte.
Tom Petty und eine Karte voller Narben
Die glazialen und maritimen Sedimente zwischen Nord- und Ostsee waren mir redlich vertraut. Ich empfand mich und alles Leben im Norden als einen Teil davon. Aber ich wollte nicht nur sehen, was das Wasser geschaffen hatte, sondern auch mir der Macht des alten Feuers gewahr werden, die magmatischen Gesteine wollte ich sehen und den vor Urzeiten von tektonischen Verschiebungen aufgeworfenen alpinen Granit, dazwischen den dunklen Basalt, den Buntsandstein, Muschelkalk und Juramarmor, Schiefer und Gneis. All dem wollte ich mich Schritt für Schritt annähern und den Geschichten lauschen, die diese Gesteine in sich bargen, ich plante gleichsam, die Vergangenheit der Welt mit meinen eigenen Füßen zu betreten und zu lesen.
Es sollte in der Tat eine Reise sein, die mich gewissermaßen in der Zeit zurückführen sollte, denn mein Großvater war in meinem Abiturjahr schon über zehn Jahre verstorben und seine sterblichen Überreste hatte man in einem lehmigen, von dünnen Kiesschichten durchzogenen Friedhofsboden an einem kleinen See mit türkisfarbenem Wasser südlich von München beigesetzt. Ich stellte mir vor, ihm auf diese Weise nahe sein zu können, auch wenn das nicht das alleinige oder vorrangige Ziel meiner Reise sein sollte.
Obwohl es auf der Karte Deutschlands von Norden nach Süden im Volksmund runtergeht und meine Eltern auch immer sagten, fahren wir runter zum Opa nach München, sollte mich mein Weg in Wirklichkeit Schritt für Schritt nach oben führen. Als Ziel hatte ich mir nämlich nichts Geringeres – oder vielleicht sollte ich besser sagen nichts Höheres – als das Gipfelkreuz der Zugspitze gesetzt. Es thronte – und thront immer noch – auf einem schroffen Backenzahn aus Wettersteinkalk über einer wüsten Karsthochfläche mit Schutt, Dolinen, Karren und Moränen. Sobald ich dort oben, auf dem fast dreitausend Meter hohen Meeresgrund, angekommen war und wie Caspar David Friedrichs Wanderer im Nebel zurück in die Ferne – also in die ursprüngliche Nähe meines Klinkersteindorfs – blicken würde, wollte ich entscheiden, ob ich meinen blonden Pferdeschwanz gegen einen Bürstenhaarschnitt und meine 501 gegen Camouflagehosen eintauschen sollte, oder ob ich mir doch irgendeinen Studiengang oder sogar ein Handwerk aussuchen mochte.
Vielleicht würde ich auch noch ein Stückchen weiter reisen, meinen Freunden hinterher, die zeitgleich an die italienische Adria oder wenigstens an den Gardasee aufzubrechen gedachten und mein steinernes Vorhaben irgendwo zwischen total bescheuert und völlig bekloppt ansiedelten. Doch während sie die A1 auf gepresstem, verdichtetem, mit Kies und Bitumen überzogenem Schotter hinuntertrampten, wollte ich die ganze Strecke bis Garmisch-Partenkirchen ausschließlich zu Fuß und nur auf kleinen Nebenwegen zurücklegen. Das fand ich durchaus angemessen, wenn man schon eine morphologische Landschaft durchwandern möchte, deren Genese das Dreieinhalbmillionenfache der eigenen, durchschnittlichen Lebensspanne ausmachte.
Eine präzise Route hatte ich nicht festgelegt. Aber abends lag ich in meinem Bett und studierte die vergilbte Deutschlandkarte an der Wand – ja, vermutlich war ich der einzige Teenager weit und breit, der eine Landkarte über seinem Bett hängen hatte, umrahmt von Kim Wilde in hautengem, schwarzem Leder und Tom Petty mit Zylinder auf der linken Seite und einem nordamerikanischen oder skandinavischen Bergsee mit kleinen, von Tannen bevölkerten Inselchen auf der rechten. Wenn ich die alte Karte lange genug anstarrte, löste sie sich unter Kim Wildes und Tom Pettys starren Blicken irgendwann von der Wand und schwebte wie das Relief einer Modelleisenbahnlandschaft vor meinen Augen. Die tiefgrünen Bereiche zuunterst, dann die hellgrünen und die beigen, schließlich zuoberst die braunen. Ich streifte von Norden nach Süden, also, wie gesagt, von unten nach oben, entlang blauer, nordsüdlich gezogener Linien, deren Pendants im Süden ostwestlich verliefen. In der Mitte, zu meiner Rechten, flackerte und blinkte ein schlafloses, rotes Lichtermeer, zu meiner Linken aber tat sich hinter einer langen, dicken, rot gestrichelten Narbe, unbekannt und bedrohlich wie Mordor, ein Niemandsland auf, mit einer geteilten, ebenso vernarbten Stadt, die zweimal den gleichen Namen trug. Eine andere große Stadt, die weiter südlich lag, wurde indes mit zwei unterschiedlichen Namen angegeben, so wie es zum Teil auch jenseits dieses zweiten, mir unbekannten Deutschlands der Fall war, etwa in Schlesien oder drieben in Böhmen. Allerdings waren beide Städtenamen über den kantigen, roten Flecken im Niemandsland deutsch, oder sie sahen zumindest so aus.
Wenn ich mich etwas bemühte, entdeckte ich auf der magischen Karte nach einer Weile einen kleinen, wandernden, dunklen Fleck, wie eine winzige Fliege, der sich gemächlich, aber unbeirrbar wie Pac-Man nach Süden bewegte, Schritt für Schritt auf seinem Weg von den maritimen Meeren zum fossilen Meer, vom Wasser zum Feuer, wie Frodo, der Hobbit, zum Schicksalsberg, von unten an der Decke bis nach oben an mein Bett.
Der steinerne Kompass
I was eight years old
And running with a dime in my hand