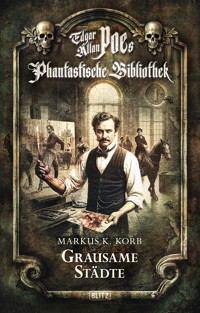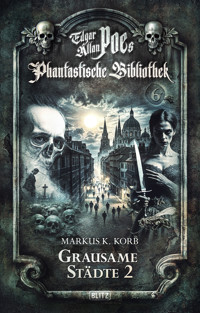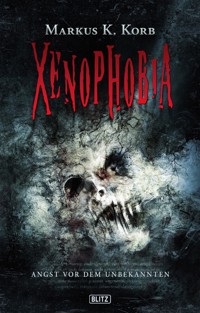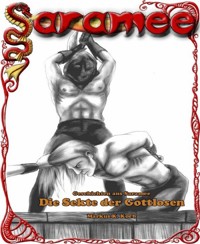Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Phantastische Stories
- Sprache: Deutsch
Welches Geheimnis versteckt sich im Kinderbuch-Klassiker "Der Struwwelpeter"? Was verbirgt sich in den Katakomben einer verlassenen Irrenanstalt? Was macht in den Tiefen des Meeres Jagd auf die Besatzung eines deutschen U-Bootes? Neue unheimliche Geschichten vom Meister des makabren Horrors. Gewinner des Vincent-Preis 2014! 1. Platz = Beste Cover-Grafik 2. Platz = Beste Horror-Geschichte 3. Platz = Beste Anthologie
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus K. Korb
DER STRUWWELPETER-CODE
In dieser Reihe bisher erschienen:
2001 Frank G. Gerigk & Petra Hartmann (Hrsg.) Drachen! Drachen!
2002 David Grashoff & Pascal Kamp (Hrsg.) Hunger
2003 Stefan Melneczuk Schattenland
2004 Markus K. Korb Der Struwwelpeter-Code
2005 Andreas Zwengel Bio Punk‘d
2006 Markus K. Korb Xenophobia
2007 Anke Laufer Nachtprotokolle
2008 Matthias Bauer Reiche Ernte
2009 Matthias Bauer Das Tor
2010 Michael Schmidt & Matthias Käther (Hrsg.) Fantastic Pulp 1
2011 F. Woitkowski (Hrsg.) Wenn die Welt klein wird und bedrohlich
2012 Stefan Melneczuk Geisterstunden
2013 Michael Schmidt & Matthias Käther (Hrsg.) Fantastic Pulp 2
2014 Torsten Scheib Schattenschwarz
2015 Michael Tillmann Der König von Mallorca
2016 Peter Biro Auf zum fröhlichen Weltuntergang
2017 Tobias Reckermann (Hrsg.) Die Zeit der Feuerernte
2018 Michael Schmidt & Matthias Käther (Hrsg.) Fantastic Pulp 3
2019 Wayne Allen Sallee Rapid Transit
2020 Tobias Reckermann (Hrsg.) Metempsychosen
2021 Michael Schmidt & Matthias Käther (Hrsg.) Fantastic Pulp 4
Der Struwwelpeter-Code
und andere sonderbare Erzählungen
Markus K. Korb
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
© 2014 Blitz Verlag
Ein Unternehmen der SilberScore Beteiligungs GmbH
Andreas-Hofer-Straße 44 • 6020 Innsbruck - Österreich
Redaktion: Jörg Kaegelmann
Titelbildgestaltung: Mark Freier
Illustrationen: Peter Davey
Satz: Gero Reimer
All rights reserved
www.BLITZ-Verlag.de
ISBN 978-3-95719-307-0
Inhalt
Vorwort
Mutter Der Puppen
Der Blick Des Lazarus
Das Holzweiberl
Der Letzte Löscht Das Licht
Pestkönigin
Die Warnung Des Geistersehers
Unter Dem Laken
Kingpin
Orpheus Blickt Zurück
Bungalow-Gespenster
Das Feld Der Sonnenblumenkinder
Die Wilde Jagd
Horchpeilung
Blindes Huhn
Der Struwwelpeter-Code
Danksagung
Markus K. Korb
Preise
Werbung
gewidmet den deutschen Phantasten
der Weimarer Republik
IN MEMORIAM: BERND ROTHE
(1945 – 2013)
Vorwort
Horror-Nerds Und Geister
Ich erinnere mich an eine sehr frühe Begegnung mit Markus K. Korb. Es war zu einer Zeit, in der wir unser gemeinsames Buch Das Arkham-Sanatorium (Atlantis Verlag 2007) noch nicht mal ansatzweise geplant hatten. Wir trafen uns anlässlich des so genannten Comic-Salons, eine Art Buchmesse für Comics, die alle zwei Jahre in Erlangen stattfindet. Das Wetter war traumhaft und so saßen wir bei einem gepflegten Krug Bier beisammen und unterhielten uns über Dinge, über die sich Autoren des Unheimlichen gerne unterhalten: Horrorcomics, Horrorbücher und irgendwann landeten wir beim Thema Geistererscheinungen. Markus schloss mit mir einen Pakt: egal, wer von uns beiden eines Tages als Erster das Zeitliche segnen würde, der würde dem anderen nach seinem Tod als Geist erscheinen. Auf diese Art und Weise wollten wir sicherstellen, dass zumindest einer von uns in Erfahrung bringen würde, ob es Geister denn nun wirklich gibt oder nicht.
Nun – bis jetzt ist mir Markus noch nicht als Geist erschienen. Ich stelle dies jede Stunde nach Mitternacht immer wieder mit Erleichterung fest. Ich bin froh darüber, denn so weiß ich einerseits, dass mein geschätzter Autorenfreund noch am Leben ist und andererseits, dass es Geister und Gespenster vielleicht doch nicht gibt. Beides empfinde ich als sehr beruhigend.
Wie kaum ein anderer ist mir Markus im Laufe der Jahre ans Herz gewachsen. Nach unserer gemeinsamen Schlachtschüssel-Lesung in Marburg sagte er zu mir: „Tobi, wir beide sind richtige Nerds. Horror-Nerds!“ Und damit hat er sicherlich recht. Wie sonst lässt es sich erklären, dass wir uns schon mal gemeinsam in Zwangsjacken stecken und in Ketten gelegt durch den Hauptsaal der Buchmesse-Convention zerren ließen, um so auf Publikumsfang für unsere Lesung zu gehen?
Als Markus mich darum bat, ein Vorwort für seinen neuen Band mit unheimlichen, phantastischen Erzählungen zu schreiben, und mir den Titel Der Struwwelpeter-Code nannte, dachte ich daher zunächst, er habe mich aufgrund meiner Frisur gefragt. Dabei weiß er vermutlich nicht einmal, wie viel mich mit dem Struwwelpeter verbindet.
Ich erinnere mich daran, als Kind Besitzer einer Ausgabe besagten Bilderbuchs von Heinrich Hoffmann gewesen zu sein. Wie wohl jedem Kind wurde es mir von irgendeinem Verwandten mit in die Wiege gelegt. Das muss Ende der 70er Jahre gewesen sein.
Doch nicht nur das: Ich besaß den Struwwelpeter sogar als Vertonung auf Schallplatte. Diese hatte etliche Kratzer und Sprünge. Ich vermochte es, den gesamten Text auswendig zu sprechen und wusste an den richtigen Stellen im Buch, wo ich umblättern musste. Das hatte den erfreulichen Aspekt, dass ich mit nur drei Jahren jedem Menschen vortäuschen konnte, ich könne bereits lesen. Wenn auch mit Betonung der Schallplattenkratzer.
Ich weiß nicht, was es war, das mich am Struwwelpeter so faszinierte. Heute gilt der Struwwelpeter als pädagogisch äußerst umstritten. Ich gehe sogar so weit und behaupte: Der Struwwelpeter ist unser erster Kontakt zur Horrorliteratur überhaupt (sieht man einmal von Grimms schrecklichen Märchen ab). Viele Kinder reagieren verstört auf die Struwwelpeter-Erzählungen. Da werden Tiere vom Friederich gequält, bis diese sich grausam rächen, in dem sie ihm bis ins Blut hineinbeißen; die Pauline entzündet sich selbst (heutzutage kennt man Selbstverbrennungen wohl eher aus den Nachrichten); der heilige Nikolaus tunkt rassistisch veranlagte Buben in ein Tintenfass; dem Konrad werden die Daumen amputiert, damit er nicht mehr an diesen lutschen kann (erinnert mich irgendwie an die Saw-Filmreihe); der Suppenkasper hungert sich zu Tode, und viele grausame Dinge mehr.
Vielleicht hat Markus ähnliche Erinnerung an den Struwwelpeter. Es mag sein, dass uns der Horror, den uns das Bilderbuch aus dem Jahre 1844 vermittelte, soweit geprägt hat, dass wir uns heute so sehr für den Horror als Genre begeistern können.
Dabei ist das Genre ebenso zeitlos, wie der Struwwelpeter zu einem Klassiker der Kinderbuchliteratur geworden ist. Beiden Büchern ist zudem die Gemeinsamkeit der kurzen Erzählweise gemein. Korbs Faible für die Kurzgeschichte ist bekannt. Bereits in seinem letzten Buch (Schock!, Atlantis Verlag 2012) hat er damit begonnen, die Kurzgeschichte auf die nötigsten Elemente zu reduzieren. Kurzschocker waren es, mit denen er uns das Grauen lehrte.
Auch in vorliegendem Band ist ein Großteil der Geschichten nicht länger als fünf Manuskript-Seiten. Mehr Raum benötigt Markus nicht, um seine Phantasmagorien zu entfalten. Ebenso zeitlos sind seine Motive. Ohne Zwang bedient er sich teilweise der antiken Sagenwelt der Griechen, lässt sich durch Jagdsagen inspirieren oder erforscht die lokale Sagenwelt, die er in altvorderer Manier als alte Mär präsentiert. In den Geschichten Horchpeilung und Der Letzte löscht das Licht geht es gar um den Umgang mit der Schuld aus der Nazi-Zeit. Zwar ein sensibles Thema, doch wie wir bereits aus den Geschichten seines Bandes Die Ernten des Schreckens (Atlantis Verlag 2009) wissen, versteht es Markus dabei äußerst behutsam und subtil vorzugehen. Überhaupt gehen seinen Geschichten gründliche Recherchen voraus, wie uns die titelgebende Erzählung eindrucksvoll vor Augen führt.
Keine Frage, Markus K. Korb ist ein Meister seines Fachs, wenn es darum geht, den Schrecken zu bündeln, die Essenz einer Geschichte so darzulegen, dass wir innerhalb weniger Seiten wie gefangen sind in seinen Welten aus Zombies, wandelnden Skeletten oder verschimmelnden Totengräbern. Markus hat seine eigene Stimme gefunden. Eine Stimme, die uns in regelmäßigem Abstand mit neuen Horrorgeschichten entzücken kann – jener Horror, den wir bereits von Kindesbeinen an zu kennen glauben und der uns seit jeher fasziniert.
Um zurück zu unserem Pakt zu kommen, den wir vor über zehn Jahren beim Erlanger Comic-Salon schlossen: Ich weiß mittlerweile, dass es unseren Pakt gar nicht gebraucht hätte, denn der Horror-Nerd aus Schweinfurt lehrt uns mit jedem neuen Buch aus seiner Feder die folgenden zwei Dinge. Erstens: Markus K. Korb ist meilenweit davon entfernt, ein Geist zu sein, denn sonst könnte er uns nicht immer wieder mit solch gruseligen Geschichten unterhalten. Zweitens: Geister gibt es doch.
Tobias Bachmann
Mutter Der Puppen
Dutzende Augenpaare blickten auf Eric herab.
Und nur eines blinzelte.
Die Frau vor ihm musste ihr siebzigstes Lebensjahr bereits weit überschritten haben, dennoch wirkte ihr Gesicht seltsam alterslos. Jedenfalls aus der Entfernung, in der Eric vor ihr saß. Ihn trennte ein altmodischer ovaler Wohnzimmertisch in Kniehöhe von der alten Dame. Auf dem Tischchen standen zwei Plastiktabletts, darauf je eine dampfende Tasse Tee nebst Porzellan-Kännchen.
Tante Barbara war eine höchst merkwürdige Person. Sie ging nicht aus, sah nicht fern und Eric hatte sie bei seinen wöchentlichen Besuchen niemals woanders als in diesem Zimmer gesehen, wo sie am Nachmittag um vier Uhr stets eine Tasse Tee mit ihm trank. Seine Eltern bestanden darauf, dass er Tante Barbara regelmäßig besuchte. Sie war seine einzige Tante und die Eltern hatten sich mit Barbaras Tochter Teresa zerstritten, sodass jene in der alten Villa am Rand der Stadt nicht mehr gern gesehen waren.
Im Zimmer herrschte ein schattendurchwobenes Zwielicht. Es rührte von den Rankenpflanzen her, welche den Balkon bis hoch über die Fenster in Besitz genommen hatten. Im Hintergrund schlug eine alte Standuhr die vierte Stunde. Kurz nur hallten die Schläge im Wohnzimmer wider und unterbrachen das peinliche Schweigen. Arabische Teppiche schluckten jedes Geräusch und Spanische Stellwände, wohinter sich alles Mögliche versteckt halten mochte, brachen die Schallwellen wie Felsklippen die Brandung.
Eric räusperte sich. Er fühlte sich unwohl unter den Blicken unzähliger Augenpaare, die auf ihm ruhten. Hinter Tante Barbara hing eine Regalwand und darin saßen, standen, hingen oder kauerten Dutzende von Puppen. Die meisten besaßen kindliche Züge, runde Pausbacken, kleiner roter Mund mit angedeuteten Milchzähnen. Sie steckten in Kinderkleidung, streckten ihre dicklichen Beinchen und Ärmchen Eric entgegen. Andere aber wirkten wie Erwachsene in Miniatur, trugen Soldaten-Uniformen, Matrosenanzüge oder eng anliegende Outfits von Stewardessen.
Tante Barbaras Hobby verwunderte Eric nicht, schließlich war sie die Senior-Chefin eines alteingesessenen Unternehmens, das sich mit der Herstellung von Puppen aller Art beschäftigte. Bereits der Urgroßvater Tante Barbaras, ein Herr Hofmann aus Bamberg, hatte sich der Zunft der Puppenmacher verschrieben. Seit jenen Tagen im 19ten Jahrhundert stellte die Firma Olivia Kinderpuppen her. Ins Sortiment gelangten noch Schaufensterpuppen und Gliederpuppen für Schneiderinnen. Irgendwann im 20ten Jahrhundert kamen sogar maschinelle Automaten hinzu, die durch ein Uhrwerk angetrieben wurden und sich roboterhaft bewegten, sobald man sie mit einem Schlüssel aufzog.
In der hohen Flügeltür erschien Teresa. Ihr Gesicht war zur Faust geballt, dennoch mühte sie sich ein Lächeln ab, das ihr teigiges, frühzeitig gealtertes Gesicht etwas aufhellte.
„Na, Eric? Alles in Ordnung?“
Er brachte nur ein Nicken zustande und nippte an seiner Tasse Tee. Teresa mochte an die vierzig Jahre alt sein. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Stefan lebte sie bei ihrer Mutter in der Villa, die über der Puppenfabrik auf einem Hügel thronte. Es war ein offenes Geheimnis, dass sie schon lange die Leitung der Fabrik übernehmen wollte. Aber ein Passus in den Gründungsunterlagen untersagte es ihr. Tante Barbara hatte hineinschreiben lassen, dass nur eine verheiratete Frau oder ein verheirateter Mann die Geschicke der Firma weiterführen durfte. Da Teresa diese Forderung nicht erfüllen wollte, blieb ihr die Betriebsleitung verwehrt. Doch Tante Barbara war kein Unmensch. Ein anderer Passus schrieb vor, dass man dem zukünftigen Firmeninhaber eine hübsche monatliche Summe als Honorar-Vorschuss auf dessen Konto überweisen sollte. Daher lebte Teresa nicht schlecht, und solange Tante Barbara am Leben war, ging es ihr besser als jeder Made im Speck.
Teresa nickte ihm zu, das Lächeln verschwand aus ihrem Gesicht.
„Nur eine Stunde, das weißt du.“
Eric nickte und nippte am Tee.
„Tante Barbara soll nicht zu lange angestrengt werden. Sie braucht ihren Schönheitsschlaf.“
Teresa verschwand und ließ Eric allein mit seiner Tante.
Nicht ganz allein, allerdings.
Rechts neben dem altmodischen Plüschsofa, auf dem Tante Barbara mit eng geschlossenen Knien saß, ragte eine Stahlstange empor. Auf deren Spitze befand sich eine Querstange, um die sich die Krallen von Rocco fest geschlossen hatten. Rocco war ein Papagei und das einzig Lebendige in diesem Wohnzimmer. Ständig rutschte er hin und her, schlug mit den Flügeln, krächzte laut und ließ die Kette klirren, mit der seine rechte Kralle an der Stange festgebunden war.
Tante Barbara besaß die Eigenart, die Lippen zu bewegen, sobald Rocco mit seiner rauen Stimme sprach. Das wirkte seltsam, als sei Tante Barbara ein Bauchredner und der Papagei sein Stofftier, dem sie ihre verstellte Stimme lieh. Dann wiederum redete Tante Barbara wieder mit ihrer normalen Stimme. Manchmal geschah dies in einem Satz, sodass die Worte durcheinanderwirbelten und Erics Gehirnwindungen verknoteten.
Ihm schwindelte stets, wenn er Tante Barbara verließ. Das lag zum einen an ihrer Sprechweise, zum anderen an dem Geruch, der das Zimmer ausfüllte. Tante Barbara pflegte ein schweres Parfüm aufzulegen. Sie verwendete es offenbar in solchen Mengen, dass sogar der Tee danach schmeckte. Schwer, orientalisch, mit einem Beigeschmack, den Eric nicht exakt einzuschätzen wusste, ihm aber scharf wie Scheuermittel vorkam. Möglich, dass dieser Geruch unter dem Parfüm verborgen war. Erics Mutter hatte einmal gesagt, dass alte Menschen streng riechen würden. Es konnte also sein, dass Tante Barbara diesen Geruch mit dem Parfüm zu überdecken versuchte.
Eric stellte seine Tasse mit einem Klappern auf der Untertasse ab und blickte Tante Barbara in die Augen. Sie waren leicht gerötet und von einem tiefen Blau. Schon als Eric noch ein kleiner Junge gewesen war, hatte er sich gern in diesen blauen Seen verloren, die so gnädig und würdevoll blickten. Aber nun, da er das zehnte Lebensjahr vollendet hatte, wirkten die Seen, als wären sie zugefroren und mit einer dicken Eisschicht bedeckt.
„Wie geht es dir, Tante Barbara?“
Das Gesicht, eben noch zur Seite gedreht, wandte sich ihm langsam zu. Eric bemerkte, dass etwas Flüssigkeit in Tante Barbaras Mundwinkel hing.
„Gut, mein Junge. Wie geht es dir?“
„Danke, prima.“
Die Worte fielen wie Wassertropfen in einen See, breiteten sich aus, verklangen. Schon war die Oberfläche des Wassers wieder still und ruhig. Tante Barbara hob den rechten Arm, der Ärmel ihres Kleides flatterte für einen Moment und hing dann wieder unbewegt herab. Sie führte die Teetasse an ihren Mund, neigte die mit Altersflecken übersäte Hand, die so gar nicht zu ihrem bleichen, faltenlosen Gesicht passen wollte. Tee rann ihr über die Lippen in den geöffneten Mund. Sie bemerkte nicht, dass nicht wenig der Flüssigkeit an den Mundwinkeln herabrann.
Fasziniert blickte Eric auf die Tasse, deren Porzellan bereits in unzähligen Rissen gesprungen war und nur noch vom Firnis zusammengehalten wurde. Seine Entsprechung fand das Porzellan im dicken Puder Tante Barbaras, das ihre mit Rouge betupften Wangen bedeckte und ebenfalls spinnennetzartige Risse aufwies. Als sie die Tasse absetzte, glänzten ihre dünnen Lippen vor Nässe. Klirrend schlug das Porzellan auf die Untertasse, welche Tante Barbara in ihrer Linken hielt.
„Ungezogener Bengel! Mach, dass du verschwindest!“
Tante Barbara bewegte den Kiefer zu Roccos Gekrächze. Eric irritierte das immer wieder aufs Neue. Manchmal fragte er sich, ob Tante Barbara nicht doch Roccos Stimme imitierte, um ihre wahre Meinung kundzutun.
„Dummer Papagei! Halt den Schnabel!“, beeilte sich Tante Barbara hinzuzufügen und drehte ihren Kopf langsam in Richtung des Vogels und wieder zurück.
Minuten verstrichen, in denen nicht gesprochen wurde. Eric nippte an seinem Tee und blickte sich um. Die Dschungelatmosphäre im Raum wurde durch eine Vielzahl an Rankenpflanzen unterstrichen, die an den Wänden aufgereiht waren und ihre Blätter und Stängel und Ranken über die gesamten Wandflächen verteilten. Eine vorwitzige Pflanze ließ ihre Blätter im Laufe der Jahre tiefer und tiefer auf Tante Barbaras sauber geteilten Scheitel weißer Haare herabsinken, die hinten zu einem Dutt zusammensteckt waren.
Tante Barbaras Kleid war luftig leicht wie Gardinenstoff. Doch darunter verbarg sich dicke Wolle, die blickdicht ihren Körper umschloss. Eric hatte noch nie ihre Füße gesehen, geschweige denn ihre Knöchel.
Die Uhr schlug fünf Mal. Als die Schläge vom arabischen Teppich verschluckt worden waren, hörte Eric die Schritte auf dem Parkett vor der Tür. Teresa streckte ihren Kopf herein, einen Schlüssel in der Hand.
„Es wird Zeit, Eric!“, sagte sie tonlos.
Eric setzte die Tasse ab und erhob sich.
„Danke für den Tee, Tante Barbara.“
Sie rührte sich nicht, blickte reglos durch ihn hindurch in die Ferne.
„Ist schon in Ordnung. Du muss verstehen, sie ist müde.“
Teresa winkte Eric mit dem Zeigefinger. Er trat auf sie zu, wirkte seltsam steif mit seinem schwarzen Sonntagsanzug, fast wie ein Roboter.
Als er draußen auf dem Flur war, klingelte das Telefon. Teresa rollte mit den Augen.
„Oh Mann! Das wird Stefan sein. Er ist auf Dienstreise im Ausland. Entschuldige mich, Eric. Du kannst schon mal zur Haustür gehen.“
Teresa verschwand durch den Flur nach hinten in die Küche, wo das Telefon stand. Eric machte sich auf in die andere Richtung. Dabei kam er an der Tür vorbei, welche in dasjenige Zimmer führte, das an das Wohnzimmer angrenzte. Sie war ein Spalt breit offen.
Das war ungewöhnlich. Bislang war sie immer abgeschlossen gewesen. Die Neugier trieb Eric dazu, einen Blick durch den Spalt zu werfen.
Sein Blick fiel auf ein nahezu leeres Zimmer. Auf dem blank gebohnerten Parkett stand ein Tisch und darauf eine seltsame Apparatur, beides nahe an jene Wand herangeschoben, welche das Zimmer mit dem Wohnzimmer teilte. Zahnräder waren an dem Kubus angeflanscht, griffen ineinander und bildeten ein Muster, das Eric schon gesehen hatte, wenn er den Rückendeckel seiner Taschenuhr aufgeklappt hatte. Dazwischen hingen Federn und Pendel, unbewegt. Nur ein leichtes Zittern lief noch durch die Teile. Ein Sprachrohr mit Sprechmuschel hing an der Seite, der Schalltrichter berührte fast die Wand.
Das alles war zwar erstaunlich, verwunderlich und Eric völlig unbegreiflich, aber es erschreckte ihn nicht. Wirklich entsetzlich waren hingegen das halbe Dutzend fingerdicker Stahlstreben, die aus dem Uhrwerk in die Wand führten und irgendwo dahinter befestigt waren. Als Eric genauer hinsah, bemerkte er, dass man die Wand durchbrochen hatte – Ziegelsteine markierten das Loch – und erkannte dahinter die Rippenbögen in der leeren Höhlung eines laienhaft konservierten Körpers.
Rippenbögen. Vor Nässe schimmernd.
Feucht vom Tee.
Der Blick Des Lazarus
„Herr, er riecht aber schon,
denn es ist bereits der vierte Tag.“
Johannes 11,39
Leise schleiche ich durch die mickrigen Vorgärten des kleinen Dorfes Bethanien, denn ich plane noch heute Nacht einen Mord zu begehen. Und das Ziel meines Anschlags ist niemand anderes als Lazarus, der Bruder von Maria, der Freund eines gewissen Jesus von Nazareth, ebenjener Mann, den der Hohepriester Kaiphas seit gestern wegen Verhetzung und Gotteslästerung von seinen Männern suchen lässt.
Gekommen bin ich, als der letzte Schein der Abendsonne über der Straße nach Jericho flimmerte und der Staub der Eselfuhrwerke sich bereits zu setzen begann. Gegen Mittag habe ich Jerusalem verlassen, mich in Richtung Ölberg gewandt, das Messer unter der Kleidung verborgen, immer in Sorge, es könnte sich aus dem Gürtel meines Untergewandes lösen, herausfallen und mich somit verraten. Gewiss, ich bin nervös, denn dies ist mein erster Mord. Und es wird zugleich mein letzter sein. Ich habe vor, das Messer nach der Tat gegen mich selbst zu richten.
Vorsichtig biege ich Sträucher um und husche gebückt durch den Lichtschein eines offenen Fensters, dahinter eine Familie die Abendbrot isst, nichts davon ahnend, welch Scheusal sich vor ihrem Haus aufhält.
Aber nein! Ich muss es tun, bin kein Scheusal, bin ein Engel des Todes, möglicherweise durch Gottes Vorhersehung erwählt. So sehr ich mich meiner hehren Absichten versichere, Zweifel bleiben dennoch.
Mein Entschluss, Lazarus zu töten, reifte lange. Man erzählt sich, dass Jesus seinen toten Freund mit einem Ruf aus dem Dunkel des Todes geholt habe. Dabei sei Lazarus vom Totenbett aufgeschnellt, habe einen tiefkehligen, sich schnell emporkreiselnden Schrei in die von Düsternis geschwängerte Luft des Totenzimmers entlassen, der die Trauernden im Nebenzimmer mit Todesfurcht erfüllt haben soll.
Einzig Maria, seine Schwester, freute sich und tanzte ausgelassen um das Totenbett. Jesus soll gelächelt haben.
Seitdem lebt Lazarus wieder. Aber was ist das für ein Leben?
So grauenvoll soll Lazarus aussehen, dass er sein Gesicht unter einem Schleier verbirgt. Es ist gezeichnet von den ersten Tagen des Zerfalls. Aber das ist noch lange nicht alles.
Niemand hält es in seiner Nähe aus, denn er riecht. Und diesem Geruch ist mit Waschen nicht beizukommen. Er dringt aus seinen Poren und haftet an ihm wie eine zweite Haut. Die Leute tuscheln, das käme davon, dass seine Innereien während der vier Tage schon angefault seien.
Anfangs ging Lazarus noch unter Menschen. Doch all seine Bewegungen waren ungelenk, so als habe er das Wissen um die Anwendung der Muskeln in der Finsternis des Todes gelassen und lediglich eine Ahnung hiervon wieder mitgenommen. Daher wirkte sein Gang grotesk, und nicht nur die Kinder nahmen Reißaus, wenn sie seine dunkle Gestalt unter dem Torbogen des Marktplatzes mit grauenvoll abgehackten Bewegungen einherstaksen sahen.
Aber sprechen, das tat Lazarus nicht mehr. Und auch die Menschen, die ihn ansahen, verstummten. Das liegt an seinem Blick.
Der Blick des Lazarus.
Sieht er jemanden an, so versteift sich dessen Körper. Das Gesicht wird kalkweiß, scheint sich in die Länge zu ziehen, als ob das Opfer im Begriff stünde zu schreien, es aber nicht könne. Und dann verstummt der Mensch – für immer. Er wird krank, bettlägerig mit einem Blick, in dem das nackte Grauen wohnt. Fiebrig ist er, es schüttelt ihn vor Kälte. Keine Nahrung nimmt er mehr zu sich, kein Wasser. Von Tag zu Tag wird er schwächer. Schließlich stirbt er.
Das ist die Wirkung von Lazarus’ Blick und gleichzeitig der Grund, warum ich ihn töten werde.
Über mir funkeln die Sterne. Sie erscheinen mir als ein hoffnungsvolles Zeichen, dass mein Vorhaben gelingen wird. Ich ducke mich tiefer in die Schatten der Olivenbäume und laufe weiter.
Bethanien liegt an der Jerusalem abgewandten Seite des Ölberges, überkrönt vom Tafelbergmassiv. Vor allem Bauern leben hier, die ihre Waren in der nahen Hauptstadt verkaufen sowie einige reiche Kaufleute. Einer davon war der Vater von Lazarus und Maria. Doch dieser ist schon lange tot. Er hat seinen Kindern ein beträchtliches Vermögen hinterlassen, dazu eine Villa in den Ölberghainen etwas außerhalb des Dorfes.
Schon sehe ich sie vor mir auftauchen, die Lichter in den Fenstern der Lazarus-Villa. Dem römischen Stil nachempfunden, umarmen die Gebäude einen quadratischen Innenhof. Helle Vierecke kennzeichnen die Fenster, dahinter Öllampen, welche die Nacht aus den Räumen verbannen. Hier bei mir ist es dunkel und in meinem Herzen breitet sich eine merkwürdige Kälte aus.
Tue ich wirklich das Richtige?
Viele Männer, Frauen und Kinder sind am Blick des Lazarus bereits gestorben. Es darf nicht mehr weitergehen, dass dieser Wiedererweckte mit seinem Blick die Menschen zum Dahinsiechen zwingt. Dabei sind mir die Menschen nicht so wichtig. Weitaus schrecklicher ist es, dass man mit diesen schrecklichen Vorgängen mehr und mehr einen ganz besonderen Mann in Zusammenhang bringt – Jesus von Nazareth.
Die Leute tuscheln: „Hätte Jesus doch nie diesen Lazarus zurückgeholt! Nichts als Tod und Verderben bringt er über uns!“
Ich kann das nicht mehr hören! Es gefährdet den Auftrag unseres Herrn Jesus. Die Verleumdungen und Anschuldigungen sind bereits zum Hohepriester Kaiphas durchgedrungen, so munkelt man. Sie seien der Grund dafür, dass er Jesus von seinen Häschern suchen lässt.
Bei Gott! Ich muss dem Herrn beistehen in der Stunde der Gefahr! Wenn nicht ich, ein Gefolgsmann Jesu, wer sollte es dann tun?
Am Portikus stehen zwei Sklaven als Wachen. Mein dunkles Gewand macht mich unsichtbar, sodass ich sie ungesehen in weitem Bogen umgehen kann. Ich gelange zur rückseitigen Hauswand. Dort ist eine Pforte. Die Bediensteten des Hauses nutzen sie, um zum Wasserholen an den gemauerten Ziehbrunnen hinter der Villa zu gehen.
Ich klopfe drei Mal, das verabredete Zeichen.
Behutsam wird die Pforte geöffnet. Im warmen Schein einer Kerze steht Maria da. Ernst sieht sie aus. Dunkle Schatten um die Augen. Ein trauriger Blick. Ohne ein Wort dreht sie sich um, gibt mir damit zu verstehen, ihr zu folgen, um ihren Bruder zu töten.
Sie ist mit ihrem Anliegen vor zwei Wochen zu mir gekommen. Natürlich war ich entsetzt, aber ich erkannte nach langen Stunden, die Maria mit mir im Gespräch verbrachte, die grauenvolle Dringlichkeit der Sache.
„Er stinkt!“, hat Maria damals gesagt und dabei die Nase voller Ekel gerümpft. „Jedes Zimmer, jeder Flur, das ganze Haus ist erfüllt von seinem Brodem. Es riecht nach Fäulnis, feuchter Erde, dem lichtlosen Dunkel alter Gruftkammern. Sein Dasein ist wider Gottes Gesetz.“
Wenn sie hingegen von Jesus sprach, leuchteten ihre Augen und ein roter Schein überzog ihre Wangen, sodass sie die Augen niederschlug, auf dass sie nicht zu viel verraten mochten.
Doch diese Gründe überzeugten mich nicht. Erst ein anderer tat es.
Lazarus oder Jesus. Einer von beiden wird für einen höheren Zweck sterben. Das war eindeutig und nicht mehr aufzuhalten. Aber Maria und ich wollen, dass es Lazarus ist.
Denn siehe: Jesus ist der Messias! Er muss weiterleben, um uns von den Römern zu befreien! Das ist seine Bestimmung, seine Mission, und wir Jünger haben uns dem unterzuordnen, auch wenn das bedeutet, einen Mord zu begehen. Was ist das Leben eines Einzelnen verglichen mit dem aller Juden?
So war es beschlossene Sache, dass Lazarus sterben muss.
Ich folge Maria durch die nächtlichen Flure, habe kaum ein Auge für ihren wunderschönen Rücken, die wohlgeformten Fesseln ihrer Beine, die unter dem Saum ihres Gewandes hervorblitzen.
Mein Geist ist scharf wie das Messer unter meiner Kleidung. Ich darf mir keinen Fehler erlauben. Ich habe das Zustechen geübt. Der Stoß muss genau zwischen dem dritten und vierten Rippenbogen auf der linken Brustseite hindurchgehen und das Herz treffen. An mir habe ich die Stelle gesucht und gefunden. Jetzt gilt es, auch bei Lazarus fündig zu werden.
Maria wird mir nicht helfen. So muss ich es alleine tun.
Unser Weg führt eine enge Steintreppe hinauf. Die Schatten unserer Körper zucken über die Mauern. Ein weiterer Flur, vom Mondlicht schwach beschienen. Wir laufen schweigend. Dann hält Maria an einer Tür, bedeutet mir mit einem Nicken: Hier ist es!
Ich presse die Lippen zusammen. Sodann reicht sie mir den Schlüssel und die Kerze. Maria verlässt mich. Ich bin allein mit meinem Gewissen.
Es muss sein!
Ich schließe die Tür auf, drücke behutsam gegen das Türblatt. Sie schwingt einen Spalt breit auf. Vorsichtig schiebe ich die Kerze in den Spalt, öffne die Tür weiter, immer darauf bedacht kein Geräusch zu machen.
Ganz langsam.
Ich habe mein Zeitgefühl verloren. Mir kommt es so vor, als würde ich stundenlang brauchen, um die Tür zu öffnen. Doch es sind tatsächlich viele Minuten, die vergehen, während ich nach und nach den Druck auf das Türblatt verstärke, es mehr und mehr aufdrücke, sodass der Schein der Kerze in den Raum fällt.
Er trifft ein Bett, wandert über das Laken und erfasst eine Gestalt, die darin liegt. Ihr Gesicht ist von einem Schleier verborgen.
Ich trete ein, gehe auf Zehenspitzen über den blanken Holzboden. Da knarrt eine Diele unter meinem Schritt und ich erstarre.