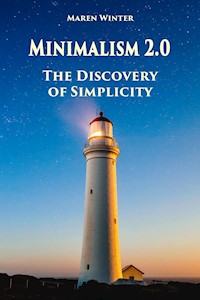4,99 €
4,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historisches Epos über den Ursprung der Neuzeit
Als Nürnberg im Jahre 1492 vom mächtigen Heer des Markgräflichen Erbprinzen angegriffen wird, sucht Severin in einer Turmuhr Schutz. Für seine Familie kommt jede Hilfe zu spät und er findet nur noch ihre Leichen auf dem Schlachtfeld.
Nie mehr wird er es zulassen, so schwört Severin, dass die Zeit ohne ihn verrinnt. Und so wird die Suche nach einer Uhr, die er immer bei sich tragen könnte, zu seinem Lebensinhalt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 679
Veröffentlichungsjahr: 2009
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Die Autorin
Widmung
PROLOG
I. KAPITEL
II. KAPITEL
III. KAPITEL
IIII. KAPITEL
V. KAPITEL
VI. KAPITEL
VII. KAPITEL
VIII. KAPITEL
IX. KAPITEL
X. KAPITEL
XI. KAPITEL
XII. KAPITEL
XIII. KAPITEL
XIV. KAPITEL
XV. KAPITEL
ANHANG
GLOSSAR
GANZ ZUM SCHLUSS UND DOCH NICHT VERGESSEN
Copyright
Das Buch
Als die Stadt Nürnberg im Jahre 1492 vom mächtigen Heer des Markgräflichen Erbprinzen angegriffen wird, sucht der Bastard Severin in einem Kirchturm Schutz. Das gleichmäßige Klacken der Uhr beruhigt ihn, bald horcht er nur noch auf das metallische Geräusch. Schreie und Schüsse verschwimmen in weiter Ferne und betreffen ihn nicht mehr. Doch dann erstirbt das Klacken – die Uhr bleibt stehen. Als Severin aus seinem Dämmerschlaf erwacht, ist das Gefecht vorbei. Er kommt zu spät, um seiner Familie zu helfen und findet nur noch Leichen auf dem Feld. Diese Erfahrung prägt ihn für sein Leben: Nie mehr wird er zulassen, dass die Zeit ohne ihn verrinnt. Bei einem Nürnberger Astronomen lernt er, die Stunden aus den Sternen zu pflücken, und er überzeugt den Schlosser Peter Henlein, ihn als Lehrling anzunehmen. Denn der verfügt über geheime Pläne, in denen eine winzige Uhr beschrieben ist, die man jederzeit bei sich tragen kann. Severin könnte glücklich sein. Doch im Henleinhaus wächst eine weitere Leidenschaft in Severin heran: die Liebe zu Kunigunde, Peters junger Ehefrau…
Die Autorin
Maren Winter, 1961 in Lübeck geboren, begann am dortigen Marionettentheater eine Ausbildung zur Puppenspielerin und gründete gemeinsam mit ihrem Mann das Figurentheater Winter. Nach Das Erbe des Puppenspielers liegt mit Der Stundensammler Maren Winters zweiter Roman bei Heyne vor.
Für Karolus, dessen Uhren alle unterschiedlich laufen, damit das Stundengeläut länger anhält und niemand die Zeit auf einen Punkt festnageln kann.
PROLOG
Severin wurde zur Unzeit geboren. Das Jahr hatte sich soeben vollendet und das nächste noch nicht begonnen. Genau zwischen Tag und Nacht, im Wechsel der Sternbilder, als die Erde für einen Augenblick stillstehen wollte, krümmte sich eine kleine Bettelmaid verborgen im Röhricht und biss auf ein Bündel Segge, damit man ihren Wehenschrei nicht hörte.
In jenem Moment glitt Severin aus dem Mutterleib und fiel zwischen die jungen Spitzen des Rohrkolbens, die wie Lanzen aus dem Uferschlamm staken.
Das Wasser des Dutzenteiches begann gerade zu gefrieren. Myriaden von winzigen Eissplittern schaukelten auf den kleinen Wellen, rieben sich aneinander und rieben die Schilfhalme wund, sodass sich ein feines Sirren über dem ganzen Ufer erhob.
Lais kippte vornüber auf die Knie. Sie stützte sich in den Morast und tastete nach Messer und Faden in ihrer Manteltasche. Mit steifen Fingern band sie die Nabelschnur ab. Wie sie es bei Nachbarinnen gesehen hatte, versuchte sie dann die Fessel zu durchtrennen. Sie brauchte mehrere Schnitte dazu. Ihre Haut war nass von Schweiß und Tränen, und der schneidende Wind machte ihren Körper fast empfindungslos. Mit einer mechanischen Bewegung strich sie sich Unterrock und Wollkleid über die Schenkel und zog den abgewetzten Mantel fest um ihre Schultern. Befremdet starrte sie auf das dampfende Häuflein Leben unter sich.
Wie groß der Knabe schon aussah, und weißlich, wie die Larve einer Drohne, die nach Honig verlangte, um nichts weiter zu tun als zu wachsen. Selbst sein erster Laut war fordernd gewesen. Aber seine Augen blickten Lais einsichtsvoll und ernst von unten an. Sollten Neugeborene nicht blaue Augen haben? Konnten sie überhaupt schon etwas erkennen? Schaudernd wandte sie sich ab. Oh doch, dieser hier konnte, er starrte durch die Seele seiner Mutter hindurch.
Aber sie wollte keine Mutter sein. Nicht jetzt! Sie war doch selbst noch ein Kind.
Der Frost knisterte in den trockenen Halmen, und Lais blies sich in die Hände. Gleich würde das fremde Wesen aufhören zu strampeln. Gleich würde es ins Wasser gleiten und aus ihrem Leben verschwinden. Sie brauchte ihm nichts anzutun, nur zu warten.
Erst spät hatte sie gemerkt, dass in ihrem Körper etwas Ungewöhnliches vorging. Über die angeschwollenen Brüste freute sie sich sogar, denn sie hoffte, ihren Gönner damit zu erregen. Als sie an ihren energischen Geliebten mit der klangvollen Stimme dachte, musste sie unwillkürlich lächeln. Jetzt war sie wieder bereit für ihn, jetzt konnte er jederzeit nach ihr verlangen. In den letzten Wochen hatte sie sich kaum zu ihren Bettelplätzen getraut. Aufgefallen wäre ihm sicher nichts, denn sie hatte ihren Bauch so fest geschnürt, dass sie nur flach atmen konnte. Doch sie hätte ihn abweisen müssen, und sie fürchtete sich davor, was er auf ihre Weigerung erwidern könnte.
Aber er war nicht gekommen.
Schon lange nicht mehr.
Gleich bei ihrer ersten Begegnung hatte er ihr den Namen Lais gegeben, nach einer begehrten Konkubine aus dem alten Griechenland, deren Schönheit die vornehmsten Philosophen bezaubert haben sollte. Und er hatte sie wie ein erwachsenes Weib behandelt, obwohl sie gerade zum ersten Mal unrein geworden war. Sie ängstigte sich ein wenig vor seiner sanft bestimmenden Art, und als sie zum ersten Mal bei ihm liegen sollte, hatte sie lautlos geweint. Da hatte er begonnen leise in ihr Ohr zu summen, schmeichelnd zuerst und zunehmend heißblütiger. Sie sei zu seiner Muse ausersehen, der Muse eines Sängers. Nun müsse sie das Ihre tun und die verborgenen Melodien in ihm wecken. Unter seinem Gewicht war sie sich zerbrechlich vorgekommen, aber auch wertvoll wie ein Kleinod.
Jetzt fühlte sie sich nur noch widerlich.
Energisch zog sie ihr wollenes Tuch vom Hals und rubbelte sich die Beine trocken. Sie bemerkte, dass der Säugling ihr dabei zusah.
Wieso drehte sie sich um? Wieso schämte sie sich vor einem Kleinkind? Tatsächlich, er beobachtete sie – lag im Dreck, glotzte sie an und forderte, dass sie ihn in die Arme schließen sollte. Reichte es nicht, dass er sie über Monate aufgezehrt und geschwächt hatte? Seit er sich in ihrem Körper eingenistet hatte, entglitten ihr all die wunderbaren Pläne. Es war gewiss nur seine Schuld, dass ihr Gönner sie seit Wochen nicht mehr begehrt hatte.
Lais wusste, dass ein Handwerker sich nie mit einer Bettelmaid vermählen würde, aber sie träumte trotzdem davon. Zumindest als Magd konnte er sie nehmen. Doch erst musste er Meister werden, ein eigenes Haus kaufen, selbst Herr über seine Entscheidungen sein … Lais würde warten.
Allmählich kehrte Leben in ihren Leib zurück. Sie fror und konnte ihre schlotternden Glieder nicht mehr ruhig halten. Sogar in der Kälte nahm sie den Gestank der Gerber und Lederer wahr, die sich an der Flussmündung angesiedelt hatten. Es war wirklich an der Zeit, diesen abscheulichen Ort zu verlassen. Lais stemmte sich hoch. Doch sie zögerte, dem fremden Balg den Rücken zuzudrehen, sie konnte sich nicht entschließen zu gehen, solange er noch lebte. Bei jedem Geräusch würde sie zusammenzucken und sich ängstlich umsehen, ob er etwa hinter ihr hergekrochen kam.
Sie sollte ihn einfach ins Wasser werfen.
Und wenn er dann anfinge zu schreien? Wenn er zwischen den Dutzenhalmen stecken blieb und sich weigerte unterzugehen?
»Ich will dich nicht, begreife das endlich!«, sagte sie laut und erschrak vor dem harschen Klang ihrer Stimme.
Der Säugling schloss die Augen, und seine Bewegungen wurden schwach.
Ein scharfer Schmerz brandete durch Lais’ Körper, als würde ihr Inneres herausgerissen. Auf einmal fürchtete sie, dass der Knabe tatsächlich sterben könnte. Bestrafte Gott sie schon jetzt, noch bevor sie ihr Kind getötet hatte?
Lais sank auf die Knie, wickelte das Neugeborene in ihr Tuch und wiegte sich wimmernd vor und zurück. »Vergib mir, ich selbst bin schuld an meinem Elend, ich habe gesündigt und habe seitdem weder eine Messe besucht, noch wurde ich von meinen Sünden losgesprochen. Ja, ich wollte, dass er von alleine stirbt, aber ich will nicht an seinem Tode schuldig sein.«
Als die Nachgeburt abgegangen war, ließ der Schmerz allmählich nach. Lais fühlte sich elend, und ihre Beine drückten schwer in den Uferschlamm. Der bloße Gedanke, sich zu erheben, erfüllte sie mit tiefer Niedergeschlagenheit, viel weniger konnte sie sich vorstellen, wieder auf den Markt zu müssen, den Blicken der Bürger preisgegeben, rempelnden Kerlen auszuweichen und sich unter den anderen Bettlern einen Platz zu behaupten. Herrgott, und das alles mit einem Säugling im Arm! Sie dachte an die steinernen Figuren am Kirchenportal, unter dem sie manchmal um Almosen bat. Dort warteten sie schon, schnitten Grimassen und reckten spitze Forken nach ihr, begierig, die sündige Maid ins Fegefeuer zu stoßen.
Am liebsten wäre sie im Röhricht liegen geblieben, um sich der Erschöpfung hinzugeben. Das wäre das Beste. Erfrieren sollte ein schöner Tod sein. Doch dieses Bett war grausam, die Schilfstoppeln stachen, und der kalte Morast erstarrte allmählich zu schartigem Eis.
Gelassen wanderte der Mond in den Steinbock, und aus der Ferne hallten die Hörner der Nachtwächter. Vereinzelte Schneeflocken sanken lautlos in den schwarzen Weiher.
Matt schlich Lais der Stadt entgegen.
Die Tore waren geschlossen, und kein Torsperrer hätte sich des Nachts überreden lassen, sie wieder zu öffnen. Auch die Fallgitter an der Pegnitzmündung hatten sie natürlich herabgelassen. Ohne den unförmigen Bauch fiel es Lais wesentlich leichter, sich am ausgespülten Ufer daran vorbeizudrücken.
Die braven Bürger lagen längst in ihren Betten und träumten davon, was das neue Jahr wohl für sie bereithalten mochte. Lais verkrampfte sich bei dem Gedanken an das Neujahrsgeschenk, welches sie selbst nach Hause brachte. Wie waidwundes Wild stahl sie sich durch die leeren Gassen, immer wieder verhaltend und horchend, um nicht einem der Nachtwächter in die Arme zu laufen. Endlich öffnete sie das Tor eines stattlichen Fachwerkhauses, huschte durch den langgezogenen Hof und blieb vor einer Baracke stehen.
»Du hast es also überlebt«, sagte eine Frauenstimme aus dem Dunkel. »Der Bastard auch?«
I. KAPITEL
Im Schutz des Waldsaumes saß Severin auf einem Baumstamm und zählte. Von Weitem hätte man den stämmigen Elfjährigen für einen Halbwüchsigen halten können, und auch er selbst kam sich bedeutender vor als sonst. Wenn er alle seine Finger umgeklappt hatte, schob er mit dem Fuß einen Zweig zurecht. Danach zählte er die Zweige und die übrigen eingeklappten Finger.
Vierundzwanzig.
Eine schöne Zahl, denn sie bedeutete, dass alle Schafe lebten und keines verloren gegangen war. Das zuletzt gezählte löste diese Erleichterung aus, das letzte war etwas Besonderes. Sobald man den Schafen Namen gab, verschwand diese Art von Besonderheit, und die Tiere verloren das Verhältnis zur Herde. Mit eigenem Namen wurden sie zu Einzelwesen und dadurch sicher sehr einsam.
Manchmal wünschte er sich, unter den Geschwistern der siebente zu sein und nicht bloß Severin. Doch seine Familie scherte sich nicht um Zahlen, ebenso wenig, wie die wollige Schar, die sich über die ganze Länge des Tales verteilt hatte. Manchmal hoben die Schafe unschlüssig ihre Köpfe oder blökten, weil es bereits dämmerte und sie gewohnt waren, um diese Zeit nach Hause getrieben zu werden. Doch ihr umsichtiger Hirte saß stramm auf einem umgestürzten Baum und bedachte jedes von ihnen gewissenhaft mit einer Ziffer, welche es von allen anderen unterschied und ihm zudem einen Platz in der Gemeinschaft zusicherte. So tat es auch Gott mit den Sternen.
Es war das erste Mal, dass Severin alleine hütete. Er hatte eine sichere Weide dafür gewählt. Am Hang im Westen erhob sich der Wald mit dichtem Unterholz, und auf der anderen Seite wand sich ein Bach durch die Wiese. Das Frühjahrswasser stand hoch, keins der Schafe würde versuchen darüber zu springen. Der Bursche kniff die Augen zusammen, um die entfernteren Tiere vom Buschwerk zu unterscheiden. Sie sahen inzwischen wie große Findlinge aus, die ein Riese über die Weide gekullert hatte.
Bei Einbruch der Dunkelheit mussten sie zurück sein. Auf keinen Fall früher, der Vater hatte mit Prügel gedroht, wenn die Tiere nicht genügend fraßen. Für den Weg brauchte er vierzehn Paternoster, das hatte er abgezählt. Aber wie sollte er es anstellen, dass es genau dann finster wurde, wenn er zu Hause ankam? Der Himmel hatte schon den ganzen Tag gleichmäßig grau gewirkt, mal bleich, mal stumpf, unmöglich, den Sonnenstand zu bestimmen. Nur sein Magen beteuerte, dass es Zeit fürs Abendessen sei, allerdings hatte er das schon den ganzen Tag behauptet. Im Gegensatz zu seinen Geschwistern wurde Severin kurz nach dem Frühmahl wieder hungrig. Er wuchs eben schneller als die anderen, daran konnte er nichts ändern.
Severin beschloss, noch etwas auszuharren. Es tat wohl, endlich eine Arbeit zu tun, die für seine Familie lebenswichtig war. Vielleicht würde seine Mutter ihm heute Abend Honig in die Grütze rühren, und vielleicht würde der Vater ihm sogar lobend über den Kopf streichen. Bisher war ja alles gut gegangen, kein Fuchs, kein Wolf und kein verirrtes Lämmchen. Fast wünschte er sich, einem Dieb zu begegnen, den er in die Flucht schlagen konnte. Die Ringkämpfe mit seinen älteren Brüdern gewann er schließlich regelmäßig durch sein größeres Gewicht und weil er die Schläge kommen sah, bevor sein Gegner überhaupt daran dachte.
Er bewegte seine nackten Zehen im Gras, es fühlte sich feucht und ziemlich kalt an. Schnell zog er die Knie hoch und strich sich den Kittel bis über die Füße. Die Schafe waren zu beneiden, sie trugen weiche Wollmäntel.
Mittlerweile konnte er die Tiere nur noch schemenhaft ausmachen, selbst, wenn er die Lider zusammenkniff und seine Augenwinkel mit den Fingern etwas nach außen zog. Er rutschte vom Baumstamm und ging ein Stück in Richtung Waldsaum. Hier war es schon richtig finster.
»Kume, kum!«, rief er und klatschte in die Hände. Wollige Schatten trabten ihm entgegen, hüpften unruhig durcheinander, rempelten und blökten. »Nicht so schnell.« Severin wedelte mit den Armen, damit sie ihn in der Düsternis besser erkennen sollten. »Wartet, nicht da entlang!« Normalerweise fanden sie den Weg von selbst, man musste nur darauf achten, dass sie nicht in die eben grünenden Felder liefen.
Zwei Tiere brachen seitlich aus. »Halt! Kommt zurück!«, schrie er, mit dem Ergebnis, dass die anderen auseinander stoben. Severin lief hinterher, über Steine und Kuhlen, lockte und trieb, sprang nach rechts, nach links, rannte zurück … Er stolperte im Dunklen und schürfte sich die Knie auf. Doch was bedeutete das schon, er musste sie nach Hause bringen – alle!
Nach und nach gelang es ihm, die aufgeregten Tiere zur Biegung des Baches zu drängen. Mit ausgebreiteten Armen stand er vor ihnen. Seine Muskeln zitterten. »Ruhig, ganz ruhig, meine Guten.«
Entwischen konnten sie nicht mehr, sie wimmelten ängstlich durcheinander, und manche versuchten, sich über die Rücken ihrer Artgenossen vor ihm zu retten.
»Beruhigt euch, bitte, ich bin es doch nur«, keuchte er. Plötzlich ein klatschendes Geräusch im Wasser und direkt danach der Angstruf eines Schafes.
Severins erster Impuls war, hinterherzuspringen.
Seine Bewegung hatte die anderen Tiere erschreckt. Schon blökten sie furchtsam und wichen vor ihm zurück. Er erstarrte sogleich und hob vorsichtig wieder die Arme. Er durfte sie nicht erneut verstören, nicht ein weiteres in den Fluss treiben. Verzweifelt schloss er die Augen und versuchte, die schrillen Laute zu überhören, die einer menschlichen Stimme so ähnlich waren. Rasch und gleichmäßig entfernten sich die Schreie.
Die Wiese verschwamm hinter einem Tränenschleier. Mechanisch lenkte er seine Herde fort vom Bach, durch das Erlenwäldchen auf den aufgeweichten Feldweg. Ein Käuzchen rief ihm Unheil hinterher. Aber es mahnte zu spät, es hätte rufen sollen, als es Zeit für den Rücktrieb war. Dunkel gurgelte das Wasser, und die Angstlaute hallten immer noch in seinen Ohren nach. Es war ein freundliches Schaf gewesen, vielleicht hätte es bald ein Lamm zur Welt gebracht.
Er führte die Tiere in den Stall und schloss sorgfältig die Tür. Die wenigen Schritte bis zur Schwelle des niedrigen Fachwerkhauses kamen ihm unendlich vor. Letztes Jahr hatte der Vater die Fensteröffnung mit ölgetränktem Papier verschlossen, und Severin konnte im Flackerlicht den Schattenriss des Männerrückens erkennen. Er wischte sich mit dem Ärmel übers Gesicht, atmete tief ein und öffnete die Tür. Alle Köpfe hoben sich, und seine Mutter riss die Augen auf. »Ach, du liebe Zeit, was ist mit deinen Kleidern geschehen? Hast du dich im Schlamm gewälzt?«
Mit einer Handbewegung brachte Georg Geiss sein Weib zum Schweigen und erhob sich. Er stand immer mit etwas vorgerecktem Kopf im Haus, da sein störrisches Haar sonst die Deckenbalken streifte. »Du kommst zu spät.«
Der Junge schloss die Tür hinter sich, senkte den Blick und machte einen Schritt auf den Vater zu. »Ich habe ein Schaf verloren. «
Die flache Hand traf ihn so heftig ins Gesicht, dass er zur Seite taumelte. Bevor er stürzte, riss der Vater ihn am Arm zurück und schleuderte ihn gegen die Wand. Severin krümmte sich und versuchte so gut wie möglich seinen Kopf zu schützen. Er wusste, dass der Vater seine Wut austoben musste, bevor er irgendeine Erklärung aufnehmen konnte.
»Ahnst du überhaupt, was ein Schaf bedeutet?« Der Hieb donnerte auf Severins Schulter. »Käse und Fleisch für Monate.« Die nächsten trafen seinen Rücken und die Arme. »Du meinst wohl, deine Kleider wüchsen in der Truhe?« Wieder schlug der Vater zu. Aber die Wucht schien etwas schwächer geworden zu sein, und Severin wagte einen scheuen Blick.
»Sieh mich nicht an, verdammt noch mal.« Schwer atmend stand der Georg Geiss über ihm.
Rasch senkte Severin den Kopf und flüsterte: »Es tut mir Leid, das Schaf ist in den Bach gesprungen. Ich konnte es nicht retten, sonst wären mir die anderen davongelaufen. Es wird nie wieder vorkommen.«
»Das wird es bestimmt nicht. Morgen geht Hanns auf die Weide. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wozu man dich gebrauchen kann. Aber glaube nicht, dass du ungeschoren davonkommst. Diesmal wirst du deine Schuld bezahlen. Du wirst weder Milch noch Fleisch, noch Käse anrühren, bis das Tier abgegolten ist.«
»Ja, Vater.« Severin rappelte sich auf und schlich in geduckter Haltung an ihm vorbei zur Leiter, die in die Dachkammer hinaufführte. Auf den Strohsäcken kroch er in den hintersten Winkel. Die Schulter tat ihm weh, und sein Kiefer pochte. Seine Unterlippe schwoll dick an und schmeckte nach Blut. Halb auf dem Bauch war die Lage am erträglichsten. Alle Wolldecken zog er über sich. Bis seine Geschwister sich zu ihm gesellten, brauchte er wenigstens nicht zu frieren.
Nun würde Vierundzwanzig nur noch Dreiundzwanzig sein. Nie wieder würde das letzte Schaf Erleichterung auslösen, sondern im Gegenteil, es würde den Verlust jedes Mal erneut heraufbeschwören.
Unten kam das Gespräch nur zögernd in Gang.
Gleichmäßig surrte die Spindel der Mutter. »Du hättest ihn damals nicht anschleppen sollen, Georg«, sagte sie. »Ich wusste von Anfang an, dass er eigentümlich ist.«
»Das Geld fandest du damals nicht eigentümlich«, brummte ihr Gemahl.
Das Geräusch der Spindel stockte. »Georg Geiss! Du allein hast die Entscheidung getroffen, wie hätte ich als dein Eheweib auch nur den leisesten Einwand erheben dürfen. Trotzdem war es ein schlechter Zeitpunkt, einen weiteren Esser ins Haus zu bringen. Gott hat schon gewusst, warum er unser siebtes Kind direkt zu sich in den Himmel holte. Da kommst du einfach mit einem neuen Schreihals daher, und dann noch mit einem solchen Brocken. Sieh ihn dir an, du hast uns einen fetten Kuckuck ins Nest gesetzt. Die paar Heller des Nürnbergers hatte der Junge im Handumdrehen verzehrt, nur leider ist sein Hunger damit nicht gestillt. Statt etwas zu schaffen, träumt er vor sich hin und frisst für drei. Du musst ihn besser anleiten, damit er nützlich wird, wie ich es mit den Mädchen schließlich auch tue.«
Der Vater knurrte etwas Unverständliches.
Hanns meinte: »Ich kann ihn ja morgen mitnehmen und ihm noch einmal alles zeigen. Er gibt sich Mühe, aber er ist nun mal der Jüngste.«
Sein älterer Bruder Matthes lachte auf. »Du warst in seinem Alter wesentlich mickriger, und trotzdem hat dich niemand für zu jung gehalten. Nein, du bist nicht erst mitten in der Nacht von der Weide gekommen.«
Anna kicherte. »Für heimliches Zuspätkommen ist ja auch unser Matthes zuständig, besonders am Samstag, nicht wahr?«
Wieder erstarb das Geräusch der Spindel, und die Mutter fragte drohend: »Was soll das heißen, Matthes? Wo warst du am Samstag?«
Severin verlagerte vorsichtig sein Gewicht. Morgen früh, wenn er weder Milch noch Käse zum Frühmahl erhielt, würden sie sich sogleich an das Unglück erinnern. Am nächsten Morgen wieder, und so fort, bis sie irgendwann bereits mit dem Gedanken erwachten, dass Severin ein Schaf auf dem Gewissen hatte.
Wie lange mochte es wohl dauern, bis so ein Tier bezahlt war? Wochen, Monate, Jahre? Alles unüberschaubare Ewigkeiten. Sein Magen zog sich zusammen. Im Moment hätte er sich gerne mit dem härtesten Brotkanten zufrieden gegeben.
Er liebte seine Eltern, auch jetzt. Aber er wusste nie genau, was sie für ihn empfanden. Schon oft hatte er aus kleinen Äußerungen geschlossen, dass er nicht ganz dazugehörte, dass er anders in die Familie geraten war als seine Geschwister. Er würde sie danach fragen – später, wenn das Schaf vergessen war. Unter der Decke faltete er die Hände und betete, dass Gott die Zeit bis dahin möglichst schnell vergehen lassen sollte.
Die Geschwister kletterten die Leiter herauf, balgten sich um die Decken und schoben sich auf den Strohsäcken zurecht. Severin drehte den Kopf zur Wand, sie mochten nicht, wenn er sie ansah, während sie schliefen.
Anna drängte sich dicht an ihn und strich ihm über den Rücken. »Wieso musste das dumme Schaf nur in den Fluss springen? «, flüsterte sie.
»Ich glaube, es hatte Angst im Dunkeln.« »Severin, du hättest einfach losgehen müssen, bevor es dunkel war.«
»Wann denn? Die Dunkelheit kommt doch jedes Mal anders. Wenn es stürmt, ist sie ganz plötzlich da, und manchmal, bei Vollmond, bleibt es einfach hell, sodass ich mitten in der Nacht noch meinen Schatten sehen kann.«
»Oje, sag das bloß nicht Vater. Du bist komisch, Severin. Du kannst zeichnen und weiter rechnen, als du Finger hast. Du findest sogar die Abstände für Radspeichen heraus, aber dass die Zeit immer gleichmäßig vergeht, verstehst du nicht. Dabei ist es ganz leicht, sogar die dummen Schafe wissen das. In der Dämmerung, wenn sie nach Hause wollen, sehen ihre Augen nämlich rund aus.«
Severin setzte sich auf. »Stimmt das?«
Anna zog ihn aufs Lager und spielte in seinen Locken. Plötzlich gluckste sie: »Und du siehst in der Dämmerung wie ein Mädchen aus, zumindest von hinten und wenn du bis auf die Haare vollkommen zugedeckt bist.«
Severin gab ihr einen Rippenstoß und lächelte, soweit es seine geschwollene Lippe zuließ.
Sein Vater blieb unversöhnlich und vertraute ihm die Herde nicht mehr an. Zum Umgraben auf dem Feld hielt er ihn aber für fähig genug, das taten sie ohnehin gemeinsam. Der Vater gab den Rhythmus vor, und neben ihm kämpften sich seine Söhne rückwärts durch die nasse Erde. Trotz des kalten Windes lief ihnen bald der Schweiß über die Schläfen. Ihre Rücken schmerzten, und an den Händen platzten Blasen auf. Jede Schaufel, die sie hochwuchteten, kam ihnen schwerer vor als die letzte. Sie hätten natürlich auf den Pflug aus dem Dorf warten können, aber wenn die Felder der Nachbarn bearbeitet waren, würde es für ihre Einsaat zu spät sein.
Als Severin immer weiter zurückblieb, nahm Hanns ihm die Schaufel weg.
»Zählst du Regenwürmer?«, fragte er. »So werden wir nie fertig. Sieh her! Wenn du in den Acker stößt, ist dein Körper aufgerichtet. Dann fährst du mit einer Hand nach unten, nah an das Schaufelblatt und hältst nur fest. Mit der anderen Hand drückst du oben auf den Stiel und hebst die Erde gerade so weit, dass du sie wenden kannst. Du brauchst die Erde nicht jedes Mal hoch in die Luft zu werfen und zuzusehen, wie sie hinunterprasselt. «
Severin gehorchte, doch die Freude an der Arbeit war ihm verdorben. Dumpf wie seine Brüder beugte er sich der Scholle zu, verlor jedes Gefühl in seinem Leib, hörte die Vögel nicht mehr und achtete nicht auf das schmatzende Geräusch, welches der Acker von sich gab, wenn ihm die feuchten Klumpen entrissen wurden. Als er endlich aufblickte, hatte er die anderen weit hinter sich gelassen.
Sie gruben gar nicht mehr, sondern hatten sich auf ihre Schaufeln gelehnt und zankten mit dem Knecht des Verwalters.
»Ich kann doch nichts dafür«, beteuerte der, »im Märzen müssen die Felder eben umgebrochen werden, und ihr vier seid mit eurem Ochsen nun einmal dienstpflichtig.«
Der Vater knirschte mit den Zähnen. »Ich wäre der Letzte, der seinem Dienst nicht nachkommen will. Aber muss das Kloster immer dann die Pflicht einfordern, wenn wir selber alle Hände voll zu tun haben?«
Verärgert warf er die Schaufel weg und winkte seinen Söhnen, damit sie dem Knecht folgen sollten. Georg Geiss war zwar kein Leibeigener wie andere Bauern aus der Umgebung, doch der Grund, auf dem er seinen Einödhof gebaut hatte, gehörte, wie das gesamte Dorf, dem Kloster Pillenreuth. Mit vollem Recht durfte das Kloster als Pacht verschiedene Abgaben und Fronarbeiten in Anspruch nehmen, was der Verwalter in zunehmendem Maße nutzte.
Da Severin trotz seiner Größe noch als Kind galt und in die Fron nicht eingerechnet wurde, plagte er sich allein auf dem väterlichen Acker weiter, bis er kaum noch den Arm heben konnte. Das Ergebnis war niederschmetternd. Im Gegensatz zu der schmalen, dunklen Spur, die er gegraben hatte, breitete sich der unbearbeitete Teil des Feldes noch unendlich vor ihm aus.
Sie müssten einen eigenen Pflug besitzen. Vielleicht einen, der gleich mit mehreren Haken nebeneinander die Erde lockerte, genauso wie sein Vater und die Brüder es eben getan hatten. Dann würde ihr Acker weit vor den anderen fertig sein, und kein Verwalter könnte ihre Saat verzögern. Severin rannte ins Haus, kramte ein Stück Kohle und ein Papier hervor, zog sich hinter den Stall zurück und begann zu zeichnen.
Als Georg Geiss mit den Brüdern nach Hause kam, hatte er einen Entwurf entwickelt, von dem er glaubte, dass er funktionieren müsse. Doch der Vater verschwendete nicht einen einzigen Blick auf das Papier. Sobald er hörte, dass Severin den Acker eigenmächtig verlassen hatte, versetzte er ihm eine krachende Ohrfeige: »Von deiner Krickelei wird niemand satt. Gerade jetzt müssen wir alle unsere Kraft einsetzen, um Vorräte zu schaffen. Uns stehen wüste Zeiten bevor.«
Die Geissin fiel ihrem Gemahl in den Arm und drückte ihn auf die Bank. »Jetzt iss erst mal, sonst werden die Rüben kalt. Auch wüste Zeiten übersteht man besser, wenn man etwas im Magen hat.«
»Aber Vater hat Recht«, sagte Matthes. »Im Kloster erzählen sie, dass Markgraf Friedrich sich mit dem Kurfürsten von Sachsen und anderen Adligen getroffen hat. Falls sie den Markgrafen nun mit Truppen gegen Nürnberg unterstützen, können wir Vieh und Felder vergessen.«
»Falls wir überhaupt mit dem Leben davonkommen«, schmatzte Hanns.
Die kleine Agnes begann zu weinen, und die Mutter warf ihren Söhnen einen drohenden Blick zu.
Anna fragte: »Was geht uns der ewige Streit zwischen Nürnberg und den Markgräflichen an? Wir haben niemandem etwas getan.«
»Ach nein?«, sagte Hanns. »Du bist also nie durch den Forst geschlendert?«
Anna sprang auf. »Das ist der Nürnberger Forst, und wir sind Nürnberger Hintersassen, auch wenn Worzeldorf fast auf der Grenze zu den Markgräflichen liegt.«
»Aber der Wildbann im Forst gehört trotzdem Markgraf Friedrich, unsereins darf ja nicht einmal die Hunde frei laufen lassen«, gab Hanns zurück. »Das Geleitrecht bis zu den Stadtmauern beansprucht er auch. Die Kaufmannszüge auf der Venezianerstraße kommen direkt durch unser Dorf, da kannst du sehen, dass sie von Friedrichs Rittern begleitet werden.«
»Das verstehe ich nicht«, sagte Anna und schüttelte den Kopf. »Vor wem beschützen Markgraf Friedrichs Ritter denn die Kaufleute?«
»Vor sich selbst natürlich. Wenn sie kein Gold für den Schutz bekämen, würden sie sich das Gold eben mit Gewalt verschaffen.«
Matthes stellte einen Napf auf den Tisch. »Das soll Nürnberg sein«, sagte er und verteilte mehrere Becher rundherum. »Sieh her, der Tisch gehört Markgraf Friedrich, aber das Geschirr ist alles Nürnberger Land. Es zerteilt Friedrichs Gebiet, sodass er seine Besitztümer nicht vereinigen kann und dauernd Umwege in Kauf nehmen muss. Umgekehrt müssen die städtischen Kaufleute in jeder Richtung durch seine Domänen reisen und deftige Zölle bezahlen.«
»Schluss damit!« Der Vater schlug mit der Hand auf den Tisch, und die Kinder verstummten. »Die Fürsten werden eher eine Einigung anstreben, als Markgraf Friedrich teure Truppen zu versprechen.« Dann senkte er seine Stimme und begann das Dankgebet für das Abendessen zu sprechen.
Am nächsten Morgen ließ sich wenigstens Matthes überreden, Severins Zeichnung anzusehen. Er drehte sie ein paar Mal hin und her und betrachtete sie mit gerunzelter Stirn.
»Matthes, so steht es auf dem Kopf.«
Der Älteste lachte. »Das war nur Spaß. Hm, ich weiß nicht, ob der Ochse das Ding ziehen könnte. Aber ich weiß, dass unsere Saat verderben wird, wenn wir die Zeit damit verschwenden, solchen Unsinn zu bauen. Wenn dir das Graben so sehr zuwider ist, dann geh und besorge Holz für den Winter.« Er hängte Severin eine hohe Kiepe auf den Rücken. »Du sammelst so lange, bis nichts mehr hineinpasst, dann kehrst du um, verstanden? Aber am Weg suchen alle, da wirst du nicht viel finden, und bis die Kiepe voll ist, hast du das Abendbrot verpasst. Außerdem ist es zu gefährlich, wenn du dort allein herumspazierst. «
»Was soll daran gefährlich sein? Ich bin stärker als du und nicht so dumm, dass ich mich auf dem Weg verlaufe.«
»Natürlich nicht, Severin, im Gegenteil, gerade weil du der Kräftigste von uns allen bist, wirst du die Last tragen können. Doch auf den Straßen ziehen Kaufleute, und wo es Kaufleute gibt, da lauern Heckenreiter. Der Markgraf drückt den räuberischen Rittern gegenüber beide Augen zu, weil er ja selbst die Nürnberger hasst.« Matthes legte ihm den Arm um die Schulter und flüsterte: »Wenn so ein Hecker mit seinem schnellen Pferd einen reichen Pfeffersack zu fassen bekommt, schleppt er ihn fort, steckt ihn in ein dunkles Verlies und lässt ihn schmachten, bis ein Lösegeld geliefert wird. Hüte dich, Severin. Du glaubst doch nicht, dass Vater für dich bezahlen würde. Das Schaf ist noch lange nicht abgegolten.«
»Ich bin aber kein Pfeffersack«, sagte Severin, doch das hörte sein Bruder nicht mehr. Der hatte seine Hände in den Kitteltaschen vergraben und verschwand pfeifend im Stall.
So ganz glaubte Severin zwar nicht, dass er ein Opfer der Ritter werden könnte, aber er mied trotzdem die Wege und stolperte quer durchs Unterholz. Immer weiter dehnte er seine Wanderungen durch die Wälder aus, er kannte bald jede Erhebung, jedes Tal und jedes Wasserloch. Im Frühjahr konnte er oft Rehe an der Tränke sehen, aber je weiter der Sommer fortschritt, desto trockener wurden die Mulden, und schließlich gab es nur noch raschelndes Laub darin. Insgeheim fand er, dass Gott die Jahreszeiten unvollkommen eingerichtet hatte, da es genau dann kein Wasser gab, wenn alle am meisten Durst verspürten.
Zu Hause schüttete er seine Last vor dem Schuppen aus und begann zu sägen. Danach mussten die krummen Stücke noch gestapelt werden. Hanns lehnte an der Tür und kaute auf einem Sauerampferblatt. »Ja, ja, Holz wärmt drei Mal, stimmt’s? Schöne Verschwendung, so etwas in der Sommerhitze zu erledigen. «
Severin streckte sich und wischte sein Gesicht mit dem Ärmel. »Du hast Recht, die reinste Verschwendung. Mutter kocht jeden Tag, und im Moment macht sie sogar für die Wäsche heißes Wasser. Am liebsten würde sie jeden Monat einen ganzen Baum verbrennen. Unglaublich, wie lange so eine Buche zum Wachsen braucht, und wie schnell sie dann nur noch Asche ist. Du könntest mir übrigens ruhig helfen.«
Abwehrend hob Hanns die Hände. »Oh nein, ich hab mich heute von oben bis unten abgeschrubbt, das muss bis zur Kirchweih reichen. Ich sehe lieber mal nach, ob die Weiber nicht vergessen, mein Hemd auszubessern.«
Als Severin später ins Haus trat, hockten die Schwestern vornübergebeugt in der Stube, tuschelten und kicherten. Spindeln und Wolle hatten sie neben sich geworfen, sie waren offenbar mit Wichtigerem beschäftigt. Severin blickte Anna über die Schulter. Sie kreischte und strich sich hastig den Rock über die Beine. Er hatte gerade noch einen Blick auf ein zwiebelfarbenes Flatterband erhaschen können, an dem sie heimlich nähte.
»Wehe, wenn du uns verrätst!«
Severin schüttelte den Kopf, und Agnes, die Jüngere, zog sofort ihre Arbeit wieder hervor. »Ein bisschen schief, oder?«, fragte sie und bekam fieberrote Wangen. Seine älteste Schwester zupfte ihn am Ärmel, wand sich eine Borte ins Haar und legte den Kopf zur Seite. »Was meinst du, steht es mir? Ist es nicht zu aufgeputzt?«
»Es ist großartig!«, sagte Severin aus voller Überzeugung. Er fand seine Schwestern alle miteinander hübsch, rosig und wunderbar kernig. Seinetwegen hätten sie keinerlei Flatterwerk bedurft.
Wie auf einen unhörbaren Befehl verschwanden die Handarbeiten unter den Röcken, und emsig drehten sich wieder die Spindeln. Die Mutter setzte sich zu ihnen und begann, die vollen Spulen abzuwickeln, um die Wolle in Schlingen zu legen. Auch sie hatte eine blühendere Gesichtsfarbe als sonst. »Du kannst dir Haferbrei nehmen, Severin. Er ist kalt, aber ich habe jetzt keine Zeit, dir etwas zu kochen. Es ist noch furchtbar viel zu tun.«
Der letzte Abend vor der Kirchweih begann spät, und die Kerze brannte lange. Die Familie saß in der Stube und schwatzte aufgeregt. Niemand von ihnen hätte jetzt schon schlafen können, obwohl sie beschlossen hatten, weit vor dem Morgengrauen aufzubrechen. Severins Brüder rieben sich ihre Schuhe mit Fett ein, damit sie glänzen sollten, und Hanns schnitzte an dem letzten von sieben kleinen Pferden, die er auf dem Markt verkaufen wollte. Die Holzrösser sahen alle genauso bissig aus wie das einzige Vorbild im Dorf.
Georg Geiss brütete düster über den wenigen Erntesäcken. »In Schwabach ziehen sich markgräfliche Truppen zusammen, und Nürnberg rüstet ebenfalls. Die Stadt hat einen Haufen Landsknechte aus Konstanz verpflichtet. Vielleicht sollten wir lieber auf die Kirchweih verzichten.«
Entsetzt hoben sich die Köpfe.
»Verzichten?« Matthes sah seinen Vater ungläubig an. »Wir können nicht verzichten. Erst Hochwasser und dann gar kein Regen mehr. Für die Abgaben reicht unsere Ernte bei Weitem nicht. Wir müssen das Zeug verkaufen, sonst können wir uns nicht einmal Saatgut leisten.«
Die Geissin legte ihrem Gemahl den Arm über die Schulter. »Lass die trüben Gedanken, Georg. In den letzten zwei Jahren hat Nürnberg so viele Soldaten auf die Kirchweih gesandt, dass es für zehn Markgrafen gereicht hätte, und nie ist etwas geschehen. Sagtest du nicht, dass Markgraf Friedrich in Erfurt weilt, um zu verhandeln? Das ist weit weg. Morgen wollen wir singen und feiern. Außerdem steht der Flachs nicht schlecht, wir können ihn schon nächste Woche rupfen. Und sieh, sogar Severin wird dir dieses Mal etwas einbringen.«
Der Vater schüttelte den Kopf über den kleinen Korb mit Blaubeeren, die Severin gesammelt hatte. »Unsinn, wer sollte seine Pfennige für etwas geben, wonach er sich nur zu bücken braucht.«
Severin schluckte. Er hatte auch etwas beitragen wollen, da war er auf den Gedanken gekommen, Beeren zu suchen. Doch statt seinen Korb zu füllen, hatte er mehrmals ins Unterholz hechten müssen, denn tatsächlich waren mehrere bewaffnete Kerle durch den Wald gestreunt, denen er keinesfalls in die Hände geraten wollte. Die meiste Zeit hatte er reglos abgewartet, bis die Gefahr vorbeigetrampelt war. Seine Ausbeute war dadurch bescheiden ausgefallen, und als er endlich nach Hause gekommen war, hatte die Mutter den Waschzuber bereits geleert und ausgeschrubbt.
Die ganze Familie hockte mit duftigem Haar und sauberen, geflickten Kleidern in trauter Runde beisammen. Er dagegen starrte vor Schmutz. Jetzt nahm niemand Notiz von seinem Zustand, aber morgen würden sie sich bestimmt seiner schämen.
Und wenn sie ihn gar nicht mitnehmen wollten?
Das Schaf war immer noch nicht abgegolten.
Severins Herz begann zu hämmern, und er fühlte, wie ihm die Röte ins Gesicht stieg.
Das konnten sie ihm nicht antun! Das durften sie nicht! »Ich bin müde«, presste er heraus und gähnte zur Bestärkung. Er senkte den Kopf, damit sie seine Tränen nicht sahen, und hastete an ihnen vorbei auf den Dachboden.
In dieser Nacht drückte Anna sich nicht an ihn. Dieses Mal flatterte ihr Herz in unbestimmter Erwartung, und sie war damit beschäftigt, es möglichst lange unruhig zu halten.
Noch im Dunklen holte der Vater den Ochsen von der Weide, damit die Burschen ihn striegeln konnten. Auch der Wagen stand zum Beladen bereit. Die Frauen sollten derweil einen kleinen Handkarren mit ihrer gesponnenen Wolle füllen. Doch sie schwirrten fiebrig hinein und hinaus, zupften sich an den Haarbändern oder wollten plötzlich doch die Schürze wechseln, sodass der Vater ihnen schließlich die Wolle aus den Händen riss. »Wenn ich auf euch warte, finden wir keinen guten Platz mehr. Packt den Wagen und dann kommt so schnell wie möglich nach. Ich werde lieber vorgehen.«
Severin stand unschlüssig an der Wand und rieb sich das Ohrläppchen. Am besten fragte er nicht lange, ob er mitkommen durfte. Er wollte helfen, so gut er konnte, und dann unauffällig hinterherlaufen.
Georg Geiss zog den Karren an. Kurz hielt er inne und sah in Severins Richtung. Jetzt würde das Verbot kommen.
Aber der Vater winkte nach ihm. »Du kommst mit mir. Vergiss deine Beeren nicht.«
Sofort stürzte Severin hinein, schnappte das Körbchen und war mit einem Satz wieder draußen. Georg Geiss hatte tatsächlich gewartet und klopfte jetzt auffordernd mit der Hand auf die Wolle.
»Ich kann doch zu Fuß gehen, du brauchst mich wirklich nicht zu ziehen.«
»Hoffen wir’s.«
Schweigend nahmen sie die Straße in Richtung Nürnberg. Die Morgenröte glitt über die Felder. Überaus klar standen die Hügel vor dem blanken Himmel, und aus den Schattenwinkeln stieg leichter Nebel empor. Zu dieser Stunde schliefen die Insekten noch, und die Vögel nutzten den Augenblick, um sich vor der Tagesstrapaze die Zeit mit Singen zu vertreiben.
Beim Steinbruch bogen sie in den Waldweg ab. Der Vater ging schnell und scherte sich weder um sonderbar verdrehte Wurzeln am Wegesrand noch um die Kaninchenlöcher, welche ein unergründliches Muster in den Waldboden tupften. Severin konnte nicht unberührt daran vorüberhasten, zumindest der hüfthohe Ameisenhaufen verlangte einen Moment der Hochachtung. Unermüdlich schichteten die Tiere winzige Sandkörner aufeinander und rückten sie sorgfältig zurecht. Wie viele Tage mochte es wohl dauern, bis sie ihre Burg um eine Handbreit aufgestockt hatten? Wussten sie von Anfang an, wie hoch sie hinauswollten? Und warum verzweifelten sie nicht an ihrer Aufgabe, die sie Bröckchen für Bröckchen der Ewigkeit abtrotzen mussten?
Georg Geiss blieb stehen und rief. Als Severin ihn keuchend eingeholt hatte, klopfte der Vater bestimmt auf die Wolle. »Starr mich nicht an. Steig auf oder pack dich nach Hause. Du hältst mich auf. Kannst du nichts anderes, als Zeit zu vergeuden? Deine Säumigkeit hat uns bereits ein Schaf gekostet, ich will nicht auch noch zu spät zum Marktplatz kommen.«
Das durchscheinende Blätterdach zog über Severin hinweg und kitzelte seine Augen mit huschenden Lichtflecken. Vor ihm beugte sich der Rücken seines Vaters gleichmäßig auf und ab. Zerknirscht lauschte Severin dem verlässlichen Schritt und nahm sich vor, nie wieder unterwegs nach rechts und links zu sehen, damit er bestimmt keine Zeit mehr vergeudete.
Schließlich erreichten sie die breite Straße, die von Nürnberg über Feucht nach Südosten führte, und reihten sich in den fröhlichen Zug von Bauern und Händlern, Pilgern und Spielleuten ein. Es wurden immer mehr, die dem jährlichen Ereignis entgegenströmten, und Severin vergaß seinen hehren Vorsatz. Bald winkte er den herausgeputzten Jungfern in ihren schmucken Wagen zu und fühlte sich auf seinem Gefährt nicht weniger vornehm als sie.
In Affalterbach angekommen, sprang er erregt vom Karren und blinzelte. Der staubige Platz zwischen den drei Höfen flirrte in der Morgensonne. Heilloses Durcheinander, wohin er sich auch wandte, halb errichtete Stände, Stapel aus Kisten und Körben, wahllos aufgestellte Gatter mit flatterndem Federvieh. Dazwischen manövrierten Fuhrwerke und rissen um, was andere gerade aufgebaut hatten. Verwünschungen und Flüche flogen über den Markt, übertönt von den Befehlen der Stadtknechte. Irgendwo spielte sich eine Musikantengruppe ein.
Nur das Kirchlein Unser Lieben Frau sah gelassen von der Anhöhe aus auf das Treiben herab.
Überall um den Weiler waren Nürnberger Soldaten postiert. Eine Menge schwerer Büchsenwagen hatten sie mitgebracht, die zur Wagenburg geschlossen als festes Bollwerk gegen den Feind dienen konnten. Severin entdeckte sogar einige Feldschlangen, Kanonen mit langen, schmalen Läufen. Die Männer sahen weniger wehrhaft aus als ihre Geschütze. Sie wirkten müde und schwitzten in den Rüstungen. Wahrscheinlich waren sie schon am Abend zuvor angekommen und hatten unbequem geschlafen. Manche trugen die Nürnberger Farben, Rot und Weiß, aber die meisten stammten aus der Fremde und stolzierten mit bunt zusammengeflickten Kleidern und wippenden Federhüten einher. Woher konnten sie nur wissen, wer Freund und Feind war, falls der Gegner seine Truppen ebenfalls aus verschiedenen Gegenden zusammengesammelt hatte?
Georg Geiss schob seine Mütze in den Nacken und wischte sich die Stirn. »Ein enormes Aufgebot für diesen kleinen Marktflecken, mehr noch als in den letzten Jahren. Das wird gepfefferte Abgaben kosten. Wenn die alle gefüttert werden müssen, möchte ich fast lieber auf ihren Schutz verzichten.« Er gab Severin eine leichte Kopfnuss. »Es wird schon nichts geschehen. Lauf und sieh dich um. Aber sei zurück, wenn die andern kommen.«
Severin fragte lieber nicht, wann das sein würde, sondern entschwand im Gedränge.
Es kam ihm absonderlich vor, inmitten der lärmenden Betriebsamkeit gemächlich einherzuschlendern, fast, als würde er sich rückwärts bewegen. In der allgemeinen Hast wurde eine Menge vergessen, fiel hinunter oder zerbrach. Statt ordnend einzugreifen, schimpften die Händler wie Eichelhäher, und alles dauerte länger, als nötig gewesen wäre.
Die Stände der Bauern sahen einander ziemlich ähnlich. Was der eine im Überfluss hatte, bot auch sein Nachbar lautstark feil, und es waren dieselben Güter, die Severins Familie zu verkaufen hoffte. Wesentlich interessanter fand er die Auslagen der Kaufleute: Messer gab es hier, irdene Töpfe und solche aus Kupfer – und einen Stand mit bunten Tuchen.
Die Kleider seiner Schwestern behielten immer einen bräunlichen Unterton, aber hier türmte sich ein wahrer Rausch von Farben vor ihm auf und schien alles ringsum in heiteren Glanz zu tauchen. Zarte Muster schimmerten darin, nicht aufgemalt, sondern eingewebt und je nachdem, wie das Licht darauf fiel, in verschiedenen Tönen aufblitzend. Severin streckte die Hand aus, um die Wunderwerke zu berühren.
Plötzlich erschien der Kopf eines Mädchens hinter dem Stapel. »Willst du etwas kaufen oder nicht?«, fragte sie, reckte sich auf die Zehenspitzen und blickte ihn mit strenger Miene an.
Sofort zuckte Severin zurück und schüttelte den Kopf. »Nein, ich … ich wollte sie nur ansehen.«
Das Mädchen lehnte sich über einen Ballen, dessen Blau mit dem Himmel wetteiferte, und tippte mit der Rückseite ihrer Finger in das Tuch, sodass eine kleine Mulde entstand.
»Waid«, sagte sie, »hab ich selbst gefärbt. Der Sud hat entsetzlich gestunken, aber es ist ganz gleichmäßig geworden. Und sieh dir erst den roten Stoff an. Das ist Scharlattin, fließendes Wollgewebe, gefärbt in Kermes. Mein Vater hütet das Rezept sogar vor mir. Ich weiß bloß, dass Schildläuse dafür gekocht werden müssen. So etwas hast du sicher noch nie gesehen.«
Sie legte den Kopf schräg, schloss die Augen und streichelte sich mit dem scharlachroten Tuch zärtlich über die Wange.
Benommen machte Severin einen Schritt auf sie zu.
»Nicht anfassen!«, kreischte sie. »Lass ja deine Dreckpfoten weg. Ich weiß wirklich nicht, warum mein Vater die schönen Stoffe mitgenommen hat. Die Nürnberger Pilger schweben ja bloß in Andacht vorbei und kaufen nichts. Landleute bleiben wenigstens stehen und glotzen, aber dann nehmen sie doch nur missratene Stücke, die grau oder braun geworden sind und kaum besser aussehen als deine Lumpen.«
Severin blickte an sich hinunter. Er trug die abgelegten Kleider seiner Geschwister, und wenn ein Kittel bei ihm ankam, war der Stoff längst mürbe. Um den Bauch herum schlotterten die Sachen meist, dafür spannten sie an den Schultern, und die Ärmel waren zu kurz. Farben konnte man beim besten Willen nicht erkennen. Falls seine Mutter tatsächlich einmal etwas Neues anschaffte, gab sie sich mit praktischen gedeckten Tönen zufrieden. Immerhin besaß Anna eine Bluse aus hellem Leinen, die nur an Feiertagen aus der Truhe geholt wurde – und zur Kirchweih natürlich. Verlegen schloss Severin die Hände hinterm Rücken, damit das Mädchen seine schwarzen Fingernägel nicht sah.
»Schon gut, ich wollte dich nicht kränken.« Das Mädchen schüttelte den Kopf, als sei sie auf sich selber ärgerlich. »Wenn du mir versprichst, nichts anzufassen, kannst du herüberkommen und mir beim Aufpassen helfen, solange Vater unterwegs ist. Er muss trinken und Geschäfte machen, das kann elend lange dauern.«
Bevor sie es sich anders überlegte, huschte Severin um den Stand herum und blieb ein paar Schritte vor ihr stehen. Sie ließ sich auf der entferntesten Kante einer Holzbank nieder. »Mein Name ist Kungund, du weißt, nach der Königin, die eine Tanzlinde auf den Burghof gepflanzt hat, damit die Stadt Nürnberg fröhlich gedeihen soll. Ich bringe also Glück.« Sie nickte ihm zu, damit er sich setzte.
Severin wagte einen knappen Seitenblick auf das Bild, das aus einer fremden Welt dicht vor ihm aufgestiegen war. Eine Bürgerstochter, etwas jünger als er selbst. Ihre feine Bluse faltete sich leicht um den schlanken Hals, verschwand züchtig unter einem rubinfarbenen Mieder und bauschte zwischen den Nestelbändern ihrer Ärmel wieder hervor. Über dem satten Rot des Kleides wirkte ihr Antlitz erlesen blass, fast durchscheinend. Das kupferne Haar, in ordentliche Flechten gelegt, schimmerte wie ein vornehmer Rahmen darum, und ihre fein gezeichneten Lippen wiederholten die Farbe in einer zurückhaltenden Nuance. Ihre ganze Erscheinung schien Severin unvergleichlich schmal und empfindlich. Dennoch wehte sie nicht davon.
Auf einmal kicherte sie nervös. »Willst du vielleicht irgendwann den Mund aufmachen? Stierst mich Ewigkeiten an und sagst keinen Ton. Da kann einem ja angst werden.«
Severin biss sich auf die Lippe und senkte den Blick. »Entschuldigung. «
Er hatte es verdorben! Wie lange mochte er sie unverschämt gemustert haben? Nicht einmal vorgestellt hatte er sich. Mit heißen Wangen holte er das Versäumnis nach. »Ich heiße Severin«, murmelte er.
Auch Kungund sah zu Boden, aber sie lächelte. Abwesend zog sie mit dem Finger die Maserung der Holzbank nach. »Du hast sonderbare Augen«, sagte sie, »wie die Pegnitz im Winter. «
Eine Männerstimme schreckte die beiden auf. »Kungund, komm schnell! Beeile dich!« Er packte sie am Arm und zog sie mit sich fort.
»Vater, was ist los? Und was wird aus dem Stand?«
Der Marktplatz hatte sich in einen verstörten Ameisenhaufen verwandelt. Alle stoben durcheinander, rafften ihr Habe zusammen, rannten und stolperten. Severin sah sich verwundert um, aber die Aufregung erreichte ihn nicht.
Das rote Tuch vor ihm dagegen glühte.
Er wischte sich sorgfältig die Hand am Kittel ab und streichelte über die zerwühlte Stelle im weichen Stoff, die Kungunds Wange berührt hatte.
Plötzlich wurde er umgestoßen. Ein Stadtknecht in voller Rüstung hatte ihn überrannt. Schwarz stand der Kopf des Mannes vor dem hellen Himmel, das Gesicht vom Helm beschattet. Severin konnte seine Miene nicht erkennen, nur ein paar blonde Strähnen, die auf dem Metall klebten.
»Was stehst du hier im Weg, Junge? Verschwinde!« Unruhig wandte sich der Kämpfer nach Süden. In der Ferne dröhnten Kanonenschüsse. »Sie kommen!«
Ringsum warfen die Nürnberger Soldaten Stände und Wagen um, bauten daraus Schutzwälle und verschanzten sich dahinter. Andere brüllten Befehle und versuchten ihre Leute zu formieren.
»Wer kommt?«, fragte Severin und rappelte sich auf. Der Stadtknecht starrte auf ihn hinunter und ließ plötzlich sein Visier hinunterklappen. Seine Stimme klang hohl in dem blanken Helm. »Die Markgräflichen! Erbprinz Kasimir! Der hat keine Geduld, die Verhandlungen seines Vaters abzuwarten.«
Eine weitere Salve war zu vernehmen, und der Mann wirbelte herum. »Das kam von Nordwesten, von Nürnberg!«
Fast gleichzeitig brüllte am anderen Ende des Marktes der Kriegshauptmann zum Sammeln. »Eine Finte!«, rief er über die Soldaten hinweg. »Kasimir zieht direkt gegen Nürnberg, Affalterbach interessiert ihn nicht. Beeilt euch, wir müssen ihn aufhalten. « Sein Ross tobte über den Platz, über Tische und Stände, direkt auf den Jungen und den Stadtknecht zu.
Er hätte sie einfach umgeritten.
Im letzten Moment riss Severin die Arme hoch. Das Pferd schnaubte nervös und donnerte mit den Hufen. Schaumiger Schweiß lief unter der wattierten Schutzdecke herab. Der Hauptmann hatte Mühe, sich oben zu halten.
»Bist du toll geworden?« Sein fleischiges Gesicht mit der eingedellten Nase verzerrte sich vor Wut, und über den Brauen schoben sich drohende Wülste zusammen. Er glotzte böse auf Severin herab, als würde er den unverschämten Burschen am liebsten absichtlich über den Haufen reiten.
Im nahen Wald bebten Hufschläge. Es mussten Hunderte von Rössern sein, die in raschem Tempo Richtung Nürnberg vorrückten. Noch eben hatte Severin dort friedlich auf einem Haufen Wolle gelegen, das kühle Blätterdach über sich vorbeiziehen lassen und auf die Schritte seines Vaters gelauscht.
»Vater!«, schrie er, drängte sich am Pferd des Hauptmanns vorbei und rannte zurück.
Georg Geiss war fort.
Severin fand weder ihn noch den Handkarren.
Weit entfernt hallten Schüsse und Schlachtgeschrei. Himmel, seine Familie musste durch den Wald, sie würden geradewegs in ein Gemetzel hineinmarschieren. Sicher war sein Vater längst unterwegs, um sie aufzuhalten.
Und wenn er es nicht schaffte?
Nur keine Zeit verlieren. Severin stürzte los, kämpfte sich durch das blitzende Meer aus Lanzen und Halbarden, huschte unter bewehrten Armen hindurch, rempelte und stieß sich vorwärts. Das riesige Heer um ihn herum war in Bewegung geraten, Wagen wurden angeschirrt und Ochsen vor die Feldschlangen gespannt. Das Fußvolk schob sich bereits übers Feld zur Straße nach Feucht. Hakenschlagend hetzte Severin zwischen den Streitrössern hin und her, aber er konnte dem Gewühl nicht entkommen.
Die Kirche! Wenn er auf den Hügel gelangen könnte, hätte er einen besseren Überblick. Von dort würde er eine Möglichkeit finden, die alles niederwalzende Truppe zu umgehen.
Mehr krabbelnd als laufend hastete er die Anhöhe hinauf.
Plötzlich sah er sich einem Kerl gegenüber, der sein struppiges Kinn vorreckte und unendlich langsam ein Messer gegen ihn hob. Der Mann trug die Nürnberger Farben, warum hielt er Severin für einen Feind? Seine Klinge schimmerte wie marmoriert in der Sonne.
Severin ballte die Fäuste, er wünschte, er besäße ebenfalls ein Messer oder wenigstens einen Stock. Dieser Kampf würde nicht so glimpflich ausgehen wie die Balgereien unter Brüdern.
Die Haltung seines Gegners ließ nicht vermuten, dass irgendjemand sich gegen seinen Willen an ihm vorbeidrücken konnte, ohne Federn zu lassen. Fest und breitbeinig stand er da.
Breitbeinig – für ein Kind eine Öffnung so weit wie ein Scheunentor, für Severin immerhin eine Möglichkeit, den Mann zu überraschen.
Er hob den Arm, als ob er ausholen wollte, doch dann duckte er sich plötzlich, spannte seinen Körper und hechtete unter dem Mann hindurch. Er stieß sich schmerzhaft die Schulter, und der Stadtknecht geriet ins Straucheln. Ohne sich umzusehen, kugelte Severin auf die Beine und hastete zur Kirche hinauf.
Dumpf fiel die Tür hinter ihm ins Schloss.
Der Kapellraum summte von Gebeten der Pilger. Severins Atem ging stoßweise. Einen Moment wollte er abwarten, bis sein Verfolger ein anderes Opfer gefunden hatte. Dann konnte er hinausschlüpfen und nach einem Umweg zum Wald Ausschau halten. Lieber Gott, liebe Maria, er musste seine Mutter rechtzeitig erreichen, seine Schwestern, seine Brüder …
Draußen auf der Schwelle waren feste Schritte zu hören, dieser Mann kam gewiss nicht, um zu beten. Als die Tür aufgerissen wurde, drückte Severin sich flach an die Wand und schob sich weiter ins Dunkel. Seine Finger berührten einen Griff. Vorsichtig öffnete er das Gelass und verschwand darin. Sein Fuß stieß gegen eine steinerne Stufe. Suchend streckte er die Arme vor und fand ein Geländerseil, welches mit mehreren Ringen an der Wand befestigt war. Die kurze Treppe endete auf einem Absatz. Von hier führte eine rohe Holzstiege weiter hinauf. Sprosse für Sprosse zog Severin sich vorwärts, bis er schwer atmend auf einer Plattform aus Brettern liegen blieb.
Die Wände dämpften das Spektakel auf dem Markt und vermischten es mit dem gleichförmigen Singsang der jammernden Menschen. Er konnte nicht unterscheiden, ob sie dort draußen die Trommeln schlugen oder Gewehre abfeuerten. Warum hatte die Geissin und seine sechs Geschwister nur am Morgen so sehr getrödelt? Hoffentlich befanden sie sich nicht gerade jetzt mitten im Wald.
»Bitte, geht langsam«, beschwor er sie, »beeilt euch nicht, ich komme, sobald ich hier entwischen kann.«
Sein Herz pochte bis in den Hals, bis in den Kopf. Nicht ein einziges Gebet wollte ihm einfallen.
Allmählich drang ein weiteres Geräusch in sein Bewusstsein. Es war ein rhythmisches, metallisches Klacken.
Das strenge Regelmaß hallte so unerbittlich in seinen Ohren, dass sein aufgewühlter Puls sich danach richten musste. Schemenhaft erkannte er in der Dunkelheit, dass sich über ihm etwas bewegte. Es war eine kurze Stange, die wie eine Wippe oder Waage an beiden Enden mit runden Gegenständen behängt war. Aber sie schwang nicht senkrecht über eine Achse, sondern vor und zurück. Die Achse selbst war mit einem Zylinder verbunden, um welchen sich ein Seil wickelte, dessen Enden in einem tiefen Schacht verschwanden. Mehrere Spulen, Reifen und Räder drehten sich darum, manche flach, andere sahen wie Kronen mit schrägen Zacken aus. Ihre Zähne griffen ineinander, sodass sie sich gegenseitig in Gang hielten. Nur das größte Rad stand still. Vorsichtig legte Severin seine Hand darauf. Es war aus Eisen und fühlte sich kalt an. Was seine Augen nicht wahrnehmen konnten, spürten jetzt seine Finger. Auch dieses bewegte sich – stetig und unendlich langsam.
Das musste die Uhr sein, das Herz der Kapelle.
Eine gleichmütige Ruhe breitete sich in ihm aus, und sein Arm folgte dem Weg des Rades. Jede Hast fiel von ihm ab, er wurde eins mit dem Räderwerk und ließ sich fallen in Gottes Zeit, die für alle Sterne, alle Welt und alle Menschen gleich verging.
Unvermittelt rasselte es in den Tiefen des eisernen Wesens. Die Zahnräder knackten und ruckten, und plötzlich wirbelten einzelne so schnell um sich selbst, dass Severin den Wind fühlen konnte. Er fuhr zurück. Etwas Schweres schlug ihm gegen die Schläfe und polterte dumpf auf die Bretter.
Das Klacken erstarb.
Totenstille.
Aus dem Kapellraum war kein Laut mehr zu hören.
Auch von draußen nichts. Kein Kampflaut, kein Geschrei, keine Schüsse.
Als wäre die Zeit gestorben.
Was hatte er getan? Severin fiel auf die Knie und tastete fahrig die Plattform ab. Seine Finger fanden einen eisernen Gegenstand. Er musste an der Stange gehangen haben. Am anderen Ende schaukelte nach wie vor ein ebensolches Ding. Er erhob sich und fummelte die kleine Öse über die Stange. Zitternd trat er zurück.
Nichts geschah. Erst als er der Stange einen leichten Stoß gab, schwang sie ein paar Mal, klackte unregelmäßig und stand wieder still.
Aus der Finsternis tauchte das Bild seiner Mutter auf. Auch sie bewegte sich nicht mehr.
Er würde zu spät kommen.
Severin taumelte rückwärts. Sein Schritt ging ins Leere, und er ruderte mit den Armen. Im Fallen erwischte er die Leiter, rutschte über die letzten Sprossen und stolperte die Steinstufen hinunter. Dann stieß er die Tür zur Kapelle auf und rannte hinaus.
Schräges Abendlicht fiel über den menschenleeren Markt, über das zertrampelte Feld und den dunstigen Forst dahinter. Severin ahnte, was er auf dem Weg vorfinden würde.
Zwischen den lichten Bäumen war der Boden bedeckt mit zerschlagenen Leibern. Die Sonne beleuchtete zitternde Flecken voller blutiger Einzelheiten. Severin glaubte, nicht mehr atmen zu können. »Bitte nicht«, flüsterte er immer wieder, »bitte nicht.« Er stieg über einen abgeknickten Arm, einen zerrissenen Umhang, eine dunkel glänzende Lache, ein zerschmettertes Gesicht …
Der Vater hatte es nicht einmal bis zum nächsten Gehöft geschafft. Er lag mit dem Kopf voran bäuchlings im Graben. Erst gestern war die Mutter damit fertig geworden, seinen guten Kittel zu flicken. Sonderbar steif hob sich die gleichmäßig gestichelte Naht am Saum des grauen Wolltuches ab. Welch langwierige Arbeit für einen einzigen Tag. Severin scheute sich, den Toten zu berühren, der außer dieser Naht nichts mehr mit seinem Vater gemein hatte.
Auf dem Waldweg war die restliche Familie ins Gefecht geraten. Ihr Wagen lag schräg, der Körper seiner Mutter eingeklemmt darunter. Den Ochsen konnte er nicht entdecken. In Matthes’ Bauch klaffte eine Wunde, und seine Augen stierten weit aufgerissen in den Himmel. Seine Brüder lagen dicht neben ihm, der eine mit gebrochenem Genick, der zweite war wohl verblutet, als sein Arm getroffen wurde. Die Mädchen mussten versucht haben, ins Gehölz zu fliehen. Weit waren sie nicht gekommen.
Severin hörte ein Rascheln unter dem Wagen. »Mutter …«
Ihr Gesicht war halb in die Walderde gedrückt. Aber sie lebte, ihre Augen flackerten leicht. Mit langem Arm versuchte Severin, ihre Wange zu erreichen.
»Ich hole dich raus, Mutter, du wirst sehen, ich hole dich raus.« Doch so sehr er sich auch gegen die Räder stemmte und rüttelte, das Gefährt rührte sich nicht. Wenn er Seile hätte, oder wenigstens einen großen Ast, den er als Hebel benutzen konnte.
»Severin.«
Sofort kroch er unter den Wagen, soweit er konnte. »Ja, Mutter?«
»Lass mich sterben«, flüsterte sie. »Meine Kinder sind tot, und ich möchte bei ihnen sein, wenn sie mich brauchen.«
Aber er lebte, und er brauchte sie auch.
Ihre Stimme war kaum noch zu hören. »Geh nach Nürnberg. Such deinen Vater. Er war hier, ich habe ihn gesehen.«
Nein, Vater konnte nicht hier gewesen sein, seine Leiche lag ein paar Ruten weiter im Graben.
Die Mutter schloss ihre Augen, und ihre Züge entspannten sich. Severin barg sein Gesicht in den trockenen Blättern.
Vielleicht hatte sie den Vater tatsächlich gesehen. Vielleicht war sein Geist gekommen, um die Familie sicher in die andere Welt zu geleiten. Eine Welt, die ewig war, in der Zeit keine Rolle spielte, und in der niemand zu spät kommen konnte. Wie gerne wäre Severin mit ihr in diese Welt gegangen.
II. KAPITEL
Cui bono? Wem zum Nutzen? Du hast auf der falschen Seite gestanden, mein Freund«, knurrte Herman Henlein sein stumpfes Spiegelbild an, während er zum vierten Mal versuchte, sich die Binde glatt um den Kopf zu wickeln. Auf dem Tuch bildete sich sofort ein dunkler Fleck. Wahrscheinlich würde eine Narbe auf seiner Schläfe zurückbleiben. Schade, er hatte seine hohen Schläfen gemocht.
Ansonsten war es gottlob der gewohnt kantige Kerl, der ihm aus dem Glas entgegenblickte. Etwas bleicher als sonst vielleicht und das helle Haar klebte von der Nacht seitlich am Schädel. Alles andere sah aus wie immer. Es gab wirklich nicht die geringste Ähnlichkeit mit diesem weichgesichtigen Bauernbengel aus Affalterbach, über den er gestern gestolpert war.
Dennoch hatte der Bursche ihn an sich selbst erinnert, als liefe dort ein zweiter Herman in unschuldiger Gestalt herum. Bis in den Traum hatte ihn das Spukgesicht verfolgt und dumpfe Erinnerungen heraufbeschworen. Er wischte den Gedanken fort und rieb sich das struppige Kinn.
In seiner Kammer war es stickig. Wollte der gestrige Tag etwa ein zweites Mal beginnen? Seine Messer lagen sauber abgewischt nebeneinander auf der Truhe. Das hatte er noch am Abend erledigt, bevor er auf seine Schlafstatt gefallen und zwischen zerwühlten Decken, Brotresten und einzelnen Büchern eingedämmert war. Mit der Rüstung hatte er sich weniger Mühe gegeben, die Einzelteile abgeworfen und auf dem Boden verteilt liegen gelassen. Das Zeug gehörte ihm schließlich nicht, und in der Mittagshitze gestern war das Metall so heiß geworden, dass er geglaubt hatte, darin zu verglühen. Der Viertelmeister hatte ihm den Harnisch geradezu aufgedrängt, weil Herman irgendwann Sieger in einem Gesellenstechen geworden war. Doch die wirkliche Schlacht hatte nichts mit einem Turnier gemeinsam.
Herman hasste es zu verlieren.
Unter Pirckheimer würde er sich jedenfalls nicht wieder aufstellen lassen. Zur Not konnte er krank werden oder schleunigst auf Reisen gehen. Patrizier hin oder her, Pirckheimer wurde vom Pech verfolgt, taugte nicht als Kaufmann, wie der Bankrott der Familie bewies, und taugte als Hauptmann noch weniger.
Reden war das Einzige, was dieser Ehrbare wirklich konnte. Worte benutzte er wie Waffen, zusammengeklaubt aus der riesigen Bibliothek seines Vaters. Damit steuerte er sein Gegenüber in jede beliebige Richtung. Belustigt erinnerte sich Herman, dass er selbst einmal der Faszination der gewandten Zunge erlegen war. Er hatte sich dem Edlen gegenüber überrumpelt und unerträglich hilflos gefühlt. Damals war ihm nichts anderes eingefallen, als den hohen Herrn mit einem Hieb auf die Nase zum Schweigen zu bringen. Bis heute konnte man die Folgen dieses Schlages erkennen.
Herman hatte daraufhin begonnen, wahllos alles zu lesen, was ihm unter die Finger geriet, um sich die Waffe des Wortes verfügbar zu machen. Inzwischen war ihm das Lesen längst keine mühevolle Arbeit mehr, sondern eröffnete ihm eine Vielfalt von geheimnisvollen Gedankengebäuden. Solange er über einer Schrift saß, war er geneigt, dem Schreiberling alles zu glauben, bis der nächste Text ihn in eine gegenteilige Welt entführte. Mittlerweile verlor er sich in der Schönheit eines Satzes genauso gerne wie in einer vollendet vorgetragenen Melodie oder dem makellosen Glanz eines polierten Messers.
Die meisten Handwerker betrachteten bedrucktes Papier eher argwöhnisch, wenn es nicht gerade aus der Bibel stammte oder mit gewinnbringenden Zahlen bedeckt war. Sie wollten ungestört arbeiten oder eben feiern, nicht irgendeinen Lebenssinn ergründen. Daher hatte Herman sich abgewöhnt, über seine Studien zu sprechen und ließ nur hier und da einen auswendig gelernten Satz fallen, der selten seine Wirkung verfehlte.