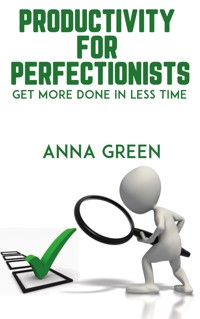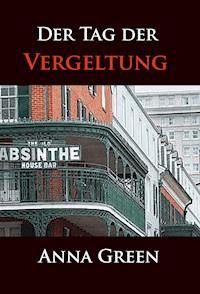
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die USA während des Sezessionskriegs. Der wohlhabende Geschäftsmann White will in die Politik. Doch irgendetwas stimmt nicht mit dem Mann. Weshalb hält er seine Familie knapp, obwohl er Geld hat wie Heu? Dann, eines Tages, erhält er einen Brief - und verschwindet. Und er ist nicht der einzige. Die Autorin war Vorbild von Krimi-Legenden wie Agatha Christie und anderen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AnnaGreen
Der Tag der Vergeltung
idb
ISBN 9783961502523
Erstes Buch. Leben oder Tod.
Erstes Kapitel. Verhängnisvolle Botschaft
Am Abend des 13. Juli 1863 verließen zwei Männer, der eine in Washington, der andere in Buffalo, ihren Wohnort, und zwar unter merkwürdig ähnlichen Umständen.
Jedem von ihnen hatte die Morgenpost einen Brief gebracht, den sie sogleich vernichteten. Beide befanden sich den ganzen Tag über in einer stets wechselnden Unruhe; ja, als sie von den Ihrigen Abschied nahmen, erreichte ihre innere Erregung einen solchen Grad, daß die bloße Tatsache ihrer raschen Berufung nach New-York in geschäftlichen Angelegenheiten dafür keine genügende Erklärung bot. Auch daß dort gerade ein gefährlicher Aufstand tobte, Leben und Sicherheit jedes friedlichen Bürgers bedrohend, konnte unmöglich der Grund ihrer heftigen Gemütsbewegung sein.
Der Mann aus Washington, Samuel White, ein früherer Makler, war jetzt angehender Staatsmann. Er galt für sehr wohlhabend, trieb aber nicht den geringsten Luxus, sondern lebte ganz still und zurückgezogen, was seiner offenbar ehrgeizigen und prunkliebenden Natur keinenfalls zusagen konnte. Freilich war es in der damals sehr unruhigen Zeit des Bürgerkriegs überhaupt nicht ratsam, seinen Reichtum auffällig zur Schau zu tragen, allein die Einfachheit von Whites Lebensweise war so groß, daß die bedrängte Lage des Vaterlandes kaum die einzige Ursache der Beschränkung sein konnte, die er sich auferlegte; die Leute meinten, es müsse wohl noch ein geheimer und zwingender Grund dahinter stecken.
Seine Frau war viel leidend, aber sie liebte die Geselligkeit; enge, dürftig ausgestattete Wohnräume waren durchaus nicht nach ihrem Geschmack.
Auch bei der Erziehung und Ausbildung des einzigen Kindes konnte eine übertriebene Sparsamkeit nicht erwünscht sein. White war kein Geizhals und doch häufte er sein Geld auf der Bank an, versagte seinen Angehörigen Bequemlichkeit und Genuß und schloß sich selbst von der segensreichen öffentlichen Wirksamkeit aus, für welche natürliche Anlage und Neigung ihn bestimmt zu haben schienen. Weshalb tat er das?
Die Frage wurde oft erörtert, blieb aber unbeantwortet. Auch seine Gattin stellte sie eines Tages und erschrak heftig über den Blick voll Seelenqual, den er ihr zuwarf. Mit einem liebevollen Kuß machte sie rasch dem peinlichen Augenblick ein Ende, zum Zeichen ihres vollen, unbedingten Vertrauens. Aber sie vergaß dies Erlebnis nicht und als sie am 12. Juli wieder jenen Ausdruck in den Mienen ihres Mannes sah, und die innere Pein den ganzen Tag nicht von ihm weichen wollte, ergriff sie das unheimliche Vorgefühl eines großen drohenden Unglückes. Oft schon hatte sie die Möglichkeit ins Auge gefaßt, daß ihr Mann tätigen Anteil am Kriege nehmen, wohl gar selbst ein Regiment ins Feld führen könne und der Gedanke an Trennung und Todesgefahr machte ihr liebendes Herz erbeben. Aber eine ganz andere Angst erfüllte sie jetzt; ein namenloses Grauen vor etwas Unbekanntem in der Seele ihres Mannes, die bisher wie ein offenes Buch vor ihr gelegen hatte. Was sie eigentlich fürchtete, wußte sie nicht, aber es quälte sie so sehr, daß sie unwillkürlich mit bangem fragendem Herzen die ganze Vergangenheit vor ihrem Geistesauge vorüberziehen ließ.
Sie kannte Samuel White von Jugend an. Im selben Landstädtchen aufgewachsen, waren sie Spielgefährten gewesen, lange bevor sie ein Liebespaar wurden. Als er fortzog, um sein Glück im Westen zu suchen, baute sie daheim die herrlichsten Zukunftspläne und träumte von ihrem künftigen seligen Eheglück. Bei seiner Rückkehr – (o wie lebendig brachte ihr der Gedanke daran die alte Zeit wieder ins Gedächtnis!) fragte sie nicht erst danach, ob er Geld und Gut erworben; sie bewillkommnete den Wanderer mit strahlendem Blick und warmem Liebesgruß. Auch er hatte ihr sein Herz bewahrt, das fühlte sie wohl, und doch war es ein seltsames Wiedersehen; denn er schien die Beweise ihrer treuen Liebe nur mit Widerstreben hinzunehmen. Dies schüchterne Wesen, wie sie es in ihrer Unerfahrenheit nannte, war ihr damals aufgefallen, nun sie aber mit gereifterem Urteil daran zurückdachte, erkannte sie wohl, daß er eine förmliche Scheu empfunden hatte, sich zum Eintritt in den Ehestand feierlich zu verpflichten. Trotzdem hatte er sie geheiratet und war ihr ein treuer, liebevoller Gatte gewesen. Kein eifersüchtiger Gedanke war je in ihr aufgestiegen, obgleich seine äußere Erscheinung ganz danach beschaffen war, die Frauenwelt unwiderstehlich anzuziehen und zu fesseln. Nur eine schwere Enttäuschung hatten ihr die Jahre gebracht: die Hoffnung, daß ihr Mann sich in der Öffentlichkeit hervortun und nach einer für seine Gaben angemessenen Stellung streben würde, hatte sich nicht erfüllt. Wie stolz würde sie auf seine Erfolge gewesen sein! Es hätte ihr Trost und Zerstreuung gebracht in ihrem bei zunehmender Kränklichkeit häufig leidenden Zustand, ihn im Staatsleben zu Ehre und Ansehen emporsteigen zu sehen. Daß er würdig gewesen wäre, einen hohen Platz unter den Führern des Volks einzunehmen, galt ihr für ausgemacht. Er besaß einen weiten Gesichtskreis, die Arbeit war seine Lust, er schien zum Herrschen geboren. Und doch blieb er in seiner Dunkelheit und wirkte nur im Geheimen, gerade als schäme er sich seines Thuns – ein Verfahren das zu seinem ganzen Charakter in völligem Widerspruch stand. alles dieses erwog die Gattin in ihrem Sinn an jenem Tage voll innerer Kämpfe, aber sie fand keinen Aufschluß über das Geheimnis, das auf seiner Seele lastete und auch ihren Frieden zu zerstören drohte.
Von den elf Jahren ihrer Ehe hatten sie fünf in New-York zugebracht, wo White das Maklergeschäft betrieb, dann waren sie nach Washington übergesiedelt und er hatte seine politische Laufbahn begonnen, aber ganz im Verborgenen und nur wie verstohlen, so daß sein Einfluß sich zwar bemerkbar machte, sein Name aber selten genannt wurde und seine Person nie in der Öffentlichkeit erschien. Seit einiger Zeit war er noch seltener ausgegangen als sonst und dann und wann sprach eine geheime Angst aus seinem Blick, die bei der Ankunft des Briefes am 13. Juli ihren Höhepunkt zu erreichen schien. Sie hätte bloß die Hand ausstrecken dürfen nach jenem Zettel, um Aufklärung über alle dunkeln Rätsel zu erlangen, die sie nicht lösen konnte. Einen Augenblick zögerte sie, aber schon war es zu spät: er riß den Brief in kleine Stücke und starrte wie hilflos ins Leere. Als sein glanzloses Auge ihrem fragenden Blick begegnete, streckte er die Hand aus, als wolle er sie anflehen zu schweigen, und schwankte aus dem Zimmer. Etwa eine Stunde später kehrte er gefaßter zurück und teilte ihr mit, er habe einen Brief erhalten, der ihn nötige, unverzüglich nach New-York abzureisen; zuvor wünsche er jedoch seinen Sohn Stanhope zu sehen, sie möge daher rasch nach ihm schicken. Diese Bitte erhöhte noch ihre Bestürzung, denn Stanhope war auf der Schule in dem mehrere Meilen entfernten Georgetown. Hielt ihr Mann vielleicht die Reise nach New-York, wo der Pöbelaufstand tobte, für gefährlich und wollte Abschied von dem Knaben nehmen? Eine derartige Furcht war doch bei der sonstigen Entschlossenheit und Kraft seines Charakters kaum denkbar.
Im Lauf des Tages sah sie ihn nur wenig, da er meist am Schreibtisch beschäftigt war; wie sehr er sich aber auch zwang, in ihrer Gegenwart unbefangen zu erscheinen, so war doch eine angstvolle Spannung, ein tiefer Kummer in seinen Mienen unverkennbar. Endlich ertrug sie es nicht länger.
»Samuel«, rief sie in schmerzlichem Flehen und schlang die Arme um seinen Hals, »was quält dich so? Was bedeutet diese plötzliche Reise? Sind es Staatsgeschäfte, die dich fortrufen, oder ist es eine persönliche Angelegenheit, die du mir nicht verschweigen solltest?«
Er zögerte einen Augenblick mit der Antwort, dann sagte er in einem Tone, der ihr jede weitere Frage abschnitt:
»Mich ruft ein Privatgeschäft nach New-York. Wäre es gut für dich, zu wissen, welcher Art es ist, so würde ich dir mein Vertrauen nicht vorenthalten.«
Die Worte klangen kränkend, doch schloß er sie dabei mit leidenschaftlicher Innigkeit in die Arme. »Vergiß nicht«, fügte er eindringlich hinzu »daß ich dich stets lieb gehabt habe!« Ehe sie sich noch von ihrer Überraschung erholen konnte, hatte er das Zimmer verlassen.
»Ich will warten bis Stanhope kommt«, dachte sie bei sich, »er wird schon ausfindig machen, was seinen Vater quält und warum er gerade jetzt die Reise nach New-York unternimmt.«
Aber Stanhopes Ankunft machte die Sache nur noch rätselhafter. Statt den Knaben zu sich kommen zu lassen und ihn zu begrüßen, schien Herr White sich förmlich zu fürchten, sein Kind zu sehen. Erst als es fast Zeit zum Zuge war, kam er aus seiner Studierstube, setzte sich und nahm den Knaben auf sein Knie. Er versuchte zu reden, aber die Stimme versagte ihm; einen Augenblick beugte er sich über das Haupt des Kindes, dann schob er das Kind beiseite, sprang auf und griff nach seinem Hut.
»Was ich zu tun habe, wird morgen Abend geschehen sein«, sagte er zu der Mutter, welche die Hand nach ihm ausstreckte, als wolle sie ihn zurückhalten. Seine Stimme hatte einen unnatürlichen fremdartigen Klang. »Übermorgen sollst du von mir hören und den Tag darauf werde ich wahrscheinlich wieder daheim sein.«
Das war er auch, aber nicht auf die Weise, wie er es offenbar erwartete.
Lemuel Philipps aus Buffalo, der an dem nämlichen Tage durch einen Brief nach New-York berufen wurde, war ein Mann ganz anderer Art als Herr White aus Washington. Von Gestalt schlank und mager mit fein geschnittenen Gesichtszügen, fesselte er den Blick des Beobachters unwillkürlich, allein, ob es gute oder böse Mächte waren, die diese Anziehungskraft ausübten, ließ sich schwer entscheiden. Er stand im vierzigsten Lebensjahr; wer aber seinen gebückten Gang auf der Straße sah, hätte ihn leicht für zwanzig Jahre älter halten können. Sein lebhaftes Auge, sein ausdrucksvoller Mund und sein rascher Schritt zeigten jedoch, daß er noch seine volle Manneskraft besaß. Er trat stets leise auf, – wie jemand der sich verfolgt glaubt und zu entkommen sucht, – sagte man; daß er sich stets von Zeit zu Zeit verstohlen umblickte, bestärkte die Leute noch in diesem Glauben, ja, wäre er nicht ein angesehener Bürger und Ehrenmann gewesen, so hätte ihm diese Eigenheit allerlei Unannehmlichkeiten zuziehen können. So aber galt er nur für einen Sonderling unter seinesgleichen und gelegentlich äffte ihm wohl ein Bube auf der Gasse hinter dem Rücken seine Gangart nach.
Er lebte in einem unscheinbaren Hause im Westen der Stadt als Privatgelehrter. Was für Studien er betrieb, wußten wenige und niemand kümmerte sich darum. Es konnte ihm nicht an Mitteln fehlen, denn er legte sich keinerlei Entbehrungen auf und steuerte im Geheimen zu vielen wohltätigen Anstalten bei. Am öffentlichen Leben nahm er nicht teil; bei Volksversammlungen oder an Orten, wo die Leute in größerer Anzahl zu verkehren pflegten, war er ebensowenig zu sehen, wie Herr White aus Washington. Er blieb meist in seinen vier Wänden und selbst dort fiel es etwaigen Besuchern auf, daß seine ruhelosen Blicke bald nach rechts bald nach links über seine Schulter schweiften, als fürchte er, einen unwillkommenen Eindringling auf der Schwelle erscheinen zu sehen. Diese fortwährende Wachsamkeit war ihm ordentlich zur zweiten Natur geworden; alle Hausgenossen kannten seine Angewohnheit und nahmen Rücksicht darauf; sogar sein kleines niedliches Töchterchen kam nie ins Zimmer gelaufen, ohne zuvor, wie zu seiner Beruhigung, mit hellem Stimmchen zu rufen: »Vater, ich bin es.«
Seit drei Jahren lebte er in Buffalo. Zuerst war er allein, später ließ er irgend woher sein Kind nachkommen, das die Wärterin noch auf dem Arme trug. Er sagte, daß er seit fünf Monaten Witwer sei, von seiner verstorbenen Frau aber und seinem früheren Wohnort sprach er nie. Trotzdem genoß er das Vertrauen seiner Mitbürger; die wahrhaft rührende Liebe, die er für sein Töchterchen an den Tag legte, und sein stilles Gelehrtenleben sprachen zu seinen Gunsten.
Bei etwas genauerer Beobachtung hätte man jedoch leicht an ihm irre werden können. Einem Manne, der bei jedem Laut erschrickt und sich fürchtet, um eine Straßenecke zu biegen, muß irgend eine geheime Angst auf der Seele lasten. Wächst nun aber diese Angst im Laufe eines einzigen Tages zu förmlichem Entsetzen, so läßt sich wohl annehmen, daß seine Vergangenheit ein Geheimnis birgt, vor dessen Enthüllung ihm graut.
Am 12. Juli 1863 hatte seine Furcht und Bangigkeit den höchsten Grad erreicht. Ruhelos verbrachte er den Tag; zur Schlafenszeit begab er sich, statt das Lager aufzusuchen, in sein Studierzimmer, wo er die ganze Nacht über seine Papiere durchsah und ordnete. Als der Morgen anbrach und der Postbote kam, war er vor nervöser Erregung kaum imstande, der treuen Dienerin, die seinen Haushalt besorgte, den Brief aus der Hand zu nehmen, den sie ihm brachte. Mit bebenden Fingern öffnete er das Schreiben, las die eine Zeile, die es enthielt, und ein unterdrückter Schmerzensschrei entrang sich seiner Brust. Als eine Stunde später sein Töchterchen ins Frühstückszimmer gehüpft kam und den Vater so traurig sah, kletterte die Kleine ihm auf das Knie, schlang die Ärmchen um seinen Hals und überhäufte ihn mit Küssen.
Als könne er ihre Liebkosungen nicht ertragen, setzte er sie schnell auf den Boden und eilte nach der Küche, wo er die brave Abigail Simmons bei der Arbeit traf. »Sie haben mir versprochen, das Kind immer liebevoll zu behandeln«, rief er die Frau bei der Schulter fassend, »vergessen Sie das nicht.«
Abigail sah ihn verwundert an: »Wie sollte ich denn anders als freundlich sein gegen die süße Kleine?«
»Aber wenn sie allein in der Welt zurückbliebe, wenn mir etwas zustoßen sollte –«
»Was ist denn geschehen – Sie sind doch nicht krank, Herr?«
»Nein, aber ich reise nach New-York«, stammelte er. »Es ist meine erste Trennung von dem Kinde und mir bangt vor Unglück. Kann ich mich darauf verlassen, daß Sie sich ihrer mit mütterlicher Sorge annehmen werden, falls ich nicht zurückkehre?«
»Ich werde sie behüten wie meinen Augapfel«, erwiderte die gute Frau, »was habe ich denn sonst Liebes auf der Welt?«
Er atmete erleichtert auf.
»Sie fürchten sich wohl vor dem Pöbelaufstand«, fuhr Abigail fort, ihn mit scharfen Blicken musternd, »das kann ich mir denken, der würde mir auch bange machen.«
Einen Augenblick sah er sie starr an, als verstehe er ihre Worte nicht, dann ging er rasch in das Zimmer zurück, wo die Kleine schon am Frühstückstisch saß. Sie strahlte vor Gesundheit und kindlichem Frohsinn, schüttelte ihr Köpfchen, daß die goldenen Locken flogen und ihr harmloses Geplauder wollte kein Ende nehmen. Der Anblick des süßen Gesichtchens, das silberhelle Lachen, das er so liebte, schien seine Qual noch zu vermehren. Das Kind schwatzte fröhlich weiter, ohne zu merken, welche fahle Blässe jetzt in des Vaters Antlitz trat, als ob ein furchtbarer Entschluß plötzlich in ihm zur Reife gediehen sei. Er schritt auf seinen Schreibtisch zu, öffnete eine der kleinen Seitenschiebladen und nahm ein Fläschchen heraus.
»Komm doch zum Frühstück, Papa«, rief das Kind, »ich mag nicht so ganz allein hier sitzen.« Beim Ton ihrer Stimme zuckte er unwillkürlich zusammen; dann trat er hinter ihren Stuhl, er vermochte ihr nicht in die unschuldigen braunen Augen zu sehen; seine Lippen waren aschbleich, große Schweißtropfen standen ihm auf der Stirn.
»Gib mir deine Milchtasse«, flüsterte er mit heiserer Stimme.
Sie sah verwundert zu ihm auf, während er die Tasse ergriff und das Fläschchen darüber hielt. Plötzlich stieß er einen gellenden Schrei aus und schleuderte es weit fort in die entfernteste Zimmerecke.
»Ich kann nicht«, stöhnte er und sank laut schluchzend auf einen Stuhl, ohne auch nur den Versuch zu machen seiner Bewegung Herr zu werden.
Die Kleine glitt erschreckt von ihrem Sitz herunter, sah den Vater einen Augenblick mit bleicher Miene und großen verwunderten Augen an und lief dann zu Abigail hinaus.
Sie ahnte wohl nicht, wie nahe der Todesengel soeben an ihr vorübergegangen war, denn kaum fünf Minuten später konnte der Vater wieder ihr helles Lachen und fröhliches Jauchzen hören, das keine Spur von Furcht mehr verriet.
*
Zweites Kapitel. Am 14. Juli 1863
Es war sieben Uhr abends und in den Straßen noch hell; trotzdem sah man schon viele Häuser in New-York fest geschlossen wie zur Nacht. In der Amity-Straße war dies besonders auffallend; der Stadtteil, in welchem sie liegt, und hauptsächlich die alten Häuser zwischen dem Broadway und der sechsten Avenue beherbergten damals viele Neger, und überall wo ein Schwarzer im Dienst stand, herrschte große Furcht. Nur eines dieser Häuser war, wenn auch gleichfalls verschlossen, doch glänzend erleuchtet, was in der Nachbarschaft nicht geringes Aufsehen erregte. Bis vor kurzem hatte es noch leer gestanden und man wußte nichts von seinen Insassen, außer, daß ein großer Neger das Gas angesteckt und die Fensterläden geschlossen hatte. Es war ein altes Gebäude, wie sie in jener Stadtgegend häufig zu finden sind; die niederen Stufen, welche zur Haustür führten, waren von seltsam geformten gußeisernen Säulen eingefaßt, die Wohnzimmerfenster gingen auf einen Balkon hinaus, und durch die halbrunde Glasscheibe über der Eingangstür sah man den einladenden Schein der Flurlampe.
Alle Vermutungen aber in Betreff der Bewohner des früher leeren Hauses, ja sogar andere noch weit wichtigere Dinge gerieten in Vergessenheit, als sich in der Amity-Straße die Schreckensnachricht verbreitete, daß ein Pöbelhaufe im Anzug sei. Schon vernahm man von weitem die unheilvollen Vorboten: zahllose Fußtritte, ein wildes Stimmengewirre und das Gebrüll einer rasenden Menschenmenge, das weit furchtbarer ist als das Tosen der aufgeregten See oder das Geheul wilder Bestien. Bis jetzt klang es nur aus der Ferne, die Straße selbst war verödet und menschenleer. Da sah man plötzlich zwei Männer um die Ecke biegen und auf das Haus Nr. 31 zuschreiten. Der eine, von schönem wohlgefälligem Äußern mit blondem Schnurrbart und schwermütigen Augen, sah starr vor sich hin, während er hastig vorwärts eilte. Des andern Gestalt war schmächtig, sein Rücken gebeugt und der Ausdruck seiner Miene so unergründlich, daß jeder, der dies Gesicht einmal gesehen hatte, es schwerlich wieder vergaß. Beide beschleunigten ihre Schritte, wie von einem stärkeren Willen getrieben; erst als sie vor der Haustür stillstanden, schienen sie einander gewahr zu werden. Ein furchtbarer Schrecken durchzuckte sie; beide öffneten die Lippen um zu sprechen, brachten aber keinen Laut hervor. Sie grüßten einander nur stumm, wie zwei Menschen, die von einem starken gemeinsamen Gefühl bewegt werden; dann stiegen sie, noch einen Blick auf die Hausnummer werfend, die wenigen Treppenstufen hinan, wobei der stattlichere Mann dem kleineren, offenbar älteren, den Vortritt ließ.
Zögernd streckten sie die Hand nach dem Klingelzug. »Sie haben sich sehr verändert«, stieß der Jüngere mit leiser Stimme heraus.
Sein Gefährte schwieg, er bebte am ganzen Körper.
»Ich habe weniger Mut als Sie«, murmelte er endlich.
Der andere fuhr zusammen und zog heftig an der Klingel. »Nur schnell, daß es vorbei ist«, rief er und fügte hastig hinzu, als drinnen Schritte laut wurden: »Taten Sie auch alles, um das Geheimnis zu wahren?«
»Treten Sie ein, meine Herren«, ertönte jetzt eine süßliche Stimme. »Sie kommen aus Washington, nicht wahr, und Sie aus Buffalo? Es ist schon recht; mein Herr erwartet Sie.«
In der geöffneten Tür stand ein großer Neger mit höflich lächelnder Miene, derselbe, über dessen Persönlichkeit man sich seit vierundzwanzig Stunden in der Nachbarschaft den Kopf zerbrach.
Bei seiner Anrede schreckten die beiden Ankömmlinge unwillkürlich zurück und warfen noch einen langen Blick auf den Himmel über ihnen und die Straße zu ihren Füßen, als wollten sie für immer Abschied nehmen von der Welt und allem was sie bietet.
Das Toben und Lärmen des nahenden Pöbelhaufens schienen sie nicht zu hören; eine schlimmere Furcht ängstigte ihre Seele und nicht draußen, sondern drinnen im Hause lauerte die Gefahr, vor welcher ihnen graute.
Jetzt waren sie beide eingetreten und der Neger verschloß die Türe hinter ihnen. Er erwies sich als ein gefälliger, wohlerzogener Diener. »Mein Herr wird bald hier sein«, versicherte er, nachdem er ihnen die Hüte aus der Hand genommen und sie in das große Vorderzimmer rechts geführt hatte; dann zog er sich geräuschlos zurück.
Die Männer waren an der Stubentür stehen geblieben und sahen sich mit ängstlichen Blicken um. Ein reich gedeckter Tisch fiel ihnen zuerst in die Augen. Der größere der beiden Männer, in dem wir bereits Herrn White erkannt haben, trat einen Schritt näher. »Drei!« sagte er mit seltsamem Nachdruck, auf die Stühle am Tische deutend.
Sein Gefährte, welcher Herrn Philipps aus Buffalo auffallend glich, näherte sich jetzt gleichfalls und begann die einzelnen Geräte auf dem Tisch mit verwunderten und zweifelnden Blicken zu mustern.
»Er will, daß wir mit ihm speisen«, murmelte er.
Der andere starrte die Weingläser an, die bei jedem Gedecke standen.
»Ein Mahl von mehreren Gängen«, bemerkte er.
»Dies Possenspiel widert mich an«, rief Philipps, »weit lieber wäre es mir gewesen, hier nichts zu finden als zwei –«
Er stockte, und rasch die Hand ausstreckend hob er den Deckel von der Schüssel, die gerade vor einem der Teller stand. »Ich dachte es mir wohl«, stammelte er, erbleichend.
White hob nun seinerseits den Deckel von einer zweiten Schüssel und ließ ihn nach einem raschen Blick leise zurückfallen. »Der Mann hat sich eine förmliche Komödie ausgedacht«, sagte er und fügte nach einer Pause hinzu: »Sehen Sie, es sind nur zwei bedeckte Schüsseln.«
»Machen wir ein Ende«, sagte Philipps wild um sich blickend und nahm mit kräftigem Griff aus der ersten Schüssel eine kleine, geladene Pistole heraus. Sein Gefährte erhob jedoch Einspruch. »Nein«, sagte er »acht Uhr stand auf dem Zettel, den ich erhielt; es fehlen noch 15 Minuten bis dahin.« Er zeigte nach der Stutzuhr auf dem Kaminsims.
»Fünfzehn Minuten? – Eine Ewigkeit!« stöhnte der andere, doch legte er die Pistole wieder an ihren Platz und White deckte sogleich die Schüssel zu.
Die unheimliche Stille, welche jetzt entstand, wurde durch die Rückkehr des Negers unterbrochen, der mehrere Champagnerflaschen brachte. Sein ehrerbietiges Wesen, seine unerschütterliche Ruhe noch länger still anzusehen, schien White unerträglich.
»Haben Sie den Tisch hier gedeckt?« fragte er in rauhem Ton.
»Jawohl. Herr.«
»Ganz allein?«
»Gewiß, Herr.«
White forschte nicht weiter. Die Miene des Schwarzen blieb unbeweglich und er hielt dem scharfen Blick, der auf ihn gerichtet war, gelassen Stand.
»Mein Herr muß jetzt gleich hier sein«, wiederholte er auf die Uhr schauend und entfernte sich abermals.
Philipps hatte sich während dieses kurzen Zwiegesprächs an den Kamin gestellt.
»Sie wollten wissen«, bemerkte er jetzt hastig, »ob ich Familie hätte? Ich besitze ein Kind, ein kleines, mutterloses Mädchen. Um seinetwillen –«
Der andere winkte ihm mit der Hand, nicht weiter zu sprechen. Dann zog er eine Photographie aus der Brusttasche: »Ich habe eine kränkliche Frau und –«
Er hielt Philipps das Bild hin, das dieser ergriff.
»Ein Knabe!« rief er mit bebender Stimme. Wie von einem elektrischen Schlag getroffen zuckten beide zusammen. White flüsterte kaum hörbar:
»Er ist erst zehn Jahre alt. O, – ich verstehe es jetzt und deshalb ergebe ich mich in mein Schicksal.«
Mit unverwandten Blicken sah Philipps noch immer das Bild an, das einen mächtigen Reiz auf ihn auszuüben schien.
»Wie schön, was für edle Züge!« rief er, es entzückt betrachtend.
Der Vater stieß einen herzzerreißenden Seufzer aus. »Seinesgleichen gibt es nicht auf der ganzen Welt«, sagte er, sein Eigentum wieder an sich nehmend. Er getraute sich jedoch nicht, das Bild anzusehen, sondern barg es rasch wieder an seiner Brust.
Unterdessen war es auf der Straße lauter und lauter geworden; das Getöse hatte jetzt einen solchen Grad erreicht, daß es die Aufmerksamkeit der beiden erregen mußte, wie sehr sie auch mit andern Dingen beschäftigt waren.
»Was geht da vor?« fragte Philipps verwundert.
In diesem Augenblick trat der Neger wieder ins Zimmer. »Bitte, beunruhigen Sie sich nicht, meine Herren«, bemerkte er. »Draußen findet ein kleiner Aufruhr statt. Man ist augenblicklich nicht gut auf die Farbigen zu sprechen und der Pöbel hat wahrscheinlich erfahren, daß ich hier bin.«
Erstaunt über seine Gelassenheit angesichts der ihn bedrohenden Gefahr sahen White und Philipps einander an. »Kommen die Aufrührer hierher?« rief letzterer, »führen sie Böses im Schilde?«
»An der Ecke wohnen noch zwei Familien, welche schwarze Diener haben«, entgegnete der Neger mit unerschrockener Ruhe. »Da wird es noch zweimal zum Kampfe kommen, der, wenn die Polizei rechtzeitig einschreitet, lange genug dauern kann, um Ihnen, meine Herren, Zeit zu lassen – Ihre Mahlzeit zu halten.«
Seine letzten Worte brachten die Röte des Zornes in Whites Antlitz; Philipps aber schien von neuer Hoffnung beseelt.
»Fürchten Sie sich denn nicht?« fragte er, »man sagt, die Aufrührer schrecken vor keiner Untat zurück.«
»Nur eins macht mir Sorge«, lautete des Dieners Antwort, »mein Herr wollte durch die sechste Avenue nach Hause kommen; leicht könnte er dem Pöbelhaufen in die Hände fallen und nicht zur verabredeten Stunde hier sein.«
Anscheinend ohne darauf zu achten, in welche heftige Erregung diese Mitteilung die beiden Männer versetzte, fuhr der Neger fort:
»Hier unten kann ich keinen Fensterladen öffnen, aber wenn Sie es wünschen, will ich einmal im obern Stockwerk hinaussehen.«
Er verließ das Zimmer.
»Das ist kein gewöhnlicher Diener«, sagte White mit dumpfem Ton, als die beiden wieder allein waren. »Das Werkzeug ist ebenso gefährlich als die Hand, die es führt. Sollte er, den wir fürchten, nicht kommen, so ist immer noch ein Zeuge da.«
»Der Pöbel brüllt: Tod allen Negern! – Wenn ein Zwischenfall eintritt – es fehlen noch fünf Minuten – so kann es unsere Rettung werden.«
Neubelebte Hoffnung klang aus seinen Worten; der Mann schien wie umgewandelt.
Whites Wesen dagegen hatte sich kaum verändert. »Würden wir nicht trotzdem durch unsern Eid gebunden sein?« sagte er kopfschüttelnd.
Der andere fuhr zurück und sah ihn mit entsetztem Blick an.
»Ist das Ihre Meinung?« fragte er. »Sollte jener Mensch verwundet – getötet werden – würden Sie dennoch – –«
Er hielt erschreckt inne. Der Neger kam mit unhörbarem Tritt wieder ins Zimmer geschlichen.
»Die Sachen stehen schlecht«, äußerte er bedenklich. »Deutlich sehen kann ich freilich nichts bei der Dunkelzeit, aber man hört von allen Seiten Steine fliegen und dazwischen Stöhnen und Schmerzensgeschrei. Die Aufrührer versuchen eben in einem der nächsten Häuser die Türe einzurennen. Das wird sie noch einige Minuten hinhalten.«
Die Herren blickten schweigend nach der Uhr, welche die achte Stunde zeigte.
»Wenn dein Herr zur festgesetzen Stunde nicht hier ist«, rief Philipps in heftiger Aufwallung, »so halte ich mich für ermächtigt, dies Haus zu verlassen.«
»Er wird zur Stelle sein«, lautete die Antwort, »wenn er am Leben ist.«
»Aber«, rief der andere triumphierend, als der erste Schlag der Uhr ertönte, »es ist schon acht und – –«
Die Hausglocke klang scharf und schrill. Philipps stockte, das Haupt sank ihm auf die Brust; er sah wieder alt und verfallen aus.
»Sehen Sie«, sagte der Neger, sich ehrerbietig verbeugend, »mein Herr ist ein Mann von Wort.«
Während er ging, um das Haus zu öffnen, traten die Männer schweigend an den Tisch und blieben wie angewurzelt neben den für sie bestimmten Stühlen stehen; der eine mit bleicher aber entschlossener Miene, der andere mit gesenktem Haupte, ein Bild ohnmächtiger Verzweiflung. Sie waren der Außenwelt völlig entrückt; wäre die Decke eingestürzt, sie hätten es kaum beachtet. Der Aufruhr auf der Straße kümmerte sie nicht; in ihrem Innern tobte ein weit wilderer Sturm und die Todesgefahr, in der sie schwebten, kam nicht von jener entfesselten Menge. Jetzt ging die Tür hinter ihnen auf; sobald sie es hörten, streckten sie, ohne sich umzusehen, mechanisch die Hand nach der verdeckten Schüssel aus. Eine Weile blieb alles still, dann vernahmen sie Worte, die ihnen so unerwartet kamen, daß sie sich auf der Stelle umwandten. Vor ihnen stand der Neger.
»Mein Herr hat eben einen kleinen Knaben hergeschickt«, sagte er, »um Sie wissen zu lassen, daß er dem Pöbel in die Hände geraten ist; er bittet Sie, einige Minuten zu warten, bis er sich wieder los machen kann. Die Mahlzeit soll nicht darunter leiden, dafür werde ich Sorge tragen.«
»Das mag sein«, schrie Philipps zornglühend, »aber mir ist die Eßlust vergangen, seit die Stunde vorüber ist. Ich muß bitten, mich zu entschuldigen.«
»Sie können das Haus jetzt nicht verlassen«, versetzte der Neger kalt und bestimmt, »es fliegen zu viele Kugeln von allen Seiten umher.«
»Sind Sie selbst mit einer Waffe versehen?« fragte White, indem er sich rasch dem Tisch näherte.
Statt der Antwort nahm der Neger die Hände vom Rücken; in jeder blitzte eine Pistole.
»Das dachte ich«, bemerkte White; »wir tun besser, auf unsern Wirt zu warten«, fügte er dann, zu Philipps gewandt, seufzend hinzu.
Über die Züge des Negers flog ein Lächeln, das keiner von ihnen gewahrte. Vielleicht wäre es ein Glück für sie gewesen, hätten sie es gesehen.
*
Drittes Kapitel. Entfesselte Leidenschaft
Jetzt erhob sich von der Straße her ein wahrer Höllenlärm. Fenster krachten, Weiber kreischten und immer näher klang das Geheul und Mordgeschrei der tobenden Menge. Abermals ward unten die Klingel gezogen, aber diesmal beeilte sich der Neger nicht, die Tür zu öffnen.
»So läutet mein Herr nicht«, sagte er und hielt das Ohr lauschend an die Tür. Doch er fuhr schnell zurück, gewaltige Faustschläge donnerten dagegen.
»Öffnet«, klang es in rauhem Ton, »gebt uns den Neger heraus, dann wollen wir weiter ziehen!«
»Den Neger, den Neger!« brüllten hundert Stimmen im Chor, »wir müssen den Neger haben.«
White, der neben Philipps im Wohnzimmer stand, hob gerade die Hand nach der Gaskrone, um das verräterische Licht auszulöschen, als der Schwarze eilig zurückkam. »Warten Sie noch einen Augenblick«, schrie er laut, um den betäubenden Lärm zu übertönen, »mein Herr kommt gewiß bald und dann –« Er hielt inne, horchte und stürzte wieder in die Halle hinaus, diesmal nach der Hinterseite der Wohnung.
»Was sollen wir tun?« fragte Philipps angstvoll; »weit lieber möchte ich den rasenden Teufeln begegnen, als jenem Manne.«
»Uns bleibt keine Wahl«, schrie White zurück. »Möglich, daß der Pöbel das Haus erstürmt, das können wir nicht hindern; aber mir war's, als hörte ich soeben eine Geschützsalve – das Militär rückt heran.«
Philipps schüttelte den Kopf und warf einen verlangenden Blick nach der Tür – der Schlüssel war abgezogen. Aber die Riegel an den Fensterläden ließen sich leicht zurückschieben; schon wollte er, ohne auf Whites finstere Blicke zu achten, den Versuch wagen, da flog ihm ein Holzsplitter entgegen – ein Laden war eben eingeschlagen worden.
»Den Neger! Gebt den Neger heraus!« klang es mit furchtbarer Deutlichkeit durch die Öffnung.
In namenloser Furcht stürzte Philipps auf den Tisch zu und wollte die Pistole in der verdeckten Schüssel ergreifen; »sie sollen mich nicht lebendig haben«, schrie er, »ich werde kämpfen bis zum letzten Atemzug.«
Plötzlich wurde sein Arm mit eisernem Griff festgehalten. Der Neger stand vor ihm, einen Papierfetzen in der Hand, auf den einige Worte flüchtig hingeworfen schienen.
»Von meinem Herrn«, rief er laut, während die Schläge immer stärker an Türe und Fenster donnerten.
Philipps starrte auf das Papier, aber er vermochte nichts zu lesen. White gelang es jedoch nach einigen Minuten die Schrift zu entziffern. Der Zettel lautete:
»Verwundet – im Sterben – sage den Herren, sie sollen gehen.
D.«
Whites bleiches Gesicht wurde plötzlich blutrot; er zitterte und zeigte sich schwächer im Augenblick der Errettung als während der ganzen Zeit der entsetzlichen Spannung.
»Wir sind erlöst, begnadigt, freigelassen«, schrie er Philipps ins Ohr. »Der Mann liegt im Sterben, das hat sein Herz erweicht.«
Der andere stieß einen gellenden Schrei ans. »Fort, fort, laßt uns fliehen«, keuchte er. »Leben, frei sein, mein Töchterchen wiedersehen –«
Er stürzte nach der Tür, aber der Gedanke an die blutgierige Menge draußen fesselte seinen Fuß. Auf diesem Weg gab es kein Entkommen. Hilflos flehend sah er den Neger an.
Dieser hatte wieder sein früheres, ehrerbietiges Wesen angenommen; er winkte den beiden, ihm zu folgen.
»An der Mauer im Hinterhof werden Sie eine Leiter finden«, sagte er sobald sie weit genug waren, daß er sich ihnen verständlich machen konnte. »Ich hatte sie dorthin gestellt, um meine eigene Rettung zu bewerkstelligen, aber sie steht zu Ihrem Dienst.«
White nahm den Papierfetzen aus seiner Westentasche, in die er ihn gesteckt hatte. »Wo ist der Bote, der den Zettel gebracht hat?« fragte er mit einem forschenden Blick auf den Neger.
»Fort. Er kam und ging durch den Hinterhof.«
»Und Ihr Herr – wo ist er?«
»In der nächsten Schenke liegt er am Boden. Er stieß gerade den letzten Seufzer aus, als der Mann ihn verließ. Ein Stein ist gegen seine Brust geflogen und hat ihm die Rippen eingeschlagen. Sonst«, fügte der Neger mit Nachdruck hinzu, »würde er sicherlich nicht versäumt haben, seine Gäste zu empfangen.«
Mit einem Fluch wandte White dem Schwarzen den Rücken. »Kommen Sie«, rief er Philipps zu und sprang, wie von einer schweren Last befreit, die wenigen Stufen in den Hof hinunter.