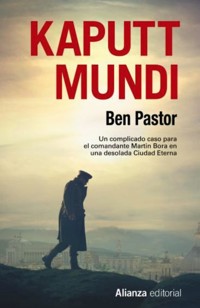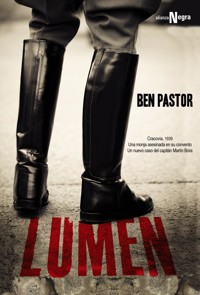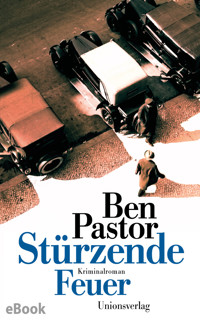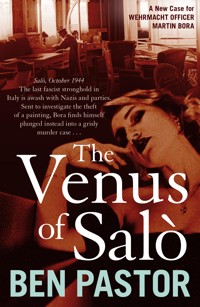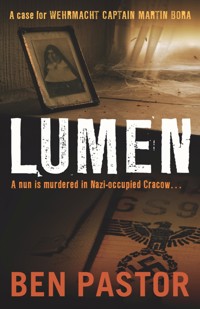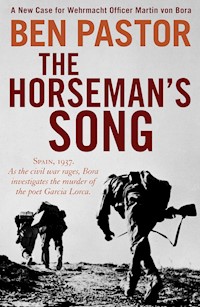11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie sieht aus wie eine riesige Schwalbe, die vom Himmel gefallen ist: Das Gesicht nach unten, die Arme seitwärts ausgestreckt, liegt die Äbtissin im Klostergarten. Erschossen. Ein Mordfall, der im zweiten Kriegsmonat im Jahr 1939 ganz Krakau entsetzt, verehrte doch das Volk die Frau wegen ihrer prophetischen Fähigkeiten wie eine Heilige. Der junge Wehrmachtsoffizier Martin Bora ist überrascht und völlig unvorbereitet, als er beauftragt wird, den Mordfall aufzuklären. Und das im Sinne der deutschen Besatzer – die Äbtissin darf nicht zur Märtyrerin für den Widerstand werden. In einem explosiven Polen, wo aufsässige Bauern und deren Vieh niedergemetzelt werden, gerät Bora bald selbst in das Labyrinth teuflischer Machenschaften.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch
Krakau, 1939: Kurz nach dem Einfall der Wehrmacht wird im Kloster eine Äbtissin erschossen. Vom polnischen Volk wie eine Heilige verehrt, war sie den Besatzern ein Dorn im Auge. Der junge Wehrmachtsoffizier Martin Bora soll den Fall lösen – im Sinne der Besatzer. Je tiefer Bora ins Labyrinth teuflischer Intrigen gerät, desto mehr zweifelt er.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Ben Pastor (*1950 in Rom) studierte Archäologie und lehrte an verschiedenen Universitäten in den USA, u. a. in Ohio, Illinois und Vermont. 2018 erhielt sie den Premio Internazionale Speciale Flaiano per la Letteratura. Pastor lebt in Italien.
Zur Webseite von Ben Pastor.
Sylvia Höfer hat u. a. Werke von Paula Fox, Diana Preston und T. Kezich übersetzt. Sie wurde mit dem Deutschen Literaturpreis und dem Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri ausgezeichnet. Höfer lebt in Heidelberg.
Zur Webseite von Sylvia Höfer.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Ben Pastor
Der Tod der Äbtissin
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Sylvia Höfer
Ein Martin-Bora-Roman (1)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1999 bei Van Neste Books, Richmond, Virginia.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2006 im Piper Verlag GmbH, München.
© by Ben Pastor 1999
Diese Ausgabe erscheint in Vereinbarung mit Piergiorgio Nicolazzini Literary Agency (PNLA)
© by Unionsverlag, Zürich 2025
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: PhotoAlto (Alamy Stock Photo)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31140-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 18.02.2025, 15:58h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER TOD DER ÄBTISSIN
1 – Krakau, Polen. Freitag, 13. Oktober 19392 – 25. Oktober 19393 – 7. November 19394 – 18. November 19395 – 1. Dezember 19396 – 9. Dezember 19397 – 12. Dezember 19398 – 20. Dezember 19399 – 22. Dezember 193910 – 28. Dezember 193911 – 1. Januar 194012 – 5. Januar 1940EpilogMehr über dieses Buch
Über Ben Pastor
Über Sylvia Höfer
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Ben Pastor
Zum Thema Deutschland
Zum Thema Polen
Zum Thema Geschichte
Zum Thema Kriminalroman
Für Alba, Alex, Ali, Dan, Sandro und Simona,die Lebenden und die Toten, die ich liebe.
Das Gute ist nicht minder mächtig zum Guten als das Böse zum Bösen. Merk dir: Wenn ich auch nimmer ein böses Werk täte, dennoch: habe ich den Willen zum Bösen, so habe ich die Sünde, wie wenn ich die Tat getan hätte: und ich könnte in einem entschiedenen Willen so große Sünde tun, wie wenn ich die ganze Welt getötet hätte, ohne dass ich doch je eine Tat dabei ausführte. Weshalb sollte das Gleiche nicht auch einem guten Willen möglich sein? Fürwahr, noch viel und unvergleichbar mehr […] Gebricht’s dir nicht am Willen, sondern nur am Vermögen, fürwahr, so hast du es vor Gott alles getan, und niemand kann es dir nehmen noch dich nur einen Augenblick daran hindern; denn tun wollen, sobald ich’s vermag, und getan haben, das ist vor Gott gleich.
MEISTER ECKHART
1
Krakau, Polen. Freitag, 13. Oktober 1939
Die polnischen Wörter, die mit einer Schablone auf das Schild gemalt waren, besagten: »Pass gut auf«, und was in hebräischer Schrift darunterstand, bedeutete vermutlich das Gleiche. Bunte Bilder, die die Buchstaben des Alphabets illustrierten, hingen um das Schild herum an der Wand. Für den Buchstaben L zeigte das entsprechende Bild ein kleines Mädchen, das einen Puppenwagen schob.
Plötzlich ein stechender, strenger Geruch nach zerfetztem Fleisch, der Bora so unerwartet in die Nase stieg, dass er sich von der Wand abwandte und auf die Mitte des Raumes zuging, wo ein Sanitäter mit Handschuhen und Mundschutz stand. Hinter diesem Mann strömten durch drei weit geöffnete Fenster das Licht der Nachmittagssonne und eine lauwarme nachmittägliche Brise in das Klassenzimmer.
Auf sechs Pulten, die an den Schmalseiten zusammengeschoben waren, lagen auf Wachstüchern die Toten in ihren Uniformen. An den Pulträndern war durch die Ritzen zwischen den Unterlagen Blut auf den Boden getropft. In den größeren Lachen gerann das Blut schon, und das Licht der Fenster spiegelte sich darin. Bora starrte darauf, bevor er näher herantrat und dem Sanitäter zunickte.
Er betrachtete jeden der Körper und nannte jedes Mal leise, mit ruhiger, beherrschter und angestrengt gedämpfter Stimme einen Namen. Der Sanitäter hielt einen Block in der Hand und notierte sich die Namen.
Als Bora von der dritten Leiche aufblickte, sah er an der Wand den Farbdruck mit dem kleinen Mädchen, das einen Puppenwagen schiebt. Darunter stand: Lalę. Dorotka ma lalę. »Wir dachten, Sie könnten sie am ehesten identifizieren, Herr Hauptmann, denn Sie haben doch im Wagen hinter ihnen gesessen.«
Bora wandte sich dem Sanitäter zu, ohne etwas zu sagen. Einen Augenblick lang ließ er seinen Blick an der schmutzigen Schürze des Sanitäters auf und ab wandern, als überlege er, was sie beide hier eigentlich verloren hatten. Und tatsächlich: Was hatten sie – tot oder lebendig – in einer jüdischen Tagesschule in der Jakuba-Straße in Krakau verloren?
Er spürte, wie ihm der Schweiß unter den Armen und am Rückgrat entlang hinunterrann.
Bora sagte: »Ja, das stimmt.«
Major Retz wartete unten im Wehrmachtsauto. Er rauchte eine Zigarre, und weil er alle Fenster hochgekurbelt hatte, war die Luft im Auto völlig verqualmt. Als Bora die Tür öffnete, um einzusteigen, schwebte ihm eine bläuliche Wolke entgegen, die beißend nach Tabak roch. Er setzte sich auf den Fahrersitz.
Retz sagte: »Also, das waren natürlich die Leutnants Klaus und Wilhelm und der arme Hans Smitt. Hätten sie ihre Erkennungsmarken getragen, hätten Sie nicht dort hingehen und sie anschauen müssen. Waren sie übel zugerichtet?«
Bora ließ den Motor an und wich Retz’ Blick im Rückspiegel aus. »Von der Taille abwärts hat es sie in Stücke gerissen.« Er ließ sein Fenster herunter, und als der Wagen anfuhr, begann der Rauch abzuziehen.
Sie fuhren die menschenleere Straße hinunter auf einen Platz; Bora folgte den Wegweisern, die man während der letzten paar Tage in aller Eile über die polnischen Namen von Straßen und Brücken angebracht hatte. Retz ließ ein paar belanglose Bemerkungen fallen, und Bora antwortete einsilbig.
Das üppige klare Nachmittagslicht warf von den Bäumen und den hohen Häuserblocks, die die Straße säumten, lange Schatten. Der Himmel über ihnen war von den nach Osten fliegenden Flugzeugen mit dünnen Kondensstreifen überzogen, die an die feinen Linien eines leeren Notenblatts erinnerten.
»Das ist doch keine Art zu sterben, oder? So, von einer Mine in die Luft gejagt.«
Bora schwieg. Retz kurbelte geräuschvoll das Fenster herunter, warf den Zigarrenstummel hinaus und wechselte das Thema. »Wie gefällt es Ihnen beim Nachrichtendienst?«
Dieses Mal sah Bora auf und blickte in den Rückspiegel. Aber Retz schaute nicht in seine Richtung. Er hatte sein arrogantes, grobes Gesicht abgewandt, und Bora hörte das Rascheln eines großen Blatts Papier, das aufgefaltet wurde.
»Ich glaube, es gefällt mir.«
Ihre Blicke trafen sich. »Ja. Man hat mir gesagt, Sie seien ein Wissenschaftler-Typ.« Bora glaubte, Retz habe irgendetwas wie »wissbegierig« äußern wollen, aber er hatte klar und deutlich »Wissenschaftler« gesagt. Diese Einschätzung seiner Person verunsicherte ihn seltsamerweise. Nach erneutem Papierrascheln wurde eine nachlässig zusammengefaltete Straßenkarte aus dem Fond auf den Vordersitz geworfen.
»Unser Quartier soll sich in der Nähe des Wawel-Hügels, also in der Altstadt, befinden. Ich hatte gehofft, wir wären näher beim Hauptquartier untergebracht, Bora, aber das haben wir davon, dass wir länger auf dem Schlachtfeld bleiben als das Gros. Hoffentlich verfügt die Wohnung über sanitäre Einrichtungen und solche Sachen. Fahren Sie zum Büro, ich möchte wissen, wo genau die uns unterbringen werden.«
14. Oktober
Das deutsche Hauptquartier an der Rakowicka-Straße blickte auf einen sorgfältig angelegten Garten. Hinter dem Tor, jenseits der Straße mit den Trambahnschienen, erhob sich die graue Dominikanerkirche. Tauben flogen flügelschlagend auf ihr Dach, allein und paarweise.
Bora hörte, was Oberst Hofer ihm erklärte. Die ganze Zeit dachte er, dass sein Kommandant im Gegensatz zu Richard Retz ein introvertierter und griesgrämiger Mann war. Da Hofers Hände schwitzten, hatte er feuchtigkeitsabsorbierendes Talkumpuder in seinen Handschuhen, und deshalb waren seine Handflächen bestäubt wie Fische, die man vor dem Braten in Mehl gewälzt hat. Der Oberst war von unbestimmbarem Alter (Bora war jung genug, um das Alter jeder Person falsch einzuschätzen, die älter war als er selbst, aber noch keine weißen Haare hatte) und hatte eine kleine, fast feminine Nase mit breiten Nasenflügeln, einen weichen Mund und eng stehende Zähne. Er setzte nur dann eine Brille auf, wenn er etwas lesen musste, aber sein Silberblick vermittelte den Eindruck, dass er sie eigentlich auch für einfachere Aufgaben gebraucht hätte, zum Beispiel dann, wenn er seine Gesprächspartner ansehen musste.
Nachdem Hofer Bora am Vormittag ausführlich über all seine Aufgaben informiert hatte, nahm er ihn beim Fenster zur Seite und sagte eine Zeit lang überhaupt nichts. Er blickte starr über die Blumenbeete hinweg auf die Straße und vergaß Boras Nähe. Schließlich richtete er seine von Ringen untermalten wässrigen Augen auf den jüngeren Mann.
Seine Augen wirken müde, dachte Bora, wie bei jemandem, der nicht schläft oder schlecht schläft – etwas, was während der letzten stürmischen Wochen auf sie alle zutraf. Nur dass man das den jungen Offizieren nicht ansah oder sie sich wahrscheinlich nicht einmal wirklich müde fühlten.
Leicht neidisch kam Hofer zu einem ähnlichen Schluss. Bora stand mit frischer, untadeliger Haltung neben ihm, geschult, seinen Diensteifer nicht herauszukehren, aber doch, wie seine bisherigen Leistungen bewiesen, von großer Einsatzfreude erfüllt. Hofer konnte über diese Begeisterung, diese Lernbegierde nur den Kopf schütteln, doch man lebte in Zeiten, in denen man zu solchen Übertreibungen ermuntern und nicht davon abraten musste.
Er sagte: »Hauptmann Bora, was wissen Sie über das Phänomen der Stigmata?«
Bora ließ sich nicht anmerken, dass ihn diese Frage überraschte. »Nicht sehr viel.« Er versuchte, nicht zurückzustarren. »Es sind Wundmale wie die, die Christus am Kreuz erlitt. Der heilige Franz von Assisi hatte sie und ein paar andere Mystiker.«
Hofer wandte seinen Blick wieder der Straße zu. »Richtig! Und wissen Sie, wie Franziskus und die anderen sie bekamen?« Er ließ Bora nicht die Zeit zu antworten. »Es passierte in der Ekstase. Es war Ekstase.« Er nickte vor sich hin und kratzte mit dem Fingernagel einen kleinen getrockneten Farbspritzer von der Fensterscheibe. »Es war Ekstase.«
Hofer wandte sich vom Fenster ab und ging in sein Büro. Bora blieb zurück, um auf die Dächer der Altstadtkirchen zu blicken, die sich wie Vorderdecke ferner Schiffe links hinter den fantasielosen neuen Häuserblocks erhoben. Unmittelbar vor ihm flogen immer noch Tauben zur Dominikanerkirche und zurück und suchten nach der sonnenbeschienenen Seite des Dachs. Bora dachte zurück an Spanien, an die Zeit nur sechs Monate zuvor, an das wilde, blendende spanische Licht.
Warum hatte Hofer die Stigmata überhaupt erwähnt? Wie war er bloß darauf gekommen?
Erst nach der Abendessenszeit, als der Oberst wieder vor seinen Schreibtisch trat, fiel ihm die Frage wieder ein. Bora hatte sich inzwischen mit der Topografie von Südostpolen vertraut gemacht und stand jetzt auf, einen roten Stift in der Hand.
Hofer nahm ihm den Stift ab und legte ihn auf den Schreibtisch.
»Genug Karten gelesen für heute, Bora. Morgen gehen Sie auf Patrouille. Ihr Dolmetscher ist Johannes Herwig, ein von hier stammender Deutscher, und er wird Ihnen alles Weitere im Gelände sagen. Ein guter Mann, der Hannes – wir kennen uns schon seit ein paar Jahren. Kommen Sie jetzt! Ich möchte, dass Sie mit mir ins Zentrum fahren.«
»Ich hole Ihren Wagen, Herr Oberst.«
»Nein, nehmen wir Ihren. Ich möchte, dass Sie fahren.«
Das Wartezimmer des Klosters zu Unserer Lieben Frau von den Sieben Schmerzen war von einem muffigen Wachsgeruch erfüllt. Licht fiel durch eine Reihe von drei Fenstern herein; sie waren hoch und schmal und hatten breite, schräge Simse, von denen aus man nicht einmal auf Zehenspitzen stehend hätte hinausschauen können. Der Raum hatte drei Türen, die alle geschlossen waren. Die Stille war so vollkommen, dass Bora das Fehlen jeglicher Geräusche wie einen Hohlraum vor den Ohren fühlen konnte.
An einer kahlen Seitenwand hing ein Kreuz mit einem bestürzend realistischen Christus in Lebensgröße, mit verrenktem, blutüberströmtem Oberkörper, mit verdrehten Augen und halb unter den Lidern verborgenen gläsernen Pupillen. Bora fühlte sich an die Leichen in der jüdischen Schule erinnert und erwartete beinahe, auf dem Boden unterhalb des Kreuzes eine Blutlache zu sehen. Doch die Fliesen waren ebenso blitzsauber wie alles andere auch. Keine Spuren an der Wand, keine Fingerabdrücke, keine Schlieren auf dem Boden. Nur dieser muffige Wachsgeruch.
Während Bora auf Hofer wartete, der in einem der Räume am Ende des Flurs verschwunden war, schritt er auf und ab. Die Stille und Ordentlichkeit des Zimmers zwangen ihm einen Vergleich mit den Trümmern und dem Lärm der vergangenen Wochen geradezu auf – niedergebrannte Dörfer, vorbeirollende, vorbeisausende Felder, die sich unter dem dahintreibenden Rauch und dem Feuer der Geschütze duckten. Bora gestand sich jetzt ein, dass er mit der Gedankenleere eines sexuellen Rausches durch die Verwüstung gestürmt war, mitgerissen und davongetragen. Umso mehr wunderte er sich über die nahezu keimfreie Friedlichkeit dieses Raums. Er hatte mehr als eine Stunde gewartet (das Licht in den Fensterchen hatte sich rötlich gefärbt und begann bereits zu schwinden), als sich eine der Türen öffnete und ein Priester hereintrat. Ihre Blicke trafen sich, und die beiden Männer begrüßten sich mit einem unverbindlichen Kopfnicken. Der Priester trug Hosen statt einer Soutane, ein ungewöhnlicher Anblick in diesem konservativen Land. Er ging an Bora vorbei, durch eine andere Tür, den Gang entlang und verschwand hinter einer weiteren Tür. Später schwebte eine Nonne vorüber und entfernte sich wieder. Das Licht in den Fensterchen färbte sich graulila, während sich draußen der Schatten des Spätnachmittags über die Straße senkte. Bora maß den Boden mit langsamen Schritten ab und versuchte, sich auf seine Gedanken und seine Langeweile zu konzentrieren. Schließlich betrat der Priester erneut das Wartezimmer.
Er sagte auf Englisch: »Oberst Hofer hat mir gesagt, dass Sie meine Sprache sprechen.«
Bora drehte sich steif um. »Ja«, und da er den amerikanischen Akzent erkannt hatte, lockerte er die Anspannung seiner Schultern etwas.
»Er hat mich hergeschickt, damit ich Ihnen so lange Gesellschaft leiste, bis sein Gespräch mit Mutter Kazimierza beendet ist.«
»Danke, aber ich komme gut zurecht.«
»Nun, wenn das so ist, dann können Sie mir Gesellschaft leisten.« Mit einem liebenswürdigen Lächeln setzte sich der Priester auf eine Bank mit gedrechselten Löwenfüßen. Bora folgte seinem Beispiel nicht. Er blieb stehen, die Hände auf dem Rücken.
Der Priester lächelte noch immer. Er war ein Mann in den Fünfzigern, so schätzte zumindest Bora, mit breiten Schultern, großen Füßen, großen sommersprossigen Händen und außergewöhnlich wachen hellen Augen. Wie Bora aus dem Augenwinkel sah, hätte sein Hals, der wie ein mächtiges Muskelpaket aus dem Priesterkragen ragte, eher zu einem Ringkämpfer gepasst. Die Kombination von aufmerksamem Blick und kräftiger Statur erinnerte an die Bilder jener kriegerischen Bauernheiligen, die in der einen Hand das Kreuz und in der anderen ein Schwert trugen.
Der Priester jedoch sagte in einem Ton, der nicht friedfertiger hätte sein können: »Ich komme aus Chicago, Illinois. Amerika.«
Bora warf ihm einen Blick zu. »Ich weiß, wo Chicago ist.«
»Ach ja? Aber wissen Sie auch, wo Bucktown liegt? Milwaukee Avenue?«
»Das natürlich nicht.«
»Natürlich nicht? Warum ›natürlich‹?« Das Gesicht des Priesters behielt den fröhlichen Ausdruck bei. »Bedenken Sie, dass für die meisten meiner Pfarrkinder die wichtigen Wegmarken eben Bucktown und Trinity Church sind, Six Corner, die Erinnerung an Pater Leopold Moczygemba …«
»Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?« Obwohl Bora ihm diese Frage stellte, begann die Sache ihm allmählich Spaß zu machen.
»Nein, nein. Nun, was ich gemeint habe … Sie und ich wären im Kriegszustand, wenn ich Brite wäre, aber ich gehöre keiner Krieg führenden Nation an.«
Das stimmte. Bora stellte fest, dass er sich immer weiter entspannte, denn er war der Warterei tatsächlich überdrüssig und nicht unglücklich, sich mit jemandem unterhalten zu können.
»Wer ist Mutter Kazimierza?«, fragte er.
Der Priester verzog den Mund zu einem noch breiteren Grinsen. »Ich schließe daraus, dass Sie nicht katholisch sind.«
»Ich bin katholisch, aber ich weiß bis jetzt nicht, wer sie ist.«
»Matka Kazimierza … Nun, Matka Kazimierza ist eine Institution für sich. In ganz Polen nennt man sie die ›heilige Äbtissin‹. Sie ist dafür bekannt, dass sie Ereignisse in Visionen vorhersieht und anscheinend über mystische und heilende Kräfte verfügt. Schließlich ist sie ja auch schon von einigen Ihrer Kommandeure aufgesucht worden.«
Bora fiel ein, dass Hofer jeden Nachmittag das Büro um die gleiche Zeit verließ. War er hierhergekommen, um die Nonne zu sehen, und war es ihm peinlich, sich von seinem Chauffeur zum Kloster fahren zu lassen? Bora sah den Priester lange an, der immer noch mit einem katzenhaften Lächeln dasaß. Freundliche Gesichter sah man in Krakau nicht alle Tage. Er hielt den Moment für gekommen, sich vorzustellen.
»Ich bin Hauptmann Martin Bora aus Leipzig.«
»Und ich bin Pater John Malecki. Ich bin von Seiner Heiligkeit beauftragt worden, das Phänomen der Mutter Kazimierza zu untersuchen.«
»Was für ein Phänomen?«
»Nun, die Sache mit den Wundmalen an ihren Händen und Füßen.«
Das war es also! Daher Hofers Gerede über die Stigmata. Bora war völlig verdutzt, und alles, was er herausbrachte, war: »Ach so.«
Pater Malecki fuhr fort: »Ich bin seit sechs Monaten in Krakau. Für den Fall, dass Sie sich das fragen: Ich habe mich zufällig hier befunden, als Sie kamen.«
Bora hatte bisher noch niemanden gehört, der mit so schlichten Worten auf den Einmarsch der Deutschen in Polen anspielte.
»Ja, Pater«, erwiderte er, leicht belustigt. »Wir sind gekommen.«
Für Bora war sonnenklar, dass der Oberst geweint hatte. Als sie auf die Straße hinaustraten, waren Hofers Augen gerötet, und obwohl er seine Schildmütze trug, war die Schwellung seines Gesichts noch deutlich zu sehen. Er gab lakonisch zu verstehen, dass er zum Hauptquartier zurückkehren wollte. Es war schon später Abend, aber er ging direkt in sein Büro und sperrte sich dort ein. Bora sammelte seine Papiere für die Fahrt am folgenden Tag ein und verließ dann das Gebäude.
15. Oktober
Die dreckverschmierten Flanken des Schweinekadavers lockten bereits grüne Fliegenschwärme an. Auf dem Einzelgehöft gab es wenig Schatten, weil der September ungewöhnlich trocken gewesen war und die welken Blätter der Bäume kaum Schutz vor der Sonne boten. Die Büsche, die die ungepflasterten Straßen säumten, waren staubbedeckt und so weiß, als läge Schnee darauf; es wehte kein Wind, kein Lüftchen regte sich. Die patrouillierenden Soldaten, die in der Mittagsglut blinzelten, schwärmten in alle Richtungen aus.
Bora ging zum Wehrmachtsauto zurück und versuchte, sich klarzumachen, dass auch dies zum Krieg gehörte: das Vieh derer schlachten zu müssen, die versprengten und desertierten Soldaten der polnischen Armee Unterschlupf gewährt hatten. Weit entfernt von der Spannung, die darin lag, Städte zu erobern, Haus für Haus, Tür für Tür. Jetzt kam es ihm so vor, als wären die glorreichen Tage bereits vorüber und als ginge es nun, nach der Hochstimmung der ersten drei Wochen, mit dem Krieg – der ohnehin höchstens noch einen Monat dauern würde – nur noch bergab. Er überlegte sogar schon, was er mit dem Rest seines Lebens anfangen würde.
Die Bauersfrau auf der Türstufe weinte in ihre Schürze. Geistesabwesend hörte Bora, wie der Dolmetscher ihn daran erinnerte, dass ein armer Haushalt nur selten sein einziges Schwein schlachtet. Er beugte sich vor, um vom Vordersitz des Wagens ein Klemmbrett aufzuheben, und drehte sich dann langsam zu dem kleinen Mann um, den Hofer ihm zugeteilt hatte. Wie ein geduldiger Lehrer deutete er mit seiner behandschuhten Hand nach rechts, wo auf dem spärlichen Gras eines baumlosen Hangs zwei braun aussehende Leichen ausgestreckt dalagen.
»Kommen Sie mir bloß nicht damit! Denken Sie daran, was da oben los ist!«
Boras Leute hatten etwas oberhalb des Gehöfts zwei versprengte polnische Soldaten erschossen, die, nachdem sie ein paar Schüsse auf die Patrouille abgefeuert hatten, den Hang hinaufgerannt waren. Von der ausgedorrten Wiese nördlich des Hauses kam jetzt einer der Soldaten zurück und führte eine braune Kuh an einem Strick. Hufe und Marschstiefel wirbelten eine dünne Staubschicht auf, die die hügelige Horizontlinie hinter ihnen leicht verschwimmen ließ. Die Bäuerin hörte die Huftritte. Sie hob ihr Gesicht aus der Schürze und lief mit ausgestreckten Händen auf Bora zu. »Nie, nie, panie oficerze!«
Verärgert stieß Bora sie zurück. Anderswo in Polen wurden Bauern getötet! Sie sollte dankbar sein, dass er keine weiter reichenden Befehle hatte.
»Es ist eine schöne Kuh«, schob Hannes nach und erboste damit den Offizier noch weiter.
Bora wandte sich an den Soldaten. »Erschießen Sie sie, Gefreiter!«
»Jawohl. Obwohl es eine Schande ist.«
Bora zog seine Walther und schoss der Kuh ins Ohr.
»Jetzt verbrennen Sie das Heu!«
Nachdem die Feuer entfacht waren, trat Bora vom Dreschboden zurück. Er ärgerte sich nicht so sehr über die Bauern wie über sich selbst. Diese Arbeit war unter der Würde eines Soldaten, jedenfalls unter seiner Würde, unter der Würde eines Soldaten seines Schlages. Eilends kletterte er den Hang hinauf, wo die Leichen der beiden versprengten Soldaten lagen.
Sie trugen immer noch die schmutzig braunen ausgebeulten Uniformen der polnischen Armee, waren aber barfuß. Hatten sie ihre zu engen Stiefel weggeworfen, um besser fliehen zu können? Bora kam zu diesem Schluss, weil ihre Zehen zusammengedrückt und gequetscht aussahen. Fliegen sammelten sich auf den langen, müden Gesichtern der Toten, und in ihren bleichen Augen schien trübes Wasser zu schwimmen. Die blauen Abzeichen auf ihren Kragen wiesen sie als Infanteristen aus.
Bora kauerte sich nieder, um ihre Jacken nach Papieren zu durchsuchen. Seit seinen Tagen als Freiwilliger in Spanien hatte er keine Leichen mehr angerührt – es war in Teruel gewesen, im letzten, im siegreichen Frühling. Das Erdrückende und die Kälte des Todes erstaunten ihn aufs Neue. Die Fliegen hoben von der blutverschmierten Kleidung ab und setzten sich wieder darauf. In der Ferne hörte man Artilleriefeuer, weit weg, vielleicht in Chrzanow. Es ist heiß, dachte er. Es ist heiß, und diese Männer spüren es nicht mehr, gar nichts mehr, bis Gott sie dereinst auferweckt.
Bora fand keine Erkennungsmarken und keinerlei Dokumente, die sie sicher alle unterwegs weggeworfen hatten. Aber in der Brusttasche des einen steckte eine zusammengefaltete Fotografie. Als Bora sie herauszog und auseinanderfaltete, zerbrach sie in zwei Hälften.
An der Unterschrift sah er, dass es sich um ein Schwarz-Weiß-Bild von Mutter Kazimierza handelte; sie stand mit gefalteten Händen da und betete. Um ihre Hände waren Bandagen gewickelt, und durch die Mullauflagen schienen dunkle Flecken hindurch. In der oberen Ecke rechts zeigte eine primitive Fotomontage ein eingeprägtes Herz, aus dem eine Flamme aufstieg. Ein Dornenkranz drückte auf das Herz, sodass Blutstropfen heraussickerten. Über dem Herzen schwebte eine Krone, und aus dieser Krone stieg eine Flamme empor. Darüber waren in einem Halbkreis die Buchstaben L. C. A. N. gedruckt. Bora drehte das Bild um und las, dass die Buchstaben für Lumen Christi Adiuva Nos standen. Licht Christi, steh uns bei. Ja, in der Tat – dem Mann, der es bei sich getragen hatte, hatte es Glück gebracht.
Gewehrschüsse am Fuße des Hangs schreckten ihn auf, aber es war nur ein Soldat, der in die Luft schoss, um die Frau von dem brennenden Heuhaufen fernzuhalten. Bora stand auf, schob das Foto in seine Kartentasche und ging hinunter.
Licht Christi. Ja, wirklich.
In dem Augenblick, als er bei der Tenne angekommen war, jagte eine in nächster Nähe wie wild abgefeuerte Maschinengewehrsalve die Soldaten auseinander. Bora duckte sich instinktiv, denn tatsächlich nahm ihm der Rauch des qualmenden Heuhaufens die Sicht.
»Achtung!«, brüllte ein Soldat, und das alles dauerte nur Sekunden, Bruchteile von Sekunden: Schüsse, Rauch, Sich-Ducken, der Schrei des Soldaten. Da machte Bora die schemenhafte Gestalt eines Mannes aus, die durch den Rauch glitt, und feuerte.
»Schießen!«, rief er. »Schießt, Leute!«
Geistergleich drehte sich der bewaffnete Mann vor den Flammen des zusammensackenden Heuhaufens ihm zu, aber Bora war schneller. Schneller auch als seine Soldaten. Zwei-, dreimal noch schoss er in die Rauchschwaden.
Aus dem Maschinengewehr kam ein letzter Schuss, himmelwärts. Der Mann sank auf die Knie, als hätte ihn ein großes Gewicht umgeworfen, und er brach in der duftenden Wiege des brennenden Heus zusammen.
Den rechten Arm noch ausgestreckt, nahm Bora den Finger vom Abzug. »Beinah hätte er uns erwischt! Habt ihr ihn denn nicht gesehen?« Er war wütend auf seine Männer, aber die Gefahr hatte ihn schlagartig in einen Zustand äußerster Beherrschtheit zurückversetzt. Er fühlte sich sogar wohler als vorher, als hätte die Gefahr seine Aufgabe hier irgendwie aufgewertet. »Durchsucht die übrigen Haufen!«, befahl er und überwachte während der nächsten fünf Minuten die Soldaten, die ihre Bajonette in das schwelende Heu stießen.
Sie hörten die Bauersfrau, die wieder auf der Türstufe hockte, laut weinen. Den Kopf zwischen den verschränkten Armen vergraben, zitterte das unglückliche Häufchen Kleider vor Angst und Kummer.
»Hannes, sag ihr, sie soll verdammt noch mal still sein!«, sagte Bora. Er drehte ihr beharrlich den Rücken zu, während die Soldaten hinter die Scheune gingen, um in der tiefen Abfallgrube und in einem Misthaufen herumzustochern, dabei aber nur die Pferdebremsen aufscheuchten.
Im Hauptquartier in Krakau litt Oberst Hofer unter Kopfschmerzen. Er versteckte den Brief von zu Hause unter einem ordentlichen Stapel Karten, damit er nur nicht in Versuchung käme, ihn noch einmal zu lesen, denn das würde ihm gewiss nicht guttun. Immer wieder wanderte sein Blick zur Wanduhr. Er verspürte einen Anflug von Groll bei dem Gedanken, dass Wehrmachtsgeneral Blaskowitz ausgerechnet um vier Uhr nachmittags vorbeischauen würde, denn die Äbtissin hatte ihm für halb fünf einen Termin eingeräumt.
Er hatte vergebens versucht, mit Blaskowitz’ Adjutanten über den Termin zu verhandeln, nachdem dieser ihm mitgeteilt hatte, dass der Oberbefehlshaber den ganzen Nachmittag in Krakau verbringen würde.
»Sie müssen viel beten«, hatte Mutter Kazimierza ihn am Tag zuvor in ihrem korrekten, aus Büchern gelernten Deutsch ermahnt. »Ihre Frau muss viel mehr beten als bisher. Wie kann Christus Sie erhören, wenn Sie nicht beten? Nur ununterbrochenes Beten öffnet Gottes Pforten.«
Hofer griff in die oberste Schublade seines Schreibtischs, in der ein von der Äbtissin – für ihn nutzlos, da in polnischer Sprache – verfasstes Büchlein über geistige Übungen lag; als Einmerker diente ihm ein kleines, quadratisches, in harten durchsichtigen Kunststoff eingeschweißtes Gazestück mit einem kreisrunden Blutfleck in der Mitte.
Hofer war so verzweifelt, dass er hätte weinen mögen. »Sie können mich nur noch nächste Woche antreffen und dann nicht mehr«, hatte Mutter Kazimierza ihm am Tag zuvor beim Hinausgehen gesagt. Sein Herz hatte sich bei diesen Worten zusammengekrampft. »Warum nur noch eine Woche?«, hatte er protestiert. »Ich brauche Ihre Gebete – warum nur noch eine Woche?«
Die Nonne wollte dazu nichts weiter sagen. Mit einem »Laudetur Jesus Christus« gab sie Schwester Irenka ein Zeichen, den Besucher hinauszubegleiten, und so hatte er gehen müssen. Hofer seufzte bei der Erinnerung tief auf, und Tränen stiegen ihm in die Augen. Es fiel ihm immer schwerer, seine Gefühle zu verbergen. Zum Glück war Hauptmann Bora so naiv und hatte nichts bemerkt. Wie die meisten Männer seiner Generation war Bora politisch schwer einzuschätzen, doch zumindest strahlte er eine gewisse traditionelle Solidität aus, eine Seriosität, die wenig mit Parteizugehörigkeit zu tun hatte. Er wusste, wie man etwas für sich behält. Das einzige Problem mit Bora war, dachte Hofer bedrückt, dass er so unverschämtes Glück hatte.
Draußen, auf dem Lande, wehte der Geruch von verkohltem Fleisch vom Heuhaufen herüber, in dem das Feuer weiter glomm, und im gärenden Inneren des Haufens verglühte die Masse um die Leiche herum zu schwarzen, festen, torfähnlichen Klumpen.
Bora blickte von seiner Karte auf und rief den Soldaten zu, die um die Schwelle des Bauernhauses herum hockten: »Um Himmels willen, zieht ihn dort heraus! Merkt ihr denn nicht, dass der arme Teufel gleich gebraten wird?«
16. Oktober
Bora kehrte erst am Montag nach Krakau zurück. Er holte Retz im Hauptquartier der Wehrmacht ab. Retz arbeitete im Versorgungsdienst und schimpfte gerade am Telefon über irgendeine verspätete Lieferung von Bettlaken. Nach Dienstschluss fuhren sie zusammen zurück zu ihrer Wohnung.
Es war ein schönes dreistöckiges Haus an der Podzamcze, direkt unterhalb der imposanten Befestigungsanlagen des Wawel-Schlosses. Von dem zartgelben Putz hoben sich die frisch bemalten Fensterläden und die schmiedeeisernen Balkongitter ab, und Bora ahnte, dass sich an der Rückseite des Gebäudes ein schmaler Garten mit immergrünen Gewächsen entlangzog.
Bora folgte Retz die zwei Treppen hinauf bis zu einer Tür, die der Major aufschloss und die den Blick in ein elegantes Inneres freigab.
»Unser Pech, dass man uns hier untergebracht hat«, sagte Retz geringschätzig und zog den Schlüssel mit einem Ruck missmutig aus dem Schloss. Sie hatten sich auf ihrem Nachhauseweg über Oberst Hofer unterhalten, aber jetzt schien sich schon allein durch das Betreten der Wohnung seine Verachtung für das zugewiesene Quartier neu zu beleben. Da er vor Bora eingetreten war, fügte er hinzu: »Haben Sie das da draußen am Türrahmen gesehen?« Er meinte den kleinen, halb aufgeschnittenen Metallbehälter, den Bora bereits bemerkt hatte. Er schien mit der Spitze eines Messers aufgeschlitzt worden zu sein und sah nun einfach aus wie ein Stück aufgeschnittenes Metall. »Wissen Sie, was das sein soll?«
Bora sagte, er glaube es zu wissen.
»Aber wissen Sie, was es bedeutet?«
Bora wandte den Blick vom Türpfosten. »Ich glaube, man nennt es mesusa. Es soll etwas aus der Heiligen Schrift enthalten.«
Retz schnallte seinen Gürtel und sein Halfter ab und warf beides auf einen Stuhl. »Ich sage Ihnen: Wenn das hier nicht so hübsch eingerichtet wäre, würde mir dieses Ding da ausreichen, um eine Umquartierung zu verlangen.«
Bora war noch immer nicht über die Schwelle getreten. Er sah, dass zwar das Namensschild von der Tür entfernt worden war, dass aber der unter der elektrischen Klingel angebrachte Familienname noch lesbar war, und es war ein jüdischer Name.
Retz war ins Badezimmer gegangen. Durch die halb offene Tür war zu hören, wie Urin in die Schüssel rauschte. Er rief Bora über das Geplätscher hinweg zu: »Sehen Sie sich um – Ihr Schlafzimmer ist hinten.«
Bora nahm seine Mütze ab. Im Gegensatz zu Retz war er zum ersten Mal in ihrer gemeinsamen Wohnung. Er blickte in die Richtung eines geradeaus gelegenen Zimmers, einen mit Teppichen ausgelegten Salon, in dem er durch die offene Tür die glänzende Ecke eines Flügels erkennen konnte. Er stellte sich gleich davor und machte ein paar gewandte Fingerübungen. Retz schlenderte ihm hinterher.
»Jetzt mal zurück zu Hofer. Sie haben ihn eine Woche lang hin und her gefahren und wissen nicht, dass sein Sohn so gut wie tot ist? Er hat irgendeine fürchterliche Krankheit und ist dabei erst vier oder fünf. Späte Ehe, spätes Kind – das einzige Kind. Der Alte ist schon das ganze letzte Jahr nicht mehr er selbst. Die Ärzte haben ihm gesagt, dass sie nichts machen können, und so lebt er von einem Tag zum nächsten wie einer, der in der Todeszelle sitzt.« Retz lehnte sich mit einem spöttischen Grinsen gegen den glänzenden Rahmen der Salontür. »Na ja, ich sehe schon: Sie haben keine Probleme, sich in einem Judenhaus einzuleben.« Er beobachtete, wie Bora interessiert einen Stapel Notenblätter durchsah. »Warum spielen Sie nicht etwas? Wie wär’s mit einem Schlager von Zarah Leander?«
20. Oktober
Die Stimme der Äbtissin drang deutlich durch die Tür; sie richtete sich zweifellos an eine Schwester, denn Bora konnte das polnische Wort Siostra heraushören. Hofer stand mit bleichem Gesicht zwei Schritte neben ihm im Klosterkorridor. Die dünne Schweißschicht auf seiner Stirn war jetzt, Ende Oktober, nicht auf die Temperatur zurückzuführen. Die Außenmauern des Klosters waren massiv und gut gegen Hitze und Kälte isoliert. Warm war es nicht. Als Hofer nervös die Knöpfe seiner Uniformjacke überprüfte, sah Bora, wie sehr seine Hände zitterten.
Deshalb und weil sonnige Tage in Krakau selten zu sein schienen, wäre Bora viel lieber draußen im Freien gewesen. Bemüht, sich seinen Ärger nicht anmerken zu lassen, hob er den Blick zu dem nächsten kleinen Fenster, durch das man ein Stück Himmel sah, das wie ein goldenes Tuch aus der kahlen Wand herausgeschnitten schien. Die Äbtissin ließ sie warten. Draußen wäre die Luft kühl und frisch, und es wäre noch hell genug, um an der Paulinerkirche vorbei zum Fluss hinunterzufahren oder weiter, über die Brücke, hinaus nach Wieliczka – ein Ausflugsziel, das aufzusuchen Bora bis jetzt noch keine Zeit gehabt hatte. Er stellte sich vor, in der milden, tief stehenden Sonne durch altehrwürdige Straßen zu spazieren.
Hofer fuhr ihn mit einem plötzlich angespannten Ton in der Stimme so an, als könne er noch schroffer sein, ziehe es aber vor, sich zu beherrschen.
»Sie haben wohl überhaupt keine Sorgen, was?«
Bora machten diese Worte betroffen. Er hatte versucht, nicht zerstreut zu wirken, und war verlegen. Als er seinen Blick vom Fenster abwandte, schwebte ihm ein grünliches Quadrat vor den Augen – so lange hatte er in das helle Fenster gestarrt.
»Tut mir leid, Herr Oberst.«
»Das war es nicht, wonach ich Sie gefragt habe.«
»Nein, Herr Oberst.« Bora hörte durch die geschlossene Tür irgendeinen gebieterischen Befehl der Äbtissin und betrachtete immer noch Hofers verärgertes Gesicht. »Ich habe meine Pflichten«, sagte er. »Und mir fehlt mein Zuhause.«
»Sie haben keine Sorgen.« Hofer sagte das mit unüberhörbarer Bitterkeit – so, als wäre es Boras Schuld. Er sah auf seine Uhr, machte einen steifen Schritt nach vorn und erstarrte dann wieder in vollkommener Regungslosigkeit, in der verkrampften Unbeweglichkeit eines Menschen, der in der Praxis eines Arztes auf sein Urteil wartet. »Wie lange glauben Sie, dass das hier noch dauern wird?«
Bora verstand Hofer richtig. »Ich bin mir sicher, dass das Leben uns alle prüft, früher oder später.«
»Früher oder später? Früher, als Sie glauben, da können Sie Gift drauf nehmen!« Über der Tür hing ein gerahmter Druck von Adam und Eva im Paradies, und Hofer deutete mit dem Kinn darauf.
»Das da oben sind Sie.«
Bora sah höflich zu dem Bild hinauf. Adams Blöße war von einem gnädig gekrümmten Zweig bedeckt. Er hatte einen stumpfen Gesichtsausdruck und große Augen, ein gut gebauter Trottel, dem eine kokette Eva ein rotbäckiges Äpfelchen entgegenstreckte.
»Dieser Krieg wird Ihnen den Apfel geben, Herr Hauptmann.«
»Damit rechne ich. Doch ich glaube, trotzdem eine Wahl zu haben.«
»Oh, Sie werden hineinbeißen! Halten Sie sich bloß nicht für etwas Besseres! Wenn man Ihnen den Apfel hinhält, werden Sie ihn sogar im Ganzen hinunterschlingen.«
Die Türklinke wurde lautlos heruntergedrückt, ein Geraschel in Schwarz und Weiß folgte, und eine Nonne mit einem hässlichen Gesicht öffnete die Tür einen Spalt, nur so weit, dass sie durchschauen konnte.
»Bitte, Herr Oberst.« Sie forderte den Obersten auf einzutreten. »Bitte sehr. Die Äbtissin wird Sie jetzt empfangen.«
»Warten Sie im anderen Zimmer«, raunzte Hofer Bora an. Während er hineinging, erhaschte Bora einen Blick von einer anderen Frau im Dreiviertelprofil: Es war eine hochgewachsene, steif wirkende Nonne mit majestätischer Haltung, deren Augen ihm einen kalten Blick zuwarfen. Dann schloss sich die Tür wie die Abweisung selbst.
Während er von einer Nonne, die plötzlich von irgendwoher aufgetaucht war, zum Wartezimmer zurückgeführt wurde, betrachtete er aufmerksam die wenigen Bilder an den Wänden, die durch die Klarheit der blitzsauberen vorhanglosen Fenster im Flur besonders gut zur Geltung kamen. In ihren schwarzen Rahmen zeigten sie eine Kreuzwegstation nach der anderen. An einer Biegung des Korridors stand auf einem mit einem Spitzendeckchen verzierten Holzsockel eine bunt bemalte Gipsstatue der Muttergottes von Lourdes. Trotz der soliden Bauweise des Klosters brachten Boras Stiefeltritte die Metallsterne ihres Heiligenscheins zum Zittern und Klirren. Obwohl er in der letzten Woche jeden Tag, den er in Krakau verbracht hatte, hierhergekommen war, hatte Bora immer noch keine klare Vorstellung vom Grundriss des Gebäudes. Räume schienen sich überallhin zu öffnen; schmale Flure und Treppen, die nach oben und unten führten, verwirrten den Besucher so sehr, dass er froh war über die lautlos schwebende Präsenz der Nonne, die seine Schritte lenkte.
21. Oktober
Nach Dienstschluss schwelgte Retz in seinen Erinnerungen: »Sie war die tolle Nummer von ganz Polen!« Er sagte das über das Glas mit dem Hochprozentigen hinweg, das er schief in der Hand hielt. Dann richtete er den Blick wieder auf die fünfzehn Jahre alte Bühnenillustrierte, die er in ihrer gemeinsamen Wohnung auf dem Tisch aufgeschlagen hatte, und schwärmte weiter: »Erst wenn Sie sie gesehen haben, wissen Sie, was Klasse und Zielstrebigkeit ist! Sehen Sie sich das an!«
Bora schaute. Es hatte den Anschein, als hätten die Kritiker der Zwanzigerjahre tatsächlich auf Ewa Kowalska geschworen. Bora überflog die gedruckten Wörter der polnischen Zeitschrift und begriff zumindest so viel, dass ihre Darstellung der Nora unübertroffen war und dass die Männer sie in Pirandellos So ist es, wie es Ihnen scheint hinreißend fanden. Sie zeigte Stärke, technische Selbstsicherheit, Talent und so weiter und versprach eine polnische Sarah Bernhardt und Eleonora Duse in einer Person zu werden.
Aus dem, was Bora von anderer Seite gehört hatte, schien Ewa Kowalska heute, keine zwanzig Jahre später, diesen Verheißungen nicht mehr zu entsprechen. Sie hatte die Änderungen in Stil und Interpretation nicht richtig mitvollzogen und sich am Ende mit der Warschauer Theaterszene überworfen. Auf Provinzbühnen konnte sie immer noch die Primadonna spielen, und wahrscheinlich war sie jetzt nur infolge des Krieges in Krakau wieder gefragt. Sie besserte ihr Einkommen dadurch auf, dass sie nebenher Übersetzungen aus dem Französischen anfertigte. Kurz und gut, den Offizieren zufolge war es in ihrer Wohnung in der Sw. Krzyza im Winter immer noch gemütlich warm, und im Sommer gab es stets frische Schnittblumen.
Bora hörte Major Retz zu und war eigentlich begierig darauf, sie einmal kennenzulernen.
»Ich glaube nicht, dass sie sich für jemanden in Ihrem Alter groß interessieren wird«, tat Retz seine Neugierde ab.
Bora wollte darüber nicht mit ihm diskutieren. Er hatte bereits aus der merkwürdigen Ansammlung von Fläschchen und Cremes auf dem Waschbecken geschlossen, dass Retz sich die Haare färbte, um jünger auszusehen. Deshalb fügte er nichts hinzu, was Retz als Wunsch hätte interpretieren können, in puncto Frauen mit ihm zu rivalisieren.
Retz sagte, während er sein Glas nachfüllte: »Ich treffe mich nächsten Samstag hier mit Frau Kowalska, Bora. Also sehen Sie bitte zu, dass Sie an diesem Tag erst sehr spät in der Nacht nach Hause kommen.«
»Wann, Herr Major?«
»Ach, was weiß ich. So um zwei oder drei Uhr in der Früh.« Retz grinste vielsagend. »Ich habe sie seit einundzwanzig Jahren nicht mehr gesehen.«
Das Ausbleiben einer Antwort legte nahe, dass der junge Mann irgendeinen unausgesprochenen Zweifel hegte. Retz spürte das und fügte hinzu: »Ich werde mich natürlich revanchieren, keine Sorge.«
»Es wird mir nicht schwerfallen, so lange auszubleiben, Herr Major. Es geht mir eher um die Sicherheit.«
»Sicherheit?«
»Um das Fraternisieren.«
Retz lachte. Er war mindestens Mitte vierzig, kräftig gebaut und trotz seiner groben Gesichtszüge ein gut aussehender Mann und, wie Bora in diesem Augenblick bemerkte, überaus selbstsicher.
»Weil ich mit einer Polin ins Bett gehe? Nun machen Sie aber mal halblang, Hauptmann Bora! Ich weiß, was Fraternisieren ist. Ich brauche keinen Nachrichtendienstler, der mich daran erinnert.« Retz leerte sein Glas, stellte es beiseite und korkte die Cognacflasche zu. »Was macht übrigens Ihr Polnisch?«
»Nicht so toll. Ich kann nur ein paar Sätze.«
»Na ja, dann sind Sie ja immerhin weiter als ich. Rufen Sie diese Nummer an, und machen Sie einen Termin mit Dr. Margolin aus. Natürlich weiß ich, dass er Jude ist! Was glauben Sie? Jetzt, da er und seinesgleichen nach Polen zurückverfrachtet worden sind, kann ich mir das doch zunutze machen. Jude oder nicht, er war nun mal der beste Zahnarzt von ganz Potsdam.«
»Dann wird er doch wohl Deutsch sprechen?«
»Dann hätte ich Sie nicht gebeten, oder? Polnisch spricht er! Solange Ihr Jiddisch nicht besser ist als Ihr Polnisch, bleiben Sie beim Polnischen. Sagen Sie ihm, dass ich ein Loch im Zahn habe oder zwei und dass er sich drum kümmern soll.«
Bora hatte keine Ahnung, wie man auf Polnisch »Loch im Zahn« sagte. Er wählte die Nummer des Amts, und es gelang ihm, nach der Praxis des Zahnarztes zu fragen. Das Telefon läutete lange, aber niemand nahm ab. Bora war gerade im Begriff aufzulegen, als sich endlich eine Frauenstimme meldete.
»Margolin? Jego niema w domu. Kiedy on wraca? Nie, nie mogç odpowiedziec na to pytanie. Nie wiem kiedy.«
»Nie rozumiem«, erwiderte Bora, weil er nichts verstanden hatte, außer dass Margolin nicht zu Hause war. Es dauerte zehn Minuten gegenseitiger Erklärungen, bis er begriff, dass Margolin überhaupt nicht mehr zurückerwartet wurde, weder zu Hause noch in seiner Praxis.
»So ein verdammtes Pech!« Retz schlug sich enttäuscht auf das Knie. »Jetzt muss ich zu einem unserer Zahnklempner von der Wehrmacht gehen. Wissen Sie überhaupt, wie unangenehm es ist, mit zwei Löchern in den Zähnen herumzulaufen?«
Bora, der keine Löcher in den Zähnen hatte, dachte, es sei gerade nicht der richtige Augenblick, das zuzugeben.
23. Oktober
In seinem Zimmer an der Karmelicka, wo er zur Untermiete wohnte, wachte Pater Malecki aus seinem nachmittäglichen Nickerchen mit dem bangen Gefühl auf, dass er gar nicht hätte einschlafen dürfen. Mit Herzklopfen richtete er den Blick auf das grün gestreifte Rechteck der geschlossenen Fensterläden und konnte aufgrund der Lichtmenge, die durch die Lamellen gefiltert wurde, sagen, dass es bereits nach vier Uhr war.
Er hielt den Atem an und versuchte, das Pochen in seiner Brust unter Kontrolle zu bringen. Es passte nicht zu ihm, in kalten Schweiß gebadet aufzuwachen, zumal er nicht einmal einen Albtraum gehabt hatte. Er setzte sich auf und griff nach seiner Armbanduhr auf dem Nachtkästchen.
Fünf nach halb fünf. Er gähnte, streifte sich das Metallarmband übers Handgelenk und streckte sich. Warum hatte er das Gefühl, zu irgendetwas zu spät zu kommen? Er hatte nicht viel zu tun bis zum Abend, wenn er sich dem Vespergebet der Ordensfrauen anschließen würde.
Diese quälende Angst war unbegründet. Malecki nahm einen Schluck Wasser, um seinen trockenen Mund anzufeuchten. Ein solches Unbehagen hatte er seit der Ankunft der Deutschen in Polen nicht mehr verspürt. Gewiss, die Nachrichten machten ihn jeden Tag abwechselnd traurig und fassungslos – ohnmächtig angesichts des Übermaßes an Gewalt. Diese Beklommenheit jetzt aber war keine nachempfundene Qual.
Im Zimmer war es still. Das Ticken einer Uhr direkt vor seiner Tür war alles, was diese Stille störte, bis Malecki aus dem Bett stieg und die Sprungfedern unter der Matratze ächzten. Sein Herz pochte nicht mehr, und vielleicht sollte er einfach nur das Kaffeetrinken aufgeben oder zu einer anständigen amerikanischen Zigarettenmarke zurückkehren, wenn er sie denn auf dem Markt finden würde.
Er ging zum Fenster, öffnete es und schaute die schmale, alte Straße hinunter. Es gab keinen Verkehr. Da bog, vom Stadtzentrum kommend, langsam ein Lastwagen der Wehrmacht ein. Malecki wandte stirnrunzelnd den Rücken zum Fensterbrett. Es hatte keinen Sinn, Kaffee oder Zigaretten die Schuld zuzuschieben. Die Angst war immer noch da und lauerte bedrohlich in seiner Magengrube.
Sein Priesteranzug hing schlaff im Lehnstuhl. Malecki schlüpfte hinein und begann, ihn zuzuknöpfen. Der Gedanke, im Kloster anzurufen, schoss ihm plötzlich durch den Kopf, aber er verwarf ihn sofort wieder. Wie kam er nur darauf? Dort gab es gar kein Telefon, und außerdem hatte er den Schwestern nichts zu sagen.
Durch die Bewegung des Stoffs aufgewirbelt, tanzten die Stäubchen in dem Lichtstrahl, der sein Zimmer durchschnitt.
Malecki setzte sich an den schmalen Schreibtisch und versuchte, in seinem Brevier zu lesen. Die Worte hüpften ihm vor den Augen, und die Zeilen verschwammen, bis er endlich das Buch zuschlug. Dann begann er, seiner Schwester in Carbondale einen Brief zu schreiben, kam aber nicht weit. Schließlich öffnete er die Tür und rief nach seiner Vermieterin.
»Frau Klara, gibt es irgendetwas in den Nachrichten?«
Am östlichen Ende der Altstadt begriff Bora genau im selben Augenblick, dass er Schwierigkeiten haben würde, den Wagen vor dem Kloster zu parken. Er hatte soeben am Gehsteig gehalten, um Hofer aussteigen zu lassen, als er ein lautes Getöse von Stahlketten und Motoren vom anderen Ende der Straße nahen hörte. Während das Auto noch im Leerlauf lief, reckte Bora den Hals aus dem Fenster, um nachzusehen.
Panzer! Wer auf dieser Welt konnte so dämlich sein und ausgerechnet hier mit Panzern anrücken? In dieser engen Gasse konnten sie doch gar nicht manövrieren! Nach wie vor kamen Panzer rasselnd und rumpelnd über das Kopfsteinpflaster von der vor ihm liegenden Biegung auf ihn zugerollt, dorthin, wo die Stufen zur Jesuitenkirche die Straße noch weiter verengten. Wie Dinosaurier wälzten sie sich, in eine stinkende Benzinwolke gehüllt, voran und brachten die Laternenpfähle, die Fenster und den Rückspiegel von Boras Wagen zum Klirren. Was für ein törichtes Kalkül auch immer hinter der Wahl dieser Straße stand – sie näherten sich so blind und dumpf, wie alle Maschinen wirken, deren Fahrer unsichtbar sind, und diese hier waren sich offenbar gar nicht der Tatsache bewusst, dass die scharfe Biegung vor ihnen ein Hindernis darstellen würde.
Umsichtig fuhr Bora seinen Wagen auf den Gehsteig und musste während der nächsten fünf Minuten genau wie die Panzer unter ohrenbetäubendem Lärm vorwärts und rückwärts manövrieren, um diese vorbeizulassen.
Das letzte schwerfällige Fahrzeug schob sich gerade mit seiner gewaltigen Flanke um die Ecke, als plötzlich Hofer aus dem Portal des Klosters wankte. Als er ihn so auf dem Gehsteig torkeln sah, sprang Bora aus dem Auto, denn er war sich jetzt sicher, dass Partisanen angegriffen hatten. Als der graubleiche Hofer verzweifelt gestikulierend um Hilfe bat, war Bora bereits bei ihm. Mit der Pistole in der Hand stellte er sich breitbeinig schützend vor ihn und drehte sich zur Straße, als käme die Gefahr von dort.
»Drinnen! Drinnen!« Hofers erstickte Stimme fand irgendwie den Weg aus seiner Mundhöhle heraus. Grob stieß er den jüngeren Mann vor sich her in den finsteren Vorraum. Einen Augenblick hatte Bora den Eindruck, dass geisterhafte Schatten in Kitteln jammernd um ihn herumschwebten. Dann erst erkannte er, dass es Nonnen waren, die in ihrer unverständlichen Sprache flüsterten und schluchzten.
Hofer trieb ihn weiter, und sie durchquerten schnellen Schrittes kahle Räume, kamen vorbei an schwarzen Kreuzen, langen Tischen, gestärktem Leinen, Stühlen und gingen durch einen Flur, über Stufen, und dann erwartete sie eine Flut grünen Lichts und der Geruch nach feuchter Erde.
Sie standen am Rand des Kreuzgangs. Ein vollkommenes Quadrat bewölkten Himmels öffnete sich über ihnen, und an allen vier Seiten waren die verschiedenen Grüntöne dicht stehender Bäumchen und Kübelpflanzen zu sehen.
»Schauen Sie sich das an, Bora!«
Mutter Kazimierza lag mit dem Gesicht nach unten beim Brunnen in der gepflasterten Mitte des Gartens, die Arme seitwärts ausgestreckt. Ein Teil ihres Schleiers leuchtete auffallend weiß. Er und das schwarze um ihre Beine gewickelte Gewand gaben ihr das Aussehen einer seltsamen, zu groß geratenen Schwalbe, die aus großer Höhe auf den Boden gestürzt war.
Unter ihrem langen Körper schlängelte ein roter Strich hervor und wand sich über die Ziegelsteine bis zum Rand des gepflasterten Bereichs. Der lange, gekrümmte Faden schien sich nach den Männern und Frauen auszustrecken, die in einiger Entfernung dastanden. Jenseits des Pflasterrands war er bereits von der feuchten Erde aufgesogen worden wie ein Bach, der in porösem Boden versickert.
Bora ließ seine Waffe sinken.
Zu seiner Linken begann eine der jungen Novizinnen, die beide Hände auf den Mund gepresst hielt, krampfhaft zu zucken, ohne Tränen zu vergießen. Als ein Windhauch, der für die Jahreszeit zu kalt war, über den Kreuzgang hinwegstrich, regneten von den Bäumen runde gelbe Blätter, nicht größer als Münzen, herein. Die Gruppe starrender Menschen gab keine zusammenhängenden Laute von sich, bis Hofer mit glasigen Augen vor sich hinstammelte: »Sie ist tot, sie ist tot, die Heilige ist tot.«
Mit seinem Blick folgte Bora der Blutspur bis zu dem filigranen Randmuster, das sie vor seinen Füßen bildete. Das hatte er schon in Aragon beobachtet, im Sommer zwei Jahre zuvor. Die Erde hatte die Flüssigkeit völlig aufgesogen, aber kleine schwarze Ameisen eilten darauf zu und inspizierten hin- und herflitzend das Ufer dessen, was sie angesichts ihrer eigenen Winzigkeit für ein nährendes, aber langsam austrocknendes Flussbett halten mussten.
2
25. Oktober 1939
Wie schätzen Sie als Fachmann den Gesundheitszustand von Oberst Hofer ein?« SS-Hauptsturmführer Salle-Weber hatte sich wie ein grob behauener, mit Abzeichen übersäter Baum hinter dem Schreibtisch des Obersten aufgepflanzt. Bora vermied, ihn direkt anzusehen.
»Ich diene Oberst Hofer erst seit zwei Wochen, Hauptsturmführer. Als Untergebener ist meine Meinung zwangsläufig unmaßgeblich, vielleicht sogar ohne jeden Belang.«
Salle-Weber hatte Boras Personalakte vor sich liegen und blätterte sie durch. »Seit wann sind Sie denn Hauptmann, Bora?«
»Seit drei Wochen.«
»Na, dann sind Sie jetzt ja ein großer Junge! Lassen Sie die Hierarchie mal beiseite, und geben Sie mir eine nüchterne Einschätzung Ihres Kommandeurs. Wir würden Sie nicht danach fragen, wenn wir das Gefühl hätten, Ihre Meinung sei ohne jeden Belang.«
»Ich glaube, Oberst Hofer ist sehr angespannt.«
»Sind wir das nicht alle?«
»Er hat private Gründe. Ich bin mir sicher, dass Sie darüber Bescheid wissen.«
»Alles, was ich weiß, ist, dass er keinen Schneid hat.«
Bora warf Salle-Weber einen flüchtigen Blick zu und sah dann wieder vor sich hin. »Nun, einen gewissen Schneid wird er wohl haben, wenn er sich doch vor zwei Jahren freiwillig nach Spanien gemeldet hat.«
»Was heißt das schon? Sie haben es auch getan, ebenso eine ganze Menge Leute von der Luftwaffe. Auch Schenck, ja, sogar Ihr unterbelichteter Dolmetscher.«
»Und obwohl wir uns auf feindlichem Gebiet befinden, legt Oberst Hofer keinen Wert darauf, eine Waffe zu tragen, so wie Sie und ich das tun. Gehört dazu denn kein Schneid?«
»Das ist doch kein Schneid! Das ist Schwachsinn!« Mit gespielter Gleichgültigkeit öffnete Salle-Weber die oberste Schublade von Hofers Schreibtisch und begann, darin herumzuwühlen. Er zog das Gebetbuch heraus. Es lag auch ein Bündel Briefe darin, das er ebenfalls herausnahm.
Bora folgte seinen Bewegungen mit dem irritierenden Gefühl, es handelte sich um seine Privatsphäre, die Salle-Weber gerade verletzte. »Geht es hier um eine Ermittlung?«
»Beantworten Sie nur meine Fragen, Herr Hauptmann. Hofer hatte vor zwei Tagen einen völligen Zusammenbruch, und das ist kaum etwas, was wir uns mitten in einem Feldzug leisten können. Sie waren bei ihm, als er durchdrehte. Seien Sie also so gut und erstatten Sie genau Bericht.«
Bora gehorchte.
Salle-Weber hörte ihm schweigend zu, machte sich aber keine Notizen; er beschränkte sich vielmehr darauf, den jüngeren Mann zu fixieren. »Sie sind ein guter Beobachter«, sagte er schließlich, nicht mit bewunderndem Unterton, sondern als reine Tatsachenfeststellung. »Das ist ein Vorteil, wissen Sie.« Endlich wandte er den Blick ab – wie Bora hatte er grüne Augen, aber in seinem Blick brannte ein anderer Eifer – und legte Hofers Sachen zurück in die Schublade. »Was bedeutet ihm diese Nonne? Was hat er sich von seinen täglichen Besuchen bei ihr versprochen?«
»Sie stand im Ruf, eine Heilige zu sein.«
Salle-Weber lachte. »Und zwar eine mausetote! Heilige – so etwas gibt es im heutigen Deutschland nicht.«
»Wir sind aber nicht in Deutschland.«
»Auch im Generalgouvernement gibt es keine Heiligen.«
»Ich habe auch nur gesagt, dass sie in diesem Ruf stand, Hauptsturmführer.«
»Das genügt schon! Bleiben Sie heute Abend nach Dienstschluss hier: Ich will einen detaillierten Bericht darüber, was Sie gesehen haben, als die Leiche entdeckt wurde.«
Bora fand sich mit dem Gedanken ab. »Und was passiert mit Oberst Hofer?«, fragte er, bevor er das Büro verließ.
»Nun, er wird auf seinen Posten zurückkehren, sobald er wieder Schneid hat. Sie werden ihn von jetzt an gut im Auge behalten. Was meinen Sie dazu?« Salle-Weber verschloss die oberste Schublade von Hofers Schreibtisch mit einem Schlüssel, den er in seine Tasche steckte. »Zwischenzeitlich werden Sie dem Kommando von Oberstleutnant Emil Schenck unterstellt, und ich glaube, er hat schon Befehle für Sie.«
Auf halbem Weg zum anderen Ende der Stadt trat Pater Malecki bedrückt seinen Heimweg vom amerikanischen Konsulat an. Soeben hatte er dem Vatikan die Nachricht vom Tod der Äbtissin telegrafiert und wollte am Nachmittag zurückkommen, um die offizielle Antwort zu erfahren. Fast achtundvierzig Stunden nach ihrem Tod stand er noch immer unter Schock. Da der Grund seines Aufenthalts in Polen damit hinfällig war, war jetzt alles offen. Weiter zu denken ermüdete ihn, und so ließ er es bleiben.
Niedergeschlagen ging er die Franciszkanska hinunter und bog dann in eine schmale, gewundene Gasse ein. Sie führte zur Klosterkirche, deren Fassade samt einer barocken Marmortreppe auf den Gehsteig schaute. Hier hatte er jeden Tag die Messe gelesen, weil sich der Pfarrer freiwillig zur Armee gemeldet hatte und wie Tausende andere den Weg in die Kriegsgefangenschaft gegangen war.
Malecki hatte nicht damit gerechnet, vor dem Eingang einen Wagen der Wehrmacht parken zu sehen. Da auf dem Fahrersitz ein Chauffeur wartete, vermutete er, dass er in der Kirche einen Offizier antreffen würde. Oben auf der Treppe, in einer Nische des von Pfeilern flankierten Portals, stand ein Soldat, die Maschinenpistole quer vor dem Bauch.
Bevor Malecki die Straße überquerte, beschloss er, nicht direkt an ihm vorbeizugehen. Da er in seiner Tasche den Schlüssel zu einer der Seitentüren hatte, spazierte er, ohne auf dem Gehsteig innezuhalten, die Straße weiter hinunter, bog in die nächste Seitengasse ein und betrat dann die Kirche von der Rückseite.
»Ewa?« Das rothaarige Mädchen steckte den Kopf zur Garderobe herein, die sie im Stadttheater miteinander teilten. »Darf ich reinkommen?«
»Komm nur!«
»Jemand hat eine Karte für dich abgegeben. Hier.«
Ewa Kowalska, die gerade dabei war, ihren Seidenstrumpf vorsichtig über das Bein zu ziehen, vermied jede hastige Bewegung. »Mach den Umschlag auf, und lies sie mir vor. Von wem ist sie?«
Das Mädchen hielt sie ihr hin, damit sie sah, dass die Adresse getippt war. »Keine Ahnung«, sagte sie mit dem Anflug eines Lächelns. »Der Gefreite, der sie hier abgegeben hat, trägt jedenfalls keine polnische Uniform.«
»Sei doch nicht so prüde, Kasia. Lies sie mir vor.«
Kasia schlitzte das Kuvert auf und sah hinein. Sie spitzte die Lippen. »Oh, verdammt! Sie ist auf Deutsch geschrieben.«
In der Kirche neben dem Kloster befanden sich keine Gläubigen. Mit rotem Kopf fuhr Bora mit seiner Tätigkeit fort, die darin bestand, aus den aufgeschlagenen Messbüchern der Reihe nach die Seite mit dem Lied Herr Gott, du Retter Polens herauszureißen.
Pater Malecki sah mit ohnmächtiger Wut zu, während der Messner die Hände rang und »Jaka szkoda, jaka szkoda« stöhnte. »Wie schade!«
Verärgert warf Bora die Messbücher auf einen Haufen. »Man hat mir gesagt, dass Sie eine ganze Woche Zeit hatten, die Seite zu entfernen, und Sie haben es nicht getan. Jetzt muss ich das machen.«
Malecki beherrschte sich. »Haben Sie von mir erwartet, dass ich Seiten aus einem Messbuch herausreiße?«
»Sie hatten genaue Anweisungen, das zu tun! Es hilft Ihnen nicht, wenn Sie uns Ihre Mitarbeit verweigern. Wenn das Lied morgen gesungen wird, wird die Kirche geschlossen.«
Malecki zwang sich, ein unbedachtes Wort hinunterzuschlucken. Ihm war klar, dass der Deutsche seine Befehle ausführen würde und dass es jetzt keinen Sinn hatte, vernünftig mit ihm reden zu wollen. Die Messbücher landeten der Reihe nach auf dem Boden – manche schlugen geöffnet dort auf, andere auf der Kante. Wie rote und schwarze Schlangenzungen schnellten die seidenen Einmerkbändchen zwischen den Seiten hervor.
Malecki begann, die Messbücher einzusammeln und sie hinter dem Soldaten aufzustapeln, der sie aufschlug und Bora überreichte. Als Bora fast fertig war, fing Malecki an, auch die zerknüllten Seiten aufzulesen. Mit einem dumpfen Geräusch landete der gespornte Stiefel dicht vor seiner Hand.
»Lassen Sie das liegen, Pater! Das nehmen wir mit.«
Malecki zog seine Hand nicht zurück, mit der er immer noch ein Blatt festhielt. Er sah nicht zu Bora auf, sein Blick blieb vielmehr an dem schwarz glänzenden Leder haften. »Gewiss gibt es andere Dinge, die ein Offizier mit Ihrer Erziehung tun könnte, Herr Hauptmann.«
Bora ließ das letzte Messbuch vor seine Füße fallen und trat einen Schritt zurück.
Auf seinen Befehl fegte der Soldat alle zerknüllten Seiten in einen Leinensack. Während sich Malecki langsam erhob, sah er, wie sich Boras Hand ihm entgegenstreckte.
»Zwingen Sie mich nicht, Ihre Hand gewaltsam zu öffnen, Pater.«