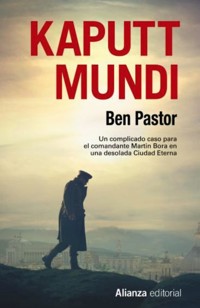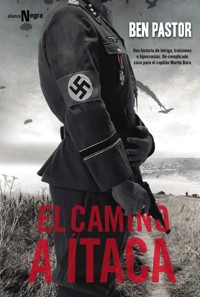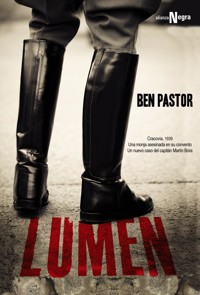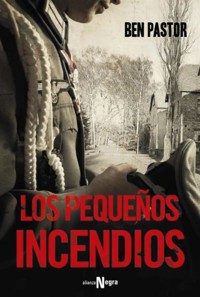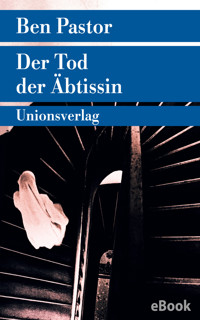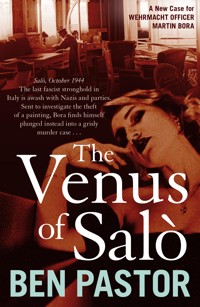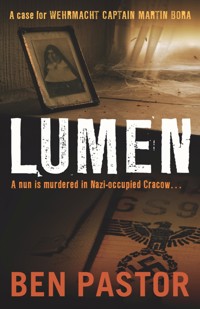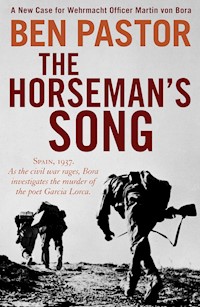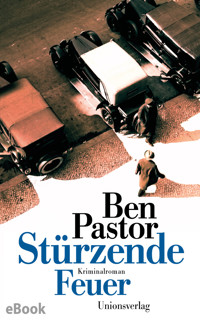
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Juli 1944 kehrt Oberstleutnant Martin Bora von der italienischen Front zurück in ein demoralisiertes Berlin. Die ganze Stadt steht unter Anspannung, Kontrollstellen registrieren jede Bewegung, im Hotel Adlon geht die Nazi-Elite ein und aus. Bora wird zur Kripo beordert und erhält einen ungewöhnlichen Auftrag: Er soll den Mord an einem illustren Hellseher aufklären, eine Legende der Zwanzigerjahre. Doch in der Stadt lauert noch weit mehr unter der Oberfläche: Gerüchte einer Verschwörung machen die Runde – eine Verschwörung um Graf von Stauffenberg, gerichtet gegen die höchsten Kreise des NS-Regimes. Bora muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht. Ben Pastor entwirft einen vielschichtigen Kriminalroman um die Tage vor dem Attentat des 20. Juli, in einer Stadt, die am Abgrund taumelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch
Im Juli 1944 kehrt Oberstleutnant Martin Bora von der Front zurück in ein nervöses Berlin. Er soll den Mord an einem Idol der Zwanzigerjahre aufklären, als ihm Gerüchte zu Ohren kommen: um eine Verschwörung um Graf von Stauffenberg, gerichtet gegen die höchsten Kreise des NS-Regimes. Bora muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Ben Pastor (*1950 in Rom) studierte Archäologie und lehrte an verschiedenen Universitäten in den USA, u. a. in Ohio, Illinois und Vermont. 2018 erhielt sie den Premio Internazionale Speciale Flaiano per la Letteratura. Pastor lebt in Italien.
Zur Webseite von Ben Pastor.
Hella Reese (*1968) hat Slawistik, Romanistik und Osteuropäische Geschichte studiert. Nach langjähriger Tätigkeit in der Strategieberatung und im Verlagswesen arbeitet sie heute als Übersetzerin und Lektorin. Sie hat u. a. Werke von Matt Haig, Ann Petry und Kseniya Melnik übersetzt.
Zur Webseite von Hella Reese.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Englische Broschur, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Ben Pastor
Stürzende Feuer
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Hella Reese
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Originalausgabe erschien 2020 bei Bitter Lemon Press, London.
Lektorat: Susanne Gretter
Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds für die großzügige Förderung ihrer Arbeit.
Originaltitel: The Night of Shooting Stars
© by Ben Pastor 2018
Diese Ausgabe erscheint in Vereinbarung mit Piergiorgio Nicolazzini Literary Agency (PNLA)
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Willy Pragher (Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Freiburg)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31142-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 07.06.2024, 16:42h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
STÜRZENDE FEUER
PersonenregisterProlog1 – Die großen Ereignisse pflegen überraschend zu kommen …2 – Wer in den Schornstein steigt, darf sich am …3 – Wanderer, Wanderer, bleibe im Haus, wenn dein Hund …4 – Kassandra wendete nicht das Schicksal Trojas, und das …5 – Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was …6 – Dreißig Speichen treffen die Nabe, aber die Leere …7 – FAUST: Die Pforte knarrt, und niemand kommt herein …8 – Wer sterben gelernt hat, der hat das Dienen …9 – Alle Wahrheit ist krumm10 – Das Überleben ist nur ein Aspekt des Kampfes11 – Wie oben, so untenAnmerkung der AutorinWorterklärungenDanksagungMehr über dieses Buch
Alf Mayer: Anstand und Haltung bewahren, in schwierigster Zeit
Über Ben Pastor
Über Hella Reese
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Deutschland
Zum Thema Italien
Gewidmet all jenen,die ebenfalls Widerstand geleistet haben,aber in Vergessenheit geraten sind.
Es brauchet aber Stiche der Fels.
FRIEDRICH HÖLDERLIN, Der Ister
Personenregister
MARTIN-HEINZ DOUGLAS VON BORA
Oberstleutnant der Wehrmacht
NINA SICKINGEN-BORA
seine Mutter
BENNO VON SALOMON
Oberst der Wehrmacht
BRUNO LATTMANN
Major der Wehrmacht
MAX KOLOWRAT
Journalist, Reisender und ehemaliger Kriegsberichterstatter
ARTHUR NEBE
Chef des Reichskriminalpolizeiamtes (Kripo)
CLAUS SCHENK GRAF VON STAUFFENBERG
Stabschef des Befehlshabers des Ersatzheeres
WILLY OSTERLOH
Bauingenieur
EMMA »EMMI« PLETSCH
Stabsführerin beim Ersatzheer
MARGARETHA »DUCKIE« SICKINGEN
Martin Boras Schwägerin
FLORIAN GRIMM
Kriminalkommissar bei der Berliner Kriminalpolizei
ALBRECHT OLBERTZ
Arzt und Mitglied der NSDAP
IDA RÜDIGER
Friseuse für die Gattinnen der Parteigrößen
BERTHOLD »BUBI« KUPINSKI
eine lichtscheue Gestalt
GERD EPPNER
Juwelier und Uhrmacher
ROLAND GLANTZ
Verleger des Sternuhr Verlags
GUSTAV KUGLER
ein ehemaliger Kripobeamter
NAMURA
Oberstleutnant in der Kaiserlich Japanischen Armee
SAMI MANDELBAUM, auch bekannt als MAGNUS MAGNUSSON alias WALTER NIEMEYER
Hellseher und Bühnenmagier
Prolog
Deutsche Allgemeine Zeitung
Berlin, Sonntag, 9. Juli 1944
Das Staatsbegräbnis für Prof. Dr. Alfred Johann Reinhardt-Thoma, der am Freitagabend, dem 7. Juli, überraschend in seinem Haus verstorben ist, wird morgen feierlich im Kaiser-Wilhelm-Institut in Dahlem begangen.
Bis 1933 war Prof. Dr. Reinhardt-Thoma Leitender Chirurg im Krankenhaus St. Jakob in Leipzig, bevor er die Klinik für Kindeswohl und Kindergesundheit, eine private Einrichtung in Dahlem, ins Leben rief und ihr als Direktor vorstand. Seine Frau Dorothea Reinhardt-Thoma, geborene Baroness von Bora, Tochter des Feldmarschalls Wilhelm-Heinrich von Bora, Held des Deutschen Bruderkriegs, ist bereits vor zwei Jahren gestorben. Saskia Reinhardt-Thoma, die Adoptivtochter der beiden erlauchten Dahingeschiedenen, kann der Feier aufgrund einer schweren Erkrankung nicht beiwohnen. Seine Schwägerin Nina Baroness von Sickingen, Witwe des verstorbenen Meisterdirigenten Friedrich Baron von Bora seligen Angedenkens, ist aus Leipzig angereist. In Kürze wird auch ihr Sohn Oberstleutnant Martin-Heinz Douglas, Baron von Bora, von der Front erwartet, wo er einen Stoßtrupp kommandiert. Er ist Träger des Ritterkreuzes mit Eichenlaub und Prof. Dr. Reinhardt-Thomas Neffe.
Folgende Persönlichkeiten werden den Verstorbenen mit ihrer Anwesenheit beehren: Seine Exzellenz Martin Bormann, Leiter der Partei-Kanzlei; Dr. Leonardo Conti, SS-Gruppenführer, Staatssekretär im Reichsinnenministerium und Leiter des Hauptamts für Volksgesundheit; SS-Brigadeführer Ludwig Steeg, Oberbürgermeister von Berlin, sowie der ehemalige Oberbürgermeister von Leipzig, Dr. Jur. Carl Friedrich Goerdeler. Folgende weitere Persönlichkeiten werden ihre Aufwartung machen: Dr. Karl Gebhardt, Präsident des Deutschen Roten Kreuzes sowie beratender Chirurg der SS und der Polizei; Dr. Max de Crinis, Ordinarius für Psychiatrie und Neurologie an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, außerdem die erlauchten Kollegen des Verstorbenen, die Herren Doktoren Matthias Göring, Karl Bonhoeffer, Hans Gerhard Creutzfeldt, Kurt Blome und Paul Nitsche nebst zahlreichen weiteren. Generaloberstabsarzt Dr. Siegfried Handloser, Chef des Wehrmachtsanitätswesens, wird die Trauerrede halten.
Gemäß der testamentarischen Verfügung des verstorbenen Prof. Dr. Reinhardt-Thoma wird es weder eine kirchliche Zeremonie noch ein Trauergeleit geben. Die Beisetzung im Familiengrab wird zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Waldfriedhof Dahlem erfolgen.
Prof. Dr. Reinhardt-Thoma, der 1878 in Halle an der Saale geboren wurde, studierte an den Universitäten zu Leipzig, Jena und Berlin (wo er zudem Ordinarius für Innere Medizin war). Am Firmament medizinischer Forschung und Praxis wird sein Stern besonders hell leuchten, und er wird als herausragende Berühmtheit in Erinnerung bleiben. In den langen Jahren seiner beeindruckenden Karriere als Kinderarzt, Vordenker und Gelehrter hat er für seine Studien zu angeborenen und perinatalen Missbildungen die renommiertesten Auszeichnungen im Vaterland wie auch im Ausland erhalten.
Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler, der stets darauf bedacht ist, dass kein Kamerad, der dem deutschen Vaterland Ehre erwiesen hat, vergessen wird, hat eine persönliche Beileidsbekundung geschickt, in der er seinem Kummer über den schwerwiegenden Verlust, den die Familie erleiden musste, Ausdruck verleiht.
1
Die großen Ereignisse pflegen überraschend zu kommen,und jede Erwartung bewirkt nur, daß sie zögern.
JOSEPH ROTH, Hotel Savoy
Im Anflug auf den Flugplatz Schönefeld, unweit von Teltow, Montag, 10. Juli 1944, 6.38 Uhr
Die Tinte in seinem Füllfederhalter ging zur Neige. Der letzte Satz in seinem Tagebuch war von einem wässrigen Blau, Bora würde ihn überschreiben müssen, damit er leserlich wurde – sofern er irgendwo Nachschub kaufen konnte. Das Löschpapier war praktisch überflüssig. Er verwendete es als Lesezeichen und legte das Tagebuch auf seinen Knien ab. Er konnte spüren, wie das Flugzeug im Sinkflug durch die Wolkenschichten stieß. Schwerfällig traf der metallene Rumpf auf Luftlöcher und sackte immer wieder durch, um im nächsten Moment erneut Auftrieb zu bekommen. Nun ging das Flugzeug in eine Kurve, richtete sich wohl am Rollfeld aus und gewann noch einmal an Höhe. Im Landeanflug vibrierte die Maschine, die Triebwerke jaulten auf, rumpelnd wurde das Fahrgestell ausgefahren, für einen Moment war der Luftwiderstand spürbar. Dann setzten die Räder mit einem dumpfen Schlag auf grasigem Boden auf.
Bora kam von der Front in Italien und hielt es für einen glücklichen Umstand, dass es keine Fenster gab und er daher keine Ahnung hatte, wie das Gebiet, das sie überflogen hatten, aussah. Natürlich wusste er von den jüngsten Luftangriffen, fand es allerdings durchaus hilfreich, nicht zu sehen, was sie angerichtet hatten. Aus der Luft hatte er also noch nicht mitbekommen, welche Zustände in Berlin herrschten – aber schon bald würde er hinausgehen und sich umsehen müssen.
Während das Flugzeug zum Hangar rollte, las er noch einmal, was er Stunden zuvor rasch in sein Tagebuch notiert hatte. Zu dem Zeitpunkt hatte er noch angenommen, sein Ziel vor Einbruch der Dunkelheit zu erreichen – eine trügerische Hoffnung, wie so viele in diesem Sommer. Da sich feindliche Jagdflugzeuge im Luftraum befanden, musste die Transportmaschine den erstbesten Flugplatz auf deutschem Gebiet für eine Zwischenlandung ansteuern. Und so kam es, dass sie noch immer in der Luft waren, als der Morgen graute.
Eintrag begonnen am 9. Juli auf einem Flugplatz im Norden Italiens, während ich darauf warte, ins Vaterland zu fliegen. Der Anlass ist traurig. Onkel Alfred ist überraschend gestorben. Nina (mit der ich kurz am Telefon gesprochen habe und die ich Gott sei Dank bald sehen werde) hatte zuletzt am Geburtstag meines Stiefvaters im Juni etwas von ihm gehört. Onkel Alfred war sechsundsechzig Jahre alt und, soweit wir wussten, gesund. Er war vollauf mit seiner Klinik beschäftigt, in der man sich um junge Patienten kümmert, die bei Luftangriffen körperliche oder seelische Verletzungen davongetragen haben. Letztere würden seiner Meinung nach länger unter den Folgen zu leiden haben.
Zivilisten und Soldaten verwenden Wörter auf sehr unterschiedliche Weise. Das Adverb »hinterher« versuche ich, so gut es geht, zu vermeiden. Aus Aberglauben? In Stalingrad hat uns einer meiner Kommandeure verboten, in seiner Gegenwart das Wort »morgen« zu benutzen. Wir waren eingekesselt, und schon bald sollten vierundachtzig Prozent von uns dem Feind in die Hände fallen, tot oder als Gefangene – oder verwundet und damit so gut wie tot. Es ist noch keine zwanzig Monate her, dass Oberst von Guzman das Wort »morgen« nicht mehr hören wollte. Man stelle sich einmal vor, welche Wortschöpfungen wir bemühen mussten, wenn wir über den folgenden Tag sprechen wollten. Ich habe keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Ob er Ende 1942 wohl auch in den Fleischwolf von Rschew geraten ist? Womöglich schmachtet er in einem sowjetischen Gefangenenlager, wo es tatsächlich kein Morgen gibt, oder – Gott bewahre! – er hat sich denen angeschlossen, die das Vaterland aus Verzweiflung oder aus Feigheit verraten haben, so wie unser Oberbefehlshaber an jener Front? Den Namen dieses Generalfeldmarschalls werde ich gewiss nicht niederschreiben.
Ich jedenfalls werde weiterhin von »morgen« sprechen, auch angesichts der brutalen Wirklichkeit. Ich bin davon überzeugt, dass ein Morgen kommen wird, in welcher Form auch immer. »Die Sonne geht auf«, so steht es beim Prediger Salomo. Ob ich allerdings den Sonnenaufgang erleben werde, ist mir im Moment weniger wichtig als der Hornknopf an meinem Hemdkragen.
Ich muss mich zwingen, meiner Familie zu schreiben (ich bin »der Einzige, der noch übrig ist«, wie mir meine Mutter Nina gern in Erinnerung ruft, ohne dabei vorwurfsvoll zu klingen – ein Jahr und einen Monat nach dem Tod meines Bruders Peter). Wie kann ich Nina oder meinem vierundsiebzig Jahre alten Stiefvater begreiflich machen, dass mich jeder Brief, ob nun von mir geschrieben oder an mich gerichtet, große Mühe kostet, weil Briefe meine Bindung an sie nur noch stärken? Keine Bindungen zu haben, bedeutet frei zu sein, weil man nicht einmal unbedingt Hoffnung haben muss, wenn man allein ist.
PS: Hinzugefügt am nächsten Morgen, 10. Juli, noch unterwegs. Die Tinte wird knapp. Mit Professor Heidegger und Hauptmann Ernst Jünger wechsele ich immer noch gern Briefe. Die Zwiesprache mit ihnen ist vollkommen abstrakt und bei Weitem nicht so schmerzlich. Ich habe sogar einen Brief von meinem Freund Bruno Lattmann bekommen, der schwer verwundet wurde, aber glücklicherweise am Leben ist. Er erholt sich in der Nähe von Berlin, seiner Heimatstadt. Ihn zu sehen (sofern es überhaupt möglich ist), aber vor allem Nina zu sehen, ist gerade jetzt, nach dem Tod eines Familienmitglieds, tröstlich.
»Wir haben es geschafft, Herr Oberst!«, rief ihm der Co-Pilot zu. »Näher an die Stadt heran ging es nicht, für Tempelhof haben wir heute Morgen keine Freigabe bekommen.«
Dass sie auf einer Graspiste gelandet waren, hatte Bora bereits registriert.
»Wo sind wir denn eigentlich?«
»In Schönefeld.«
»Ich hatte angenommen, dass es hier befestigte Landebahnen gäbe.« Aus seiner Haut als Offizier der Abwehr kam er nicht heraus, Fragen zu stellen war Bora zur zweiten Natur geworden. Davon abgesehen war er zeitlich gebunden.
»Es gibt drei. Aber sie sind zu kurz, um darauf zu manövrieren, und Tante Ju muss schließlich auch wieder abheben.«
»Danke.« Das Tagebuch war inzwischen in Boras Aktentasche verschwunden. »Scheint so, als sei ein Sturm im Anzug. Regnet es vielleicht?«
»Nein.«
Der Wagen, der Bora nach Dahlem im Südwesten der Stadt bringen sollte, erwartete ihn vermutlich am Zivilflughafen Tempelhof, der in der Nacht zuvor für seinen Militärflug ausnahmsweise offen gehalten worden war. Die Zeremonie sollte in zwei Stunden beginnen. Die Planänderung gab wenig Anlass zur Hoffnung, dass er sich hier, auf diesem ländlichen Flecken im Südosten des Großraums Berlin, einen Wagen würde beschaffen können, um noch pünktlich dort zu sein. Bora benutzte das Telefon im Kontrollturm, um seine Verspätung anzukündigen, doch es stellte sich heraus, dass der ihm zugewiesene Fahrer Bescheid wusste und bereits Richtung Schönefeld unterwegs war.
Kaiser-Wilhelm-Institut, Dahlem, 8.55 Uhr
Eilig betrat Bora das überfüllte Auditorium der Universität, kurz bevor die Regierungsvertreter hereinkamen. Er konnte gerade noch seine Mutter Nina begrüßen, als sich auch schon alle erheben mussten, weil der Leiter der Partei-Kanzlei erschien. Auf dem Weg ins Gebäude hatte Bora hektisch seine Orden angelegt. In dem Moment hielt ihn jemand auf, der sich als Dr. Olbertz vorstellte – und offensichtlich auf ihn gewartet hatte. Nur einen einzigen Satz hatte er Bora ins Ohr geflüstert, aber den wurde er jetzt nicht mehr los. Angehörige der Wehrmacht und Parteimitglieder zu begrüßen, hier ein Nicken, da ein Händeschütteln, das alles kam ihm nach diesen Worten seltsam und unangebracht vor. Und er stand noch immer unter dem Eindruck, dass sich ein Sturm zusammenbraute: Die Gerüche wurden intensiver und die Farben greller, eine unheilvolle Erwartung lag in der Luft.
Die Kränze mit den Schleifen, die um den Sarg herum aufgestellt waren, verströmten einen fremdartigen Duft, als ob über die Zweige und Blumen, die keinen Eigengeruch hatten, Parfüm versprüht worden wäre, so süßlich, künstlich und kitschig wie Karneval-Konfetti. Boras Platz war in der ersten Reihe, und er war dankbar dafür, hier an der Seite seiner Mutter stehen zu dürfen – jedenfalls mehr als für das Staatsbegräbnis, das zu einem öffentlichen Spektakel geriet. Sie hatte den schwarzen Trauerschleier zurückgeschlagen und verstieß damit gegen die üblichen Gepflogenheiten, wenn nicht sogar gegen die Etikette, indem sie die ruhige Unerschütterlichkeit ihrer Trauer allen Blicken preisgab. Eine typische Nina-Botschaft. Meinen Schneid hab ich von ihr, dachte er. Olbertz’ hastig hervorgestoßene Enthüllung wäre gar nicht nötig gewesen. Die Andeutungen in dem Zeitungsartikel, den er beklommen gelesen hatte, waren Bora nicht entgangen. Die Aufzählung der Trauergäste aus der Partei hatte mehr Platz eingenommen als die Lebensgeschichte des Verstorbenen. Es hatte ihn nicht weiter überrascht, dass Reinhardt-Thomas Adoptivsohn, der seit acht Jahren in Amerika lebte, nicht erwähnt wurde. Aber der explizite Verweis auf das Jahr 1933, als sein Onkel aus dem Krankenhaus St. Jakob ausgeschieden war, und Saskias Erkrankung gerade zur rechten Zeit (die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machte, kaum zu glauben!) zeichneten ein Bild politischer Unzuverlässigkeit. In Ungnade war sein Onkel zwar nicht gefallen – aber nur, weil man einen angesehenen Arzt nicht in Ungnade fallen ließ, einen Arzt, dem selbst der »großherzige« Führer mit einer persönlichen Botschaft seine Ehre erwies.
Generaloberstabsarzt Dr. Handloser verströmte in seiner Uniform Düsternis. Er las seine Rede von einem maschinenbeschriebenen Blatt Papier ab, das er wie ein königliches Dekret vor sich hielt. »Lassen Sie uns nun unsere Köpfe neigen und unseren stolzen Geist erheben. Lassen Sie uns unsere unermessliche Trauer um diesen ausgezeichneten Kollegen, Lehrer und Suchenden zum Ausdruck bringen – hier vor dem medicus amabilis, dessen Wirken zum Wohle von Wissenschaft und Menschheit über drei Jahrzehnte dem Namen unseres Vaterlands zur Zierde gereicht hat …«
Die Kränze rochen tatsächlich nach Konfetti. Sie wirkten riesig, wie große Räder, die am Streitwagen eines gefallenen Helden lehnten, in diesem Fall an einem luxuriösen Sarg, den die Reichsärztekammer für den Trauerakt besorgt hatte. Die Beisetzung seines Bruders in Russland war vergleichsweise überstürzt und schlicht erfolgt. Heutzutage lernte man, den Grad der politischen Verlässlichkeit eines Verstorbenen am Pomp seines Begräbnisses abzulesen – oder vielmehr umgekehrt. Rechts von Bora stand der Leiter der Partei-Kanzlei höchstpersönlich, sein in den Hemdkragen gepresster fleischiger Nacken ließ ihn wie eine Bulldogge aussehen, die jeden Moment auf jemanden losgehen konnte. In der ersten Reihe saßen außerdem die Mediziner Conti, Steeg, de Crinis und Göring (sämtlich in Parteiuniform). Der alte Professor Bonhoeffer wirkte ergriffen. Goerdeler hingegen, der gerade mit Nina gesprochen hatte, als Bora eingetroffen war, hatte sich noch vor der Trauerrede hinausgeschlichen. Und Albrecht Olbertz stand ganz hinten im Auditorium, noch hinter den Staatsbeamten, den Bürokraten und den Naziärzten, die über einen »nicht so freien Tod« tuschelten und damit die Verlogenheit dieses Tages offenlegten. In der Tat: Es schien ein gewaltiger Sturm aufzuziehen.
»Wir alle, seine Mitarbeiter und Freunde, empfinden ehrerbietigen und innigen Dank, denn wir sehen in Alfred Reinhardt-Thoma die Tugenden unserer Rasse und der medizinischen Wissenschaft in höchstem Maße verkörpert …«
»Ein nicht so freier Tod.« Wenn »Freitod« die beschönigende Umschreibung für Selbstmord war, was war dann ein Tod, der »nicht so frei« eingetreten war? Boras gut kaschierte Beklommenheit kam wohl nicht von ungefähr. Ein übergroßer Saal, wuchtige Kränze, einflussreiche Gäste … Die Dinge (wie auch die Umstände und Ereignisse) schienen dieser Tage größer als sonst. Es sei denn, er irrte sich und war nur überwältigt von den Geschehnissen. Aber eigentlich glaubte er das nicht. Ungeachtet seiner Verwundungen und der militärischen Lage war er tatkräftig wie immer, der kühne und etwas arrogante Draufgänger, dem sein Regiment so großes Vertrauen entgegenbrachte. »Ich diene mit Bora« (oder »unter Bora«, je nach Rang), schrieben die Männer nach Hause oder erwähnten es gegenüber Kameraden aus anderen Einheiten, und die Worte »mein Kommandeur« wurden mit dem unüberhörbaren Stolz ausgesprochen, den alle im Regiment empfanden – außer Martin Bora selbst. Im Sommer 1944, im umkämpften Apennin, wo Deutschland seine letzte Karte in Italien ausspielte, war eine solche Treue nur Ballast für sein Verantwortungsgefühl. Bora sprach es nie laut aus, dachte aber mit einer guten Portion Realismus: Ich werde mein Bestes geben, aber wir können nicht alle gerettet werden.
»Die Stiftung, die den Namen seiner ihm ergebenen Gattin trägt, ist heute und für alle Zeiten ein leuchtendes Beispiel für Spitzenleistungen und uns allen ein Ansporn, dem Weg zu folgen, den er uns so selbstlos und meisterhaft gebahnt hat …«
Rückenstärkung – nur das wollen meine Männer, die Offiziere eingeschlossen. Auf alles Übrige habe ich keine Antwort. Onkel Reinhardt-Thoma ist tot, und ein Sturm zieht auf. Dabei hatte er keineswegs die Hoffnung verloren: Ohne Hoffnung wäre er in Stalingrad gestorben oder neben dem Feldweg, nachdem ihm eine von einem Partisanen geworfene Granate seine linke Hand genommen hatte, oder als Dikta über seinen Kopf hinweg ihre Ehe hatte annullieren lassen. In den vergangenen vier Monaten hatte er sich nicht einmal mehr die Mühe gemacht zu beten. Seit dreißig Jahren war er auf der Welt, sieben davon hatte er als Soldat verbracht und fünf im Krieg. Hoffen konnte Martin Bora nur, solange er nicht versuchte, sich vorzustellen, wie seine Zukunft konkret aussehen sollte.
»Der Himmel über uns beherbergt flüchtige Meteore und ewige Fixsterne. Unser Kollege, unser Kamerad Alfred Reinhardt-Thoma hat sich seinen Platz am unveränderlichen Firmament gesichert. Alfred Reinhardt-Thoma ist nicht tot. In seinem Vermächtnis lebt er für immer fort.«
Nach der Zeremonie wurden Bora und seine Mutter voneinander getrennt, als Kollegen und Freunde sich um sie scharten, um höflich zu kondolieren. Nina konnte ihm gerade noch mitteilen, dass jemand angeboten habe, sie zum Adlon zu fahren. Dort werde sie auf ihn warten. Als kurz darauf die Menge und die Behördenvertreter – die natürlich als Erste aufgebrochen waren – den Saal verlassen hatten, trat erneut jener Mann, der sich als Dr. Olbertz vorgestellt hatte, an Bora heran. »Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie vorhin angesprochen habe«, sagte er brüsk. »Sie kennen mich nicht, Herr Oberst, aber ich habe mit Ihrem Onkel zusammengearbeitet. Vorhin habe ich mich hinreißen lassen und einfach ausgesprochen, was mir durch den Kopf ging … Es war bloß so ein Eindruck.«
Wir, seine Angehörigen, haben die Möglichkeit eines Selbstmords nie in Erwägung gezogen. Diese Worte lagen Bora schon auf der Zunge, doch er bezähmte sich. Höflich wartete er ab, legte dabei aber keine Freundlichkeit an den Tag, nicht zuletzt deshalb, weil der Arzt keine Uniform trug. Dass von ihm keine Reaktion kam, schien Olbertz zu befremden, denn er machte eine knappe Handbewegung, als wäre er ungehalten über sich selbst. »Was zum Teufel, nein, sehen Sie, Herr Oberst, ich weiß ganz sicher, dass es Selbstmord war. Noch am Vorabend habe ich mit Ihrem Onkel gesprochen.«
»Aha. Und hat mein Onkel geäußert, dass er die Absicht hat, sich das Leben zu nehmen?«
»Nicht ganz aus freien Stücken. Das möchte ich damit sagen. Was Sie daraus machen, überlasse ich Ihnen. Aber ich werde stets abstreiten, mit Ihnen darüber gesprochen zu haben.«
Auch darauf ging Bora nicht weiter ein. In diesen Zeiten war Zurückhaltung angebracht. Man musste stets darauf gefasst sein, dass einem eine Falle gestellt oder man provoziert wurde. Kummer oder Wut zu zeigen, stand außer Frage, ja nicht einmal Entrüstung, das hatte ihn seine Arbeit bei der Abwehr gelehrt. Aber ihm fielen mindestens drei Gründe ein, warum Olbertz richtigliegen könnte: Zunächst einmal hatte sich Reinhardt-Thoma geweigert, Parteimitglied zu werden, und die Konsequenzen, die seit 1933 eine solche Weigerung nach sich zog, auf sich genommen. Wegen seines internationalen Rufes hatten sie zwar nicht gewagt, seine Karriere zu zerstören, aber man hatte ihn von hochrangigen Regierungsämtern ausgeschlossen. Außerdem hatte er die Kinder zweier Kollegen adoptiert, die in Schande gestorben waren, einer von ihnen ein Jude. Der Adoptivsohn war schon vor Jahren zum Studium nach Amerika geschickt worden. Dort lebte er immer noch, in Sicherheit. Im Übrigen dürfte es sich schwierig gestalten, ihn vom Tod seines Adoptivvaters in Kenntnis zu setzen: Möglicherweise würde dies nur Großvater Franz-August gelingen, dank seiner alten Verbindungen in diplomatischen Kreisen. Angesichts von Olbertz’ Unbehagen wäre die dritte Möglichkeit die fatalste. Bora verbot sich jeden weiteren Gedanken daran, weil ihm nach seiner Zeit in Polen einige Besuche im Haus seines Onkels nur allzu gut in Erinnerung geblieben waren. Ballastexistenzen – diesen Begriff hatte er damals zum ersten Mal gehört, im Zusammenhang mit medizinischen Praktiken, gegen die der alte Herr Widerspruch erhoben und die anzuwenden er sich geweigert hatte. Dabei stellten die hoch angesehenen Ärzte, die heute ebenfalls zugegen gewesen waren, darunter Karl Bonhoeffer und Leonardo Conti, Theorien darüber auf oder unterstützten entsprechende Forschungen. Wer weiß, vielleicht war Olbertz auch ein Gestapo-Mitarbeiter oder ein Informant. Oder er hatte ihn unverhohlen angelogen.
Bedienstete mussten die Tür zu einem an den Saal angrenzenden Hinterzimmer geöffnet haben, denn plötzlich strich ein Luftzug vorbei, der den künstlichen Konfettigeruch von den Kränzen herbeitrug. War dies ein Vorbote des heraufziehenden Sturms? Bora machte es kurz.
»Ich danke Ihnen, Dr. Olbertz.«
»Gut, man sieht sich«, brummelte Olbertz ebenso kühl und drehte ihm den Rücken zu.
»Man sieht sich …« Von Wehrmachtskameraden wusste Bora, dass Soldaten auf Heimaturlaub sich in Berlin heutzutage für gewöhnlich mit dem Satz »Bleib am Leben, ja?« voneinander verabschiedeten. Kaum war Olbertz gegangen, nahm Bora das Ritterkreuz vom Hals und legte auch die anderen Orden ab. Nur die Kampfabzeichen ließ er an Ort und Stelle. Erst dann trat er auf die Straße.
Es war warm und sonnig – ein Wetter, das Speichellecker als »Führerwetter« bezeichneten, so wie sie es zu Zeiten Wilhelms II. »Kaiserwetter« genannt hatten. Im fünften Jahr des Krieges besagte es, dass sich kein Sturm ankündigte und dass die feindlichen Piloten grünes Licht bekamen. Bora, der gerade aus dem Süden Europas eingetroffen war, empfand die Temperatur als angenehm, vor allem im Schatten der voll belaubten alten Linden. Am Thielplatz stieg er in die Schnellbahn. Vom Leipziger Platz aus ging er zu Fuß weiter zum Adlon. Er beschloss, so zu tun, als wäre er noch nie in Berlin gewesen und hätte hier nicht einen Gutteil seiner militärischen Ausbildung erhalten und Dikta so häufig getroffen. Das hier ist einfach ein Ort, den ich zum ersten Mal besuche, dachte er, über den ich mir kein Urteil erlaube. Mehr als die schweren Schäden an kompletten Häuserblocks, mehr als die verwüsteten Ministerien und ausgebrannten Botschaften fielen ihm Kleinigkeiten auf, und er bemerkte jene Narben, die er aus anderen Städten kannte und für die häufig deutsche Bomben verantwortlich waren: In der Sommerhitze wucherte Unkraut zwischen den Ruinen, Trümmer waren sorgfältig beiseitegeräumt worden, Glasscherben schimmerten wie frostige Fangzähne. Statt Blumenbeeten waren Gemüsegärten zu sehen, würdevolle Brüstungen, die das Nichts überragten, hier und da vielleicht eine einzelne herabgefallene Kachel oder gleich ein ganzes Meer von Kacheln, der unverhüllte Himmel. Gestern Abend, als er darauf wartete, dass die zweite Etappe seiner Reise begann, hatte der Co-Pilot, ein Berliner, ausdruckslos vorgetragen, wie viel gänzlich oder teilweise zerstört worden war. »In Mitte und den umliegenden Vierteln lässt sich leichter aufzählen, was alles noch steht. Wir haben getan, was wir konnten, aber wir konnten nicht …« Er hielt inne. »Mein Bruder war auch Pilot«, hatte Bora zu ihm gesagt. »Morgen ist es auf den Tag genau dreizehn Monate her, dass er über Kursk ums Leben gekommen ist. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ihr alles getan habt, was in eurer Macht stand.« In diesem Krieg hatte er nicht jeden seiner Aufenthaltsorte leicht abschütteln können, einige hatten ihn fasziniert oder eingeschüchtert. Spanien, Polen, Russland, Frankreich, Italien, sogar die wenigen Tage auf Kreta. Jede Front war ihm im Gedächtnis geblieben, häufig auch in seinem Herzen. Dieser Tage jedoch bewegte er sich nur von seinem Kommandoposten zu diesem oder jenem Abschnitt entlang der Verteidigungslinie wie jemand, der weiß, dass er nur auf der Durchreise ist und kein Gefühl für seine Umgebung entwickeln darf – weder Hass noch Liebe. Alles sehen, jede Einzelheit wahrnehmen, aber nur durchreisen.
Im Grunde genommen zog er sich schon seit einiger Zeit mehr und mehr zurück. Das beunruhigte ihn, weil die Bindung an eine Sache oder an einen Menschen ihn bisher am Leben gehalten hatte. Aber Bindungen brachten auch Kummer mit sich. Ohne Bindungen war es leichter zu kämpfen, Widerstand zu leisten, vorausgesetzt, man rechnete nicht unbedingt damit, am Leben zu bleiben. Er konnte sich nur darum bemühen, nicht aus der Rolle zu fallen, damit die anderen nichts merkten – weder die halbwüchsigen Soldaten, die ihn als Erwachsenen betrachteten, noch die Kommandeure, in deren Augen er noch ein junger Bursche war. Seltsam, dass einige seiner Kameraden ihn immer noch für umgänglich hielten: Bora empfand sich keineswegs als unkompliziert. Er verhielt sich gemäß seiner strengen Erziehung und Ausbildung und gab niemals etwas von sich preis, außer in seinem Tagebuch, aus dem er allerdings schon so manche Seite herausgerissen und vernichtet hatte.
12.15 Uhr
Auf dem Leipziger Platz ging es drunter und drüber. Feuerwehrtrupps und der Bombenräumdienst blockierten sowohl die Hermann-Göring-Straße als auch die Leipziger Straße. Anscheinend war man gerade dabei, einen Blindgänger fortzuschaffen, der bei einem Luftangriff drei Wochen zuvor abgeworfen worden war. Bora musste also einen Umweg über die Saarlandstraße machen, um zur Prinz-Albrecht-Straße zu gelangen. Ein kleiner Vorfall, der sich unterwegs zugetragen hatte, beschäftigte ihn noch immer, und nun musste er ausgerechnet am berüchtigten Gestapo-Hauptquartier vorbeigehen und obendrein auch noch an der Verwaltungszentrale der SS, bevor er die Wilhelmstraße erreichte und sich nach Norden wandte.
Die prachtvollen Gebäude entlang der Paradestrecke waren vom Bombenhagel nicht verschont geblieben. Bora nahm nichts um sich herum wahr. Er starrte vor sich hin, fest entschlossen, seiner Mutter zu verheimlichen, was Olbertz zu ihm gesagt hatte. Wozu sollte er sie unnötig beunruhigen?
Der Ehrenhof des Luftfahrtministeriums lag bereits hinter ihm, und er hatte schon fast die Kreuzung mit der Leipziger Straße erreicht (die auch auf dieser Höhe von einer bewaffneten Streife versperrt wurde), als er hörte, wie sich von hinten jemand eilig näherte. Die Person trug Stiefel. Bora gehörte zu jenen Männern, die an der Front stoisch geworden waren. Also drehte er sich nicht um. Wer auch immer das sein mochte, diese Person würde ihn einfach überholen. Am Ellbogen gepackt zu werden, war jedoch etwas völlig anderes: Auf körperlichen Kontakt reagierte er sofort. Erst einige angespannte Momente später erkannte er den Mann, dessen Uniform ihn als Mitglied des deutschen Generalstabs auswies.
»Bora, wusst ich’s doch, dass Sie es sind!«
Irgendwo hatte Bora davon gehört, dass Benno von Salomon inzwischen zum Oberst befördert worden war. Seit ihrer gemeinsamen Zeit in der Gegend von Kursk war ein ganzes Jahr vergangen. Bora salutierte, und nur an dem Blick, mit dem er die Hand bedachte, die seinen linken Arm festhielt, ließ sich seine Verärgerung ablesen. Der Griff wurde gelockert, aber Salomons Kontaktaufnahme war spürbar von Angst geprägt.
»Ich muss dringend mit Ihnen reden. Mit Ihnen reden, verstehen Sie?«
»Aber, Herr Oberst –«
»Scht, scht … Bitte, verhalten Sie sich ganz normal.«
Nichts anderes tat Bora. Salomon hingegen starrte ihn verunsichert an, und obwohl Bora bereits in Russland mitbekommen hatte, dass Salomon bisweilen mit seinen »inneren Dämonen« kämpfte, wie er es nannte, wirkte er diesmal nicht einfach nur beunruhigt: Sein Zustand grenzte an Panik. Bora trat einen Schritt zurück.
»Was ist los, Herr Oberst? Was ist passiert?«, fragte er, obwohl er aus irgendeinem Grund bezweifelte, es wirklich wissen zu wollen.
Erneut ergriff Salomon seinen Arm, was Bora ausgesprochen verärgerte.
»Lassen Sie uns weitergehen. Gehen Sie auf dieser Seite. Lassen Sie uns hier die Straße überqueren. Verhalten Sie sich ganz normal. Da hinüber, zur Kaiserhofstraße.« Warum sie die Straße überqueren mussten, erschloss sich Bora nicht. Auf der anderen Straßenseite türmte sich der Schutt. Von dem einst imposanten Hotel Kaiserhof war nur noch ein ausgebranntes Gerippe übrig geblieben – alles reif für die Müllhalde, samt dem bogenförmigen überdachten Eingangsbereich. Der vergoldete Schriftzug auf der Fassade hatte mit einem Kaiserhof ebenso wenig gemein wie die Straße und das Etablissement, das einst diesen Namen getragen hatte. Auf der gegenüberliegenden Straße war eine Reihe junger Bäume enthauptet worden, dort standen nur noch Stümpfe.
»Rasch, Bora, sagen Sie mir: Ist Ihnen die volle Bedeutung des Wortes ›Eid‹ bekannt, ist Ihnen Loyalität ein Begriff?«
Bora traute seinen Ohren nicht. Die Frage war hier fehl am Platz, aber ihn beunruhigte nicht, dass die Antwort auf der Hand lag; bedenklich war vielmehr, dass Salomon einzelne Wörter mit Nachdruck versehen hatte.
»Ja, natürlich.«
»Diese Begriffe sind nicht eindeutig. Es gibt nicht nur eine Art von Loyalität. Genau das erschwert das Leben von Männern, von Offizieren … von uns allen. Letztlich sind es nur Wörter.«
Ich habe Philosophie studiert – mit Nominalismus kenne ich mich aus, dachte Bora. Wenn Prinzipien zu bloßen sprachlichen Ausdrücken verkamen, lauerte Gefahr für die Moral. Er erwiderte nichts, weil eine Meinungsäußerung nicht zwangsläufig eine Antwort erforderte. Sein Schweigen mochte ihn wie einen politisierten jungen Offizier wirken lassen, der er nicht war, oder zumindest nur teilweise. Aber unverhohlene Angst rief in ihm kein Mitgefühl hervor. Er trat zur Seite und befreite sich dabei aus Salomons Griff.
»Ich möchte –« Der ehemalige Rechtsanwalt mit dem Hundegesicht unterbrach sich mitten im Satz und blinzelte im Sonnenlicht. Nicht einmal im Hochsommer bräunte seine Haut; Bora erinnerte sich gut an diese Eigenheit. Heute jedoch war er eher grün im Gesicht. »Ich muss mit Ihnen sprechen.«
Bora bemühte sich, ihn nicht zu erstaunt anzustarren. Kein Zweifel: Ein Wetterumschwung stand kurz bevor, das spürte er. Dass er nun seinem ehemaligen Kommandeur gegenüberstand, ohne ihn zum Sprechen zu ermutigen, würde den Mann entweder davon abhalten, unerfreuliche Bekenntnisse abzulegen, oder aber ihn dazu verleiten, sich leichtfertig ausführlich zu äußern.
Mit einem gestärkten Taschentuch wischte sich Salomon die Schweißtropfen von der Oberlippe, und als er es wieder einstecken wollte, verfehlte er zunächst die Tasche in seiner Stiefelhose. Wie Bora aus seiner Zeit in Rom wusste, brachten die karmesinroten Lampassen, die einem Generalstabsoffizier zustanden, Vorrechte wie auch Beschränkungen mit sich. Gelegentlich auch Risiken, wenn man bereit war, diese einzugehen.
»Ich muss unbedingt unter vier Augen mit Ihnen reden, Bora. Wann sind Sie angekommen? Wie lange werden Sie in Berlin bleiben? Wo sind Sie untergebracht?«
Eine Lüge war besser als die halbe Wahrheit. »Ich weiß noch nicht, wo ich einquartiert werde. Ich werde nur ein paar Stunden hier sein, also sollten wir besser jetzt gleich reden, Herr Oberst. Wir sind im Freien, und es ist niemand zu sehen. Hier scheint es sicher zu sein.«
»Nein. Nicht hier. Und ›Sicherheit‹ ist nur eine Aneinanderreihung bedeutungsloser Buchstaben.«
Noch mehr Unfug. Bora musste nun einfach eine naheliegende Frage stellen.
»Fühlen Sie sich nicht wohl?«
»Seit drei Tagen schon muss ich mich immer wieder erbrechen. Das ist schlimmer als 1941.« Das gestärkte Taschentuch kam wieder zum Vorschein. »Urteilen Sie selbst.«
Wenn es so um den Mann stand, sollte er auf keinen Fall fragen, ob er irgendetwas tun könne. Er schwieg also. Wo verlief die Grenze zwischen Salomons Erschöpfung und einer echten Bedrohung? Bei einem Mann wie ihm war alles denkbar, von einem kleinen privaten Skandal bis hin zu einer schändlichen Krankheit oder einer ganz und gar unvorstellbaren Extremsituation, in die ein kriegsmüder deutscher Offizier im Jahr 1944 geraten mochte und die Bora gedanklich nicht einmal streifen wollte. Bitte sagen Sie mir, worum es geht, wollte er schon drängen.
Doch der Oberst ersparte ihm die Mühe. »Fritz-Dietlof von der Schulenburg ist an mich herangetreten.«
Diese wenigen, scheinbar sachlichen Worte, die leise hervorgepresst wurden, versetzten Bora in höchste Alarmbereitschaft. Bereits 1941 war er (ausgerechnet auf Kreta) vor den linksgerichteten Schulenburgs gewarnt worden. Fritz-Dietlof war damals Regierungspräsident der Provinzen Ober- und Niederschlesien gewesen, sein Onkel Botschafter in Moskau. Bora hatte in seiner Zeit bei der Abwehr in Moskau den Befehl, Schulenburgs Telefonate in der Botschaft zu überwachen – was er auch getan hätte, wenn dieser nicht ungefähr zeitgleich aus der Sowjetunion ausgewiesen worden wäre.
»Der jüngere Graf von der Schulenburg hat durch Oberst Claus von Stauffenberg von Ihnen gehört. Es ist ein Glücksfall, Ihnen heute hier zu begegnen.«
Nun musste er energischer auftreten. »Verzeihen Sie, warum sollte Oberst von Stauffenberg mich Fritz-Dietlof von der Schulenburg gegenüber erwähnen? Ich kenne keinen der beiden persönlich. Claus von Stauffenberg habe ich ein einziges Mal getroffen, bei einem Sportwettbewerb, und das ist Jahre her.«
»Wissen Sie, dass er Stabschef des Befehlshabers des Ersatzheeres ist?«
»Ja, das weiß ich, Herr Oberst, aber mir ist immer noch nicht klar, warum er mich gegenüber Graf von der Schulenburg oder sonst jemandem erwähnen sollte und warum diese Tatsache Sie derart zu beunruhigen scheint.«
Rosiger Staub stieg von dem gespenstisch aussehenden Hotel Kaiserhof auf, als ein Ziegelstein lautlos aus einem Fensterrahmen fiel. Salomon gab keine Antwort.
»Ich logiere im Adlon – jedenfalls bis heute Morgen noch. Sie doch auch, richtig? Ich hörte, Ihre werte Frau Mutter sei dort ebenfalls abgestiegen.«
»Ihre werte Frau Mutter …« In einer Straße wie dieser, wo es aussah wie auf dem Mond, wirkten derart altmodische Höflichkeitsfloskeln fehl am Platze. Bora verhielt sich ebenso undurchschaubar wie bereits Olbertz gegenüber. »Wie schon gesagt, Herr Oberst, ich werde Berlin sehr bald wieder verlassen. Wenn Sie mir etwas Vertrauliches oder Dringliches mitteilen möchten, dann tun Sie es bitte jetzt. Ich bin in Eile.«
»Nein, auf keinen Fall. Ich werde es Ihnen nicht hier und jetzt sagen. Belassen wir es dabei. Heute Abend … Sie reisen doch nicht vor heute Abend ab, oder?«
»Ich glaube nicht.«
»Ich werde Sie schon ausfindig machen.«
Bora sah ihm nach, wie er in Richtung der ausgebrannten Dreifaltigkeitskirche eilte. Er schlug Haken wie ein Hase, der vor einem Fuchs flieht. Zu allem Überfluss jetzt auch noch so etwas. Das hatte ihm gerade noch gefehlt. Nun hatte er es umso eiliger, seine Mutter zu treffen, denn auch sie würde bald wieder abreisen, jedenfalls sobald ein Zug halbwegs sicher nach Leipzig fahren konnte.
Bedrückt setzte Bora seinen Weg durch die verwüsteten Straßen fort. Was in dem Viertel von den Luftangriffen Anfang März verschont worden war, hatten die Bombenabwürfe vom 21. Juni vollbracht. Kaum ein Ministerium war unversehrt geblieben, ganz zu schweigen von der Alten und der Neuen Reichskanzlei. Und schon vor über einem Jahr war die St.-Hedwigs-Kathedrale ausgebrannt. Dort hatte die Familie Bora bei ihren Aufenthalten in Berlin immer die Messe besucht.
Hotel Adlon, Pariser Platz, 13.10 Uhr
Wenigstens stand das Adlon noch. Das zugemauerte Erdgeschoss, eine massive Wand, die die berühmten Bogenfenster vollständig verdeckte, ließ das Gebäude wie eine reizlose chinesische Festung wirken, die aus einem Trümmermeer emporragte. Ob sich die heiteren Masken aus Fassadenstuck, die einst die Bögen geziert hatten, wohl noch hinter den Ziegelsteinen erhalten hatten? In Anbetracht der Erinnerungen an Dikta, die für immer mit dem Adlon verbunden waren, betrachtete Bora auch das Hotel sicherheitshalber so, als sähe er es zum ersten Mal. Nach Ausbruch des Krieges (zu der Zeit hatte Bora sich gerade der Schulung bei der Abwehr unterzogen und später Gastvorträge in der Kriegsakademie gehalten) hatten sich immer wieder Jungs und Mädchen vor dem Hoteleingang eingefunden, die Autogramme haben wollten. Sie verschlangen die Zeitschriften Signal und Der Adler und sammelten die signierten Konterfeis der erfolgreichsten Flieger und Soldaten, die mit dem begehrten Ritterkreuz ausgezeichnet worden waren. Wie Pokerspieler blätterten sie durch die Postkarten mit Porträts und spionierten die Offiziere aus, die im Adlon ein und aus gingen. Starb der Porträtierte später den Heldentod, gewannen die Karten offenbar an Wert. Diese Mythenbildung war Bora inzwischen zuwider. Es hatte ihn geärgert, dass in sämtlichen Leipziger Tageszeitungen darüber berichtet worden war, als er in Kiew das Ritterkreuz erhalten hatte. Das ließ sich jedoch kaum vermeiden, wenn der eigene Großvater Verleger war – auch wenn es den Journalisten womöglich nur darum ging, diesem zu schmeicheln. Sein Stiefvater pflegte zu predigen, dass ein Ehrenmann nur anlässlich seiner Geburt und seines Todes in einer Zeitung erwähnt werden sollte.
Derzeit allerdings bestand keine Nachfrage nach Autogrammen. Bora bemerkte nur einige Schulmädchen, von denen lediglich eine Handvoll halbwegs gut gekleidet war, und selbst deren Kleidung war entweder zu kurz oder zu eng. Säume und Ärmelaufschläge waren mit Spitze versehen worden, damit die Kleidungsstücke noch eine weitere Saison hielten. Es beeindruckte Bora, dass die Berlinerinnen trugen, was immer sie finden konnten, sogar Stoffe, die eigentlich für Abendkleider gedacht waren, wie Satin und anderes glänzendes Material. Schließlich hatte ein Viertel von ihnen kein Dach mehr über dem Kopf, geschweige denn, dass sie einen Kleiderschrank besaßen. Von den Frauen, die er in der U-Bahn oder in den Schlangen vor Geschäften und Kaufhäusern beobachtet hatte, hoben sich die Huren wie Tropenvögel ab. Strumpfhosen aus Seide oder Nylon, hohe Absätze, das Aufblitzen eines spitzenbesetzten Unterkleids, wenn sie in den Bus stiegen – die schönen Waffen der Frauen, die Männer so mochten (Bora eingeschlossen), sah man nur allzu oft an Mädchen, die frech ihre Zunge über die Zähne gleiten ließen, nachdem sie die rote Farbe auf ihren Lippen aufgefrischt hatten. Sein Stiefvater äußerte sich abfällig über die »Vernuttung« – das Wort hatte er sich selbst ausgedacht – französischer Mädchen im Weltkrieg. Damals war er bereits zum Katholizismus übergetreten und verzehrte sich – ein bigotter frisch Bekehrter – nach der jungen Witwe Bora, die sich Zeit ließ, ehe sie einer erneuten Heirat zustimmte. Für General Sickingen war mit Ausnahme seiner Frau und seiner Schwestern jede Frau eine potenzielle Nutte.
War es denn wirklich so? Obwohl Bora ein Gutteil seines Lebens in Kasernen und an der Front zugebracht hatte, führte er das Wort »Nutte« nur selten im Munde. Vielleicht lag es daran, dass man seiner Meinung nach eine Frau nicht derart bezeichnen konnte, wenn nicht mindestens ein Mann zugegen war.
Obwohl das Innere des Hotels in ein Halbdunkel gehüllt war, vermittelte sich dem Eintretenden doch eine gewisse Kultiviertheit. Den Portier kannte er noch von seinen Aufenthalten mit Dikta her – er war nur stärker ergraut und wirkte wie ein desillusionierter, entschlossener Kapitän, dessen Schiff im Sinken begriffen war, der aber auf keinen Fall die Fahne einholen würde. Er erinnerte sich an Bora. In seinem untadeligen Gruß lag ein Wiedererkennen, dem nichts Unterwürfiges anhaftete. Beide waren insgeheim überrascht, dass der andere in der Zwischenzeit nicht gestorben war. Der Mann beantwortete Boras Nachfrage mit einem knappen soldatischen Nicken und sagte, ja, Baroness Sickingen sei da. Ob er sie auf ihrem Zimmer anrufen solle?
»Ja, bitte.«
»Ihr Schlüssel, mein Herr.«
Dass das Innenministerium ihm dankenswerterweise einen Wagen an den Flughafen geschickt hatte (wenn auch an den falschen) und ihm ein Bett in Berlins führendem Hotel zur Verfügung stellte, war höchst ungewöhnlich. Dahinter mochte tatsächlich das Bestreben stecken, Reinhardt-Thomas Tod natürlich aussehen zu lassen.
»Bitte benachrichtigen Sie mich, sobald ein Anruf vom Schönefelder Flugplatz für mich eingeht«, sagte er.
Das Blaue Zimmer, das früher so lichtdurchflutet gewesen war, wirkte ziemlich düster, weil die französischen Fenster verdunkelt waren. Das konnten auch die Wandleuchten nicht wettmachen. In diesem Raum ging Bora nun auf und ab, während er auf seine Mutter wartete. Bei der Trauerfeier hatten sie bloß nebeneinandergestanden. Aber hier würden sie sich nun wirklich begegnen, und die Kluft, die sich mit dem Tod seines Bruders Peter und seiner eigenen Verstümmelung zwischen ihnen aufgetan hatte, ließ sich nicht mehr ignorieren. Sie musste irgendwie überbrückt werden.
Als Nina eintrat, hatte er das Zimmer gerade halb durchquert. Er blieb abrupt stehen, dann machte er kehrt, um sie zu begrüßen. Sie kam auf ihn zu. Er schlug die Hacken zusammen und küsste ihre Hand. Diesen förmlichen Ablauf brauchte er, damit er sie danach umso ungezwungener umarmen konnte. Glücklicherweise vermochten sie mit Blicken auszudrücken, wofür sie keine Worte fanden. Nina konnte nicht an sich halten und fragte: »Wie geht es dir, Martin?« – »Gut«, sagte er sofort, und sie drang nicht weiter in ihn. Dann folgten einige beflissene Phrasen zu den Neuigkeiten, die unter diesen Umständen zu erwarten waren. Wie es zu Hause gehe – und, ja, wie plötzlich Onkel Reinhardt-Thoma ihnen genommen worden sei. Die Worte trieben wie nutzlose Fremdkörper über ihren eigentlichen Gefühlen. Es stimmte Bora traurig, Nina in Schwarz zu sehen, das sie nicht nur wegen Peter trug, sondern jetzt auch wegen seines Onkels.
Sie ging voran zu einem kleinen Tisch. Die eleganten Lehnsessel von früher ließen ihre Begegnung in dieser zerbombten Stadt weniger absurd wirken.
»Man hat mich wissen lassen, dass die Beisetzung so rasch wie möglich erfolgen soll«, sagte sie. »Bei Nacht, zusammen mit anderen.«
Als sie am Kamin vorbeiging, spiegelten sich in den glänzenden Quadraten über der Feuerstelle flüchtig ihr schlanker Hals und ihre schmale Schulterpartie, und einen Augenblick lang wirkte es, als würde ihre zierliche Doppelgängerin ein angrenzendes Phantomzimmer durchschreiten. »Als Nächstes muss ich Saskia aufsuchen, wenn es möglich ist.«
»Ich komme mit.«
»Ich gehe besser allein hin, Martin. Frau Sommer, die Sekretärin deines Onkels, wird mich in einer halben Stunde mit dem Auto abholen und mich ins Krankenhaus Wilmersdorf begleiten. Saskia liegt auf der Station für Infektionskrankheiten, musst du wissen.«
Bora, der einige Schritte entfernt von ihr stand, ging zur Tür und schloss diese.
»Warum, was ist denn los?«
»Ich vermute, es war die einzige Möglichkeit, die ihr einfiel, um der Trauerfeier fernzubleiben. In der letzten Zeit haben sie es nicht leicht gehabt.«
An dieser Stelle hätte Bora einhaken und von Olbertz’ Geschwätz berichten können, unterließ es aber. Er ahnte, dass Nina ihrerseits Getuschel von den Krankenschwestern zu Ohren gekommen war, das sie ihm aus irgendeinem Grund verheimlichte. Er hätte die knappe Zeit mit seiner Mutter in Berlin gern so gut wie möglich genutzt, aber ihm war auch klar, dass sie sich in Dahlem um einiges kümmern musste.
Sie setzte sich und forderte ihn auf, es ihr gleichzutun.
»Martin, vor der Trauerfeier hat mir Dr. Goerdeler eine Botschaft für dich anvertraut.«
»Ach, tatsächlich?«
Normalerweise ließ Bora sich nicht anmerken, wenn er überrascht war, aber in diesem Fall konnte er es sich leisten, seine Gefühle zu zeigen. Nina war die Verschwiegenheit in Person. Ihre kleine Handtasche, die Handschuhe, die zarte Puderschicht auf ihrem Gesicht – ihre elegante Erscheinung speiste sich aus bewusster Zurückhaltung.
»Ja. Heute Abend sollst du dich um einundzwanzig Uhr im Büro von Arthur Nebe, dem Chef der Kriminalpolizei, melden.« Sie atmete einmal durch. »Carl-Friedrich wirkte nicht beunruhigt, also ist es wohl eine reine Routineangelegenheit …«
Diesmal fiel es Bora schwer, ungerührt zu bleiben. Eine Routineangelegenheit? Was daran könnte Routine sein, wenn mich der Chef der Kripo einbestellt, der zufälligerweise auch SS-Gruppenführer und Direktor des Internationalen Büros der Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission ist?
»Hat er sonst noch etwas gesagt, Nina?«
»Nur dass du dir keine Sorgen zu machen brauchst und den Personaleingang nehmen sollst.«
Das ergab doch alles keinen Sinn. Wenn seine Mutter sich ängstigte (was gut sein konnte), verbarg sie es ihm zuliebe. Auch Bora bewahrte Haltung.
»Also gut. Wir werden ja sehen, was Gruppenführer Nebe will.«
Dabei war ihm ziemlich mulmig zumute, erst recht nach der Begegnung mit Salomon. Nebe war ihm seit dessen Zeit im Osten bei der Einsatzgruppe B, einer Todesschwadron, ein Begriff. Der Gedanke, aus freien Stücken in Nebes Büro zu marschieren, behagte ihm nicht im Geringsten. Nur zu gern hätte er sich eingeredet, dass er sich mit seinen Ansichten nicht in Schwierigkeiten gebracht hatte, aber das wäre gelogen gewesen – obwohl diese Schwierigkeiten in den Verantwortungsbereich der Gestapo fielen, nicht in den der Kriminalpolizei. Nur eines beruhigte ihn ein wenig: dass Carl-Friedrich Goerdeler der Überbringer war, ein ehemaliger Beamter, der bei der Partei nicht gut angeschrieben war. Wenn Nebe ihm die Botschaft anvertraut hatte anstatt einem seiner uniformierten Schlägertypen, dann musste es einen guten Grund dafür geben. Wieder kamen ihm Olbertz’ geflüsterte Worte in den Sinn, und obwohl er sie seiner Mutter verschwieg, sagte er doch: »Das könnte etwas mit Onkel Alfred zu tun haben, Nina. Sofern seine Klinik und sein Wohnhaus noch stehen, wer weiß, vielleicht hat in der Nacht jemand versucht einzubrechen.«
»Meinst du? Ja, vielleicht.«
Sie saßen so nah beieinander, dass sie die Hand des anderen hätten ergreifen können, wenn sie sich ein wenig vorgeneigt hätten. Aber Bora hielt sich bewusst zurück, weil dies Ninas offensichtliche Bemühungen zunichtemachen könnte, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten. Also saßen sie da und sahen einander an – in gegenseitiger Wertschätzung. Dabei war ihm klar, dass er sogar jetzt, selbst in ihrer Gegenwart, weiter auf Distanz ging. Er zwang sich, höflich Konversation zu machen, und erkundigte sich nach seinem Stiefvater, dem General (den Nina als seinen Vater bezeichnete), dem Befinden seiner Großeltern, nach Peters Frau Margaretha samt Baby sowie nach ausgebombten Freunden, die sich im Haus der Familie in Borna aufhielten. Er war überrascht zu hören, dass seine Schwägerin aus dem Haus in der Birkenstraße ausgezogen war.
»Sie ist ins Haus ihrer Eltern in Esterwegen zurückgekehrt, Martin.«
»Oh. Weiter im Westen auf dem Land ist es sicherer.«
»Wohl wahr.«
»Und wie geht’s dem Berliner Ableger des Bora Verlags …?«
Nina zog bedächtig ihre Handschuhe aus und legte sie auf ihren Schoß, wo sich bereits ihre kleine Handtasche befand. »Wie erwartet hat der Luftangriff im Juni den Verlagssitz im Zeitungsviertel völlig zerstört, und auch das Stadthaus von Großvater Franz-August wurde schwer getroffen. Aber die Druckerei draußen in Potsdam läuft weiter. Leopardis Opera omnia erscheint in der nächsten Woche, mit einem Vorwort von Ungaretti, dem Dichter.«
»Ungaretti, richtig. Er lehrt inzwischen in Italien, oder?«
»In Rom, glaube ich.«
Bora nickte. Es fiel ihm schwer, seine Schulterpartie zu entspannen oder seinen Blick von Nina zu wenden. »Auf Distanz zu gehen« schützte einen nicht vor dem Schmerz. Von einem Moment zum anderen konnten Worte unerheblich erscheinen oder unerträglich schwer, gingen sie leicht über die Lippen oder gar nicht. Je voller das Herz ist, desto weniger vermag es sich auszuschütten. Sonderbarerweise erschien ihm seine Mutter umso schöner, je mehr er innerlich auf Abstand ging – doch Bora konnte ihr kein entsprechendes Kompliment machen. Er hatte Angst, sie zu verletzen, ganz gleich, was er sagte. Vor allem mochte er sie nicht auf ihre Trauer ansprechen. Der Tod seines Bruders war auch ein Grund dafür, dass er sich nicht öffnete.
»Bitte richte Saskia liebe Grüße aus.«
»Selbstverständlich.«
»Und frag sie, ob sie irgendetwas braucht.«
»Das werde ich tun.«
Seine eigenen Verwundungen, das Ende seiner Ehe, das Wissen darum, dass er mit seiner politischen Einstellung in Gefahr war, wirkte belanglos im Vergleich zu dem Verlust, den Nina, den die ganze Familie erlitten hatte. Sie hat einen ihrer beiden Söhne verloren, und ich werde für immer »der andere« sein – ich wurde zum »anderen«, als es geschah, und ich werde für immer derjenige sein, der anstelle von Peter hätte sterben sollen. Wenn ich mir das schon nicht verzeihen kann, wie sollten es dann meine Eltern können? Dieser Gedanke überwältigte Bora, und er wappnete sich gegen eine Gefühlsaufwallung. Er war selten zu Tränen gerührt. Wenn er sich recht entsann, war er zwölf Jahre alt gewesen, als seine Mutter ihn zuletzt weinen sah. Es erstaunte ihn, dass sie nicht weinte. Dabei musste es unerträglich für sie sein, ihn hier sitzen zu sehen, während Peter tot war. Wäre ich an seiner Stelle gestorben, wären sie immer noch eine vollständige Familie – Vater, Mutter, Sohn. Nun sind wir zwei verstümmelte Familien: meine Mutter und der General sowie meine Mutter und ich.
»Hast du in letzter Zeit etwas von unseren Freunden in Ostpreußen gehört, Nina?«
»Nicht direkt. Einer der Modereggers hat geschrieben, dass es ihnen gut gehe.«
Als Nina ihre Handtasche öffnete, um die Handschuhe wegzustecken, erhaschte er einen flüchtigen Blick auf ein stilvolles Zigarettenetui. Früher hatte sie nicht geraucht, also verstieß sie inzwischen offensichtlich gegen einen der Befehle des Generals, der einer gesunden Lebensführung anhing. Dafür stieg sie gleich noch mehr in Boras Achtung.
Da saßen sie nun also, die Angehörigen eines Mannes, an dessen Tod möglicherweise das Regime schuld war, während einige Häuserblocks weiter eine Fliegerbombe entschärft wurde und er eine Vorladung von Arthur Nebe für den Abend hatte, doch er erkundigte sich bloß höflich nach ihren Freunden. Jeder von uns schützt sich wohl, so gut es geht. Sie wartet darauf, dass ich etwas sage, und weiß genau, dass ich es nicht kann. Also wartet sie, ohne mich zum Sprechen zu ermuntern. Mit einem Gefühl der Dankbarkeit, der Erleichterung warf Bora einen bewundernden Blick auf die Hände seiner Mutter. Sie legte nur selten Schmuck an, und dies war weder der rechte Zeitpunkt noch der rechte Ort, ihn zur Schau zu stellen. An ihrer rechten Hand trug sie nur ihren Ehering und einen alten Ring aus Familienbesitz. Diesen Ring hatte sie eigentlich Dikta am Tag der kirchlichen Trauung mit Bora schenken wollen. Doch der General, der die Verbindung nie gutgeheißen hatte, hatte es ihr untersagt. Inzwischen wunderte sich Bora darüber, dass sie sich damals gefügt hatte, weil seine Mutter keine Frau war, die sich etwas vorschreiben ließ. Wahrscheinlich hatte auch sie Dikta nicht gemocht. Sogar damit habe ich sie enttäuscht, wie ich sie auch damit enttäuscht habe, dass wir keine Kinder bekommen haben … Dann wurde ihm klar – und es war ein unsanftes Erwachen –, dass Nina möglicherweise von Diktas Abtreibungen gewusst, es ihm gegenüber aber nicht erwähnt hatte. Ja, Nina muss von den Abtreibungen gewusst oder zumindest eine Ahnung gehabt haben. Als sie mir noch vor Stalingrad schrieb, dass »Dikta sich nicht wohlfühle«, lag das an ihrer Schwangerschaft. Natürlich. Und als daraus schließlich nichts wurde, muss sie geargwöhnt haben, dass Dikta beschlossen hatte, das Kind nicht auszutragen, sofern sie keine Fehlgeburt erlitten hatte. Das hat mir Dikta in Rom erzählt – damit wollte sie mir den Todesstoß versetzen, damit ich mich von ihr trennte und sie freigab. Und nun ist sie frei und ich nicht.
Bora betrachtete seine Mutter mit dem unrühmlichen Bedürfnis, ihr seinen Schmerz zu gestehen, wollte diesem aber auf keinen Fall nachgeben. »Je voller das Herz ist …« Was auch immer geschehen mag, was auch immer die merkwürdigen Begegnungen des heutigen Tages bedeuten mögen, für mich geht es danach zurück an die Front. Machen wir uns doch nichts vor: Vielleicht sehen wir uns in diesem Leben nicht mehr wieder. Im Zwiegespräch mit sich selbst verwendete er dieselben Argumente, derer er sich auch bei Vernehmungen feindlicher Gefangener bedient hätte. Letztlich lief es immer mehr oder weniger auf einen Satz hinaus: »Sie sollten jetzt besser mal den Mund aufmachen.«
In den Kacheln über dem verrammelten Kamin – damit sollte verhindert werden, dass nach einem Luftangriff Rauch und Trümmerteile über den Schornstein ins Zimmer gelangten – spiegelte sich die gegenüberliegende Wand. Darüber hing ein Gemälde, das fast bis zur stuckverzierten Decke reichte und auf dem sich zwei Mädchen in einer unglaublich idyllischen Landschaft räkelten. Bora betrachtete die geschmackvolle Einrichtung und drückte sich weiterhin davor, zur Sache zu kommen. Schließlich setzte er gezwungenermaßen doch an: »Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass Peters Frau bei euch bleiben würde.« Margaretha zog gerade aus dem Haus ihrer Schwiegereltern aus, wo sie genau wie Dikta seit ihrer Eheschließung gewohnt hatte. »Ich hoffe, es hat nichts damit zu tun, dass Dikta abgereist ist. Mir ist bewusst, wie nah sich die beiden standen.« Eigentlich wollte er damit sagen: »Ich hoffe, Dikta hatte keinen schlechten Einfluss auf sie, zumindest nicht in deinen Augen.«
»Ja, die beiden standen sich tatsächlich nah«, stimmte Nina ihm zu. Sie war zu taktvoll, um Boras Worte zu kommentieren, nutzte aber die Gelegenheit, ihm etwas zu sagen, ohne ihn dabei anzublicken: »Als du mir vor einigen Monaten geschrieben und mich gebeten hast, deine Frau zu fragen, ob sie dich liebe, hat Benedikta zuerst nur gelächelt. Du kennst ihr Lächeln. Dann hat sie geantwortet: ›Natürlich.‹ – ›Aber liebst du ihn auch genug, um ein Kind von ihm zu bekommen?‹, wollte ich wissen. ›Nina, ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind, Kinder zu bekommen.‹ – ›Martin ist es.‹ – ›Ich bin es nicht. Aber ich liebe ihn wirklich. Liebst denn du deinen Ehemann?‹«
Dass sie so schnell am springenden Punkt waren, versetzte Bora einen schmerzlichen Stich – auch diese Reaktion wollte er sich auf keinen Fall anmerken lassen. An Ninas Blick las er ab, dass sie seine leise Erwiderung nicht verstanden hatte, und wiederholte: »Das war respektlos von ihr«, als ob das Gespräch die ganze Zeit um Diktas Unverfrorenheit gekreist wäre und er es nun abbrechen könnte.
»So war Benedikta eben, Martin. Als du im September aus dem Hinterhalt angegriffen und verwundet worden warst, war das für sie der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Sie war noch verzweifelter als während deiner Zeit in Stalingrad, weil deine Verwundung so schwer war. Ich hatte gehofft, sie würden dich heimschicken. Aber dein Vater hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass du darum gebeten hattest, nicht nach Deutschland geschickt zu werden, und dich lieber in Italien im Krankenhaus behandeln lassen wolltest. ›Er hat recht. Er ist Soldat und möchte nicht riskieren, nach Deutschland gebracht zu werden, um dann eine Schreibtischarbeit zugewiesen zu bekommen. Ich verstehe ihn, und kann das nur befürworten.‹ Daraufhin ließ uns Benedikta unmissverständlich wissen, dass es so nicht weitergehen könne und sie bereits einen Antrag auf die Annullierung eurer Ehe gestellt habe. Das war der eigentliche Grund für ihre bevorstehende Reise nach Rom. Dein Vater wurde so wütend, dass er sie geohrfeigt hat.«
»Das hätte er nie und nimmer tun dürfen.«
Geistesabwesend strich Nina über die Manschette ihrer Bluse, als wolle sie Boras Vorwurf ausbügeln.
Wieder hatte er einen Rückzieher gemacht und sich vor dem Wesentlichen gedrückt. Aber dann gestand Nina etwas ein – sei es, weil sie das Gefühl hatte, freier sprechen zu können, oder weil sie ihn ablenken wollte: »Ich kann Benedikta gar nicht genug danken für ihr Verhalten, nachdem Peter über Russland abgeschossen worden war.« Nina richtete sich auf, um sich der Erinnerung zu stellen. »Als vor dreizehn Monaten dein Anruf mit den furchtbaren Neuigkeiten kam, waren Benedikta und Margaretha gerade unten im Garten. Margaretha war hochschwanger, das Baby sollte in wenigen Tagen kommen, wir haben Peter zur Geburt in Leipzig erwartet … und es reichte, dass dein verzweifelter Vater Benedikta einen Blick durchs Fenster zuwarf. Sie hat sofort verstanden, dass ein Unglück geschehen war und dass es Margaretha betraf. Ich weiß nicht, wie, aber sie schaffte es, sich nichts anmerken zu lassen und auf ihre verständige Art ihre Schwägerin zu einem langen Spaziergang zu überreden. Das tat sie, damit wir eine oder zwei Stunden ungestört trauern konnten. Und so hat sie erst einen Monat später davon erfahren, als keine Gefahr mehr für die Gesundheit von Mutter und Kind bestand.«
»Das wusste ich nicht.«
»In den Wochen danach war Benedikta einfach großartig. Sie war mir so eine große Hilfe, Martin. Sie verschwieg Margaretha, was geschehen war, und erzählte ihr, dass alle Heimaturlaube gestrichen worden seien. Auf diese Weise konnte sie Margaretha geschickt von deinem Vater fernhalten, der schweigsam und in sich gekehrt war.«
Sie wusste immer das Richtige zu sagen. Bora starrte auf den Boden.
»Hat Benedikta dir das nicht erzählt?«
»Nein.«
»Es tut mir leid, dass ihr beide nicht mehr zusammen seid.«
Diese Worte erfüllten Bora mit tiefer Dankbarkeit und brachten seine Entschlossenheit ins Wanken. Er konnte sich aber nicht dazu durchringen zu sagen, dass es ihm auch leidtat. Das Thema bereitete ihm körperliches Unbehagen. Nina bemerkte es und verstummte.
»Ich muss dir noch etwas anderes sagen, weil du dich bestimmt schon gewundert hast: Vor Stalingrad zeigte Benedikta ganz ähnliche körperliche Symptome wie Margaretha … und, nun ja, Margaretha war ja tatsächlich schwanger. Nach einer Auslandsreise, die Benedikta mit ihrer Mutter unternommen hatte, waren diese Symptome verschwunden. Die Gesundheit junger Frauen ist unberechenbar. Du verstehst sicher, dass eine Vermutung nicht genügte … und dann beanspruchte Peters Frau den Großteil unserer Aufmerksamkeit. Du warst in Stalingrad, und da konnte ich einfach nicht …«
»Danke, Nina, dass du es mir damals nicht gesagt hast.«
Kurz darauf wurden sie durch ein leises Klopfen an der Tür abgelenkt. Davor stand kein Hotelpage, nein, der Portier höchstpersönlich öffnete die Tür einen Spalt, um zu verkünden, dass eine Frau Sommer für die Frau Baronin eingetroffen sei.
»Danke«, sagte Nina. »Ich komme gleich zu ihr hinunter.«
Bora sprang auf und bot seiner Mutter an, sie zum Auto zu begleiten. Er wollte die gemeinsame Zeit so lange wie möglich ausdehnen.
Unten im Foyer, als sie schon drauf und dran war, in den blendend hellen Tag hinauszutreten, zögerte sie und drehte sich zu ihm um. Leise sagte sie zu ihm auf Englisch, ihrer Muttersprache: »Dein Vater hat mir dringend davon abgeraten, danach zu fragen, aber – er hat nicht gelitten, oder?« Was so viel bedeutete wie: »Sag mir bitte, dass Peter nicht leiden musste.«
Wie sehr musste es sie in der vergangenen halben Stunde danach verlangt haben, diese Frage zu stellen! Stattdessen hatte sie über den Sohn gesprochen, der noch am Leben war … Ihr zuliebe hätte Bora selbst im Angesicht des Todes gelogen.
»Er hat nicht gelitten, Nina. Wirklich nicht. Man leidet nicht, wenn so etwas geschieht.«
Sorgsam vermied sie es, auf die behandschuhte Faust zu blicken, die seine linke Hand ersetzt hatte. »Aber du musst schrecklich gelitten haben.«