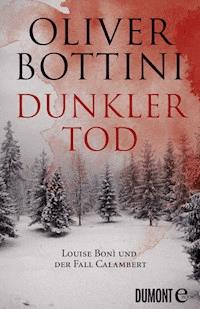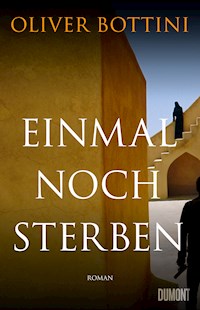9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Platz 1 Deutscher Krimipreis 2018« Banat/Rumänien 2014: Ioan Cozma hat abgeschlossen mit der Welt. Der Kripo-Kommissar lebt allein, es sind nur noch ein paar Jahre bis zu seiner Pensionierung; wenn er nicht groß auffällt, wird auch niemand in seiner Vergangenheit wühlen. Es ist besser so. Doch die Welt will ihn nicht in Ruhe lassen. Ausgerechnet Cozma wird die Ermittlungsleitung in einem brutalen Mordfall übertragen: Die junge Lisa Marthen, eine Deutsche, wurde erstochen aufgefunden. Ihrem Vater gehört ein landwirtschaftlicher Großbetrieb, und der Verdacht fällt auf einen seiner jungen Feldarbeiter, der in Lisa verliebt war und seit ihrem Tod verschwunden ist. Als eine Spur nach Mecklenburg führt, macht Cozma sich auf den Weg – und muss feststellen, dass er dort nicht der Einzige ist, der für Gerechtigkeit sorgen will … Oliver Bottini zeigt, wie sich die radikale Einsamkeit des Menschen durch Gier und Machthunger noch verstärkt. Doch eines bricht sich immer wieder Bahn – der Glaube an etwas Gutes und an Menschlichkeit. Die Spannung zwischen diesen Polen ist es, durch die ›Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens‹ eine existenzielle Wucht entfaltet. »Einer unserer besten Krimischriftsteller« ELMAR KREKELER, DIE LITERARISCHE WELT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Temeswar/Rumänien 2014: Ioan Cozma hat abgeschlossen mit der Welt. Der Kripo-Kommissar hat nur noch ein paar Jahre bis zur Pensionierung, und wenn er nicht groß auffällt, wird er sie erreichen, ohne dass jemand in seiner heiklen Vergangenheit wühlt. Doch die Welt will ihn nicht in Ruhe lassen. Ausgerechnet Cozma wird die Ermittlungsleitung in einem brutalen Mordfall übertragen: Die junge Lisa Marthen, eine Deutsche, wurde erstochen aufgefunden. Ihr Vater ist einer der vielen Großgrundbesitzer in Rumänien, und so fällt der Verdacht schnell auf einen Feldarbeiter, der in Lisa verliebt war und seit ihrem Tod verschwunden ist. Als eine Spur nach Mecklenburg-Vorpommern führt, macht Cozma sich auf den Weg und muss feststellen, dass er dort nicht der Einzige ist, der für Gerechtigkeit sorgen will – und dass er der eigenen Vergangenheit nicht entkommen kann.
Oliver Bottini zeigt den Menschen in seiner radikalen Einsamkeit. Einer Einsamkeit, die er durch Gier und Starrsinn selbst noch verstärkt. Doch eines bricht sich immer wieder Bahn – der Glaube an etwas Gutes und an Menschlichkeit. Die Spannung zwischen diesen Polen ist es, durch die ›Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens‹ eine existenzielle Wucht entfaltet.
Credit: © Hans Scherhaufer
Oliver Bottini wurde 1965 geboren. Für seine Romane erhielt er zahlreiche Preise, unter anderem viermal den Deutschen Krimi Preis, den Krimipreis von Radio Bremen, den Berliner ›Krimifuchs‹ und zuletzt den Stuttgarter Krimipreis für ›Ein paar Tage Licht‹ (DuMont 2014). Bei DuMont erschienen außerdem ›Der kalte Traum‹ (2012) sowie die Kriminalromane um die Freiburger Kommissarin Louise Bonì. Oliver Bottini lebt mit seiner Familie in Berlin.
OLIVER BOTTINI
DER TOD IN DEN STILLEN WINKELN DES LEBENS
Kriminalroman
Die Figuren der Romanhandlung sind erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen wären zufällig und nicht beabsichtigt. Gleiches gilt für die Firmen Flying Banat, JM Romania, Rothauser Gruppe Immobilien bzw. Agrar (ROGA) und Tayma Group/Tayma Cereals sowie die fiktiven Dörfer Coruia und Prenzlin.
Oliver Bottini
Die Recherche für diesen Roman wurde von der Robert Bosch Stiftung im Rahmen des Förderprogramms »Grenzgänger« unterstützt.
Am Ende befindet sich ein Namensregister.
eBook 2017
© 2017 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © plainpicture/Martin Benner
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN
Im Andenken an Giselher W.
Wie hab ich das gefühlt was Abschied heißt. Wie weiß ichs noch: ein dunkles unverwundnes grausames Etwas, das ein Schönverbundnes noch einmal zeigt und hinhält und zerreißt.
2011
Mecklenburg-Vorpommern
7./8.April 2011
Sie verbrachten die Nacht auf Freitag im Haus in Prenzlin, fuhren am späten Vormittag weiter, gegen den Widerstand der Kinder, die das Haus liebten und Dänemark blöd fanden.
»Ihr wart noch nie in Dänemark«, sagte Winter.
»Weil wir es blöd finden«, erwiderte Emmy.
»Ist doch nur für ein Wochenende.«
»Und wenn wir in Dänemark vor Langeweile sterben?«, fragte Leon.
Auf der Autobahn wurden sie fröhlicher, keine Rede mehr vom Sterben, Winter hatte sie an seine Versprechen für Blåvand erinnert. Sie spielten ihr Lieblingsspiel, Sänger raten. »›On the Floor‹«, sagte Emmy und begann zu singen, und Leon rief: »Jennifer Lopez mit Pitbull!«, und fiel mit hoher Stimme ein. Winter hatte wie immer Mühe, den Text zu verstehen, zwei Jahre Schulenglisch in den Achtzigern bei einer Lehrerin, die nie über Güstrow hinausgekommen war, da konnte man nicht viel erwarten. Er hob den Blick zum Rückspiegel und musste lächeln. Emmys sich sanft wiegender Kopf, der Mund noch ein bisschen unsicher mit der Zahnspange, ein entrückter Blick aus dem Seitenfenster. Er ahnte, dass sie an die Pferde dachte, die er ihr versprochen hatte, Pferde am Strand von Blåvand. Wo er die herbekommen sollte, wusste er noch nicht.
Versprich mir was für Dänemark, Papa.
Was denn?
Weiß nicht, irgendwas Tolles.
Mir auch, Papa!
Leon hatte er ein Quad-Rennen in den Dünen versprochen, der Vater gegen den Sohn plus Revanche. Winter hatte keine Ahnung, ob es in Blåvand Quads gab. Ob Neunjährige Quad fahren durften.
Dünen gab es vermutlich.
Pferde und Quads im Sand von Blåvand also, dachte er zufrieden. Er hatte schon Unmöglicheres möglich gemacht.
»La la la, la la«, sangen die Kinder, das immerhin verstand er.
Eine Windböe drückte schwer gegen den Wagen, plötzlich war der Sturm da, der für Mecklenburg vorhergesagt worden war, und mit ihm die Anspannung. Windstärke 10, Nordost; noch immer stieg der Adrenalinspiegel, wenn Stürme kamen. Winter war in seiner Jugend zu oft draußen gewesen auf den Feldern, hatte gerettet, was zu retten war, wenn Unwetter über das flache Land rasten.
Claudias Fingerspitzen berührten seinen Arm. »Fährst du bitte langsamer?«
»Nein, schneller«, sagte Emmy. »Das ist eine Autobahn.«
»Viel schneller!«, rief Leon.
»Weitersingen«, sagte Winter, während er das Tempo drosselte.
Sie fuhren aus dem Waldstück in die ungeschützte Ebene hinaus. Der Wind drückte und lärmte, die Kinder sangen wieder.
Auch die Versprechen wurzelten, wie der Respekt vor Stürmen, weit in der Vergangenheit. Ein anderes Leben, ein anderes Land. Eine andere Frau … Manchmal hatten das Leben und die Frau wie gelähmt unter einem tiefen grauen Himmel gelegen. Winters Versprechen waren sanfte Versuche gewesen, Licht vorzutäuschen. Ja,Rom wäre toll. Versprich mir, dass ich irgendwann nach Rom komme … Dass ich irgendwann losfahren kann und nicht mehr stehen bleiben muss, außer wenn ich will, und du fährst natürlich mit.
Versprochen, Anett.
Er war eines Tages stehengeblieben. Anett nicht.
Die nächste Böe, er lenkte gegen, hielt den Citroën in der Mitte der Spur.
»Der Pitbull von Jennifer Lopez kann singen?«, fragte Claudia.
Leon brach in Gelächter aus, Emmy verzog fast angewidert das Gesicht. Emmy und ihre Mutter, da war der Wurm drin seit einer Weile. Winters Blick streifte Claudia. Die Wangen angespannt und blass, unter den schmalen Augen viele neue Fältchen, um den Mund ein trotziger Zug. Er wusste, dass sie mit sich rang, im Durcheinander ihrer Gefühle um die Familie kämpfte. Um ihn. Sie hatte sich verliebt, in irgendjemanden aus dem Büro. Alles stand plötzlich auf dem Spiel.
Dann geh, war er manchmal versucht zu sagen.
Er wollte nicht, dass sie ging.
Und Emmy spürte es. Spürte alles mit elf Jahren.
»Warum ist das so lustig?«, fragte er.
Leon erklärte es nachsichtig. Pitbull war ein Rapper.
»Micha?« Claudia deutete nach vorn, und er konzentrierte sich wieder auf die Straße. Die Sicht war schlecht geworden. Vor ihnen trieben die Böen Staubfahnen über die Fahrbahn. Winzige Partikel prasselten hart gegen seine Seite. Er sah Bremslichter aufleuchten und verringerte die Geschwindigkeit abrupt auf achtzig. Leon beschwerte sich theatralisch und lachte dann, es klang ein bisschen erschrocken. Winter wechselte auf die linke Spur. Im Rückspiegel Aufblendlicht, gedämpftes Hupen. Rasch gab er Gas.
»Und warum heißt der Pitbull?«, fragte er.
Claudia hob erneut die Hand und sagte etwas, doch es ging im plötzlichen Aufheulen des Sturms unter. Zwei-, dreihundert Meter vor ihnen schob sich eine haushohe sandfarbene Wolke über die Autobahn, und Winter dachte, dass es am besten wäre, stehen zu bleiben, aber das ging ja nicht, auf der Autobahn stehen bleiben. Dann waren sie schon mittendrin, waren von wirbelndem Sand umgeben, die Scheiben bedeckt von Sand, er sah nicht einmal mehr das vordere Ende des Wagens, nur rote Lichter, denen sie sich rasend schnell näherten.
Er hörte Claudia aufschreien, als er das Bremspedal durchtrat, zu spät, sie krachten auf das Auto vor ihnen. Laut knallend schossen die Airbags aus der Verkleidung, ein heftiger Schlag gegen Brust und Gesicht, benommen rang er nach Luft, während er zusah, wie der Airbag schon wieder erschlaffte, was seltsam beruhigend wirkte, alles gut, dachte er, siehst du, alles vorbei …
Sekundenlang war er unfähig, sich zu bewegen. Hektisch atmend starrte er auf die geborstene Windschutzscheibe, durch deren Risse Sand ins Wageninnere wirbelte, wo er sich mit dem weißen Talkumpuder der Airbags vermischte. Jenseits der Scheibe lag die Sichtweite unter fünf Metern.
Mehrere Menschen tauchten auf, rannten in Richtung Standstreifen.
Endlich gelang es ihm, den Gurt zu lösen und sich zur Seite zu drehen. Ein rascher Blick nach hinten, die Kinder schienen unversehrt. Claudia war in sich zusammengesunken, hielt sich den Unterarm. Winter zwang sich zur Ruhe, öffnete ihre Gurtschnalle und half ihr, sich zurückzulehnen, vorsichtig, der Unterarm war wohl gebrochen. Sie war leichenblass, brachte kein Wort hervor, nickte nur, alles okay, fast, und er unterdrückte die Angst und die Schmerzen in seiner Brust und nickte ebenfalls, bei mir auch.
Er wandte sich den Kindern zu. Emmy saß hochaufgerichtet da, die Hände auf den Ohren, die Augen geschlossen, aus ihrer Nase lief jetzt ein wenig Blut. Vor dem Fenster neben ihr flatterte der Seitenairbag. Plötzlich schüttelte sie wimmernd den Kopf, der Schock kam mit Verzögerung.
Leon rieb sich das Bein und weinte leise.
»Alles okay?«, stieß Winter hervor.
Emmy riss die Augen auf, wirkte vollkommen verwirrt, als wäre sie aus einem tagelangen Schlaf erwacht. Sie begann zu schreien, und er sah, wie ihre Hand nach dem Türgriff tastete. Nur nicht aussteigen, dachte er, und herrschte sie an: »Emmy, sitzenbleiben!« Sie beachtete ihn nicht. Als sie die Tür aufstieß, fuhr ein kräftiger Luftstrom ins Wageninnere, Sand drang in Winters Augen. Er hörte Claudias verstörte Stimme, legte ihr die Hand auf die Schulter, aber er hatte jetzt keine Zeit für sie, Emmys Schreie wurden immer schriller, sie hatte schon ein Bein halb im Freien, während sie mit beiden Händen am Gurtschloss herumfingerte und nach ihm schlug, weil er sie davon abzuhalten versuchte.
»Nicht aussteigen, Emmy, bitte! Emmy!«
Sie zerrte am Gurt, versuchte durchzuschlüpfen, und Winter öffnete hastig seine Tür, kämpfte sich in den lärmenden Sturm hinaus, wollte um den Wagen herum zu ihr. Sandkörner stachen wie Hunderte feinster Nadeln auf seiner Haut, drangen ihm in Ohren, Nase, Mund, und er dachte fassungslos, dass sie in eine Art Wüstensturm geraten sein mussten, bis er begriff, dass der Sand nicht aus einer Wüste kam, sondern von den umliegenden Äckern, er hatte den Geschmack von Erde im Mund, und er wusste doch, wie Erde schmeckte.
Die Augen mit einem Arm abschirmend, ließ er sich von den Böen am Wagen entlangstoßen, vorbei an Leons Tür zum Heck, musste sich für einen Moment an der Dachreling festklammern, um nicht weitergetrieben zu werden. Kaum einen Meter entfernt stand das nachfolgende Auto, die Beifahrertür offen, der Innenraum leer. Plötzlich brach ein riesiger Schatten in sein Blickfeld, grelle Lichter, eine mehrtonige Lkw-Hupe dröhnte. Hastig trat er einen Schritt zurück, stürzte über die Leitplanke des Mittelstreifens, kam mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf. Noch immer dröhnte das Horn, alle anderen Geräusche verloren sich darin, selbst das Tosen des Sturms und seine Schreie, nur das Horn blieb, ein unerträglich aggressiver Klang, der sich an ihm vorbeizubewegen schien und doch gleich laut blieb, und er presste die Hände auf die Ohren, bis der Lärm endlich abbrach, Sekunden später, vielleicht auch Minuten, er hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Solange Emmy nur nicht ausgestiegen war, dachte er, während er auf die Knie kam, solange die drei im Auto blieben, bis Hilfe eintraf, war alles egal.
Taumelnd stand er auf. Durch das Sandgestöber erkannte er mehrere Autos vor sich, doch die Farben stimmten nicht, kein Rot darunter, auch der Lkw war nicht zu sehen, er musste sich der falschen Seite zugewandt haben, vielleicht hatte er sich auch, ohne es zu bemerken, ein paar Meter entfernt.
Der Sturm riss ihm fast die Jacke vom Leib, während er sich den schmalen Mittelstreifen entlangkämpfte. Rechts und links Dutzende ineinander verkeilte, aufgerissene, querstehende Autos, auch rote darunter, aber nicht der Citroën, dazu Lkws, Kleintransporter, alle dicht an dicht, und doch nahm er dazwischen geisterhafte Schemen wahr, andere krochen aus Autofenstern, einer hockte auf einem Wagendach. Ein Stoß gegen die Schulter ließ ihn zur Seite wanken, ein Mann war aus der Sandwand gestürzt, gegen ihn geprallt und weitergerannt. Vor ihm plötzlich eine dumpfe Explosion, Flammen griffen um sich, die der Wind auf ihn zu trieb. Die Schemen bewegten sich jetzt schneller, auch Winter begann zu laufen, auf das Feuer zu, als ihm klar wurde, dass er natürlich in die falsche Richtung rannte, ins Zentrum des Albtraums, Claudia und die Kinder waren doch auf der anderen Seite …
Er wandte sich um, hatte die Böen jetzt im Rücken. Der Citroën musste links von ihm stehen, dicht neben der Leitplanke, also konzentrierte er sich auf diese Seite, passierte ein zerstörtes Auto nach dem anderen, hier und da Rot, doch kein Citroën, soweit sich das überhaupt noch erkennen ließ, der Sand machte es fast unmöglich, der Sand in den Augen, der Sand, den der Sturm über die Autos trieb, der Sand, der alles, was noch zu sehen war, in ein dunkles Gelb hüllte. Hinter einem nahen Fenster kaum sichtbar Menschen, nicht Claudia und die Kinder, ein Kombi, vermutlich weiß, warteten vielleicht auf Hilfe, so wie Claudia und die Kinder auf ihn warteten. Dann wieder etwas Rotes, ein Kleintransporter, wo um Gottes willen war der Citroën, dreißig, vierzig Meter hatte er abgesucht, der Citroën wie vom Erdboden verschwunden oder im Sand nicht mehr zu sehen. Jetzt ein weiterer liegengebliebener Lkw, die Fahrerkabine schräg über ihm wie ein aufsteigendes, zorniges dunkelgelbes Pferd, ein Pferd in Blåvand, dachte er und spürte plötzlich, dass er nicht mehr weiterlaufen konnte, dass er hier bleiben musste, bei dem zornigen Pferd, als gäbe es kein Weiter, kein Woanders mehr …
Erschöpft ließ er sich auf den Mittelstreifen sinken und kauerte sich mit dem Rücken an die Leitplanke, die in den heftigen Böen vibrierte, den Blick gesenkt im Bewusstsein, dass das zornige Pferd da war und bleiben würde, hoch über ihm trotzte es dem Sturm. Unvermittelt dachte er an das Haus in Prenzlin, andere Gedanken waren nicht mehr möglich, als hätte es nie etwas anderes gegeben, nur das Haus. Wären sie doch auch an diesem Wochenende dort geblieben wie an so vielen Wochenenden zuvor, die Kinder liebten es, die stillen Winkel und Nischen, die uralten fremden Gerüche, die weichen Holzböden, die Geschichten von früher, die er ihnen an den Wochenenden im Haus erzählte, auch Anett schmuggelte er manchmal in diese Geschichten hinein, das ist die Schwester von Jörg, den wir in Rumänien besucht haben, wisst ihr noch, und die Anett war schon überall auf der Welt und am liebsten in Rom, nur zu Hause war sie nie mehr, bestimmt war sie auch in Dänemark … Wir wollen nicht nach Dänemark, sagte Emmy, und Leon sagte, weil wir da vielleicht sterben, und Winter sagte: Dann fahren wir da nicht hin, wir kehren um und fahren ins Haus zurück, da bleiben wir, solange wir wollen, und Leon rief: für immer, und Winter nickte und dachte: für immer, und begann zu weinen, er wusste jetzt, es war für immer. Hier und heute war für immer.
2014
I
FÜR IMMER
1
Temeswar,
Hauptstadt des Kreises Timiş,
Rumänien
Ende September 2014
WIE BEINAHE JEDEN MORGEN seit seiner Versetzung zur Kripo Temeswar vor fünfzehn Jahren stand Ioan Cozma auch an diesem Tag um sieben Uhr auf seiner Veranda, eine Tasse Kaffee in der einen, eine Zigarette in der anderen Hand, und blickte voller Mitgefühl auf die Bega, die jenseits der Straße in kaum zehn Metern Entfernung an seinem Häuschen vorbeirann. Ein Fluss, der nicht mehr wirklich Fluss sein durfte, sondern lediglich Kanal, zumindest über weite Strecken seiner zweihundertfünfzig Kilometer, weil im frühen achtzehnten Jahrhundert ein Kaiserlicher mit aberwitzigem Namen und aberwitziger Perücke verfügt hatte, die Sümpfe müssten trockengelegt werden. Die wilde Bega wurde begradigt, ein stolzer Fluss wurde zum Kanal, und aus den Sümpfen zu beiden Seiten der rumänisch-serbischen Grenze entstand die Banater Heide, Ackerland, so hieß es, erster Güte.
Fünfzigtausend Euro hatte ein italienischer Investor kürzlich pro Hektar dieses Ackerlandes bezahlt. Cozma hatte keine Ahnung, wie groß ein Hektar war. Er interessierte sich nicht im Geringsten für Landwirtschaft. Aber er kannte den Radiomoderator, Liviu, und hörte ihm gern zu. Er hatte Liviu vor Jahren erleichtert seine zweite Ehefrau abgetreten, die wie die erste ein verheerender Irrtum gewesen war. Cozma und die Frauen – eine kleine Tragödie. Selbst jetzt, mit dreiundfünfzig, wusste er noch nicht, welche zu ihm passten und welche er unbedingt meiden sollte.
Er schnippte den Zigarettenstummel über den Grasstreifen auf das Sträßchen und kehrte ins Haus zurück. Die Bega passte zu ihm. Das Leben hatte auch ihn begradigt, das Unkontrollierte, Zornige der frühen Jahre war nun einbetoniert, die gefährlichen Sümpfe ausgetrocknet. Wie die Bega trieb Ioan Cozma mit müdem Fatalismus dahin.
Die Frauen mochten das nicht.
Ihm dagegen war es lieber so. Nicht mehr auffallen. Nichts mehr riskieren. Keine Ermittlungsleitung mehr. Nichts Politisches. Unter dem Radar segeln, wie Cippo zu sagen pflegte, der Dienstälteste unter den Temeswarer Comisari: Wir lassen die anderen in die Scheiße treten, wir segeln unter dem Radar.
»Fünfzigtausend!«, rief Livius empörte Stimme aus der Küche. »Das Fünfzehnfache des durchschnittlichen Hektarpreises! 2005 hat der Hektar noch vierhundert Euro gekostet! Kein Wunder, dass unsere Bauern verkaufen, wenn die Ausländer mit dem Scheck wedeln!«
Cozma schlenderte durch den für das gedrungene Haus grotesk breiten Flur in die Küche. Liviu wurde immer radikaler und leidenschaftlicher in seinen Beiträgen vom Kühlschrank herab. Man konnte die wachsende Verzweiflung in seiner Stimme hören. Er suchte die Provokation, die Katastrophe. Cozmas zweite Exfrau schien auch ihn allmählich zu zermürben.
Sie werden es nicht leicht haben, hatte Cozma Anfang 2008 gesagt. Sie ist sehr anspruchsvoll. Ein kleines Haus an der Bega mit zwei Zimmern und Blick auf eine Betonsiloanlage genügt ihr nicht. Es muss mehr sein. Immer mehr.
Ich habe mehr, hatte Liviu erwidert. Danke für Ihre Besonnenheit, Herr Cozma.
Rufen Sie an, wenn Sie einen Rat brauchen.
»Weißt du, wie groß ein Hektar ist, Vater?« Cozma stellte Tasse und Teller ins Spülbecken und wandte sich dem Esstisch zu. Mit der rechten Hand fuhr er über das Wachstuch, um die Brotkrümel in der linken aufzufangen. Im Radio lief jetzt Musik von Bere Gratis. Liviu spielte seit Wochen fast nur noch rumänischen Pop, offiziell ein Zeichen des Protests gegen die Globalisierung und die damit verbundene kulturelle Gleichschaltung, in Wahrheit gegen die Aushöhlung seiner Identität als Mann und Mensch durch eine missgelaunte einstige Schönheitskönigin aus dem weit entfernten Vaslui, die die westliche Welt erobern wollte und nur bis Temeswar gekommen war, wo Rumäniens Westen endete.
»Aber jetzt eine gute Nachricht!«, rief Liviu. »Unsere Freunde vom ›Institut für die Aufarbeitung der kommunistischen Verbrechen‹ lassen sich nicht aufhalten! Nach Alexandru Vişinescu sollen weitere Verbrecher der Diktatur für ihre Untaten angeklagt …«
Cozma schaltete das Radio aus, nahm das Jackett von der Garderobe im Flur und verließ das Haus. Ein letzter Blick auf die Bega an diesem Morgen, man sprach sich gegenseitig Mut zu für alles, was da kommen mochte. Auf dem einst weißen Opel Kadett lag erstes gelbes Herbstlaub. Er klaubte Blätter von der Windschutzscheibe, dann stieg er ein, wie immer irritiert darüber, dass der Geruch der Mentholzigaretten seiner zweiten Exfrau noch immer aus dem Polster kroch, wenn er sich setzte.
Erneut Livius Stimme, Cozma drehte ihn stumm.
»Siehst du, Vater«, murmelte er, die Hände schon am Steuer, während der Dieselmotor unwillig auf Touren kam, »habe ich es nicht gewusst, sie kriegen alle, ob bedeutend oder unbedeutend, egal, wie lange es her ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, das ist das Wesen der Demokratie. Die Demokratie ist eine Verheißung, aber wenn sie da ist, tut sie weh.« Alexandru Vişinescu war fast neunzig und der Erste, der nach einer Anzeige des IICCMER angeklagt worden war. Ein ehemaliger Gefängnisdirektor, der politische Häftlinge angeblich misshandelt hatte, sodass viele von ihnen gestorben waren. Zuerst die Alten, so die Erklärung des Instituts, deren Sünden bis in die fünfziger und sechziger Jahre zurückreichten, denn sie sollten nicht sterben, ohne sich verantworten zu müssen. Später dann werde man sich den Jüngeren unter den einstigen »Schergen Ceauşescus« zuwenden.
Cozma fuhr los, bog auf die 591 in Richtung Zentrum ab. Ja, nur eine Frage der Zeit, wiederholte er in Gedanken, und nun war es eben so weit, nun war die Demokratie in Rumäniens dunkelste Vergangenheit vorgedrungen, und das war wie so vieles gut und schlecht zugleich.
Auch beim Serviciul Criminalistica hatte sich die Demokratie mittlerweile ausgebreitet, nein, eher die Globalisierung, dachte Cozma, während er gemessenen Schrittes die Treppen hochstieg, weil ihm der Fahrstuhl, ein widerspenstiges Relikt der Diktatur, zu häufig steckenblieb. Die meisten der jungen Kollegen waren ehrgeiziger und weltgewandter als er und Cippo und die anderen »Alten«. Sie verließen die Direktion nicht ohne Laptop oder iPad und vollbrachten mit dem Smartphone Unbegreifliches. Sie hospitierten bei westeuropäischen oder gar amerikanischen Polizeien und sprachen so gut Englisch, dass man ihnen zutraute, drei oder auch sechs weitere Sprachen zu beherrschen. Mehrere hatten nebenbei Italienisch oder Spanisch gelernt, weil arbeitslose Landsleute noch immer zur Obsternte ans Mittelmeer zogen und ihnen gelegentlich ein Temeswarer Ermittler nachreisen musste, wenn wieder ein elternloses Kind auf den Straßen der Stadt eingesammelt worden war. Ein anderer radebrechte Chinesisch, seit die fünfzigtausend Smithfield-Schweine den Chinesen gehörten. Ein dritter belegte Arabischkurse, denn schon länger bewirtschafteten arabische Agrarinvestoren Felder im Kreis Timiş und wurden wie viele andere von zumeist einheimischen Maschinen- oder Fruchtdieben heimgesucht.
Er passierte den Aufzug, der sich im selben Moment öffnete. Cippo stieg aus und trat neben ihn, wie immer leicht atemlos, als wäre er die Treppen hochgestiegen, und leicht nach Alkohol riechend. Mit eiserner Disziplin begann er zwar erst mittags zu trinken, doch der Geruch saß längst untilgbar in den Falten seiner Haut. Ohne den anderen anzusehen, reichten sie sich die Hand, eine Gewohnheit aus fünfzehn gemeinsamen Dienstjahren. Cozma war nicht sicher, ob er jemals auch nur einen einzigen Arbeitstag ohne diesen Händedruck beginnen wollte.
»Hast du Radio gehört?«, brummelte Cippo.
Er nickte. »Fünfzigtausend Euro pro Hektar, unfassbar.«
»Nicht das. Das … andere.«
Sie bogen in den Flur ab, in dem das gemeinsame Büro lag.
»Wie groß ein Hektar wohl ist?«, fragte Cozma.
Cippo schloss die Bürotür auf. Wie immer ließ er Cozma, dem Ranghöheren, den Vortritt, eine Angewohnheit aus kommunistischer Zeit, die ihm nicht auszutreiben war, mochte die Freundschaft noch so stabil sein. »Na, hundert mal hundert Meter. Zehntausend Quadratmeter.«
Natürlich, dachte Cozma, die Rusus waren eine Familie von Kleinbauern, das war ihm entfallen. Bis zurück zu den Ururgroßeltern hatten Cippos Vorfahren nördlich der Stadt bei Firiteaz ein paar Hektar Land bewirtschaftet. Weil der Sohn Polizist geworden war, hatte man sie nach der Revolution verkauft.
Er setzte sich auf seine Seite des Schreibtischs und fasste die verschmutzten Fenster ins Auge, versuchte, sich eine Fläche von hundert mal hundert Metern vorzustellen. Ein Fußballfeld? Nein, eher eineinhalb Fußballfelder. Fünfzigtausend Euro für eineinhalb Fußballfelder Ackerland …
Er verwarf den Gedanken, sagte: »Ovidiu fährt wieder nach Berlin. Die Deutschen waren letztes Jahr so angetan von ihm, dass sie ihn noch mal eingeladen haben.« Vier Wochen Hospitanz bei der Berliner Kripo Ende 2013. Tagtäglich auf Taschendiebjagd in Bahnhöfen, auf Weihnachtsmärkten. Ovidiu kehrte begeistert und beschämt zurück. Drei Viertel der Diebe kamen nicht aus Deutschland. Zwei Drittel davon waren Rumänen, darunter viele Jugendliche. Einen hatte Ovidiu erkannt. Victor Nica, du Dreckskerl!, hatte er über den Bahnsteig eines S-Bahnhofs gebrüllt. Nimm die Pfoten aus der Handtasche, sonst ruf ich deinen Vater an und hol mir die Erlaubnis, dich windelweich zu prügeln! Drei Jungs rannten, einer sank fluchend aufs Pflaster.
»Ioan.« Cippo stand dicht bei ihm, rieb sich die wässrigen Augen.
»Keine Sorge«, sagte Cozma. »Sie sind erst bei den fünfziger Jahren. Bis sie die achtziger aufarbeiten, gibt es uns nicht mehr.«
Cippo hielt inne. »Uns?«
»Dich und mich.«
»Um mich mache ich mir keine Sorgen.« Er hob die Schultern, drehte die Handflächen nach oben. In seiner theatralischen Gestik offenbarte sich der überbordende Konsum italienischer Soap Operas, die er sich an einsamen Abenden ansah. Die meisten Abende in Cippos Leben waren einsam. »Abgesehen davon wird es mich noch lange geben, Alkohol konserviert. Du dagegen könntest Glück haben und früh sterben.«
Schmunzelnd öffnete Cozma die Fallakte auf seinem Schreibtisch und fuhr den PC hoch. Einer der Ermittlungsleiter hatte ihn gebeten, eine Zeugenaussage auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Erst die Aufnahmen ansehen, dann mit geschlossenen Augen anhören, das war seine Spezialität, seit er sich aus der ersten Reihe zurückgezogen hatte und mit mehr Muße arbeitete. Er sah und hörte nun Gefühle und Zwischentöne, wo die »Jungen« nur Bewegungen sahen und Wörter hörten. Sie hatten es nicht so mit Gefühlen. Mit Logik und Fakten ja, aber Gefühle entgingen ihnen oft. Gefühle ließen sich nicht in Nullen und Einsen übertragen, waren zu schwammig für Excel-Dateien, waren da, ohne da zu sein. Sie standen dem raschen Erfolg im Weg, weil man alles vier- oder fünfmal sagen und hören und hinterfragen musste. In den Budgetvorgaben und time schedules moderner rumänischer Polizeiarbeit war kein Raum für Gefühle und Zwischentöne; in diesem Büro dagegen schon.
»Der, von dem sie heute berichtet haben, ist fünfundfünfzig«, sagte Cippo und nahm auf seiner Schreibtischseite Platz. »Einer von uns. Aus Transsilvanien.«
Cozma sah nicht auf. »Lass uns arbeiten.«
»Ich habe letzte Nacht nicht geschlafen deswegen.«
»Kam es nicht erst heute Morgen im Radio?«
»Vorahnungen. Ist mir schon einmal passiert, 24.Dezember 89, die Nacht, bevor sie Ceauşescu hingerichtet haben. Du wirst ein schlimmes Ende finden, Ioan.«
»Zwanzig Lei, wenn du den Mund hältst.«
»Von dir nehme ich kein Geld.«
»Dreißig?«
»Vierzig.«
Cozma schob vier Zehner über den Schreibtisch und hörte, wie Cippo sie in der Kaffeekasse verschwinden ließ.
»Fünfzigtausend Euro für den Hektar, weil sie nur zweieinhalb Hektar gekauft haben. Sonst zahlst du hier im Kreis drei-, viertausend. Hab ich schon gesagt, dass ich den Chef unten getroffen habe?«
Cozma sah auf. »Nein.«
»Er wollte dich sprechen.«
»Gleich?«
»Sofort.«
Cozma erhob sich seufzend.
»Hat sich bestimmt erledigt«, sagte Cippo. »Sofort ist lange her.«
2
Nahe Coruia, Kreis Timiş
WEIL DIE DEUTSCHE NICHT AUFHÖRTE, sich zu wehren, schlug er zu.
Jag ihr ein bisschen Angst ein, hatte ihm der Boss aufgetragen. Sag ihr, du beobachtest sie jeden Morgen, wenn sie im Fluss schwimmt. Du kannst nicht aufhören, an sie zu denken. Tag für Tag, Nacht für Nacht denkst du an sie. Du stellst dir vor, sie zu bumsen. Sag ihr, eines Nachts wirst du es nicht mehr aushalten und dich ins Haus schleichen, in ihr Zimmer, und sie bumsen. Jag ihr ein bisschen Angst ein, du weißt schon.
Dass er sie schlagen sollte, hatte ihm der Boss nicht aufgetragen. Aber sie hörte nicht auf, sich zu wehren. Also schlug er sie stumm.
Und weil sie fast nackt war und ihre Haut vom Wasser glitzerte, stellte er sich vor, sie zu bumsen, und hielt es plötzlich nicht mehr aus, und weil sie dabei wieder zu Bewusstsein kam, schlug er erneut zu, aber dann dachte er, dass sie ihn dabei ansehen sollte, und langte in den Fluss und spritzte Wasser über ihr Gesicht, und als sie die Augen öffnete, legte er ihr die Hand auf den Mund und sah sie an, während sie ihn dabei ansah.
Jag ihr ein bisschen Angst ein, nicht zu viel, hatte der Boss gesagt. Zu viel wäre nicht gut. Ihr soll nichts passieren. Nicht viel jedenfalls. Angst ist nicht viel. Angst ist genau das, was wir brauchen. Nicht mehr.
Aber sie hörte einfach nicht auf, sich zu wehren, selbst jetzt nicht, als er schwer auf ihr lag. Sie biss und kratzte und versuchte, zu schreien und zu treten, und da musste er sie wieder schlagen, bis sie endlich stillhielt.
Als er fertig war, fuhr ihm der Schreck über das, was er getan hatte, in die Knochen, und mit dem Schreck kam die Wut.
»Adrian …!«, schrie sie unter seiner Hand und fing wieder an, sich zu wehren, und seine Wut wuchs immer mehr.
Da griff er zum Messer und befreite sich von der Angst und der Wut.
3
Temeswar
SIE STANDEN AM FENSTER, blickten aus dem dritten Stock über den Bulevardul Take Ionescu, Temeswar hinter Staub und Schlieren, verblasst und brüchig konturiert wie auf alten Fotos, ein Blick in die Vergangenheit. Ein Gespräch über die Zukunft.
»Also gut«, sagte Paul Bejenaru gereizt, »Dezember 2015. Vier Monate. Keinen Monat länger.«
»Februar 2016«, beharrte Cozma. »Du kannst einen wie ihn nicht zu Weihnachten freistellen.«
Bejenaru wandte sich ihm zu. »Einen wie ihn?«
»Fünfunddreißig Jahre Dienst.«
»Zwanzig zu viel, wenn du mich fragst.«
»Keine Frau, keine Kinder, keine Geschwister mehr. Was soll er den ganzen Tag machen?«
»Einen wie ihn«, wiederholte Bejenaru, den Kopf schüttelnd. »Er ist Alkoholiker und die Ineffizienz in Person.«
»So unmenschlich wirst du nicht sein, Paul.«
»Ich muss rationalisieren. Bukarest kürzt die Budgets. Die Abteilung muss effizienter werden. Vieles muss sich ändern.« Bejenaru ächzte. »Also gut, sechs Monate. Februar 2016.«
Cozma willigte ein, obwohl es ihm schwerfiel. Zwei Jahre Verlängerung beantragt, sechs Monate bekommen. Weiter würde Bejenaru Cippo nicht entgegenkommen, das wusste er. Immerhin, sechs Monate waren besser als nichts – anfangs hatte Bejenaru Cippos Verlängerungsgesuch ganz ablehnen wollen.
Er berührte die Scheibe mit zwei Fingern, zog eine Schneise in den Schmutz. Ohne den Schmutz sah Temeswar außerhalb der Altstadt anders aus, fand er, hässlicher. Man erkannte die Defizite. Die grauen Wohntürme an den Boulevards abweisend, menschenfeindlich. Die zahllosen Häuschen in den Seitenstraßen wie sein eigenes angeschlagen und notdürftig geflickt. Die Tausenden historischen Gebäude vor sich hin bröckelnd, bis sie irgendwann abgerissen werden mussten. Ein bisschen Schmutz auf den Fensterscheiben tat Temeswar gut.
Bejenaru war zur Kaffeemaschine gegangen und hatte zwei Tassen gefüllt. Cozma wischte die Finger an seiner Hose ab, folgte ihm langsam, sagte: »2016 ist ein Schaltjahr. Am 29.Februar feiern wir seinen Abschied. Das wird ihn trösten. Ein Tag, der nur alle vier Jahre vorkommt. Ein Tag, den es schon im Jahr darauf nicht mehr gibt.«
»Du sagst es ihm?«
»Im Frühling.« Im Frühling war alles leichter, dachte er. Ein Ende wirkte im Frühling nicht so endgültig. Man hatte Energie und konnte Pläne machen über das Ende hinaus. Cippo liebte den Frühling. Wenn alles um ihn herum blühte, spürte er Kraft in sich. Im Frühling trank er weniger. Die Abende verbrachte er nicht zu Hause vor den italienischen Soaps, sondern saß auf den belebten Plätzen der Stadt und machte Pläne.
Ioan, wir sollten mal gemeinsam verreisen, eine Kreuzfahrt im Mittelmeer, so was in der Art. Ioan, ich denke darüber nach, mir einen Mops anzuschaffen, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zwischen mir und einem Mops. Ich könnte mich sozusagen mit mir selbst unterhalten.
Bejenaru reichte ihm eine Tasse. »Wenn du meinst.«
Sie tranken, schwiegen, mieden den Blick des anderen. Schoben hinaus, was kommen musste.
Auch Paul Bejenaru war für Cozma einer der Jungen, obwohl schon Anfang vierzig. Er hatte deutlich länger im postkommunistischen Rumänien gelebt als im kommunistischen. Ein feingliedriger, eleganter Mann, der sich die grauen Schläfen passend zum Naturschwarz färbte. Hospitanz beim FBI mit Mitte dreißig. Machte bei komplizierten Power-Point-Präsentationen mit hochgekrempelten Hemdsärmeln eine hervorragende Figur. Der Beste beim Schießtraining, Krav-Maga-Ausbildung. Blitzgescheit, nicht ohne Herz, ehrgeizig. Vielleicht zu ehrgeizig. Er sah die Leitung der Kripo Temeswar als Zwischenstation auf dem Weg nach Europa, ohne den Umweg Bukarest. Europol in Den Haag war das Ziel, soweit Cozma wusste.
Er stellte die leere Tasse ab. »Und wann soll ich gehen, Paul?«
Cozma war aufs Dach des Gebäudes gestiegen, wohin Bejenaru die Raucher vertrieben hatte. Eine Zigarette im Mund, die Hände in den Hosentaschen, stand er im kalten Licht der Morgensonne an der Betonbrüstung und kämpfte gegen die Sorgen und Ängste an.
Keine Verlängerung. Der Abschied aus dem Dienst wie offiziell vorgesehen im November 2016. Noch zwei Jahre und zwei Monate statt, wie gedacht, gut vier Jahre.
Schon übernächstes Jahr.
Zwei Jahre und zwei Monate, dann war also Schluss, dachte er, dann waren die Tage und die Nächte tausendmal so lang wie jetzt und die Stille zu Hause unendlich. Und auch, wenn er die Rituale beibehalten konnte, morgens um sieben Liviu zuhören, auf der Veranda die erste Zigarette des Tages rauchen, die Bega betrachten, um Viertel nach sieben in den Kadett steigen – wozu? Wohin sollte er fahren? Warum sollte er zurückkehren? Wie sollte er in seinem stillen Haus mit den winzigen Zimmern die Erinnerungen und die Nöte und die Einsamkeit verdrängen?
Er hatte nicht gefeilscht, das hätte er als unter seiner Würde empfunden. Für einen Kollegen und Freund wie Cippo ja, aber nicht für sich selbst. Bejenaru hatte ihn angesehen und darauf gewartet, doch Cozma hatte ihm den Gefallen nicht getan. So, hatte er stattdessen gesagt und sich eine weitere Tasse des wunderbaren Kaffees eingeschenkt, äthiopische Bohnen, garantiert fair trade, streng rationalisiert und nur für besondere Momente, zum Beispiel, wenn Bejenaru die Verlängerungsgesuche der Altgedienten ablehnte. So, so.
Tut mir leid, Ioan.
Ja.
Nach dreißig, fünfunddreißig Jahren sollte man gehen. Die Motivation lässt nach. Man ist müde. Nein?
So muss es sein. Cozma hatte die Tasse in einem Zug geleert, als wäre Wasser darin gewesen, und gesagt: Du solltest die Fenster putzen lassen, Paul, bevor man nicht mehr rausschauen kann. Dann hatte er Bejenarus Büro mit dem seltsamen Gefühl, es wäre für immer, verlassen.
Er schnippte die Zigarettenkippe über die Brüstung. Zwei Jahre und zwei Monate, um sich Hobbys zuzulegen, eine Frau zu finden, die passte, vielleicht einen Job, ein neues Leben.
Cippo tauchte neben ihm auf.
»Fang bitte nicht wieder an«, sagte Cozma.
»Wüsste nicht, wovon.«
Cozma hielt ihm die Schachtel hin, schweigend rauchten sie, räusperten sich gelegentlich, um nicht aus Versehen etwas zu sagen.
Auf dem Weg zurück zum Treppenhaus fragte Cozma: »Hast du an Weihnachten 2016 schon was vor?«
»Nichts, was ich nicht absagen könnte.«
»Dann lass uns eine Kreuzfahrt machen. Du und ich und der Mops.«
»So schlimm?«, fragte Cippo.
»Nein, nein«, erwiderte Cozma. »Alles bestens.«
4
Banater Gebirge,
Kreis Caraş-Severin
EIN SECHSJÄHRIGES MÄDCHEN um Mitternacht auf einer Weide, umgeben von schwarzen Bergen, schwarzen Ängsten, Mutter und Vater seit Tagen spurlos verschwunden. Die Tante immer wieder wispernd am Dorftelefon, bis sie eines Abends ein Bündel geschnürt, dem Mädchen in die Hand gedrückt und gesagt hatte: Lauf, es darf dich keiner sehen, auf der Weide wartest du, bis einer kommt, der Viorel heißt, er bringt dich in Sicherheit. Auf der Weide verstrichen die Minuten quälend langsam, die Nacht und die Ängste wurden immer schwärzer. Als sie fast nicht mehr zu ertragen waren, hörte das Mädchen über sich ein Brummen.
Viorel kam aus der Luft.
Zwei Nächte und zwei Tage lang wohnte das Mädchen in seinem kleinen blauen Flugzeug. Um Viorel war ein Geheimnis. Die Finger seiner linken Hand waren krumm, als hätten sie sich auf halber Strecke entschieden, in eine andere Richtung zu wachsen. Er summte häufig vor sich hin, ansonsten schwieg er viel, doch sein Schweigen war leicht und hell. Seine Haare und seine Augen schimmerten golden im Sonnenlicht. Seine Haut war golden.
Am Abend des zweiten Tages stieg das Mädchen zum letzten Mal mit Viorel und dem Flugzeug in die Luft, wo alles einfach und freundlich war. Sie flogen tief über ein Meer, das Donau hieß. In einem Land namens Jugoslawien fiel das Mädchen in Viorels goldene Arme und sagte: Darf ich bei dir bleiben?
Nein, meine Ana, erwiderte er. Ich gehe in die Nacht zurück, und du gehst ins Licht.
Ana Desmerean wandte den Blick von den Bergen ab. Die alte Heimat greifbar nah im Osten, das Banater Gebirge, durch die Luft verlassen und nie mehr betreten. Fünfunddreißig Jahre waren seitdem vergangen. Fünf, seit sie aus Deutschland nach Rumänien zurückgekehrt war.
Sie steuerte den Hubschrauber in einer weiten Kurve Richtung Südwesten, gelangte in die Ebenen, aus den Morgenschatten der Hügel hinaus.
Anfangs hatte sie überall nach Viorel gefragt, doch niemand schien ihn zu kennen oder von ihm gehört zu haben. Nach einer Weile hatte sie aufgegeben. Vielleicht sollte Viorels Geheimnis nicht gelüftet werden. Vielleicht hatte es ihn so ja nie gegeben. Der goldene Viorel, Traum einer verstörten Sechsjährigen, deren Eltern wenige Tage zuvor wohl von Männern der Securitate verschleppt worden waren.
Wichtiger war es, das Rätsel um die Eltern zu lösen.
Ihre Leichen zu finden.
Dann, und erst dann, hatte sie sich vorgenommen, würde sie in die alte Heimat zurückkehren: um die Eltern dort zu beerdigen.
Im Westen reflektierten die Silos des Holländers das Licht, unter ihr lagen die Sonnenblumenfelder der Italiener, ein wogender gelber Teppich mit Zehntausenden braunen Punkten, dreihundert Hektar ohne Unterbrechung. Wie schlafende Geparden, hatte Jörg Marthen vor einer Weile während eines Fluges gesagt.
Vielleicht hatte sie sich in diesem Moment in ihn verliebt.
Geparden passten nicht zu ihm, viel zu exotisch, zu impulsiv, viel zu romantisch. Marthen war nüchtern und still, ein Mann, der nichts anderes als den Anblick und den Geruch und die Geräusche seiner Felder zu brauchen schien, nicht einmal eine Frau. Dass er an Geparden dachte, machte ihn geheimnisvoll.
Noch so ein ungreifbarer Mann wie Viorel, wenn auch nicht in der Luft, sondern am Boden.
Böen drückten die Robinson sanft nach Osten. Ana steuerte gegen, ließ die schlafenden Geparden hinter sich. Im Süden lagen, in der Ferne verborgen, die Flächen des Österreichers, im Westen an der Grenze zu Serbien die der Araber aus den Emiraten, auch sie hatten mittlerweile in Timiş gekauft. Ana Desmerean flog für viele von ihnen, für den Holländer, die Italiener, die Araber, die Amerikaner südlich von Temeswar, für den Dänen, den Deutschen oben im Kreis Arad und neuerdings auch für einen saudischen Konzern, der Männer mit rotweiß karierten Kopftüchern in langen weißen Gewändern schickte, die im Banater Wind flatterten wie die Segel eines gestrandeten Schiffs.
Für Touristen gelegentlich.
Für Marthen flog sie offiziell nicht.
Sie ging von eintausend auf fünfhundert Fuß hinunter. Die Äcker unter ihr gehörten schon zu Marthens Land. Drei seiner grünen John-Deere-Traktoren säten mit den meterbreiten Drillmaschinen Winterraps aus. Von oben sahen sie ein wenig aus wie riesige mechanische Heuschrecken.
Eine ähnliche Route musste Viorel vor fünfunddreißig Jahren genommen haben, bevor sie die Donau im Tiefflug überquert hatten. Sie waren ausschließlich nachts unterwegs gewesen, immer nur für fünfzehn, zwanzig Minuten, hatten dazwischen in menschenleeren Gegenden Station gemacht und gewartet, bis Viorel der Ansicht war, dass sie wieder ein paar Kilometer fliegen konnten.
Darf ich bei dir bleiben?
Nein, meine Ana.
Noch heute spürte sie die Sehnsucht und die Hoffnung, die das sechsjährige Mädchen in diesem Moment empfunden hatte. Die Enttäuschung darüber, dass Viorel sie fortgeschickt hatte, ins Licht.
Das Licht war Deutschland gewesen, Ansbach in Mittelfranken, wo andere Tanten gelebt hatten. Tanten, die nichts verstanden und nichts erlaubt hatten. Das ist kein Beruf für ein Mädchen!, hatten sie wieder und wieder gerufen. Also hatte Ana die Tanten nach der Schule verlassen und für ihren goldenen Traum zu arbeiten begonnen. Mit neunzehn hatte sie den Segelflugschein gemacht, mit einundzwanzig die Privatpilotenlizenz erworben. Von einem Brandenburger Flugplatz aus transportierte sie viele Jahre lang Touristen und Geschäftsleute in Cessnas und Pipers durch die Luft, wo alles freundlich und einfach war.
Bis einer der Kunden, ein Rumäne namens Miron, von Temeswar zu sprechen begann.
Ein anderer Traum. All die ausländischen Agrarinvestoren und Bodenspezialisten und Landkäufer mit ihren riesigen Flächen und ihrer Gier nach mehr, wie sollten die sich einen Überblick verschaffen, wo man noch kaufen konnte, bei den Straßen, wenn nicht durch die Luft? Ich besorge den Hubschrauber, und du fliegst ihn, sagte Miron. Ana dachte eine Nacht lang in seinem Bett darüber nach und willigte am Morgen ein. Sechs Monate später zog sie mit ihm nach Temeswar. Kurz darauf verliebte er sich in eine gebürtige Ungarin, Ana war es nur recht. Die Ungarin bekam den Mann, sie hatte die Robinson.
Unter ihr lag jetzt Coruia, eine Handvoll Steinhütten an einem Sandweg, in die braune Erde geduckt und von oben kaum zu erkennen. Zwei schwarze Punkte bewegten sich den hellen Weg entlang, noch aus fünfhundert Fuß Höhe sah es mühsam aus. Dann ein Wald, zweigeteilt von der neuen, wie üblich verwaisten Nationalstraße. Während sie sich ihr näherte, fasste sie Marthens Betrieb inmitten der weiten Felder in den Blick, die sich an den Wald anschlossen. Acht Silos, drei flache Hallen, Abdächer, das Bürogebäude, am Rand der Hofstelle das dreistöckige Wohnhaus, als hätte Marthen beim Bau geplant, vier, fünf weitere Kinder in die Welt zu setzen oder seine Eltern und Schwiegereltern nachzuholen. Keine weiteren Kinder, keine Eltern, und seine Frau war fort. Im Haus wohnten nur er selbst, seine Tochter Lisa und sein Betriebsleiter Winter, der düstere Freund aus Deutschland; ein ganzes Stockwerk stand leer.
Sie legte die linke Hand um den Pitch, ging auf zweihundert Fuß hinunter und war im Begriff, die Nationalstraße zu überfliegen, als sie unter sich Bewegung wahrnahm. Ein grünes Auto schoss aus dem Wald und bog mit ausbrechendem Heck auf die Straße ab. Die Fahrertür flog auf, am Steuer für Momente ein Mann zu erkennen, erst auf den letzten Zentimetern Asphalt fing er den Wagen ab. Schlingernd raste er auf der Gegenfahrbahn weiter, die Tür schwang hin und her, schließlich griff er danach und zog sie zu. Erst dann überquerte er den Mittelstreifen.
Ana hatte die Robinson abgebremst und schwebte auf einhundert Fuß über der Straße, während sie ihm nachsah. Zu viel Testosteron oder Alkohol, vielleicht beides. Sie wusste von Kunden, dass die ausländischen Arbeiter der Großbetriebe manchmal über die Stränge schlugen. Der hier musste vom Fluss am Waldrand gekommen sein, hatte den Wagen im Suff vielleicht durch eine seichte Stelle geprügelt, um zu testen, ob er als Amphibienfahrzeug taugte. Ein VW, anscheinend gut in Schuss, sie schätzte seine Geschwindigkeit auf hundertfünfzig km/h, und noch immer schien er zu beschleunigen.
Sie zog den Hubschrauber hoch und richtete ihn wieder nach Süden aus. Als sie Sekunden später zurücksah, war das Auto verschwunden. Über den Baumkronen westlich der Nationalstraße hing aufgewirbelter Staub; offenbar war es auf den Sandweg abgebogen, der nach Coruia führte.
Sie ließ den Wald hinter sich, dann den Fluss und hielt auf Marthens Gebäude zu, wie immer mit klopfendem Herzen. Eine Schwärmerei ohne Hoffnung und Sinn, sie wusste das. Sie brauchte weder das eine noch das andere, sie brauchte nur das klopfende Herz, ihre billige, kleine Schwärmerei, damit sie irgendwie auch ein Teil der Gegenwart und der Zukunft war, während sie dabei half, das Land Ceauşescus und der Securitate an die Ausländer zu verkaufen, und die Leichen ihrer Eltern suchte.
5
Coruia
DIE LETZTEN EINHUNDERT METER rannte Adrian. Hinter einem Fenster ein regloses Gesicht, Bogdan, sonst fiel ihm niemand auf, die Straße leer, und Bogdan war krank im Kopf; was er sah, geriet ihm durcheinander mit allem, was er jemals zuvor gesehen hatte, die Lebenden mit den Toten, das Klare mit dem Unklaren. Das Blut auf dem Hemd und der Hose hätte Bogdan ohnehin nicht bemerkt, ihr Blut, feucht und kühl auf seiner Haut, und während er an das Blut auf seiner Haut dachte und an all das Blut auf ihrer Haut und die Risse und Löcher in ihrer Haut, spürte er ihre halb geschlossenen Augen auf sich liegen, die ihn starr und kalt und matt anblickten und gleichzeitig durch ihn hindurchschauten. Ihre Augen würden ihm von jetzt an überallhin folgen, dachte er, sie sahen durch ihn hindurch in die Zukunft und wussten, was er tun würde, wo er sein würde, bevor er selbst es wusste, und sie würden ihn beobachten, wie sie ihn jetzt beobachteten, während er Bogdans schützenden Gartenzaun verließ und zum Haus der Familie rannte. Mit Wucht stieß er das in den Angeln quietschende Metalltor auf und schloss es hinter sich, ein Knäuel junger Katzen um die Füße, kurz darauf auch die beiden kläffenden Hunde, die nach seinen Waden schnappten und stehen blieben und nicht verstanden, warum er nicht mit ihnen spielte.
Dann stand er im dämmrigen Wohnraum und wusste nicht, was er tun sollte, die Stille in dem niedrigen, steinernen Zimmer, Zentrum seines bisherigen Lebens, lähmte ihn, raubte ihm den Atem. Das Häuschen lag verlassen, der Vater in der Fabrik in Temeswar, die Mutter drüben im Haus der Marthens, Razvan mit dem Fahrrad unterwegs zur Tankstelle, wo er den Tag mit ein paar Flaschen Bier verbringen würde. In der Luft hing noch der Geruch des starken türkischen Kaffees, den sie am Morgen getrunken hatten. Wäre nur der Vater hier, dachte er verzweifelt, der wüsste, was zu tun war, würde mit seiner leisen, rauen Stimme Ratschläge geben, würde vielleicht sagen: Erst mal ziehst du dich um, dann rauchen wir draußen eine Zigarette und überlegen, komm, Adi, zieh dich um, und was du anhast, verbrennst du am besten. Er streifte Hemd, T-Shirt und Hose ab und warf alles in den Kamin, in dem noch die Glut vom frühen Morgen glomm, Zweige hinterher und zwei Holzscheite und sah einen Moment lang zu, wie ihr Blut verbrannte. Dann lief er ins größere Schlafzimmer, das er mit Razvan teilte, und nahm frische Kleidung aus dem Schrank und hatte sich gerade angezogen, als er hinter sich ein Grunzen hörte.
Erschrocken fuhr er herum.
Razvan saß halb aufgerichtet im Bett, auf einen Arm gestützt. »Was soll das, was machst du hier?«
»Ich muss nach Voiteg«, stieß Adrian hervor.
»Und deswegen weckst du mich? Platzt hier rein und weckst deinen kranken Bruder?«
»Du bist krank?«
Razvan zuckte die Achseln. »Fieber.«
Fieber vom Bier am Tag zuvor, dachte Adrian, vielleicht auch von der Unzufriedenheit, den dauernden Klagen, zu krank, um weiterzutrinken. Mit jeder Minute ohne Bier würde die Unzufriedenheit wachsen, am Abend würde es wie so oft Streit geben. Plötzlich wusste er, was zu tun war: den kleinen Rucksack packen, den Pass aus dem Nachttischchen nehmen, dann schnell raus, weg von Razvan, bevor das Fieber von der Wut weggespült war und der Bruder aus ihm herausprügeln würde, was geschehen war, Razvan, vierzehn Jahre älter und doppelt so schwer und rasend in seiner Wut.
»Und warum musst du nach Voiteg?«
Wahllos griff er in die Fächer auf seiner Seite des Schranks und füllte den Rucksack, während er darüber nachdachte, was er antworten sollte. Weil ihm nichts einfiel, schwieg er. Als er die Schublade des Nachttischchens aufzog, hörte er die Federn von Razvans Bett quietschen, der Bruder hatte sich ganz aufgesetzt, die Füße auf den Boden gestellt, knurrte jetzt drohend: »He, antworte mir!«
»Weil Winter es so will.«
»Winter?«
»Der Betriebsleiter.« Er kehrte in den Wohnraum zurück und lief zum Kamin. Hinter einem losen Stein in der Wand daneben hatte der Vater gespartes Geld vor Razvan versteckt, mehrere Tausend Lei, falls du mal heiraten willst oder die Fabrik schließt, immer schön warm, damit es uns gewogen bleibt, das Geld, und nicht an Wert verliert, wenn’s draußen kalt ist. So leise wie möglich zog er den Stein heraus, langte in den Hohlraum, ein Bündel Scheine, nicht nur Lei, sondern auch Euro, wie er irritiert bemerkte, Hunderte Euro, Tausende, unvorstellbar viel. Er teilte das Bündel hastig in zwei Hälften, legte eine zurück und schob den Stein wieder davor.
»Und warum sollte der ausgerechnet dich nach Voiteg schicken?« Razvan stand im Türrahmen, eine Zigarette im Mund, starrte auf die Scheine in Adrians Hand.
»Mich und andere.«
»Ach, und weshalb?«
»Sie haben da Brachland, das aufgearbeitet werden muss.«
»Als hättest du Ahnung vom Aufarbeiten.«
Adrian zwang sich zur Ruhe. Er steckte das Geld in den Rucksack, warf ihn sich über die Schultern und ging zur Haustür, wo er die Schuhe ausgezogen hatte. Wie so oft blieb sein Blick für eine Sekunde auf den Küchenschränken haften, die schief über dem Herd und der Spüle hingen, von Anbeginn schon, seit fast fünf Jahrzehnten, und niemand außer Razvan störte sich daran. Die Mutter weigerte sich, die Küchenschränke gerade hängen zu lassen, nichts sollte sich verändern in diesem Raum, in den sie ihre sechs Kinder hineingeboren hatte, von denen nur noch zwei am Leben waren. Alle sechs waren hier aufgewachsen, sagte sie, und waren also in den Wänden und im Boden und den Gerüchen und Möbeln dieses Raumes und auch in der Schiefe der Küchenschränke, und deswegen durfte sich nichts ändern, es hätte bedeutet, die Erinnerung an die vier, die nicht mehr lebten, aus diesem Raum zu vertreiben, die Seelen der vier fortzuschicken, und das wollte die Mutter nicht, und der Vater verstand sie.
»Nichts weißt du vom Aufarbeiten«, sagte Razvan, der ihm lautlos gefolgt war und sich nun zwischen ihn und die Haustür stellte, »und du weißt wohl auch nicht, dass man seinen Bruder nicht belügt und dass man seine Familie nicht bestiehlt, du Hund!«
Adrian schlüpfte in die Turnschuhe, wehrte sich nicht, als sich Razvans Finger um seinen Nacken schlossen, der Bauch weiß und weich an seinem Arm, weiße Füße mit großen weißen Zehen neben seinen Schuhen, sieben Zehen, noch immer ein seltsamer Anblick: der Fuß, von dem fast ein Drittel fehlte.
»Gib mir das Geld.«
Er richtete sich auf und tat, als wollte er nach Razvan schlagen, doch der lachte nur und drückte ihn mit beiden Händen von sich, und wie immer griff Adrian wieder an und wurde wieder weggeschoben und fing sich und stürzte sich ein drittes Mal auf den Bruder, der einen Schritt nach vorn machte und ihn mit aller Kraft von sich stieß, weit in den Raum hinein. Adrian ließ sich fallen, drehte sich noch im Aufrappeln um und rannte in die andere Richtung zu der schmalen Öffnung in der Seitenwand, sprang durch den Perlenvorhang, lief den engen, fensterlosen Gang entlang, an der Toilette vorbei, warf sich mit Wucht gegen die Sperrholztür an dessen Ende und fiel zwischen die zu Tode erschrockenen Hühner.
Ohne sich umzusehen, hastete er ins Freie, obwohl er wusste, dass Razvan ihm mit dem verstümmelten Fuß nicht folgen konnte, hinaus in den Garten, an den beiden Sofas aus verlassenen Nachbarhäusern vorbei, die der Vater und er unter den Apfelbaum gestellt hatten, um gemeinsam Zigaretten zu rauchen, und er dachte, dass er so weit von zu Hause weg musste wie noch nie zuvor, irgendwohin, wo er sicher war und bleiben und neu anfangen konnte, ohne seine Träume, ohne diesen Tag und alles, was nun zerstört war.
Einmal nur sah er zurück, Minuten später, als er die Ackerfläche schon halb überquert hatte, das Elternhaus im Sonnenlicht und trotzdem kaum zu erkennen, so flach und erdfarben, wie es war, und er dachte, dass jetzt nur noch eines von den sechs Kindern der Familie Lascu dort wohnte und auch er nur noch eine Erinnerung war, die in Wänden und Möbeln und einem schiefen Küchenschrank lebte.
6
Neu-Prenzlin, nahe Coruia
WINTER DUSCHTE LANGE, um die Gespenster zu verscheuchen, dann ging er ins Erdgeschoss hinunter. Im Flur kam ihm Ecaterina entgegen, die Haushälterin, eine schmale, stille Frau Anfang fünfzig. Ihr Gesicht und die Hände hätten zu einer Siebzigjährigen gepasst, ihre Willenskraft und Zähigkeit waren die einer Zwanzigjährigen. Er ließ sich von ihrem gewohnten Lächeln nicht täuschen, sah immer eine Art Schmerz in ihren Augen. Er mochte sie, verstand irgendetwas, ohne zu wissen, was.
»Die Frau mit dem Hubschrauber ist da.«
Er nickte, fragte auf Rumänisch: »Wo sind sie?«
»Im Büro, glaube ich.«
»Und Lisa?«
»Lisa ist schwimmen.«
»So lange?«
Ein ratloses Achselzucken, dann verschwand Ecaterina in Richtung Küche. Winter zog seine Stiefel an und verließ das Haus. Eugen, der rumänische Vorarbeiter, eilte ihm aus der Traktorenhalle entgegen, ging mit ihm in der Sonne über den asphaltierten Platz. Sie hätten nach dem Update Probleme mit den GPS-Geräten, sagte er, die Überlappung sei zu groß, vierzig Zentimeter, die Korrektursysteme funktionierten nicht. Winter rief in Temeswar an, bekam erst für den nächsten Tag einen Techniker. Er rechnete die Verluste vor, regte sich ein bisschen auf, ohne Erfolg, es blieb bei morgen. Er war mit dem Rücken zur Sonne stehen geblieben, sagte, während er das Telefon in die Hosentasche schob: »Fahrt so lange manuell.«
Allein ging er weiter, auf das Bürogebäude zu, das ein wenig abseits im Windschatten der Hofstelle lag, grellweiß im Licht der Morgensonne. Fast alle Parkplätze belegt, mehr als ein Dutzend Autos, dazu der Kleinbus, mit dem sie Mitarbeiter aus entfernteren Orten einsammelten. Ana Desmerean war ein Stück hinter dem Gebäude gelandet, die lange Säule des Hubschraubers mit dem Hauptrotor war eben noch über dem Flachdach zu sehen. Er mied den Vordereingang, wollte nicht durchs größte Büro, wo alles, was den Betrieb erreichte und verließ, registriert wurde und wo es immer Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen gab. Durch den Seiteneingang betrat er den Trakt mit den Einzelbüros.
Marthen und Ana Desmerean saßen im Flächenraum an einem der Tische vor den topografischen Landkarten, Kaffee und Gebäck vor sich, Ana wie üblich mit leicht gerötetem Gesicht und ein wenig verlegen. Hoch oben in der Luft brachte sie nichts aus der Ruhe, unten auf dem Boden wirkte sie unsicher, als traute sie dem Grund nicht, auf dem ihre Füße standen. Sie war klein, schmal, in sich gekehrt. Winter wusste nicht viel über sie, nur dass sie als Kind nach Deutschland gegangen und vor wenigen Jahren zurückgekehrt war. Weshalb sie alle paar Wochen zu Marthen kam, ohne dass es dafür offensichtliche Gründe gab, konnte er nur vermuten.
Er setzte sich mit einem Gruß zu ihnen, schenkte sich eine Tasse ein, wartete.
»Oraviţa«, sagte Marthen, sah ihn an. »Zwanzig Hektar, kompakt, bis vor einem Jahr bewirtschaftet.«
»Der Besitzer ist krank«, erklärte Ana. »Er muss zur Behandlung nach Italien, aber das ist teuer. Wie lange er bleibt, weiß er nicht, deswegen verkauft er. Der Österreicher ist interessiert, die Dänen auch, aber wenn ihr schnell seid, habt ihr eine Chance.«
Winter mochte die Art, wie sie Deutsch sprach, langsam, dunkel, melodisch, die Vokale rund und voll. Er nahm einen Schluck, den Blick auf die Flurkarte mit den Flächen von JM Romania gerichtet, spürte dem sauren deutschen Filterkaffee nach, auf den Marthen nicht verzichten wollte. Die Karte endete im Süden mit Jamu Mare, bis Oraviţa waren es noch einmal gut vierzig Kilometer, aber das war nicht das Problem. Marthen besaß bei Oraviţa keine Flächen, müsste dort bei Null anfangen. »Fünfzig-, sechzigtausend Euro?«, fragte er.
»Fünfzigtausend, soweit ich weiß«, erwiderte Ana.
»Du weißt, wie ich dazu stehe, Jörg.«
»Kein Geld«, sagte Marthen.
Winter nickte. »Kein Geld, keine Leute, keine Zeit, keine freien Maschinen.«
»Macht es wie die Italiener oben bei Curtea«, sagte Ana.
Marthen ging nicht darauf ein, auch Winter schwieg. So arbeitete JM Romania nicht – Land kaufen, über Jahre brachliegen lassen, bis der Preis gestiegen war, dann mit hohem Gewinn verkaufen. Marthen war Landwirt aus Leidenschaft, war für die Landwirtschaft gemacht. Er wollte Früchte wachsen sehen, wollte die Böden verbessern, die Fruchtfolgen optimieren, wollte mit der Natur arbeiten, nicht gegen sie. Die Sehnsucht nach eigenen Flächen hatte ihn fünfzehnhundert Kilometer von zu Hause fortgetrieben. Im rumänischen Banat lebte er seinen verzweifelten Traum, ein bisschen besessen, ein bisschen kauzig. Er würde die Natur nicht um der Rendite willen ausbeuten. Würde zu Winters Leidwesen wohl eher den Konkurs riskieren.
Marthen räusperte sich. »Bis wann müssen wir uns entscheiden?«
»Die Dänen sind Ende nächster Woche in Oraviţa«, sagte Ana. »Der Österreicher ist bis Mitte Oktober in den USA.«
Marthen nickte nachdenklich, fast versonnen. Winter wusste, was das bedeutete – neue Ideen, neue Risiken, neue Ziele, vielleicht neue Enttäuschungen. Resigniert schwenkte er seine Tasse in Richtung Karte, sagte: »Du hast hier oben fast tausend Hektar, die du nicht bewirtschaften kannst, weil sie nicht arrondiert sind. Tausend Hektar, Jörg! Fast fünfundzwanzig Prozent deiner Flächen, die außer Subventionen keinen Cent einbringen. Willst du dich nicht erst mal darum kümmern?«
»Apropos«, sagte Marthen, scheinbar unbeeindruckt, »die Dänen haben angerufen, sie wollen tauschen.« Er stand auf, trat zu der mittleren der drei grünen Karten, auf der jedes einzelne Flurstück von 0,58Hektar auf dem Gebiet von JM Romania eingezeichnet war, gelb umrandet die Parzellen, die ihm gehörten, schwarz die übrigen. Er klopfte mit den Fingern auf ein spitzes Dreieck. »Wir bekommen von ihnen die sechs Lands von Popescu auf der 322. Hier.« Er tippte auf die fraglichen Parzellen, die über Fläche 322 verstreut lagen und deren Bewirtschaftung stark erschwerten, weil die Traktoristen sie jedes Mal umfahren mussten. »Dafür wollen sie die 36.«
Winter folgte dem Zeigefinger. Die 36 lag ein gutes Stück Richtung Voiteg, umfasste sechs arrondierte Hektar im Gebiet der Dänen, die Marthen vor langer Zeit gepachtet und schließlich gekauft hatte, als die Großen die Region noch nicht in Interessengebiete aufgeteilt hatten. Gut drei Hektar gegen sechs, dachte er, aber die Vorteile überwogen. In der 322 blieben dann nur noch vier Parzellen, die Marthen nicht gehörten. »Ich dachte, Popescu will nicht verkaufen?«
»Er wollte nicht an euch verkaufen«, sagte Ana. »Gegen die Dänen hat er nichts.«
Winter war nicht in alles involviert, was Marthens Flächen betraf, hatte ganz offensichtlich nicht mitbekommen, wie der Deal eingefädelt worden war; vielleicht auf einen Tipp von Ana Desmerean hin, die von vielen ausländischen Landwirten in den Kreisen Timiş und Arad wusste, was sie wollten, und manchmal auch, wie sie es bekamen. Ein Anruf Marthens bei den Dänen, kurz darauf hatte der alte Popescu, der kein Telefon besaß, vermutlich Besuch von freundlichen, jungen Männern aus dem kühlen Norden und deren rumänischem Anwalt bekommen und ein paar Dokumente unterschrieben und den restlichen Tag damit verbracht, wieder und wieder die Euroscheine auf seinem Tisch zu zählen.
»Und was hat er gegen uns?«, fragte Marthen.
»Ihr seid zu oft über seine Flächen gefahren.« Ana stand auf. »Ich muss leider weiter. Was sage ich dem Bauern in Oraviţa?«
»Ich komme am Montag runter und seh’s mir an.«
Winter rieb sich seufzend über die Stirn, beachtete die Blicke der beiden nicht. Schon in den gemeinsamen Prenzliner Jahren hatte er versucht, Marthen vor dessen selbstmörderischer Sturheit zu schützen. Das Gleiche in der Beziehung mit Anett, die ähnlich dickköpfig war. Hatten die beiden Geschwister ein Ziel, setzten sie alles daran, es zu realisieren. Hindernisse akzeptierten sie nicht. Rückschläge, Niederlagen. Also mussten sie scheitern, irgendwann, irgendwie. Anett hatte sich an den Grenzen der DDR