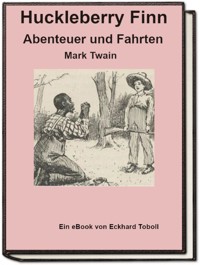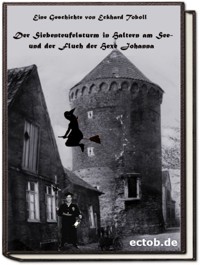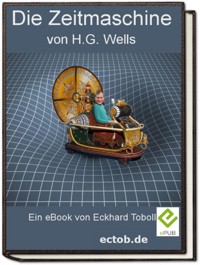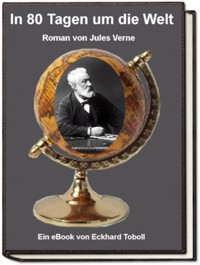Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Thomas Mann schrieb seine Novelle »Der Tod in Venedig« im Jahr 1911 während seiner Zeit in München. Erstmals erschien das Werk 1912 in einer Literaturzeitschrift und wenige Monate später als separate Ausgabe. Im Mittelpunkt der fünf Kapitel steht neben dem Schriftsteller Gustav Aschenbach der 14-jährige polnische Junge Tadzio. Zeitlich ist die Novelle zu Beginn des 20. Jahrhunderts angesiedelt. Schauplätze sind im Wesentlichen Aschenbachs Heimatstadt München sowie Venedig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Titel: »Der Tod in Venedig oder der Jüngling mit lockigem Haar«
Eine Novelle von Thomas Mann aus dem Jahr 1911
eBook-Autor: Eckhard Toboll
Copyright: © 2022 Eckhard Toboll, D-45772 Marl
Verlag: epubli.de, Berlin
ISBN: 9783756540716
Inhaltsangabe
Quelle: Der Tod in Venedig • Zusammenfassung auf Inhaltsangabe.de
Thomas Mann schrieb seine Novelle »Der Tod in Venedig« im Jahr 1911 während seiner Zeit in München. Erstmals erschien das Werk 1912 in einer Literaturzeitschrift und wenige Monate später als separate Ausgabe. Im Mittelpunkt der fünf Kapitel steht neben dem Schriftsteller Gustav Aschenbach der 14-jährige polnische Junge Tadzio. Zeitlich ist die Novelle zu Beginn des 20. Jahrhunderts angesiedelt. Schauplätze sind im Wesentlichen Aschenbachs Heimatstadt München sowie Venedig.
Über das erste Kapitel
Schriftsteller Aschenbach – gerade 50 Jahre alt geworden – sucht bei einem Spaziergang durch die bayerische Metropole etwas Entspannung und Ablenkung vom Alltag, als ein offensichtlich fremdländischer Wandergeselle das Fernweh und die Reiselust in ihm weckt. Daraufhin beschließt der Schriftsteller, München für einige Tage zu verlassen, um Neues zu entdecken und dabei Kraft und Ideen für neue Stücke zu sammeln. Außerdem hofft Aschenbach so, dem hohen Erwartungsdruck an seine Werke vorübergehend zu entgehen.
Über das zweite Kapitel
Hier wird der biografische Hintergrund des Schriftstellers beleuchtet. Berichtet wird von den eher nüchternen und rationalen Wurzeln der väterlichen Seite (Militär, Jurist, Verwaltung etc.) und vom spontanen und emotionellen Hintergrund der mütterlichen Vorfahren (Musik, Kunst etc.). Ausgehend von diesen Voraussetzungen, war das Leben von Gustav Aschenbach schon immer auf hohe Leistung und gesellschaftliches Ansehen ausgerichtet. Sein Wissen und seine künstlerisch-literarischen Fähigkeiten haben ihm hohes Ansehen eingebracht und durch den Verlust seiner jungen Ehefrau hat sich der Schriftsteller noch intensiver mit seiner Arbeit beschäftigt. Der Preis für seine derzeitige Akzeptanz und das Ansehen sind allerdings Erschöpfung, Müdigkeit und Gereiztheit – ebenfalls gute Gründe für einen Urlaub.
Über das dritte Kapitel
Die Reise von Gustav Aschenbach führt ihn zuerst nach Triest. Aber noch hat er die innere Unruhe nicht abgelegt, weshalb er schon am nächsten Tag nach Pola weiterreist. Eine gute Woche später beschließt Aschenbach, auf dem Seeweg nach Venedig zu fahren. Bereits auf dem Schiff und auch später in einer venezianischen Gondel werden in Aschenbach erste Überlegungen laut, nach denen er sich in einer für ihn fremden Welt befindet, in der ihm noch viele Dinge völlig unbekannt sind. Insbesondere einige Personen, die auf der Reise seinen Weg kreuzten, machten Aschenbach klar, das andere Länder und andere Kulturkreise auch andere – ihm bisher unbekannte – Charaktere von Menschen hervorbringen. Teils überrascht, teils fasziniert von dieser Vielfältigkeit, genießt es der Schriftsteller am ersten Abend in Venedig, die zahlreichen verschiedenen Hotelgäste zu beobachten. Dabei fällt ihm besonders der polnische Jüngling Tadzio auf, von dessen Schönheit Aschenbach vollkommen überwältigt ist. Seine innere Unruhe und die schier überwältigenden neuen Eindrücke verleiten den Münchner am nächsten Tag schon wieder zur Abreise, aber ein weiteres Zusammentreffen mit dem »gottähnlichen« polnischen Jungen lässt diese Gedanken vorerst wieder verfliegen.
Wenig begeistert ist Aschenbach von den Gassen Venedigs und dem dort herrschenden Klima, weshalb er am Nachmittag ein weiteres Mal seine Abreise beschließt. Am nächsten Tag muss Aschenbach jedoch erfahren, dass sein vorausgeschicktes Gepäck auf einen falschen Zug verladen wurde. Die einzige Alternative ist nun, in das Hotel zurückzukehren und sich erneut dort einzumieten. Allerdings ist der Schriftsteller nicht ärgerlich wegen des fehlenden Gepäcks, sondern viel mehr froh, nun wieder in der Nähe des schönen Knaben Tadzio zu sein.
Über das vierte Kapitel
Zwei Tage später erhält der Schriftsteller sein Gepäck wieder zurück, hat aber dennoch längst kein Verlangen mehr, abzureisen. Stattdessen gestaltet er seinen Aufenthalt so, dass er Tadzio möglichst oft beobachten und in dessen Nähe sein kann. Einige Tage später kommt es vor dem Hotel zu einer unverhofften Begegnung zwischen Aschenbach und Tadzio. Beide sind überrascht. Ohne es mit Worten zu sagen, offenbaren Ausdruck, Gestik und Mimik Aschenbachs die Gefühle, die er dem Jungen heimlich entgegenbringt. Tadzio seinerseits lächelt den älteren Mann nur an, was dieser aber völlig falsch als starke Zuneigung interpretiert. Nun ist Aschenbach fest davon überzeugt, dass seine starken Gefühle (inzwischen hält er es für echte Liebe) von Tadzio erwidert werden.
Über das fünfte Kapitel
Aschenbach weilt inzwischen die vierte Woche in der Lagunenstadt. Seltsame Düfte, heimliche Gespräche und aufgestellte Transparente lassen den Dichter den Ausbruch einer Seuche vermuten, die den Touristen jedoch verschwiegen werden soll. Zwar reisen auch einige Hotelgäste vorzeitig ab, da es sich aber dabei hauptsächlich um deutsche und österreichische Gäste handelt, ist Aschenbach wegen seiner heimlichen Leidenschaft eher erleichtert. Die Chancen, dass seine Zuneigung zu Tadzio weiter sein Geheimnis bleibt, sind so gestiegen. Diese Zuneigung hat in den letzten vier Wochen allerdings fast schon skurrile Züge angenommen und bestimmt den kompletten Aufenthalt des Münchners. Täglich schleicht er dem Jungen nach und folgt so oft wie möglich dem Tagesablauf Tadzios. Kurz darauf wird Aschenbach in einem Reisebüro über das wahre Ausmaß der Seuche aufgeklärt und ihm wird zur baldigen Abreise geraten. Er erwägt sogar, die Familie des Angebeteten einzuweihen, verwirft den Gedanken jedoch wieder.
Irritiert und aufgewühlt von einem seltsamen Traum, befürchtet Aschenbach plötzlich, er könne dem heimlichen Geliebten nicht gefallen. Er beschließt eine »Verjüngungskur« mithilfe von Pudern, Cremes, Makeup und einer völlig neuen Frisur mit gefärbten Haaren, was den einstmals ehrwürdigen gereiften Dichter zu einer absonderlichen Erscheinung werden lässt. Wenige Tage später überkommt Aschenbach – inzwischen völlig verblendet und unter der Wirkung verdorbener Erdbeeren – ein weiterer Traum, der die gesamte Zerrissenheit und das Dilemma des Schriftstellers verdeutlicht. Kurz darauf – Aschenbach stellt einmal wieder dem polnischen Knaben nach – geht dieser ins Meer, um sich zu erfrischen. In Aschenbachs Fantasie will er aber seinem jungen Leben ein Ende setzen. Dabei lächelt der Junge ihn an und lockt ihn ebenfalls ins Meer. Diese Wunschvorstellung war der letzte Gedanke Aschenbachs, kurz darauf verstirbt er.
In der Novelle »Der Tod in Venedig« lässt Mann zwei wesentliche Gegensätze aufeinander treffen. Der eigentlich eher rationale, nach Perfektion strebende Schriftsteller, der von gesellschaftlichen Konventionen, aber auch von hohem Leistungs- und Schaffensdruck geprägt ist, trifft auf eine äußerst emotionale Welt, die sich nur schwer in Worte fassen lässt. Außerdem liegen in dieser Welt Dinge wie Tod und Liebe dicht beieinander. Erzählt werden die Ereignisse dabei durch einen Erzähler bzw. durch Aschenbachs Augen. Mann verwendet lange, teils sehr verschachtelte Haupt- und Nebensätze sowie verschiedene verheißungsvolle Begegnungen (seltsamer Wandergeselle, Gondoliere, Musiker im Hotel). Durch diese Erzählweise wird die eigentlich wenig spektakuläre Geschichte dennoch fesselnd und spannend.
Thomas Mann
Der Tod in Venedig oder der Jüngling mit lockigem Haar
Erstes Kapitel
Gustav Aschenbach oder von Aschenbach, wie seit seinem fünfzigsten Geburtstag amtlich sein Name lautete, hatte an einem Frühlingsnachmittag des Jahres 19.., das unserem Kontinent monatelang eine so gefahrdrohende Miene zeigte, von seiner Wohnung in der Prinz-Regentenstraße zu München aus, allein einen weiteren Spaziergang unternommen. Überreizt von der schwierigen und gefährlichen, eben jetzt eine höchste Behutsamkeit, Umsicht, Eindringlichkeit und Genauigkeit des Willens erfordernden Arbeit der Vormittagsstunden, hatte der Schriftsteller dem Fortschwingen des produzierenden Triebwerks in seinem Innern, jenem »motus animi continuus«, worin nach Cicero das Wesen der Beredsamkeit besteht, auch nach der Mittagsmahlzeit nicht Einhalt zu tun vermocht und den entlastenden Schlummer nicht gefunden, der ihm, bei zunehmender Abnutzbarkeit seiner Kräfte, einmal untertags so nötig war. So hatte er bald nach dem Tee das Freie gesucht, in der Hoffnung, daß Luft und Bewegung ihn wieder herstellen und ihm zu einem ersprießlichen Abend verhelfen würden.
Es war Anfang Mai und, nach naßkalten Wochen, ein falscher Hochsommer eingefallen. Der Englische Garten, obgleich nur erst zart belaubt, war dumpfig wie im August und in der Nähe der Stadt voller Wagen und Spaziergänger gewesen. Beim Aumeister, wohin stillere und stillere Wege ihn geführt, hatte Aschenbach eine kleine Weile den volkstümlich belebten Wirtsgarten überblickt, an dessen Rande einige Droschken und Equipagen hielten, hatte von dort bei sinkender Sonne seinen Heimweg außerhalb des Parks über die offene Flur genommen und erwartete, da er sich müde fühlte und über Föhring Gewitter drohte, am Nördlichen Friedhof die Tram, die ihn in gerader Linie zur Stadt zurückbringen sollte. Zufällig fand er den Halteplatz und seine Umgebung von Menschen leer. Weder auf der gepflasterten Ungererstraße, deren Schienengeleise sich einsam gleißend gegen Schwabing erstreckten, noch auf der Föhringer Chaussee war ein Fuhrwerk zu sehen; hinter den Zäunen der Steinmetzereien, wo zu Kauf stehende Kreuze, Gedächtnistafeln und Monumente ein zweites, unbehaustes Gräberfeld bilden, regte sich nichts, und das byzantinische Bauwerk der Aussegnungshalle gegenüber lag schweigend im Abglanz des scheidenden Tages. Ihre Stirnseite, mit griechischen Kreuzen und hieratischen Schildereien in lichten Farben geschmückt, weist überdies symmetrisch angeordnete Inschriften in Goldlettern auf, ausgewählte, das jenseitige Leben betreffende Schriftworte wie etwa: »Sie gehen ein in die Wohnung Gottes« oder: »Das ewige Licht leuchte ihnen«; und der Wartende hatte während einiger Minuten eine ernste Zerstreuung darin gefunden, die Formeln abzulesen und sein geistiges Auge in ihrer durchscheinenden Mystik sich verlieren zu lassen, als er, aus seinen Träumereien zurückkehrend, im Portikus, oberhalb der beiden apokalyptischen Tiere, welche die Freitreppe bewachen, einen Mann bemerkte, dessen nicht ganz gewöhnliche Erscheinung seinen Gedanken eine völlig andere Richtung gab.
Ob er nun aus dem Innern der Halle durch das bronzene Tor hervorgetreten oder von außen unversehens heran und hinauf gelangt war, blieb ungewiß. Aschenbach, ohne sich sonderlich in die Frage zu vertiefen, neigte zur ersteren Annahme. Mäßig hochgewachsen, mager, bartlos und auffallend stumpfnäsig, gehörte der Mann zum rothaarigen Typ und besaß dessen milchige und sommersprossige Haut. Offenbar war er durchaus nicht bajuwarischen Schlages: wie denn wenigstens der breit und gerade gerandete Basthut, der ihm den Kopf bedeckte, seinem Aussehen ein Gepräge des Fremdländischen und Weitherkommenden verlieh. Freilich trug er dazu den landesüblichen Rucksack um die Schultern geschnallt, einen gelblichen Gurtanzug aus Lodenstoff, wie es schien, einen grauen Wetterkragen über dem linken Unterarm, den er in die Weiche gestützt hielt, und in der Rechten einen mit eiserner Spitze versehenen Stock, welchen er schräg gegen den Boden stemmte und auf dessen Krücke er, bei gekreuzten Füßen, die Hüfte lehnte.
Erhobenen Hauptes, so daß an seinem hager dem losen Sporthemd entwachsenden Halse der Adamsapfel stark und nackt hervortrat, blickte er mit farblosen, rot bewimperten Augen, zwischen denen, sonderbar genug zu seiner kurz aufgeworfenen Nase passend, zwei senkrechte, energische Furchen standen, scharf spähend ins Weite. So—und vielleicht trug sein erhöhter und erhöhender Standort zu diesem Eindruck bei—hatte seine Haltung etwas herrisch Überschauendes, Kühnes oder selbst Wildes; denn sei es, daß er, geblendet, gegen die untergehende Sonne grimassierte oder daß es sich um eine dauernde physiognomische Entstellung handelte: seine Lippen schienen zu kurz, sie waren völlig von den Zähnen zurückgezogen, dergestalt, daß diese, bis zum Zahnfleisch bloßgelegt, weiß und lang dazwischen hervorbleckten.
Wohl möglich, daß Aschenbach es bei seiner halb zerstreuten, halb inquisitiven Musterung des Fremden an Rücksicht hatte fehlen lassen; denn plötzlich ward er gewahr, daß jener seinen Blick erwiderte und zwar so kriegerisch, so gerade ins Auge hinein, so offenkundig gesonnen, die Sache aufs Äußerste zu treiben und den Blick des andern zum Abzug zu zwingen, daß Aschenbach, peinlich berührt, sich abwandte und einen Gang die Zäune entlang begann, mit dem beiläufigen Entschluß, des Menschen nicht weiter achtzuhaben. Er hatte ihn in der nächsten Minute vergessen. Mochte nun aber das Wandererhafte in der Erscheinung des Fremden auf seine Einbildungskraft gewirkt haben oder sonst irgendein physischer oder seelischer Einfluß im Spiele sein: eine seltsame Ausweitung seines Innern ward ihm ganz überraschend bewußt, eine Art schweifender Unruhe, ein jugendlich durstiges Verlangen in die Ferne, ein Gefühl, so lebhaft, so neu oder doch so längst entwöhnt und verlernt, daß er, die Hände auf dem Rücken und den Blick am Boden, gefesselt stehen blieb, um die Empfindung auf Wesen und Ziel zu prüfen. Es war Reiselust, nichts weiter; aber wahrhaft als Anfall auftretend und ins Leidenschaftliche, ja bis zur Sinnestäuschung gesteigert. Er sah nämlich, als Beispiel gleichsam für alle Wunder und Schrecken der mannigfaltigen Erde, die seine Begierde sich auf einmal vorzustellen trachtete, —sah wie mit leiblichem Auge eine ungeheuere Landschaft, ein tropisches Sumpfgebiet unter dickdunstigem Himmel, feucht, üppig und ungesund, eine von Menschen gemiedene Urweltwildnis aus Inseln, Morästen und Schlamm führenden Wasserarmen. Die flachen Eilande, deren Boden mit Blättern, so dick wie Hände, mit riesigen Farnen, mit fettem, gequollenem und abenteuerlich blühendem Pflanzenwerk überwuchert war, sandten haarige Palmenschäfte empor, und wunderlich ungestalte Bäume, deren Wurzeln dem Stamm entwuchsen und sich durch die Luft in den Boden, ins Wasser senkten, bildeten verworrene Waldungen. Auf der stockenden, grünschattig spiegelnden Flut schwammen, wie Schüsseln groß, milchweiße Blumen; Vögel von fremder Art, hochschultrig, mit unförmigen Schnäbeln, standen auf hohen Beinen im Seichten und blickten unbeweglich zur Seite, während durch ausgedehnte Schilffelder ein klapperndes Wetzen und Rauschen ging, wie durch Heere von Geharnischten; dem Schauenden war es, als hauchte der laue, mephitische Odem dieser geilen und untauglichen Öde ihn an, die in einem ungeheuerlichen Zustande von Werden oder Vergehen zu schweben schien, zwischen den knotigen Rohrstämmen eines Bambusdickichts glaubte er einen Augenblick die phosphoreszierenden Lichter des Tigers funkeln zu sehen— und fühlte sein Herz pochen vor Entsetzen und rätselhaftem Verlangen. Dann wich das Gesicht; und mit einem Kopfschütteln nahm Aschenbach seine Promenade an den Zäunen der Grabsteinmetzereien wieder auf.
Er hatte, zum mindesten seit ihm die Mittel zu Gebote gewesen wären, die Vorteile des Weltverkehrs beliebig zu genießen, das Reisen nicht anders denn als eine hygienische Maßregel betrachtet, die gegen Sinn und Neigung dann und wann hatte getroffen werden müssen. Zu beschäftigt mit den Aufgaben, welche sein Ich und die europäische Seele ihm stellten, zu belastet von der Verpflichtung zur Produktion, der Zerstreuung zu abgeneigt, um zum Liebhaber der bunten Außenwelt zu taugen, hatte er sich durchaus mit der Anschauung begnügt, die heute jedermann, ohne sich weit aus seinem Kreise zu rühren, von der Oberfläche der Erde gewinnen kann, und war niemals auch nur versucht gewesen, Europa zu verlassen. Zumal seit sein Leben sich langsam neigte, seit seine Künstlerfurcht, nicht fertig zu werden,—diese Besorgnis, die Uhr möchte abgelaufen sein, bevor er das Seine getan und völlig sich selbst gegeben, nicht mehr als bloße Grille von der Hand zu weisen war, hatte sein äußeres Dasein sich fast ausschließlich auf die schöne Stadt, die ihm zur Heimat geworden, und auf den rauhen Landsitz beschränkt, den er sich im Gebirge errichtet und wo er die regnerischen Sommer verbrachte.