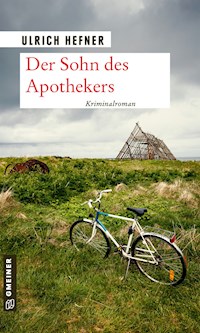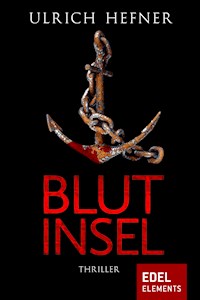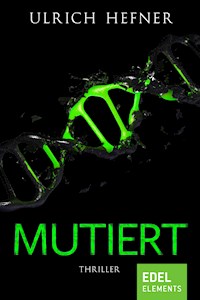Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
In den Dünen von Wangerooge wird die Leiche eines Rentners entdeckt. Wenige Tage später findet man an Bord eines führerlosen Fischkutters drei Tote. Während Hauptkommissar Martin Trevisan von der Kripo Wilhelmshaven den Serienmörder jagt, verfolgt der Täter unerkannt und unbeirrt seinen Plan. Lautlos und tödlich bewegt er sich durch Friesland und Ostfriesland.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrich Hefner
Der Tod kommt in Schwarz-Lila
Inselkrimi
Zum Autor
Ulrich Hefner wurde 1961 in Bad Mergentheim geboren. Er wohnt in Lauda-Königshofen, ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Hefner arbeitet als Polizeibeamter und ist freier Autor und Journalist. Er ist Mitglied in der IGdA (Interessengemeinschaft deutschsprachiger Autoren), im DPV (Deutschen Presseverband) und im Syndikat. Weiterhin ist er Gründungsmitglied der Polizei-Poeten. Die Polizei-Poeten veröffentlichten inzwischen vier Bücher, die nicht nur in Polizistenkreisen auf großes Interesse stießen. Neben der Krimiserie um den Ermittler Martin Trevisan, die inzwischen aus sechs Bänden besteht, sind inzwischen auch drei Thriller erschienen, die bereits in mehrere Sprachen übersetzt wurden. www.ulrichhefner.de und www.autorengilde.de.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
(Originalausgabe erschienen 2007 im Leda-Verlag)
Umschlaggestaltung: Katrin Lahmer
unter Verwendung eines Fotos von: zwehren / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-6412-6
Widmung
Vielen Dank, Benno. Dein Vertrauen hat mich bestärkt.
Aktenzeichen: 2000-Tr./6
Gedicht
Rot ist die Liebe,
Die Hoffnung ist grün,
weiß ist die Unschuld –
doch der Tod, der Tod kommt in
Schwarz-Lila
Westlich von Wangerooge
Sanft rollten die Wellen der Nordsee gegen den Rumpf des alten Kutters. Die Positionslichter schimmerten über das gekräuselte Wasser. Kein Schiff kreuzte ihren Kurs. Die Nordsee zeigte ihre angenehme Seite. Ein leichter Westwind umschmeichelte die schweißnassen Gesichter der Fischer und blies ihnen salzige Luft in die Nasen. Säuberlich aufgereiht hingen die Netze über der Reling und warteten auf Beute.
Harte Arbeit lag vor Kapitän Hansen und seinen Männern. Am späten Nachmittag waren sie aufgebrochen und hatten den Hafen verlassen. Der Wetterbericht verhieß zwei gute Tage, und diese Zeit galt es zu nutzen. Hier draußen am Borkumgrund westlich von Wangerooge hatten sie vor knapp zwei Wochen schon einmal gefischt. Prall gefüllt hatte die Winsch ihre Netze an Deck gehievt. Noch einmal so einen Fang und sein Schuldenberg wäre um ein Beträchtliches kleiner.
Hansen stand hinter dem Ruder und blickte hinaus auf die weite See. In der mondlosen Nacht konnte er den Horizont nur erahnen. Achtern warnte ein Leuchtfeuer vor gefährlichen Untiefen. Er wusste genau, wo er sich befand. Seit über dreißig Jahren kreuzte er in diesen Gewässern. Er kannte die Tücken der Nordsee. Gerade bei Neumond galt es besonders wachsam zu sein. Innerhalb kürzester Zeit konnten sich die sanft spielenden Wellen in tobende und alles verschlingende Gischt verwandeln. Erst wenn das Wasser vom Nordmeer in das schmale Nordseebecken eingelaufen war, konnte er sicher sein, dass es bei einer ruhigen See blieb.
So nahe am Wangerooger Fahrwasser war es immer ratsam, einen Blick auf das Radar zu werfen. Doch der Schirm flimmerte in beruhigendem Grün. Kein Schiffsverkehr störte ihre Kreise.
Hansen lauschte in die Nacht. Nur das monotone und gutmütige Tuckern des alten Diesels war zu hören. Fast zwanzigtausend Mark hatte die Reparatur des Motors gekostet. Für ihn ein kleines Vermögen.
Er warf einen Blick durch das schmutzige Fensterglas des Ruderhauses und sah Willemsen, der auf dem Vordeck stand und sich eine Zigarette anzündete. Nur noch wenige Minuten bis zum Wendepunkt, dann würde er auf volle Kraft gehen, damit Willemsen und Jan Ekke, der zweite Helfer an Bord, das Fanggeschirr wegfieren konnten. Diese Arbeit bedurfte äußerster Konzentration. Doch Hansen machte sich keine Sorgen. Sie waren ein eingespieltes Team. Jan Ekke Mijboer war zwar erst ein halbes Jahr auf Hansens Boot, hatte aber schon auf anderen Trawlern gearbeitet, bis er für fast ein Jahr ins Gefängnis musste. Er hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht. Warum auch? Er war ein junger Mann und hatte für seine Dummheit gebüßt. Er hatte bezahlt. Jeden einzelnen Tag, jede einsame Nacht in einer engen und muffigen Zelle. Weitab von der salzigen Luft, weitab von der Freiheit der See, weitab von seinem Kurs.
Hansen blickte abermals auf den Radarschirm. Was war das? Eine Ortung? Der Schirm war leer. »Vermutlich nur Einbildung«, dachte er und konzentrierte sich wieder auf das Ruder. Er schaute hinaus, doch jetzt war Willemsen plötzlich verschwunden.
»Verdammt, was treiben die beiden da draußen?«, murmelte er. Sein Blick suchte durch die verschmierten Scheiben des Ruderhauses das Vorschiff ab, doch von Willemsen und Jan Ekke fehlte jede Spur. Er drosselte die Maschine und arretierte das Ruder. Mit einem Fluch auf den Lippen ging er nach draußen in die milde Nacht. Der trübe Schein der Bootslichter erhellte nur leidlich das Deck. Hansen umrundete das Ruderhaus und wandte sich nach Steuerbord. Im Vorbeigehen überprüfte er den festen Sitz der Kurrleinen an der Winsch. Was hatten sich die beiden Kerle nur gedacht, kurz vor dem Wendemanöver einfach die Netze zu verlassen?
Als er auf das Heck des Schiffes zuging, hörte er ein schepperndes Geräusch. Er fuhr zusammen und spähte hinaus in die Finsternis. Nichts war zu erkennen. Seit achtundvierzig Jahren fuhr er zur See und war beileibe kein ängstlicher Mensch, dennoch lief ihm ein kalter Schauer über den Rücken.
»Sven, Jan Ekke, verdammt, wo seid ihr?«, rief er in die undurchdringliche Schwärze.
Keine Antwort. Nur das Plätschern der Wellen füllte die Stille. Das Leuchtfeuer von Wangerooge schickte einen gleißend hellen Strahl nach dem anderen über das Wasser und doch wäre Hansen beinahe gestolpert. Auf der Laufplanke lag etwas, das dort nicht hingehörte. Weich und leblos fühlte es sich an, als Hansen mit dem Fuß danach tastete.
»Was zum Teufel …?« Er bückte sich. Vor ihm lag ein menschlicher Körper. Im vorbeifliegenden Licht erkannte er das Gesicht von Willemsen. Eine dunkel glänzende Spur lief von dessen Kopf zur Reling hinüber und Hansen wusste sofort, dass hier das Leben aus Willemsens Schädel rann. Er beugte sich über den regungslosen Körper. Plötzlich hörte er erneut das ungewöhnliche Geräusch. Hansen fuhr herum. Ein brutaler Schlag gegen seinen Kopf bremste die Bewegung. Schmerzen durchfluteten ihn. Dann tauchte er mitten hinein in ein Meer der Besinnungslosigkeit.
*
Erschöpft legte er den Schreibstift zur Seite. Ein zufriedener Blick huschte über die noch feuchten Zeilen. Er pustete und erst als die Tinte getrocknet war, schloss er das Buch. Andächtig legte er es auf den Altar. Es war ein feierlicher Moment und er genoss jede einzelne Sekunde.
Seit dreizehn Jahren konnte er zum ersten Mal wieder frei atmen. Es war eine Erlösung. Wie ein zentnerschwerer Stein lastete die Schuld der anderen auf seinem Gewissen. Heute hatte er diesen Stein eine kleine Strecke anheben können.
Das bleiche, bläuliche Gesicht tauchte wieder vor seinen Augen auf. Das kleine Gesicht aus der Dunkelheit. Doch diesmal waren die Züge nicht verzerrt, die Augen nicht schreckensstarr auf ihn gerichtet. Diesmal nicht. Im Gegenteil. Ein weiches Lächeln lag auf den Lippen.
Er ging hinüber zum Tisch. Dort lag seine Beute. Der Beweis seiner Aufrichtigkeit. Er hatte sich zurückgeholt, was ihm damals gestohlen worden war. Das Taschentuch war rot.
Er blickte auf seine Armbanduhr. Eine Funkuhr. Sie war teuer gewesen. Lütjens hatte sie ihm damals geschenkt, weil er stets hilfsbereit gewesen war und sich um alles gekümmert hatte.
Auch heute war er hilfsbereit gewesen und heute hatte er sich eine Belohnung verdient: Ruhe.
Er steckte das blutige Taschentuch in seine Jacke und zog sich die Stiefel an. Er war müde, doch er hatte noch etwas zu erledigen, das keinen Aufschub duldete.
Die Tür knarrte, als er hinaus in den Flur ging.
Noch immer herrschte hier ein strenger Brandgeruch. Die verkohlten Balken auf der Südseite der alten Villa hatten den Geruch der Flammen in ihren Poren eingeschlossen und ließen ihn nur zögernd wieder frei. Er hasste diesen Gestank. Als er durch die Hintertür hinaus ins Freie trat, sog er die kühle und salzige Seeluft tief in seine Lungen.
Er ging hinüber zum Schuppen. Es war dunkel, denn Strom gab es hier schon lange nicht mehr. Er öffnete die kleine Tür, doch plötzlich hielt er inne. Die vorwurfsvollen Gesichter kehrten mit lauten Stimmen zurück. Wie ein Sturmgewitter brachen sie über ihn herein, die Schreie hallten in seinen Ohren. Sein Kopf schien platzen zu wollen und seine Hände zitterten.
Warum nur? Er hatte doch getan, was sie von ihm gefordert hatten. Warum ließen sie ihn nicht in Ruhe?
Er sank auf die Knie. Die Schreie wurden greller. Dann kam das andere, das verzerrte, das unnachgiebige und grausame Gesicht aus der Finsternis hervor. Schützend schlug er die Hände vor die Augen. Doch es nutzte nichts. Er konnte dieses Bild nicht vertreiben.
»Vater …nein, nicht …Es ist …es ist nur der Anfang«, stammelte er, doch die Fratze wollte nicht wieder verschwinden. Entkräftet sank er zu Boden. Seine Hände krallten sich in den feinen Sand.
*
Die Schreie der Möwen hallten durch das Morgengrauen. Dicke Wolken hingen über dem Himmel und ein stürmischer Wind blies von Westen her. Als er erwachte, wunderte er sich darüber, dass er im Freien lag. Zusammengekrümmt wie ein Kind im Mutterleib. Er fror. Es war Mai und noch immer wurde es nachts bitterkalt.
Mühsam erhob er sich. Er massierte sich die Starre aus den Gliedern. Sein Kopf schmerzte. Langsam kehrten die Erinnerungen an die letzte Nacht wieder. Doch es waren nur noch Fragmente, vernebelte Bruchstücke aus einer anderen Welt. Als er den Schuppen betrat, blickte er sich suchend um. Dann fiel ihm wieder ein, warum er hierher gekommen war. Zielstrebig ging er auf den Schrank zu und öffnete ihn. Hier hinein hatte er die kleine Schachtel gelegt. Es war ein Geschenkkarton, bunt gemustert und mit einer roten Schleife auf dem Deckel. Mareike würde das Geschenk gefallen. Damals, zu ihrem siebten Geburtstag, hatte er ihr schon einmal ein kostbares Geschenk gemacht. Mit einem kleinen Ring hatte er sie überrascht. Sie hatte sich sehr darüber gefreut, war aufgesprungen, auf ihn zugestürmt und hatte ihn umarmt und auf die Wange geküsst. Heute hatte er sogar ein viel schöneres Geschenk für sie.
Er holte das blutgetränkte Taschentuch hervor und stopfte es samt Inhalt in die Schachtel. Dann verließ er den Schuppen und ging zurück in das verfallene Haus. Er musste etwas essen. Schließlich lag noch eine schwere Aufgabe vor ihm. Er durfte nicht versagen.
»Träne um Träne, Blut für Blut«, sagte er.
Ein alter und harter Brotkanten war alles, was er fand. Er setzte sich und biss hungrig hinein.
Wangerland Mai 2000 1
Rudolf Gabler stand am Fenster seines Pensionszimmers und schaute auf seine Armbanduhr. Es war kurz nach neun und er wusste, dass er nur noch wenig Zeit hatte. Das Wetter hatte sich geändert. Der Wind hatte zugenommen und peitschte die Wellen heftig gegen das Land. Er griff nach seinem Fotoapparat und überprüfte zum letzten Mal die Batterieanzeige. Zufrieden packte er den Apparat wieder zurück in die Tasche.
Er kannte sich aus mit der Fotografie. Seine Fotos waren keine bloßen Abbildungen der Realität. Die Bilder sollten immer auch seinem künstlerischen Anspruch genügen. Darauf legte er Wert, das war sein Markenzeichen.
Die Fotografie war nur eine seiner Leidenschaften, doch die andere hatte er längst schon vergessen.
Er war alt geworden, die Zeit hatte ihn eingeholt und seine einstmals pechschwarzen und vollen Haare waren jetzt grau und dünn.
Ehe er ins Badezimmer ging, warf er noch einmal einen sorgenvollen Blick nach draußen. Die Dunkelheit legte sich über die Insel und bedeckte das schäumende Wasser der aufbrausenden See. Noch regnete es nicht und er hoffte sehr, dass es in dieser Nacht trocken bleiben würde.
Plötzlich klingelte das Telefon. Gabler erschrak. Eilends lief er hinüber zum Apparat. Wer konnte ihn zu dieser Zeit noch anrufen? Neugierig nahm er den Hörer ab und meldete sich mit einem leisen »Hallo«.
Er erkannte ihre Stimme sofort. »Soll ich Ihnen zwei Brötchen für das Frühstück besorgen?«, fragte Frau Melsung, die Betreiberin der Ferienpension.
Sein Körper entspannte sich. »Nein, danke. Ich muss heute noch einmal hinaus. Es kann sein, dass es den ganzen morgigen Tag dauert, ehe ich zurückkehre.«
Sie sprachen noch eine Weile miteinander, dann verabschiedete er sich.
Er blickte erneut auf die Uhr. Es wurde Zeit. Er nahm seine dicke Windjacke von der Garderobe und zog sich die Gummistiefel an. Dann griff er nach seinem Fernglas und hängte es sich um den Hals. Es war ein exzellentes Glas, bot eine hervorragende Vergrößerung und war extrem lichtstark.
Als er hinaus ins Freie trat, fröstelte er. Der kalte Wind traf ihn mit voller Wucht. Er kniff die Augen zusammen und machte sich auf seinen Weg.
Sein Verleger würde staunen. Ein Foto des seltenen Austernfischers im Morgenlicht wäre eine Bereicherung für den geplanten Bildband. Noch immer war er sich über den Titel des Buches nicht im Klaren, doch darauf kam es auch gar nicht an. Zuerst einmal mussten die Vorarbeiten geleistet werden. Über dreihundert Fotografien lagen zu Hause in der Schublade, unzählige Textseiten hatte er geschrieben, redigiert, verworfen und neu verfasst. Schon sein erstes Werk war ein echter Erfolg in ornithologischen Fachkreisen gewesen.
Er erinnerte sich noch gut an den Tag, als er den Verleger bei einer Ausstellung seiner Fotografien im Rathaus von Wilhelmshaven getroffen hatte. Sie waren ins Gespräch gekommen und der Verleger hatte sich nur lobend über seine Arbeiten geäußert. Er hatte den künstlerischen Wert in Gablers Bildern sofort erkannt und nicht lange gewartet, bis er ihm ein Angebot machte. Für sein Vorhaben suchte er noch einen Fotografen, dessen Werke eine unverwechselbare Ausstrahlung besaßen. Kunstwerke, die voller Ästhetik und Anmut die Schönheit der Vogelwelt darstellten. Rudolf Gabler hatte diese seltene Gabe. Der Vorschlag des Verlegers war mehr als akzeptabel und so unterschrieb Gabler den Vertrag. Ein paar Tage später war er auf Kosten des Verlages in den Schwarzwald gereist, um seinen ersten Auftrag zu erfüllen.
Es hatte damals gut getan, nach all der verlorenen Zeit wieder eine echte Aufgabe gefunden zu haben. Seit seiner unrühmlichen Entlassung vor sieben Jahren hatte er sich nicht mehr so geachtet gefühlt. Er war noch nicht bereit gewesen für die Pensionierung. Der Schulamtsleiter hatte ihm erklärt, dass es das Beste für ihn sei. Er hatte es schließlich eingesehen und schweren Herzens zugestimmt. Die Wochen und Monate zuvor, als er noch voller Kampfeskraft gewesen war und die Herausforderung annehmen wollte, waren nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Jeder neue Tag in der Schule kam einem Spießrutenlauf gleich und jedes neue Wortgefecht mit seinen Vorgesetzten ähnelte einem Kampf gegen Windmühlen. Egal was er tat, egal wie er sich verhielt: Er wurde den Makel nicht mehr los. Wenn er das Lehrerzimmer betrat, dann verstummten die Gespräche. Wenn er sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen unterhalten wollte, blieb es bei höflichen, aber nichtssagenden Floskeln, ehe sie ihn stehen ließen.
Schließlich hatte er kapituliert, die Flagge gestrichen und war zurück nach Jever gezogen. Er wusste, dass es am Ende nicht mehr darum gegangen war, ob er Schuld auf sein Gewissen geladen hatte; schon der leise Verdacht hatte genügt, ihm das Kainsmal auf die Stirn zu drücken. Sieben Jahre später redete niemand mehr davon. Nur er konnte nicht vergessen.
Er nahm den Weg am Bahnhof entlang. Die letzten Lichter von Wangerooge blieben hinter ihm zurück. Über die südliche Route wanderte er hinaus zu den Ostdünen.
Er liebte die Vögel und wusste, dass er sie bei der Brut nicht stören durfte. Er hatte einen lichtstarken Film eingelegt und würde in seinem Unterstand warten, bis sich die Gelegenheit ergab. Bei Tagesanbruch waren die Tiere am aktivsten. Ein schwebender Austernfischer und im Hintergrund nur die stürmischen Wolken des Küstenlandes, das wäre eine Aufnahme, wie er sie sich vorstellte. Trotz aller Geduld, die er brauchte, wusste er, dass er schnell handeln musste. Oft genug spielte das Wetter an der Nordsee Kapriolen. Gestern war es noch mild und trocken gewesen. Und heute? Für alle Fälle hatte er seinen Blitz aufgeladen.
Als Rudolf Gabler am Rollfeld des Flugplatzes vorüberging, begegnete ihm ein Pärchen, das in dieser stürmischen Nacht ebenfalls die Ruhe und Abgeschiedenheit des Ostteils der Insel suchte. Der sandige Weg beschrieb einen Linksbogen. Mittlerweile war es dunkel geworden. Gabler holte seine Taschenlampe hervor und richtete den hellen Lichtstrahl auf den Weg. Der Sand glitzerte. Dünen umgaben ihn. Drei Kilometer hatte er bereits zurückgelegt, er war das Wandern gewohnt. Es strengte ihn überhaupt nicht an. Er war fünfundsechzig und fühlte sich noch lange nicht alt, auch wenn ihm sein Spiegelbild oft genug das Gegenteil beweisen wollte.
Freunde aus vergangenen Tagen hatte er keine mehr. Sie wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Seine Frau war schon lange tot und Kinder hatte sie ihm nie geschenkt. Sie hatte nie diesen innigen Kinderwunsch in sich getragen, so wie er es von anderen Frauen kannte.
Seit über einem halben Jahr war er nicht mehr an ihrem Grab gewesen. Er schämte sich dafür. Andererseits war es gut, dass sie nicht mehr miterleben musste, welchen Streich ihm das Leben gespielt hatte. Seine Frau war immer zart und zerbrechlich gewesen. Sie wäre daran zugrunde gegangen.
Er war alleine mit seinen düsteren Gedanken, mit sich, mit dem Wind und den rauschenden und tobenden Wellen der Nordsee. Die Luft schmeckte frisch und er spürte einen salzigen Belag auf seinen Lippen.
Kurz hinter der Weggabelung zweigte ein Trampelpfad ab und führte mitten hinein in die Dünenlandschaft Wangerooges. Hier hatte er gestern bei Tageslicht den Weg verlassen, um nach dem Gelege eines Austernfischers zu suchen. Vorsichtig war er einige Meter weit durch die Dünen gegangen und plötzlich auf brütende Vögel gestoßen. Zuerst hatte er angenommen, die Brutstätten einiger Silbermöwen ausgemacht zu haben, doch dann hatte sein Blick das schwarz-weiß gefleckte Gefieder eines Vogels gestreift, der sich tief ins Gras duckte. Ein langer, gelber Schnabel und kleine, rote Augenpunkte, die nervös hin und her flogen. Sieben Gelege hatte er am Ende gezählt.
Doch die Einstellungen hatten ihm noch nicht zugesagt. Die Vögel saßen träge auf ihren Nestern. So hatte er beschlossen, den kommenden Morgen zu nutzen. Er hatte ein Nest ausgewählt, das im Schatten einer Düne lag. Eine ganz besondere Einstellung, wie er fand. In der Nähe hatte er sich mit einem Tarnnetz einen kleinen Unterstand gebaut. Dann war er einige Zeit geblieben. Die Vögel sollten sich an seine Anwesenheit gewöhnen. Am Nachmittag war er zurückgegangen, hatte sich hingelegt und vier Stunden geschlafen. Er wusste, dass es lange dauern konnte, bis er zufrieden war. Rudolf Gabler war ein Perfektionist. Er wusste genau, was er wollte, und war nicht bereit, auch nur einen Zentimeter davon abzuweichen. So war es eigentlich immer gewesen.
Damals, als er die neunte Klasse in Schortens übernommen hatte, war dieser Perfektionismus wohl auch einer seiner Angriffspunkte gewesen. Mit Schrecken dachte er an die Zeit zurück. Diese kleine durchtriebene Göre hatte es aber auch auf die Spitze getrieben. Ihm war die Hand einfach ausgerutscht. Er hatte sich nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Und alles nur, weil sie beinahe durchgefallen wäre. Er hatte es immer gesagt: Die Welt war schlecht, die Menschen waren schlecht und auch die Jugend wurde immer schlechter. Und er wusste, wovon er sprach, schließlich war er vom Fach.
Seine Frau hatte immer nur den Kopf geschüttelt, wenn er so redete. Sie wusste es vielleicht nicht besser. Sie hatte es immer nur mit den Jüngsten zu tun gehabt. Sechs- bis Achtjährige. Die waren noch leicht zu bändigen. Waren noch wirkliche Kinder, Kinder mit großen Augen und kleinen Stupsnasen. Er hingegen unterrichtete ältere. Dreizehn, vierzehn, manchmal sogar schon sechzehn Jahre alt. Sie ahnte ja gar nicht, welche Gemeinheiten diese Teufel in ihren Köpfen ausbrüteten.
Seine Frau hatte einen leichten Tod gehabt. Früh morgens hatte er sie leblos im Bett gefunden. Ihr Gesicht war blau und auf ihren Lippen lag ein Lächeln. Der Tod war über sie gekommen, als er neben ihr friedlich geschlafen hatte. Sie hatte schon immer Probleme mit dem Herzen gehabt und Anfang der Woche hatten ihr Brustkorb und ihr linker Arm geschmerzt.
»Wenn es am Montag noch nicht besser ist, dann gehe ich zum Arzt«, hatte sie noch am Sonntagmorgen gesagt. Doch den Montag hatte sie nicht mehr erlebt.
Er hatte sie gewarnt. Mit Schmerzen im Brustkorb spaßt man nicht, hatte er zu ihr gesagt, doch sie hatte alle Warnungen in den Wind geschlagen. Sie war gerade mal dreiundfünfzig, als sie starb. Er hatte nicht einmal einen Sohn oder eine Tochter, mit denen er seinen Schmerz teilen konnte. Er ertrug ihn alleine.
»Es ist schon klar, wenn man in einem gewissen Alter ist, noch nicht zum alten Eisen gehört und einem die Frau so früh wegstirbt, dann kann es passieren, dass man die Orientierung verliert«, hatte ihm der Polizist damals auf dem Revier gesagt. Doch Rudolf Gabler hatte genau gewusst, welche Antwort der Kommissar erwartete. Er wollte ihm eine Brücke bauen, den verständigen Freund und Partner, vielleicht sogar den Leidensgenossen spielen, doch Rudolf Gabler war nicht darauf eingegangen. Er hatte geschwiegen. Schuld, wer ist schon frei von Schuld?
Er war kurz vor seinem Ziel. Er verharrte und holte den Fotoapparat hervor. Alles musste vorbereitet sein. Keine unnötige Bewegung in ihrer Nähe. Sie sollten sich den Rest der Nacht an ihn gewöhnen, damit sie sich im ersten Morgenlicht so unbefangen verhielten, wie es nur möglich war. Er schaute auf seine Kamera. Das Display stand auf 13. Er blickte zum Himmel, dann holte er das Blitzgerät hervor und steckte es auf. Er hoffte, dass er es nicht brauchen würde, doch die schweren Wolken am Himmel und der stürmische Wind verhießen nichts Gutes. Er hatte nur noch den morgigen Tag.
Gabler ging vorsichtig weiter. Der Unterstand war nicht mehr weit entfernt, doch jedes Geräusch, jede Unvorsichtigkeit konnte ihn um die Früchte seiner Arbeit bringen. Er lauschte in die Nacht. Sie waren nah.
Plötzlich zerriss ein gequälter Schrei die Stille. Ein paar Vögel flatterten vor ihm auf und verschwanden in der Dunkelheit. Gabler fuhr der Schreck in die Glieder. Was war das?
Nichts war mehr zu hören. Hatten ihm seine Sinne einen Streich gespielt? Nein, die Vögel waren bestimmt nicht grundlos aufgeflogen. Gabler wandte sich um. Seine Finger umschlossen den Fotoapparat. Der Wind wehte ein leises Wimmern zu ihm herüber. Es war gespenstisch.
»Vielleicht ein Heuler«,beruhigte er seine angespannten Nerven, als er über die Düne stieg. Ein unvorsichtiger Schritt, und er strauchelte. Lang gestreckt fiel er in den weichen Sand. Die Taschenlampe stieß dumpf gegen seine Kamera. Leise zerbiss er einen Fluch auf den Lippen. Er raffte sich auf und griff nach der Lampe. Das Wimmern war verstummt. Er klopfte sich den Sand von der Jacke, dann ging er zögernd weiter. Das östliche Ende der Insel lag schon vor ihm. Ein weiterer Sandhügel versperrte seinen Weg. Er erklomm den Gipfel und suchte die Umgebung mit der Taschenlampe ab. Plötzlich sah er einen Schatten. Direkt vor ihm tauchte er auf. Unmenschlich. Der Schatten sprang auf ihn zu. Bedrohlich.
Vor Schreck ließ Gabler die Lampe fallen. »Oh Gott, nein …!« Er riss die Hände in die Höhe und bekam den Schatten zu fassen. Hart und kühl fühlte er sich an. Dann spürte Gabler nur noch einen rasenden Schmerz. Ein greller Blitz durchzuckte die Nacht. Er wollte schreien, doch er bekam keinen Ton heraus. Etwas hatte ihm die Worte in der Kehle zerschnitten.
*
Er raffte die wenigen Habseligkeiten zusammen und warf sie hinter die Düne. Schweiß lief ihm über die Stirn. Ströme vom Schweiß der Angst. Dann ging er hinunter zum Wasser. Die Insel schwächte die Wucht der Wellen, dennoch schaukelte das kleine Boot wie eine Nussschale hin und her. Er stieg ein und warf einen letzten Blick zurück. Dann startete er den Motor und brauste davon. Es war noch Zeit, dreieinhalb Stunden bis zur Ebbe.
2
»Du bist gemein, alle dürfen mit. Nur ich bekomme wieder alles verboten!« Paula rannte aus dem Zimmer. Mit einem lauten Knall fiel die Tür ins Schloss.
Trevisan schüttelte den Kopf. Wenn sie sich ärgerte, benahm sie sich genauso wie ihre Mutter. Er hatte es sich einfacher vorgestellt, mit seiner Tochter zusammenzuleben. In letzter Zeit war sie besonders zickig und abweisend gewesen. Er versuchte, ihre Launen und Stimmungsschwankungen auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber den Ausflug konnte er ihr nicht gestatten. Paula war erst vierzehn und er konnte nicht zulassen, dass sie sich mit ihren Freunden vier Tage mit dem Boot im Wattenmeer herumtrieb. So eine verrückte Idee.
Trevisan schlug seine Zeitung auf. Gedankenverloren überflog er die Überschriften. Der Streit mit seiner Tochter ging ihm nicht aus dem Kopf. Damals, als Grit nach der Scheidung das Angebot einer Kieler Fährgesellschaft annahm, hatte sie Paula zu ihm gebracht. »Es ist nur vorübergehend. So lange, bis ich etwas Passendes gefunden habe. Dann kann sie wieder bei mir wohnen.«
Zwei Jahre waren inzwischen vergangen. Mittlerweile war keine Rede mehr davon, dass Paula nach Kiel zurückkehren sollte. Sie selbst hatte beschlossen, bei ihm in Sande zu bleiben. Und Trevisan hatte zähneknirschend zugestimmt. Nicht, dass er seine Tochter nicht liebte. Aber er wollte die Liebe zu seinem Kind nicht durch die Spannungen des alltäglichen Lebens eines Kriminalbeamten belasten. Und in seinem Job sah er, wie Kinder auf die schiefe Bahn gerieten und keinen Weg mehr zurück fanden, wenn ihnen die moralische Führung fehlte. Er hatte ein wenig Angst vor der Verantwortung.
Andererseits wollte er Paula ersparen, ein Spielball von Grits Launen zu werden. Immer hin und her geschoben, so wie es Grit passte.
Wenn es auch nicht leicht war, er hatte seine Linie gefunden und wich nicht davon ab. Auch wenn ihm Paula jetzt vorwarf, ihre Freiheiten zu beschneiden und überängstlich zu reagieren: Er konnte ihr die Tour nicht erlauben.
Trevisan faltete die Zeitung zusammen und warf sie zurück auf den Tisch. Seine Aktien hatten erneut nachgegeben und Werder Bremen hatte knapp mit 1:2 gegen Bayern München verloren. Früher hatte er kein Spiel seines Lieblingsvereins verpasst, aber nachdem er Leiter des 1. Fachkommissariats bei der Wilhelmshavener Kriminalpolizei geworden war und vor vier Jahren das kleine Reihenhaus in Sande gekauft hatte, fand er selten Gelegenheit, zum Fußball zu gehen.
Er ging hinüber zum Fenster und warf einen Blick hinaus. Vor zwei Wochen hatte er den Rasen gemäht, doch davon war kaum noch etwas zu erkennen. Er würde sich wieder etwas mehr Zeit für den Garten nehmen müssen. Noch immer lagen die Steinplatten für die Erweiterung der Terrasse zusammengeschnürt auf der Palette.
*
Horst Brinkmann genoss die Zeit, die er im Frühjahr auf Wangerooge zubringen konnte. Jedes Jahr verschlug es ihn auf diese Insel. Der Stress, dem er als Fluglotse jeden Tag ausgesetzt war, fiel nach wenigen Tagen wie lästiger Schorf von ihm ab und die würzige Seeluft machte seinen Kopf frei und beflügelte die Sinne.
Brinkmann war ein naturverbundener Mensch. Er liebte die Spaziergänge im Frühjahr, wenn sich noch keine Touristenströme durch die Dünen drängten. In der idyllischen Einsamkeit fühlte er sich wohl.
Nach dem Mittagessen in der Pension war er aufgebrochen. Heute führte ihn sein Weg hinüber in den Osten der Insel, in die sandige Dünenlandschaft. Als er sich dem Strand näherte, hörte er schon von weitem das wilde Geschrei der Möwen. »Was für ein Spektakel!«
Unzählige Vögel flatterten durch die Lüfte, stießen auf den Boden herab und stiegen rasant wieder auf. Andere ließen sich auf einem Dünenkamm nieder und beharkten sich mit den scharfen Schnäbeln. Brinkmann wusste nicht viel über das Verhalten der Vögel. Aber das aufgeregte Gehabe der Tiere konnte nur eines bedeuten. »Da habt ihr aber einen echten Leckerbissen gefunden«, murmelte er den Möwen zu. Die ließen sich nicht von ihm stören. Sie flogen nicht einmal auf, als er nur noch wenige Meter von ihnen entfernt war. Ihr ganzes Interesse galt dem Aas, auf das sie sich wieder und immer wieder stürzten.
Ein verendeter Heuler, eine Robbe vielleicht, bei der großen Anzahl der Vögel musste es schon ein großes Stück Fleisch sein. Brinkmanns Interesse war geweckt. Die frechen Biester ließen sich nicht so leicht verscheuchen. Er war nur noch wenige Schritte von der unüberschaubaren Zahl der Streithähne entfernt. Ihre ausgebreiteten Flügel versperrten ihm den Blick auf die Beute. Mit einer heftigen Bewegung gelang es Brinkmann schließlich, ein paar der Tiere zu verscheuchen, um das Aas in Augenschein zu nehmen.
Eine Beute mit Armen und Beinen.
Brinkmann stolperte und stürzte in den Sand. Hastig rappelte er sich wieder auf. So schnell ihn seine Beine trugen, rannte er zurück ins Dorf. Kraftlos und schweißnass hämmerte er an die erstbeste Tür. Eine alte Frau öffnete zögernd.
»Wo ist das Telefon … schnell, das Telefon!« Er schlängelte sich an der Frau vorbei in den Flur.
Verängstigt schaute sie ihm nach und wähnte sich schon als Opfer eines Überfalls. Horst Brinkmann blickte sich suchend um und fand endlich einen altertümlichen Apparat auf einer kleinen Wandkonsole. Er stürzte darauf zu und riss den Hörer ans Ohr. Mit zitternden Fingern wählte er die Nummer der Polizei.
*
»Ich kann einfach nicht anders«, sagte Martin Trevisan ärgerlich und presste den Telefonhörer an sein Ohr. »Sie ist noch viel zu jung dafür. Und davon mal abgesehen, ist eine Bootstour auf der Nordsee auch nicht gerade ungefährlich. Was ist, wenn sie in schwere See kommen? Der junge Altermann hat zwar einen Bootsführerschein, aber es fehlt ihm noch an jeglicher Erfahrung. Ich verstehe gar nicht, dass seine Eltern so verantwortungslos sein können und diesen Unsinn auch noch erlauben.«
»Ich werde mit ihr reden. Ich komme morgen Mittag zu euch rüber«, antwortete Angela verständnisvoll.
Trevisans Ärger verflog. »Dann bring deine Zahnbürste und den Pyjama mit. Ich lade dich zum Frühstück ein.«
»Also gut, dann bis morgen!« Sie verabschiedete sich.
Trevisan blickte nachdenklich auf das Bild an der Wand. Ein Bild von seiner Tochter und ihm.
Konnte Angela an die Stelle der Mutter treten? Würde er nach all den negativen Erlebnissen mit Grit jemals wieder mit einer Frau zusammenleben wollen? Jetzt, wo er sich an seine Freiheit gewöhnt hatte?
Er hatte Angela vor knapp einem Jahr auf der Geburtstagsfeier eines Kollegen kennen gelernt. Sie war eine hübsche und selbstbewusste Frau und ebenfalls geschieden. Sie hatten sich an diesem Abend lange unterhalten. Tags darauf hatten sie den Nachmittag miteinander verbracht. Beide spürten eine tiefe Zuneigung füreinander. Sie sagte ihm, dass sie ihre Freiheit erst wieder aufgeben würde, wenn sie sich absolut sicher sein konnte, dass es der Kerl auch wert war.
Mittlerweile war sich Trevisan klar darüber, dass er sie liebte. Wenn sie beisammen waren oder auch nur miteinander telefonierten, dann spürte er wieder dieses Kribbeln im Bauch. Ein Gefühl, das er lange schon verloren gewähnt hatte.
Außerdem verstand sie sich blendend mit Paula. Sie waren Freundinnen geworden.
Angela wohnte in Westerwerde und arbeitete als Journalistin bei einem Zeitschriftenverlag. Sie verdiente gut, fuhr einen kleinen Sportwagen und hatte ständig neue Klamotten. Sie war vierzig, doch das sah ihr keiner an.
Unter der Woche telefonierten sie jeden zweiten Tag miteinander und es tat immer gut, ihre Stimme zu hören. Auch heute hatte er zum Telefonhörer gegriffen und ihr von seinen Problemen mit Paula erzählt. Vielleicht gelang es ihr, Paula von diesem unsinnigen Gedanken mit dem Bootsausflug abzubringen.
Wo war Paula überhaupt? Seitdem sie so lautstark das Zimmer verlassen hatte, war sie nicht wieder aufgetaucht. Trevisan ging in den Flur. Hektische Technomusik drang durch das Treppenhaus. Sie war wohl oben in ihrem Zimmer. Er überlegte, ob er hinaufgehen sollte, um noch einmal mit ihr zu reden, doch er verwarf den Gedanken. Es war besser, etwas Zeit verstreichen zu lassen. Auf weiteren Streit hatte er keine Lust. Morgen war auch noch ein Tag.
Er setzte den Teekessel auf den Herd. Es war kurz vor sechs Uhr. Er öffnete den Kühlschrank. Paula hatte eingekauft. Alles war an seinem Platz. Er griff nach einem Joghurtbecher. Als der Kessel zu pfeifen begann, nahm er ihn von der Platte und goss heißes Wasser in eine Tasse. Just in diesem Augenblick klingelte das Telefon. Wahrscheinlich jemand, der Paula sprechen will, dachte er. Als das Klingeln überhaupt nicht enden wollte, ging er schließlich in den Flur und nahm den Hörer ab.
»Wo bleibst du nur?«, sagte die weibliche Stimme am anderen Ende. »Zuerst führst du Dauergespräche und dann lässt du es einfach durchklingeln.« Seine Kollegin Monika Sander war in der Leitung.
»Ich dachte, es wäre für Paula«, entschuldigte er sich. »Was treibt dich so spät am Abend noch aus dem Haus?«
»Arbeit, was sonst?«, erwiderte Monika.
Trevisan schluckte.
Monika sprach genau das aus, was er befürchtet hatte: »Komm bitte sofort zur Dienststelle, wir haben eine Leiche.«
In der letzten Zeit war es ruhig gewesen. Nur hier und da ein Selbstmord, doch das war meist reine Routine. Das letzte Tötungsdelikt hatte es vor einem Dreivierteljahr gegeben. Und selbst dabei hatte es sich nur um Totschlag gehandelt. Ein Mann hatte im Alkoholrausch seine Frau erschlagen.
»Ich komme sofort, bis gleich!« Trevisan legte auf. Dann ging er hinauf zu Paula. Nun blieb ihm nichts anderes übrig, nun musste er mit ihr sprechen.
3
»Hallo, Martin, wo bleibst du denn?«, begrüßte ihn Monika, als er in ihr Dienstzimmer kam. Er warf ihr einen entschuldigenden Blick zu und strich sich über seine widerspenstigen Haare. Monika Sander war seit zehn Jahren bei der Kripo und Trevisans Stellvertreterin. Sie war verheiratet und hatte zwei Töchter.
»Du siehst etwas mitgenommen aus«, stellte sie fest, nachdem sie ihren Kollegen eingehend gemustert hatte. Er trug wie meistens einen Anzug in gedeckten Farben, korrekt und gepflegt. Aber um die Augen herum zeigte sich Müdigkeit. »Geht es dir gut?«
»Ärger mit Paula und etwas Kopfweh, aber es geht schon.«
Monikas älteste Tochter war im gleichen Alter wie Paula. So wusste sie, wovon Martin Trevisan sprach, als er ihr sein Leid klagte. »Mädchen in diesem Alter sind alle gleich«, kommentierte sie Trevisans Erzählung.
»Was liegt eigentlich an?«, fragte Trevisan nach einem kurzen Moment des Schweigens.
»Eine Leiche, männlich, Alter etwa sechzig, mit durchschnittener Kehle. Das Polizeiboot wird uns rüberbringen. Sie warten schon im Hafen.«
»Eine Wasserleiche?«
»Nein, der Tote liegt auf Wangerooge in den Dünen.«
»Wangerooge?«, sagte er entgeistert. »Auch das noch.« Ausgerechnet der nördlichste Punkt ihres Zuständigkeitsbereichs. Das warf seinen ganzen Plan für das Wochenende über den Haufen. Er blickte auf die Uhr. Es war kurz nach sieben. Er griff nach Monikas Telefon.
»Besetzt. Verdammt, ich habe ihr doch gesagt, dass ich noch anrufe. Immer dasselbe.« Er warf den Hörer zurück auf die Gabel.
Monika schaute ihn fragend an.
»Paula«, sagte er. »Ich dachte, ich bin bis Mitternacht wieder zurück.«
Monika warf ihm einen mitleidigen Blick zu, dann griff sie in ihre Jackentasche und kramte ein Handy hervor. »Versuch es eben später noch mal.«
»Okay, dann los. Wo sind die anderen?«
»Dietmar ist mit Alex und Tina schon aufgebrochen.«
Das Polizeiboot nahm die beiden am Handelshafen an Bord und legte sofort in Richtung Wangerooge ab. Die Überfahrt dauerte knapp zwei Stunden und trotz der relativ ruhigen See war es Trevisan nicht ganz wohl im Magen.
»Vielleicht eine Grippe«, dachte er. Er war froh, als das Boot im kleinen Yachthafen von Wangerooge festmachte. Mit unsicheren Schritten betrat er die Mole. Zum Glück trug er den warmen Trenchcoat über seinem dunklen Einreiher, denn inzwischen war ein kalter Wind aufgekommen, der heftig von Norden über die Insel fegte.
Ein alter Mann, wohl schon an die siebzig, erwartete sie. Er stellte sich als Joost vor und sagte, dass er vom Ortspolizisten den Auftrag habe, die Herren aus Wilhelmshaven an den Fundort der Leiche zu bringen. Sein Blick streifte Monika und eine Spur spitzbübischer Neugier lag in seinen Augen.
»Das ist meine Kollegin, Frau Sander«, stellte Trevisan klar, und ein Lächeln huschte über das Gesicht des Alten.
Joost verbeugte sich. »Entschuldigen Sie, aber Herbst sprach von ein paar Herren. Es ist mir aber ein Vergnügen, eine so hübsche Dame führen zu dürfen.«
Mit dem Schlauchboot setzten sie ihre Fahrt im flachen Küstengewässer fort. Joost lenkte das Boot geschickt durch die Dunkelheit. Schon von weitem sahen sie ein Scheinwerferlicht zwischen den Dünen.
Joost kannte die Insel wie seine Westentasche. Er war auf Wangerooge geboren und hatte hier lange Jahre als Leuchtturmwärter gearbeitet, bis er durch einen Haufen Elektronik ersetzt worden war. Er war zweiundsechzig gewesen, als er in Pension ging. Zwar hatte man ihm auf dem Festland Arbeit in der Verwaltung der Nordsee-Schifffahrtsdirektion angeboten, doch Joost hatte abgelehnt und war auf Wangerooge geblieben. Seitdem führte er Touristen durch das Watt.
*
Lauter Motorenlärm der Generatoren dröhnte durch die Nacht. Mehrere Scheinwerfer erhellten den Tatort. Rot-weißes Absperrband surrte wie eine Drachenleine im Wind. Männer in papierenen Overalls waren geschäftig am Werk. Einer suchte den sandigen Boden mit einem Metalldetektor ab. Die Gegend wirkte im Licht der starken Scheinwerfer wie eine Mondlandschaft. Vor dem Absperrband am Rande des Weges lag ein Fahrrad. Zwei Männer standen daneben. Einer von ihnen war Dietmar Petermann, Trevisans Kollege. Der andere trug eine Polizeiuniform. Das musste wohl Herbst, der Ortspolizist, sein.
»Hallo, Dietmar – habt ihr schon etwas?«, schrie Trevisan gegen den Lärm an.
Petermann fuhr herum. »Martin, endlich. Ich dachte schon, ihr kommt nicht mehr.«
»Wir lassen euch doch nicht hängen. Weiß man schon …«
»Sein Name war Rudolf Gabler. Ein Pensionär aus Jever. Der Doktor ist noch mit ihm beschäftigt. Er meint, Mord oder Totschlag, auf keinen Fall Selbstmord. Der Tote hat eine hässliche Wunde am Hals und liegt wohl ein bis zwei Tage. Die Möwen hatten schon ihre Freude an ihm. Allem Anschein nach wurde er hier ermordet.«
»Irgendwelche Spuren?«, fragte Trevisan.
»Kleinschmidt hat seine ganze Crew im Einsatz. Sie suchen noch. Keiner darf bislang zum Tatort, nur der Doktor.«
»Ich kümmere mich mal um den Schreibkram«, sagte Monika, als sie die junge Tina Harloff, das Küken des 1. FK, hinter einer Düne auftauchen sah. Tina hielt eine Kladde in der Hand und kämpfte mit dem Wind um ein Blatt Papier.
Trevisan wandte sich wieder Petermann zu. »Weiß man schon, woher …?«
»Aus Jever, sagte ich doch schon.«
»Nein, ich meine hier auf der Insel.«
»Alex kümmert sich darum. Anscheinend hatte der Tote im Dorf ein Zimmer angemietet. Alex klappert sämtliche Pensionen ab. Eine Vermisstenmeldung liegt nicht vor.«
Trevisan schaute hinüber zu den Dünen. Die Spurensicherung schien mit ihrer Arbeit langsam zum Ende zu kommen. Kleinschmidt, der Chef der Spurensicherung, kam hinter den Dünen hervor. Er klopfte sich den Sand von der Hose.
»Ist Martin schon da?«, rief er lautstark herüber.
Martin Trevisan trat vor und winkte ihn zu sich heran.
*
Alex Uhlenbruch und der zweite Mann der Wangerooger Polizeistation hatten schon neun Pensionen überprüft. Niemand dort vermisste einen Feriengast. Aber noch waren sie nicht am Ende. In Wangerooge gab es zudem noch genügend Privatunterkünfte. Fast an jedem zweiten Haus hing ein Schild mit der Aufschrift Ferienwohnung oder Zimmerfrei.
Alex schaute auf seine Uhr. Es war kurz nach zehn. Sie standen vor der Tür und blickten auf das hölzerne Schild, das sich im Rhythmus des Windes hin und her wiegte. Pension Seeblick, Fremdenzimmer mit Frühstück, stand darauf.
»Hoffentlich ist noch jemand wach.« Alex Uhlenbruch drückte den Klingelknopf.
Es dauerte eine Weile, bis eine ältere Dame mit grauem Haar öffnete. Sie hatte eine gestrickte Stola umgelegt und die Arme vor der Brust verschränkt. Sie fror. Als sie die Uniform des Dorfpolizisten erkannte, der Alex begleitete, erschrak sie. »Ist etwas passiert?«
Alex Uhlenbruch schüttelte den Kopf. »Haben Sie derzeit einen Feriengast?« Er strich sich ungeduldig eine Strähne seiner tiefschwarzen Haare aus der Stirn, die ihm in das sonnengebräunte Gesicht gefallen war.
»Ja«, antwortete sie gedehnt. »Einen Herrn aus Jever. Aber er ist momentan nicht im Haus.«
»Wo ist er denn?«
»Er ist Fotograf. Er ging gestern hinaus in die Dünen und ist bis heute noch nicht zurückgekommen.«
»Und warum haben Sie nicht sofort die Polizei verständigt?«, brauste der Inselpolizist auf.
»Er sagte, er habe etwas zu erledigen und es könne die ganze Nacht und vielleicht auch den nächsten Tag dauern«, antwortete sie eingeschüchtert. »Seit Stunden überlege ich schon, ob ich Sie anrufen soll.«
*
Trevisan schaute sich um. Die Leiche des alten Mannes lag hinter einer Sanddüne und war vom Weg aus nicht zu sehen. Der Tote lag auf dem Rücken. Seine Augenhöhlen waren leer. Tiefe Wunden bedeckten sein Gesicht. Der Hals war auf der rechten Seite nur noch ein Klumpen aus blutigem Gewebe. Der Knochen der Wirbelsäule war fast freigelegt. Neben der Leiche lag eine große Tasche. Filme, mehrere Objektive und sonstiges Zubehör befanden sich darin. Der Fotoapparat lag in der Nähe seiner Beine und sah aus wie ein Teleskop. Ein riesiges Objektiv war aufgeschraubt. Ein Fernglas und eine Taschenlampe lagen im Sand.
»Ich sag dir, es war eine wahre Schufterei, bis wir die Ausrüstung endlich auf die Insel geschafft hatten«, beschwerte sich Kleinschmidt.
Trevisan beugte sich zum Opfer hinab. Vorsichtig begann er die Taschen des Toten zu durchsuchen.
»Wir haben die Taschen schon geleert«, sagte Kleinschmidt. »Ein Taschenmesser, eine Packung Hustenbonbons und eine Brieftasche. Ausweis, Führerschein, Scheckkarte und dreihundertsieben Mark. Wir haben alles in Tüten gepackt.«
Trevisan erhob sich. Ihm war schlecht. Der Anblick von Leichen machte ihm nicht viel aus, sie gehörten zu seinem Beruf. Aber etwas anderes lag in der Luft. Er hatte es schon den ganzen Tag über gespürt. »Weißt du schon, wie es passiert ist?«
»Massiver Angriff mit einem scharfkantigen Gegenstand gegen den Hals. Vermutlich stand er auf der Düne, als er getötet wurde. Er muss nach hinten gefallen sein, denn auf dem Weg gibt es starke Einblutungen im Sand. Anschließend wurde er hierher gebracht. Der oder die Täter haben sich keine besondere Mühe gegeben, die Leiche zu verstecken.«
»Auf Geld oder Wertsachen hatte es der Mörder offensichtlich nicht abgesehen«, erwiderte Trevisan nachdenklich.
»So wie das hier aussieht, scheint es nur wenige Ansatzpunkte zu geben. Das wird eine harte Nuss«, sagte Kleinschmidt mit Bedauern.
»Was glaubst du, war es Zufall oder ein gezielter Anschlag?«
»Das Spurenbild gibt keinen Aufschluss darüber.« Kleinschmidt wandte sich um, als sein Name gerufen wurde.
Hanselmann, sein Mitarbeiter, kam angelaufen. In der Hand hielt er eine kleine Tüte. »Das haben wir da oben gefunden. Wahrscheinlich hat der Tote dort gestanden. Es lag genau im Fallwinkel der versickerten Blutlache. Vielleicht ist es eine Spur.«
Kleinschmidt griff nach dem Tütchen und untersuchte den kleinen runden Gegenstand durch das Plastik hindurch. Nachdenklich fuhr er sich durch seine spärlichen Haare. Dann reichte er den Beutel an Trevisan weiter.
Trevisan schaute verdutzt auf den kleinen Metallring. »Was ist das?«
»Ich weiß es nicht, aber wir werden es herausfinden«, antwortete Kleinschmidt.
Wenig später trug der Wind die ersten Regentropfen heran. Fluchend zog Trevisan seinen Kragen höher. Er blickte auf die Uhr. Kurz nach Mitternacht.
*
Sie polterten und tanzten in seinem Kopf. Das Hämmern wurde unerträglich. Er nahm das Bild in seine Hand und schaute in das lächelnde Gesicht des fremden Mannes. Dann warf er es zurück auf den Tisch.
»Vater, lass mich in Ruhe. Ich habe doch alles getan. Aber du hörst einfach nicht auf. Lass mich. Ich will nicht mehr!«, schrie er in das leere Zimmer. Sein Kopf schien zu platzen. Der Magen krampfte. Dann kam das hässliche, fratzenhafte Gesicht erneut auf ihn zu. Es wollte nach ihm greifen. Ein Gesicht, ohne Arme und ohne Hände. Es kam immer näher und er spürte einen eiskalten Hauch, der von ihm Besitz nehmen wollte. Sein Magen rebellierte. Er erbrach die Mahlzeit, die er eben erst eingenommen hatte.
Das Gesicht gönnte ihm keine Ruhe. »Blut für Blut!«, kreischte es in ihm. Er erhob sich aus seiner kauernden Haltung und taumelte zu dem kleinen Tisch in der Ecke. Zwei Tabletten mussten genügen. Er hatte nicht mehr viele und sie waren schwer zu besorgen. Bald würde er wieder Ruhe finden, doch noch musste er abwarten. Er brauchte Geduld – Geduld, bis das Opfer eingekreist und der Zeitpunkt gekommen war. Nur abends, wenn ihn eine abgrundtiefe Leere umgab, wenn er nicht mehr mit Planen und Taktieren beschäftigt war, dann kamen die Gesichter aus ihrer düsteren Schattenwelt hervor. Sie ließen ihn nicht in Ruhe. Vielleicht wäre es eine Erlösung, wenn er die ganzen Tabletten auf einmal nähme, dann hätte er ewige Ruhe. Aber nein, er wollte nicht schon wieder versagen. Die Rechnung war noch nicht beglichen. Nein, er konnte diesen Schritt nicht tun. Jetzt noch nicht.
Er nahm einen kräftigen Schluck aus der Flasche. Der Alkohol brannte im Hals, doch er tat gut. Er griff nach dem kleinen, roten Notizbuch und schlug die Seiten auf. Dort stand ein Name in krakeliger Schrift. Es war nicht leicht gewesen, alle Namen der Schuldigen in Erfahrung zu bringen. Aber er hatte es geschafft. Sie konnten ihm nicht mehr entkommen.
Er ging hinüber zu der Matratze und legte sich hin. Er dachte an seine Mutter. Ihr erschrockener Blick, als sie damals die Tür öffnete. Sie hatte es nie verwunden, genauso wenig wie Vater. Doch sie hatten sich geirrt. Niemand hatte ihm geglaubt. Jetzt würde er es beweisen können. Vor dem höchsten Gericht gab es keine Lügen mehr. Hier gab es nur noch Wahrheit. Die reine Wahrheit. Er freute sich auf diesen Tag. Noch lag er fern. Noch gab es viel zu tun, bevor die letzte Verhandlung einberufen werden konnte.
Das abscheuliche Gesicht war verblasst. Es war wie weggezaubert, doch er wusste, dass es irgendwo in der Dunkelheit auf ihn lauerte. Nur nicht nachgeben, dachte er. Unruhig erhob er sich. Zum Ausruhen war noch keine Zeit. Draußen heulte der Wind ums Haus und peitschte den Regen gegen die hölzernen Wände. Erneut ergriff er die Flasche, doch diesmal stellte er sie nicht zurück auf den Tisch. Er nahm sie mit auf sein Lager.
Ein weiterer Schluck. Er spürte langsam die entspannende Wirkung. Die Zeiger des alten Weckers wanderten unaufhörlich voran. Endlich erfüllte die Wärme aus der Flasche auch seinen Geist. Langsam und kontrolliert ging sein Atem. Er schlief mit dem Gedanken ein, dass das fratzenhafte Gesicht lächeln und für immer seine schreckliche Maske verlieren sollte. Für immer sollte es glückselig werden.
Er würde dafür sorgen.
Bald.
*
Sie saßen um den langen Konferenztisch und blickten einander ratlos in die übernächtigten Gesichter. Es war kurz nach acht Uhr. Trevisan fror und fuhr sich mit den Händen durch das feuchte Haar. Sie hatten noch bis zum frühen Morgen ausgeharrt, bis das Polizeiboot wiedergekommen war, um sie abzuholen. Die Tatortarbeit war erledigt. Die Leiche befand sich auf dem Weg in die Gerichtsmedizin. Trevisan hoffte auf schnelle Ergebnisse, doch außer dem Namen des Toten hielten sie nicht viel in den Händen.
Wer war der Tote? Welche Geschichte verknüpfte sich mit diesem Namen? Was wollte er zu dieser unchristlichen Zeit draußen in den Dünen? Hatte dort der Tod auf ihn gelauert oder war er nur zufällig über ihn gekommen?
Trevisan wusste, dass keine leichte Aufgabe vor ihm lag.
Alex Uhlenbruch hatte das Zimmer des Toten ausfindig gemacht, doch von der Vermieterin war nicht viel über ihn zu erfahren. Mit Sicherheit wusste sie nur, dass Rudolf Gabler am vergangenen Freitag die Pension nach 21.15 Uhr verlassen hatte. Er war alleine hinaus in die Nacht gegangen. Es musste wichtig für ihn gewesen sein. Doch was genau er vorgehabt hatte, das konnte Frau Melsung nicht sagen. Gabler war schon im letzten Frühjahr und im Herbst Feriengast bei ihr gewesen. Er war stets alleine gekommen und meist hinaus in die Dünen gegangen. Den Fotoapparat und das Fernglas hatte er immer bei sich getragen. Eines war klar: Gabler war nicht hier gewesen, um Urlaub zu machen. Er hatte ein bestimmtes Ziel verfolgt, dessen war sich die Pensionsbesitzerin sicher. Aber was genau er tat, danach hatte sie ihn nie gefragt. Jedes Mal hatte er nach dem Aufenthalt bar bezahlt und eine Quittung verlangt. Einmal hatte er erwähnt, dass er die Quittung zur Abrechnung brauche.
Aus den zurückgebliebenen persönlichen Dingen konnte nur ein Rückschluss gezogen werden: Er war ein ordentlicher Mensch gewesen. Das Zimmer und auch das Bad waren aufgeräumt und sauber. Seine Kleidung hatte er bereits akkurat in seinem Koffer verstaut. Seine Abreise hatte bevorgestanden. Im Bad hatten sie Zahncreme, eine Zahnbürste, einen Kamm, Seife, Shampoo und einen Rasierapparat gefunden. Auf der Ablage vor dem Spiegel herrschte Ordnung. Im Koffer auf der Kleidung lag ein Bild von einer Frau um die fünfzig. Mehr fanden sie nicht.
Bislang wusste Trevisan nicht einmal, ob Gabler Angehörige hatte. Nach dem Bericht der Polizeistreife, die zur Adresse des Toten geschickt worden war, hatte Gabler in einem Mehrfamilienhaus im Westen von Jever gewohnt. Außer Gabler standen noch drei weitere Namen auf den Briefkästen neben der Tür. Gabler hatte offenbar die Dachwohnung gemietet. Auf das Klingeln der Beamten hatte niemand geöffnet, auch bei den Nachbarn nicht. Nach zehn Uhr würde es eine Polizeistreife noch einmal versuchen.
Der Wagen des Mordopfers war noch in der Nacht bei Harlesiel auf einem Parkplatz nahe dem Fährhafen aufgefunden worden. Doch der Innenraum hatte keine Geheimnisse geborgen. Sein Zustand bestätigte nur, dass Gabler zu Lebzeiten ein ordentlicher Mensch gewesen war. Ansonsten befand sich nichts Auffälliges darin. Frau Melsung hatte ausgesagt, dass Rudolf Gabler am letzten Donnerstag um die Mittagszeit in Wangerooge angekommen war. Außer dem Koffer mit Kleidung hatte er nur noch seine aufwändige und teure Fotoausrüstung bei sich getragen.
»Heute haben die Ämter geschlossen.« Trevisan gähnte. »Ich glaube, wir können in den nächsten Stunden nichts ausrichten. Wir sollten uns ausruhen und heute Mittag wieder hier treffen, um unsere weitere Strategie festzulegen.«
Er war müde. Er war nun seit zweiundzwanzig Stunden auf den Beinen. Seinen Mitarbeitern ging es ähnlich. Zustimmendes Gemurmel wurde laut, dann erhoben sie sich und verließen das Bürogebäude in der Peterstraße.
Trevisan fiel ein, dass er ganz vergessen hatte, Paula anzurufen. Jetzt schlief seine Tochter bestimmt noch. – Und Angela wollte heute kommen. Sollte er ihr absagen?
Es war Sonntag und dicke Wolken hingen am Himmel.
4
Holger Björndahl arbeitete seit über sieben Jahren als Steuermann an Bord des Kühlcontainerschiffs Hansa Ekklund. Noch bei Dunkelheit hatten sie am Morgen in Bremen Ladung aufgenommen, ehe sie kurz nach sieben mit Kurs auf die Deutsche Bucht ausgelaufen waren. Über 2500 Seemeilen und ein stürmischer Atlantik lagen zwischen ihnen und ihrem Zielhafen. Selbst bei guten Bedingungen und voller Fahrt wären sie mindestens sieben Tage unterwegs.
Björndahl stand hinter dem Ruder und kontrollierte mit konzentriertem Blick die Instrumente. 285° Nordnordwest lag an. Das Schiff ging gleichmäßig in den Wellen, dennoch war die See aufgewühlt. Die Untiefen von Mellumplate lagen bereits hinter ihnen. Trotzdem war es Björndahl nicht ganz wohl in seiner Haut. Der Leuchtturm Roter Sand lag voraus und bald war es an der Zeit, den Kurs zu ändern.
Der leise Warnton des Radargerätes machte ihn unruhig. Dort draußen im Fahrwasser war etwas und es schien keine Notiz von ihnen zu nehmen. Angestrengt blickte er über den Horizont, doch er konnte nichts erkennen. Wenn das Ding in den nächsten paar Minuten keine Anstalten zur Kursänderung machte, dann blieb ihm keine andere Wahl, als den Kapitän zu rufen.
Der Funker saß hinter seinem Instrumentenpult und blickte ratlos auf die Armaturen. »Jetzt habe ich es auf allen Frequenzen versucht. Niemand meldet sich. Wie weit sind wir noch entfernt?«
Björndahl schaute auf den Radarschirm. »Etwa zwei Seemeilen bei unveränderter Position. Es scheint stillzustehen und hat keine Eigengeschwindigkeit.«
»Was treiben die da draußen?«, murmelte der Funker.
»Der Größe nach zu urteilen ist das ein Fischkutter, aber ich habe keine Ahnung, warum sie die Fahrrinne blockieren«, antwortete Björndahl.
Der Funker gab erneut die Kennung ihres Schiffes und den augenblicklichen Kurs durch. Doch aus dem Lautsprecher drang nur statisches Rauschen.
»Sei’s drum, ich hole den Alten«, entschied Björndahl und griff nach dem Bordtelefon.
*
Martin Trevisan hatte trotz großer Müdigkeit schlecht geschlafen. Draußen hingen dicke, graue Wolken vor dem Fenster und die Regentropfen klatschten gegen das kalte Glas. Angela war mit Paula in die Stadt gefahren. Er hoffte, sie würde seiner Tochter die Bootstour ausreden. Er duschte heiß und kalt, um seinen Kreislauf in Schwung zu bringen. Dann fuhr er ins Büro. Er hatte Angela gesagt, dass er wohl sehr spät nach Hause kommen würde.
»Dann werde ich eben mit Paula ins Kino gehen«, hatte sie verständnisvoll geantwortet.
Das liebte er an ihr. Sie war vollkommen unkompliziert. Er hatte einen Mord aufzuklären und Angela verstand es einfach. Grit hätte ihm bestimmt eine Szene gemacht.
Als Trevisan das Besprechungszimmer betrat, saßen Monika Sander und Dietmar Petermann am langen Tisch und betrachteten die Tatortfotos. Die Polizeifotografen hatten schnell gearbeitet und die Bilder sofort nach ihrer Rückkehr entwickelt. Dietmar blickte nachdenklich drein und zupfte sich seine grellfarbene Krawatte zurecht. Sie passte wie immer nicht zu den gedeckten Farben des Hemdes. Trevisan hatte sich früher oft gefragt, wer wohl für die Zusammenstellung von Petermanns Kleidung verantwortlich war. Mittlerweile wusste er, dass in der patriarchalisch ausgerichteten Familie allein Dietmar das letzte Wort hatte.
Trevisan trat an den kleinen Beistelltisch in der Ecke. Er schenkte sich eine Tasse Kaffee ein. »Wo sind Tina und Alex?«, fragte er, nachdem er einen Schluck getrunken hatte.
»Sie sind nach Jever gefahren. Sie nehmen sich Gablers Wohnung vor«, antwortete Dietmar.
»Beck hat schon zweimal angerufen. Es ist besser, wenn du sofort zurückrufst«, sagte Monika.
Trevisan seufzte griesgrämig. »Und was soll ich dem Chef erzählen?«
»Alles, was wir bislang wissen.« Monika zuckte die Schultern.
»Also nichts!« Trevisan griff nach den Fotos und betrachtete sie schweigend. »Hat sich noch etwas mit dem Wagen ergeben?«, fragte er nach einer Weile.
»Wir haben ihn sichergestellt. Kleinschmidt nimmt ihn sich morgen noch einmal genau vor«, antwortete Dietmar.
»Übrigens, die Kollegen aus Jever haben sich gemeldet«, sagte Monika. »Sie haben mit Gablers Nachbarn gesprochen. Gabler war alleinstehend. Er lebte ein leises und zurückgezogenes Leben. Keine Freunde, keine regelmäßigen Besucher, keine Frauengeschichten. Er verreiste oft und blieb tagelang verschwunden. Von Verwandten wissen sie nichts. Auch unser Computer weiß nichts über ihn. Mehr lässt sich im Moment nicht feststellen.«
Trevisan schaute aus dem Fenster.
War Rudolf Gabler aus purem Zufall Opfer eines Wahnsinnigen geworden? Warum? Was hatte er dort draußen gesehen? Auf wen war er dort gestoßen?
Auf Wangerooge waren die Befragungen abgeschlossen. Dort kamen sie nicht mehr weiter. Jever, Gablers Wohnung, das Umfeld, sein Leben, das waren die nächsten Schritte. Vielleicht würden sich daraus irgendwelche Hinweise ergeben.
»Also gut, gleich morgen früh beginnen wir. Dietmar, du nimmst dir mal seine Bankkonten vor. Monika, ich will alles über ihn wissen. Seine Herkunft, seine Kindheit, seine Freunde und sein Leben, überhaupt alles. Wir müssen uns ein detailliertes Bild über ihn machen können.«
»Glaubst du, er hat seinen Mörder gekannt?«, fragte Monika.
»Ich weiß es nicht«, erwiderte Trevisan unsicher.
»Also ich glaube, jemand hat ihm aufgelauert«, sagte Dietmar. »Ihr müsst doch zugeben, es ist schon ungewöhnlich, wenn ein alter Mann seine warme Pension verlässt, um eine stürmische Nacht draußen in den Dünen zu verbringen. Da stimmt doch etwas nicht. Was hatte er vor?«
Trevisan zeichnete auf dem Papier vor sich kleine Kreise mit seinem Füller. Er dachte über Dietmars Worte nach. Als das Telefon klingelte, fuhr er erschrocken zusammen. Monika nahm den Hörer ab.
Nur ab und an kam ein erstauntes »Aha« oder ein zustimmendes »Ja« über ihre Lippen. Das Gespräch dauerte lange und Trevisan trommelte unruhig mit dem Füller auf den Tisch, bis er feststellte, dass er die ganze Tinte auf dem Papier verkleckerte.
Endlich kam Monika zum Ende.
»Und?«, fragte Trevisan ungeduldig. Auch Dietmar schaute sie neugierig an.
»Alex war dran«, sagte sie. »Gabler war offenbar Berufsfotograf. In seiner Wohnung stehen zwei Bildbände, an denen er beteiligt war. Die Schrankschubläden sind auch voller Fotos. Landschaften, Architektur, Fabriken, Portraits. Vor allem alte Menschen und Kinder. Er scheint ein recht einfaches Leben geführt zu haben. Die Wohnung war ordentlich und alles stand an seinem Platz. Keine Anzeichen für einen Einbruch. Sie haben zwei Sparbücher sichergestellt. Auf dem einem sind fast einhunderttausend Mark. Er war also nicht gerade arm.«
Trevisan hörte aufmerksam zu. Ein ganz normales Rentnerleben. Wo war der Punkt, wo konnte man einhaken? Gablers Vorliebe für die Fotografie war schon beim Anblick der sündhaft teuren Fotoausrüstung klar geworden.
»Haben wir eigentlich den Film aus der Kamera?«, fiel es ihm siedendheiß ein.
»Kleinschmidt hat alles eingetütet und mitgenommen«, sagte Dietmar. »Er sagt, dass er sich im Labor darum kümmern wird. Ich gehe davon aus, dass er auch den Film aus der Kamera hat, sofern sich überhaupt einer darin befand.«
Trevisan nickte zufrieden. Er arbeitete seit über fünf Jahren mit Kleinschmidt zusammen und wusste, dass er sich auf ihn verlassen konnte.
Das Telefon klingelte erneut. Diesmal war Dietmar schneller am Apparat. Doch mit diesem Anrufer schien er nicht gerechnet zu haben. Er verzog sein Gesicht und formte tonlos mit den Lippen einen Nachnamen. Trevisan wusste sofort, wer in der Leitung war. Dietmar verabschiedete sich freundlich und reichte ihm den Hörer.
Kriminaldirektor Beck meldete sich mit krächzender Stimme. »Trevisan, ich warte schon seit Stunden auf deinen Anruf. Hast du schon Anhaltspunkte?«, polterte er ungehalten drauflos.
Er verschwendet wirklich keine Zeit mit Höflichkeitsfloskeln, dachte Trevisan. »Hallo. Gut, dass du anrufst. Ich wollte gerade …«
»Erzähl mir nichts! Wie sieht es aus?«, fiel ihm Beck ins Wort.
»Es sieht schlecht aus. Es ist noch viel zu früh, um irgendetwas sagen zu können«, erklärte Trevisan. »Uhlenbruch und Harloff durchsuchen gerade die Wohnung des Opfers. Ich hoffe, dass sie fündig werden. Etwas, das uns weiterbringt, verstehst du?«
»Mein Gott, Trevisan … So lange war es ruhig bei uns, und nun so ein bestialischer Mord. Es sind schon sieben Anrufe der Presse hier eingegangen. Mensch, was soll ich denen morgen bloß sagen?«
»Das überlasse ich dir«, erwiderte Trevisan.
»Wir müssen der Öffentlichkeit bald eine positive Nachricht servieren, sonst fallen die Journalisten wie eine Meute Hyänen über uns her.«
Trevisan verzog das Gesicht. Er war froh, als sich Beck verabschiedete. Als er die fragenden Mienen seiner Kollegen sah, zuckte er nur mit den Schultern.
Es war kurz vor fünf und draußen ließ der Regen nach.
*
Der Kapitän der Hansa Ekklund blickte ratlos durch sein Fernglas. »Der Kutter treibt ganz nahe an der Fahrrinne. Gib mir mal die Karte«, sagte er und setzte das Fernglas ab.
Björndahl reichte dem Kapitän die Seekarte und blickte ihn verwundert an. Was hatte der Alte vor?
Die Karten zeigten nichts Gutes. Im Roten Sand gab es Stellen mit weniger als fünf Metern Wassertiefe. Die Hansa Ekklund hatte im beladenen Zustand einen Tiefgang von fast zehn Metern. Die Strömungsverhältnisse waren außerordentlich schwierig. Wenn der Kutter in die Fahrrinne trieb, waren die nachfolgenden Schiffe in ernsthafter Gefahr. Erneut hob der Kapitän das Glas an die Augen. Ein roter Eimer hing am Vormast des Kutters und tat allen kund, dass dieser Trawler beim Fischen war. Netze jedoch erkannte er nicht. Zumindest nicht auf der Steuerbordseite.
»Versuchen Sie noch ein letztes Mal, mit dem Kutter Kontakt aufzunehmen«, befahl der Kapitän seinem Funker. Der Mann nickte und schraubte an der Frequenzwählscheibe seines Funkgerätes. Langsam und bedächtig sprach er in das kleine Mikrophon. Keine Antwort, nur das Rauschen und Knistern atmosphärischer Störungen war zu hören. Björndahl schluckte. Die Geräusche hatten etwas Gespenstisches.
Noch immer beobachtete der Kapitän angespannt den Kutter, doch keine Bewegung war an Bord zu erkennen. Nur das Auf und Ab der Wellen hauchte dem Schiff noch etwas Leben ein.
Der Funker gab seine Versuche auf. Der Kapitän quittierte seine Meldung mit einem kurzen Nicken.
»Rufen Sie die Küstenwache«, entschied er nach einer Weile des Schweigens. »Da stimmt etwas nicht.«
Der Funker befolgte die Anweisung und gab den Vorfall an den Seenotrettungsdienst in Harlesiel weiter. Mit ihren wendigen Schnellbooten war es kein Problem, die Untiefen der Sandbank anzufahren. Die Hansa Ekklund setzte ihre Fahrt fort. Der Kapitän hatte getan, was er in dieser Situation tun konnte.
*
Gegen sieben betrat Kleinschmidt das Konferenzzimmer, in dem Trevisan und seine Kollegen noch immer am Tisch saßen und angestrengt nach Ermittlungsansätzen suchten. Er ließ sich mit einem Seufzer in einen Stuhl fallen und warf Trevisan einen dankbaren Blick zu, als dieser eine dampfende Tasse Kaffee vor ihm auf den Tisch stellte. Kleinschmidts Pfeife rauchte und ein süßlicher Geruch mischte sich unter den Duft des frischen Kaffees.
»Ich weiß, es ist noch zu früh, aber hast du schon etwas herausgefunden?«, fragte Trevisan.
»Ich habe den Film aus Gablers Kamera entwickelt«, entgegnete Kleinschmidt trocken.
Trevisan und die anderen schauten ihn gespannt an. »Und?«
»Insgesamt wurden vierzehn Bilder belichtet. Die ersten beiden sind schwarz. Elf Bilder zeigen Vögel …«
»Vögel?«, bemerkte Monika Sander erstaunt.
»Ja, Vögel. Brütende, fliegende, kreischende und herumsitzende Vögel«, bestätigte Kleinschmidt. »Wenn ihr mich fragt, dann war Gabler so eine Art Vogelkundler. Außerdem war er ein absoluter Profi. Hundertprozentiger Bildmittelpunkt, große Tiefenschärfe. Eben die Bilder eines Profis. Aber das habe ich mir schon bei seiner Ausrüstung gedacht. Eine Leica, dazu passende Originalobjektive. Mindestens fünfzehntausend Mark wert. Auch das Fernglas war nicht billig. Mich wundert nur, dass der Täter die Ausrüstung nicht mitgenommen hat.«
»Du sagtest: vierzehn Bilder«, sagte Trevisan ungeduldig. »Was ist auf dem letzten Bild?«
Kleinschmidt fasste in seine Jackentasche und warf einen Packen Fotos auf den Tisch.