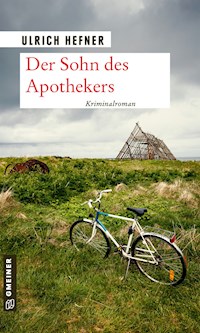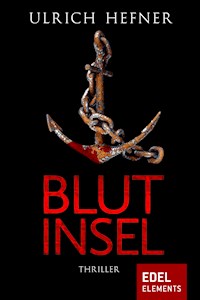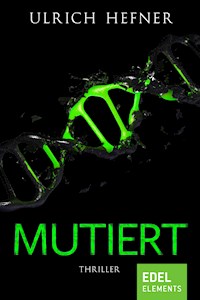Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Eine Serie von Selbstmorden Jugendlicher erschüttert das Wangerland und den hohen Norden. In Horumersiel erhängt sich der Sohn eines reichen Industriellen aus Wilhelmshaven. Hauptkommissar Trevisan wird beauftragt, den Selbstmord zu untersuchen und stößt innerhalb der Familie auf eine Mauer des Schweigens. Die Freunde des toten Jungen sind fassungslos und stellen auf eigene Faust Ermittlungen an. Erst als einer der Jugendlichen auf rätselhafte Weise umkommt, ahnt Trevisan, das sich hinter dem Selbstmord mehr verbirgt, als nur die Tat eines fehlgeleiteten und orientierungslosen Sechzehnjährigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrich Hefner
Das Lächeln der toten Augen
Frieslandkrimi
Zum Autor
Ulrich Hefner wurde 1961 in Bad Mergentheim geboren. Er wohnt in Lauda-Königshofen, ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Hefner arbeitet als Polizeibeamter und ist freier Autor und Journalist. Er ist Mitglied in der IGdA (Interessengemeinschaft deutschsprachiger Autoren), im DPV (Deutschen Presseverband) und im Syndikat. Weiterhin ist er Gründungsmitglied der Polizei-Poeten. Die Polizei-Poeten veröffentlichten inzwischen vier Bücher, die nicht nur in Polizistenkreisen auf großes Interesse stießen. Neben der Krimiserie um den Ermittler Martin Trevisan, die inzwischen aus sechs Bänden besteht, sind inzwischen auch drei Thriller erschienen, die bereits in mehrere Sprachen übersetzt wurden. www.ulrichhefner.de und www.autorengilde.de.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
(Originalausgabe erschienen 2009 im Leda-Verlag)
Umschlaggestaltung: Katrin Lahmer
unter Verwendung eines Fotos von: © LianeM/stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-6486-7
Widmung
Für Blue, Rainer und Richi und die alten Zeiten
Gedicht
und ich blickte in ihre Augen,
mitten hinein in den blauen Grund
eines tiefen, nicht enden wollenden Sees
… und auf dem Grund begegnete mir
das Grauen.
… unergründlich und erbarmungslos …
2001/Tr-8
Prolog
Das einsame Gehöft lag an der Küste von Nordjütland, etwa zwei Kilometer südlich von Lønstrup. Matt glänzten die Scheiben des kleinen Wohnhauses im Licht der untergehenden Sonne. Es war kalt geworden in Dänemark. Mats Lundgren hatte die kalten Monate des Jahres noch nie gemocht. Und dabei war es gerade mal November. Der Winter stand noch bevor. Stumm und in ohnmächtigem Schmerz schaute er hinaus auf das Meer.
Er hatte in ihre Augen geblickt, hatte fassungslos nach dem Sinn gefragt. Was bewegte sie in ihrem Alter zu dieser Tat, welcher Wahnsinn hatte sie dazu getrieben?
Es gab viele Gründe, warum Menschen freiwillig aus dem Leben schieden. Eine unglückliche Liebe, Vereinsamung oder eine unstillbare Todessehnsucht, aber diese Mädchen hatten doch erst am Anfang ihres Lebens gestanden. Außerdem gab es noch einen großen Unterschied.
Die Augen der Toten waren meist stumpf und leer, manchmal auch schreckensstarr geweitet und von einem kalten Glanz umgeben, doch nicht ihre Augen, nicht die Augen dieser Mädchen. Sie schienen glücklich, fast so, als sei der Tod nur die Pforte ins Paradies. Sie hatten sich nebeneinander gelegt, in einem mit weißer Farbe gezeichneten Kreis. Sie lagen darin, Kopf an Kopf, wie die Speichen eines Wagenrades, und hatten an die schmucklose Decke geblickt, ehe der Tod über sie kam. Doch ihre Gesichtszüge verrieten, dass es kein überraschender und schmerzvoller Tod gewesen war. Gemeinsam hatten sie ihr Ende erwartet.
»Wir sind fertig«, hörte er Loyen sagen. Langsam wandte er sich um. Im Hintergrund sah er die schwarz gekleideten Männer, die einen schmucklosen Zinksarg in den bereitstehenden Kombi trugen.
»Gibt es schon irgendeinen Anhaltspunkt?«
»Keine Spuren von Gewaltanwendung. Keine Spuren weiterer Personen im Zimmer. Keine Fußabdrücke, keine Fasern, einfach nichts.«
»Wie?«
»Medikamente, Gift. Das werden die Gerichtsmediziner in Aalborg schon feststellen. Wir haben in der Tasche eine silberne Schatulle mit weiteren Spritzen gefunden«, antwortete Loyen.
Mats Lundgren wandte sich erneut dem Meer zu.
»Sie müssen doch irgendwie hier herausgekommen sein«, sagte er nachdenklich.
Loyen zuckte mit den Schultern.
»Drei Mädchen zwischen sechzehn und zwanzig«, sagte Lundgren. »Eine Asiatin und zwei Mädchen mit dunkler Hautfarbe. Jemand muss sie gesehen haben, jemand muss sie vermissen. Wir müssen in allen benachbarten Wohnheimen nachfragen.«
Loyen nickte.
Olson kam schnaufend den Weg entlanggelaufen. Unmittelbar vor Lundgren blieb er stehen und atmete erst einmal tief durch.
»Und?«, fragte Lundgren.
»Ich habe Jaspers nach Hause geschickt«, antwortete Olsen. »Wir haben seine Angaben. Er wollte wie jeden Tag hinunter zum Strand, um nach seinen Reusen zu sehen, da fiel ihm die offene Eingangstür auf. Seit Jahren war niemand mehr hier draußen.«
»Weiß er, wem das Anwesen gehört?«
»Er sagt, einer alten Frau aus Thule. Doch den Namen und die genaue Adresse kennt er nicht. Sie hat sich schon lange nicht mehr hier blicken lassen.«
»Ich will wissen, warum sie das getan haben«, sagte Mats Lundgren nach einer Weile.
»Es gibt keinen Brief, wir haben alles durchsucht …«
»Erst wenn wir wissen, wer die Mädchen waren, wird es uns gelingen, mehr über die Hintergründe zu erfahren«, sagte Loyen.
»Du hast recht«, antwortete Mats Lundgren. »Lass uns zurück nach Hjørring fahren. Hier draußen werden wir keine Antworten auf unsere Fragen finden.« Er wandte sich um und ging auf dem schmalen Pfad zum Haus zurück.
Langeoog, sechs Monate später …
Die weiße Yacht schaukelte in den sanften Wellen des Hafenwassers auf und ab. Das dicke Tau hielt den schlanken Leib des Bootes im festen Griff gefangen. Es war kurz nach Mitternacht und die beiden Passagiere schliefen friedlich in der Kajüte.
Es war eine harte und anstrengende Überfahrt von Helgoland aus gewesen. Das Focksegel der Schärenyacht hatte sich in der steifen Brise aufgebläht und vor den Wind gestellt. In voller Fahrt hatten sie Strecke gemacht, ehe der Wind wechselte und von Nord auf Ost drehte. Mit halber Fahrt hatten sie schließlich Langeoog erreicht und das Boot an der Mole vertäut. Kurz darauf war die Dunkelheit auf die Insel geschlichen. Müde ließ sich der Skipper in die Hängematte fallen, die er zwischen Masten und Reling festgezurrt hatte. Seine Frau kochte auf dem Gaskocher seine Leibspeise, während er die Seekarten im fahlen Schein der Bootslampe studierte.
Nach dem Essen hatten sie sich in die Kajüte zurückgezogen. Für einen Landgang war auch noch morgen Zeit. Wenig später schlummerten beide friedlich in ihren Kojen.
Sie kamen im Morgengrauen. Lautlos schlichen sie sich an Bord. Im fahlen Schein der wenigen Laternen, die den Hafen nur spärlich erhellten, wirkten sie wie dunkle Schatten ohne Gesichter. Sie hatten das Boot nach dem Einlaufen in das Hafenbecken nicht mehr aus den Augen gelassen und auf ihre Gelegenheit gelauert. Niemand bemerkte sie.
Zielstrebig gingen sie zum Niedergang. Sie redeten nicht, sie brauchten keine Absprache. Unter ihnen herrschte blindes Verständnis.
Das Schloss der Kajütentür war kein Hindernis. Nach wenigen Sekunden knackte die Verriegelung. Es war das einzige Geräusch, das von Bord des Bootes hinaus in den Frühnebel drang.
Vorsichtig schlichen sie sich ins Innere. Das Schnarchen des Skippers drang an ihre Ohren, darunter mischte sich das gleichmäßige Atmen seiner Frau.
Auf diese Gelegenheit hatten sie wochenlang gewartet. Endlose Stunden hatten sie damit zugebracht, ihn zu studieren. Seine Gewohnheiten, seine Vorlieben, sie wussten, wie er seine Tage verbrachte. Offenbar kannte der Mann nur noch ein Ziel. Er war herumgefahren und hatte Fragen gestellt. Viele Fragen und vor allem: die falschen Fragen. Sie hatten gespürt, dass er ihnen sehr nahe gekommen war. Zuerst hatten sie geplant, ihn in seinem Haus aus dem Weg zu schaffen. Doch das hätte Spuren hinterlassen. Dann hatten sie von dem Segeltörn erfahren. Das war die Gelegenheit.
Seine Yacht und das Meer bedeuteten ihm viel. Es war eine schönes Boot, eine weiße Schärenyacht mit geringem Tiefgang. Hochseetauglich. Sie hatten sich gefragt, wie er sich dieses Hobby bei seiner schmalen Pension leisten konnte. Doch es war offenbar neben den Rosen im Garten seines Häuschens in Horne die einzige Liebhaberei geblieben, die er hatte.
Der Skipper war ein erfahrener und leidenschaftlicher Segler. Offenbar teilte seine Frau diese Begeisterung, obwohl sie gar nicht von der Küste stammte. Sie war vor vier Jahren aus der Hauptstadt in den Norden Jütlands gekommen, um an der Skøpping-Skole die Erstklässler zu unterrichten. Eigene Kinder gab es keine. Er hätte in aller Seelenruhe den Rest seines Lebens genießen können. Doch er tat es nicht, er hatte weiter geforscht. Etwas trieb ihn voran. Die Frage nach dem Warum. Was hoffte er dabei zu gewinnen? Der letzte Fall war abgeschlossen, es gab keine Veranlassung mehr, daran zu rühren. Niemand würde seine Fragen beantworten können. Er hätte einfach nur den Toten ihre Ruhe gönnen sollen. Er hatte seine Frau, die Yacht und die Rosen, es gab viele, die weniger besaßen als er. Doch es hatte ihm nicht gereicht.
Nun gab es kein Zurück mehr. Nun würde er seinen inneren Frieden finden. Jetzt würde sich der Kreis schließen. Der Drachenkopf hatte nach dem Schwert gerufen und alle hatten zugestimmt.
Schon waren sie über ihm. Nur ein leises Ächzen kam über seine Lippen, das in einem tiefen Schweigen verklang. Der Atem der Frau ging gleichmäßig. Sie hatte nicht bemerkt, dass sein Schnarchen verstummt war.
Es war kurz nach fünf Uhr, als der schlanke Körper einer Schärenyacht aus dem Hafen von Langeoog bei ansteigender Flut ins offene Meer glitt. Die dänische Flagge hing leblos vom Großmast herab. Nur die Augen eines einsamen Fischers folgten dem Boot, wie es in die Gewässer des Dollarts schipperte. Der Fischer wunderte sich noch, hatte doch der Wetterdienst für den heutigen Vormittag Sturmwarnung ausgegeben. Aber der Skipper würde schon wissen, was er tat. Vielleicht wollte er auch nur auf eine der benachbarten Inseln.
Der Fischer widmete sich längst wieder seinen Netzen, als der Horizont die weiße Yacht endgültig verschlang.
*
Der weißhaarige alte Mann blickte nachdenklich hinaus auf das Meer. Der Wind peitschte das Wasser auf und die tosenden Wellen brandeten gegen die steinerne Klippe. Seine langen, weißen Haare schwangen im Rhythmus der aufbrausenden Böen, doch das Wetter schien ihm nichts auszumachen. Er trotzte dem Sturm.
»Wir haben getan, was getan werden musste. Uns bleibt nichts, als abzuwarten und uns in Geduld zu üben«, schrie sein dunkel gekleideter Begleiter gegen die aufbrausende Naturgewalt an. Der Mann mochte wohl mehr als zwanzig Jahre jünger sein. Er war nervös und unruhig.
»Die Zeit ist gegen uns. Vergiss nicht, dass sich der Stein seinen Lauf durch unser Innerstes bahnt. Es ist, als ob dir eine feurige Hand mitten in deine Eingeweide greift. Ich spüre die Macht der Veränderung. Furchtbares wird geschehen. Die Feinde sind noch immer mächtig. Sie belauern uns. Wir werden dem Bösen entgegentreten, mit aller Macht. Die Toten blicken auf uns herab. Ich sehe ihre Augen. Jede Nacht sehe ich sie. Und ihre Tränen sind rot wie Blut.«
Der Alte sprach die Worte leise und mit tiefer Stimme, und trotz des Heulens des Windes klangen sie klar und verständlich.
Wangerland, Juli 2001 1
Die Frau schaltete den Staubsauger ab und horchte auf. Die laute Musik aus dem Nachbarhaus war verklungen, doch nun war ein anderes Geräusch an die Stelle der Musik getreten. Ein dumpfes Klopfen, fast so, als würde jemand mit vollen Kräften auf eine Pauke schlagen. Immer und immer kehrte es wieder. Es wirkte mechanisch und bedrohlich.
Ängstlich und zugleich ein wenig neugierig schlich sie an das Küchenfenster und blickte hinaus. Doch niemand war zu sehen. Noch immer stand das Moped vor dem Nachbarhaus. Vielleicht war dort ein Handwerker zugange. Schließlich dauerte es nicht mehr lange, bis die ersten Sommerfrischler den Badestrand jenseits der Deichstraße bevölkern würden. Sie wandte sich um und ging zurück in den Flur. Erneut betätigte sie den Schalter des Staubsaugers und das brausende Tosen des Gerätes überlagerte das hämmernde Pochen. Sie musste sich beeilen. Am Sonntag würden die ersten Feriengäste anreisen und dann musste das Haus gereinigt sein. Drei gute Monate im Sommer blieben ihr, damit sich das Ferienhaus rentierte. Niemand würde sich im Frühjahr oder Herbst oder gar im Winter für ihr Haus am Hohenstiefer Siel interessieren. Deshalb war sie bedacht darauf, dass sich die Feriengäste bei ihr wohlfühlten, im nächsten Jahr wiederkamen oder sie zumindest weiterempfahlen. Und Sauberkeit gehörte zu ihrem Geschäft.
Die beiden Wohnungen waren bereits gereinigt, die Betten mit frischer Wäsche überzogen und das Besteck in den beiden Küchen ergänzt. Nur noch der Flur und das Treppenhaus waren zu säubern. Eifrig ging sie ans Werk, dennoch lauschte sie ab und an, und noch immer war dumpf das Klopfen zu hören.
»Das geht nicht mit rechten Dingen zu«, sagte sie, als sie erneut den Staubsauger abschaltete und das Saugrohr beiseite legte.
Sie wusste, dass das Nachbarhaus einem reichen Industriellen aus Wilhelmshaven gehörte, der nur ab und zu ein paar Wochen in Horumersiel verbrachte. Die meiste Zeit über stand das Haus leer. Doch in den letzten Wochen, so hatte sie von einer Nachbarin erfahren, hätte sich der Sohn des reichen Mannes dort herumtrieben und mit seinen Freunden ausgelassene Partys gefeiert und laute Musik gehört.
Erneut schlich sie zum Küchenfenster. Ein Blick auf die Uhr sagte ihr, dass inzwischen mehr als zehn Minuten vergangen waren. Niemand würde mehr als zehn Minuten mit dieser Gleichmäßigkeit hämmern. Etwas stimmte nicht.
Sie fasste sich ein Herz und ging zur Tür. Draußen war keine Menschenseele zu sehen. Noch hielt die kleine Feriensiedlung ihren Dornröschenschlaf.
Sie ging auf den Eingang des Nachbarhauses zu. Das Hämmern wurde lauter. Sie blickte auf und bemerkte das offene Fenster an der Westseite unterhalb des Daches. Wenn sich ihr Gehör nicht irrte, kam das Hämmern genau aus diesem Zimmer.
Sie klingelte. Die Sekunden verstrichen. Sie klingelte erneut, doch nichts geschah. Schließlich legte sie ihre Hand auf den Klingelknopf. Bestimmt eine Minute lang war das Schnarren der Türklingel zu hören. Sie fühlte sich nicht ganz wohl in ihrer Haut. Aber schließlich machte sie sich Sorgen und wollte nur nach dem Rechten sehen.
Ihre Hoffnung war vergebens. Niemand öffnete ihr. Kein Geräusch deutete darauf hin, dass jemand durch das Treppenhaus lief. Nur das laute, gleichförmige und nervenaufreibende Hämmern schien nicht enden zu wollen.
Sie umrundete das Haus und rief laut »Hallo!« in Richtung des Fensters. Aber wiederum blieben ihre Bemühungen ohne Erfolg. Dabei wusste sie genau, dass jemand im Haus sein musste. Als sie vor knapp zwei Stunden aus ihrem Wagen gestiegen war, hatte sie doch die laute Musik aus dem Haus gehört.
Sie ging den kleinen Fußweg entlang, der in den Garten führte. Vor der Terrassentür blieb sie stehen. Die Tür stand weit offen und der Vorhang flatterte im Wind.
Erneut rief sie laut: »Hallo, ist da wer?«
Niemand antwortete. Schließlich fasste sie sich ein Herz und betrat das Wohnzimmer durch die Terrassentür.
Das Haus war geschmackvoll eingerichtet. Ein teurer Palisanderschrank und eine gediegene Ledercouch standen in dem geräumigen Zimmer. Auch der Teppich dürfte mehr als ihr kleiner Wagen gekostet haben, den sie sich zu Beginn des Frühjahrs angeschafft hatte, um ein klein wenig unabhängiger von ihrem Mann zu sein.
»Hallo, ist etwas passiert?«, rief sie. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Das Hämmern wurde schier unerträglich. Sie ging ins Treppenhaus und blickte nach oben.
Sie sah den Schatten oberhalb des Geländers nur aus den Augenwinkeln. Doch dieser Moment genügte. Ihr schriller Schrei übertönte sogar das stetige Hämmern.
*
»Du kannst mir glauben, ich kann gut darauf verzichten«, sagte Martin Trevisan und nippte an seinem Pils. Dann blickte er auf die Uhr. Es war kurz nach zehn und die Morgensonne verbreitete bereits ihre drückende Hitze im Raum.
»Paula ist jetzt in einem schwierigen Alter«, antwortete Peter Koch und griff mit einem Lächeln zu seinem Mineralwasser. »Bei Mira ist es nicht viel anders. Wenn ich abends nach Hause komme, ist auch ständig was los. Mira ist manchmal so gereizt, dass ich nicht ein Wort zu sagen brauche und schon stecken wir mitten im größten Krach. – Prost!«
»Spielen wir noch eine Runde?«, fragte Trevisan.
Peter nickte, trank sein Glas leer und stellte es geräuschvoll zurück auf den Tresen.
»Und was machst du dann?«
»Was meinst du?«
»Ich meine, wenn du mit Mira …«
»Ach so«, fiel ihm Peter ins Wort, »ich sage dann immer, das ist die Pubertät, da kann man nichts machen, das ist einfach so. Fünfzehn ist ein schwieriges Alter.«
Trevisan nickte.
Peter erhob sich, nahm seinen Squashschläger in die Hand und blickte Trevisan herausfordernd an. »Diesmal gewinne ich, alter Mann«, sagte er mit einem Lächeln.
Seit einem halben Jahr spielte Trevisan mit Peter Koch Squash im Fitnesscenter am Arsenalhafen. Peter war Stationsarzt im Nieter-Krankenhaus. Sie hatten sich im Fitnesscenter kennengelernt. Er war vier Jahre jünger als Trevisan, aber sie verstanden sich prima. Seit etwa drei Monaten trafen sie sich regelmäßig jeden Samstag, vorausgesetzt, ihre Arbeit ließ es zu.
Vor sechs Monaten, als Trevisan nach dem Duschen nur mit einem Handtuch bekleidet aus dem Badezimmer gekommen war, hatte Angela im Beisein von Paula seinen leichten Bauchansatz bemängelt. Er selbst hatte dieses kleine Polster, das sich hämisch über seinen Gürtel wölbte, längst bemerkt.
»Das ist das Alter und die mangelnde Bewegung«, hatte Angela gesagt.
Bewegung? Wie denn, wenn man den ganzen Tag im Büro herumsaß oder an irgendeinem Tatort herumstöberte, wie sollte man sich da angemessen bewegen? Und am Abend war man froh, wenn man zu Hause einen bequemen Sessel vorfand.
Aber sie hatten nicht lockergelassen. Zuerst hatte er es mit Joggen versucht. Doch meist kam er nicht weit, ehe er von einem leichten Trab in einen behäbigen Schritt verfiel. Regen, der Wind und dann auch noch der Schweiß, der ihm nach kurzer Zeit in Bächen über die Stirne rann, verdarben ihm schnell die Freude an der sportlichen Betätigung. Schließlich hatte er sich für das Fitnessstudio entschieden. Paula hatte ihn dazu genötigt und er war gegangen. Zögernd am Anfang, mit Unbehagen, er hasste die Muckibuden, in denen geistige Dünnbrettbohrer meinten, sie könnten um jeden Zentimeter wetteifern. Aber schließlich hatte er erste Erfolge festgestellt. Seine Hosen passten wieder und er fühlte sich einfach besser, gesünder, wacher und auch ein klein wenig ausgeglichener.
Dort war er dann auf Peter Koch getroffen, der einen Squash-Partner suchte. Er verstand sich sofort mit ihm, sie lagen auf einer Wellenlänge. Seit dieser Zeit verbrachte er die Samstagvormittage in kurzen weißen Hosen und Turnschuhen im Glaskäfig der Sporthalle.
Gemeinsam verließen sie die sonnendurchflutete Bar, die zum Studio gehörte, und betraten die Halle. Noch bevor der erste Ball auf den Boden krachte, klingelte ein Handy. Trevisan hatte gerade zum Schlag ausgeholt. Er verfehlte den Ball und fluchte laut.
»Verdammt, kann man denn nicht einmal …«
»Ich glaube, das ist für mich.« Peter Koch ging zu seiner Sporttasche. Er griff nach seinem Handy und meldete sich. Trevisan atmete auf. Paula war bei einer Freundin und Angela auf einer Auslandsreise. Er wusste genau, dass ein Anruf während des Samstagvormittags nichts Gutes zu bedeuten hätte. Niemand anderes als die Dienststelle würde ihn in diesen zwei Stunden stören.
Das Gespräch war nur kurz. Trevisan lehnte an der gläsernen Wand und spielte mit dem kleinen, schwarzen Gummiball.
»Ich muss in die Klinik. Ein Unfall, sechs Schwerverletzte. Tut mir leid«, sagte Peter. Trevisan konnte mitfühlen, oft genug war er in seiner Freizeit schon in die Polizeiinspektion gerufen worden. Er wartete, bis Peter gegangen war, dann ging auch er in die Umkleidekabine. Es war Viertel nach zehn. Er hatte es nicht eilig. Er duschte und genoss den warmen Wasserstrahl, der über seinen Rücken perlte.
Als Trevisan fertig war, fuhr er in die Innenstadt. In der Nähe des Bahnhofs fand er einen Parkplatz und ging zu Fuß in die Marktstraße. In einem Buchladen suchte er nach einem packenden Roman. Nur kein Krimi sollte es sein, Mord und Totschlag gab es genug in Trevisans Leben. Eine Stunde später kehrte er zurück zu seinem Wagen. In seiner Tüte befanden sich zwei Kochbücher. Eine Trennkostfibel und eines über leichte mediterrane Küche.
Als er in seinen Wagen stieg, fiel sein Blick auf ein junges Paar, das ein paar Meter entfernt vor einem dunklen Wagen stand. Das rotblonde Mädchen küsste den jungen Mann voller Hingabe, bevor dieser den Wagen umrundete und auf der Fahrerseite einstieg.
Trevisans Mund stand offen, er war zu keiner Bewegung fähig. Die roten Haare standen ihr nicht, ihr natürliches, mittelblondes Haar gefiel ihm viel besser, doch welcher Vater konnte schon gegen die modischen Flausen seiner pubertierenden Tochter angehen. Auch das Mädchen war mittlerweile eingestiegen. Der dunkle Wagen fuhr los.
»Paula …?«, murmelte Trevisan. Hatte sie nicht gesagt, dass sie den Tag bei ihrer Freundin Anja in Breddewarden verbringen wollte?
Vor lauter Verblüffung vergaß Trevisan, sich das Autokennzeichen zu merken. Er war sich aber sicher, dass der Wagen eine Wilhelmshavener Zulassung hatte. Nachdenklich fuhr er nach Sande zurück. Den Gedanken, bei Anjas Eltern vorbeizufahren und sich nach Paula zu erkundigen, verwarf er. Ein Anruf war vielleicht besser. Schließlich wollte er sich nicht lächerlich machen. Aber das Bild des rothaarigen Mädchens ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Hatte er sich getäuscht? Wie sehr er doch hoffte, sich geirrt zu haben …
Es war kurz nach zwei. Viermal hatte Trevisan inzwischen vergeblich versucht, bei den Stendals, Anjas Eltern, anzurufen. Bislang hatte sich niemand gemeldet. Konnte es sein, dass Paula ihn angelogen hatte und gar nicht zu Anja gefahren war?
Trevisan überlegte, ob er nicht nach Breddewarden hinauffahren sollte. Erneut griff er nach dem Telefonhörer. Mit nervösen Fingern wählte er die Nummer von Anjas Eltern. Diesmal musste er nicht lange warten, bis sich eine Frauenstimme am anderen Ende meldete.
»Guten Tag, ich bin Martin Trevisan, Paulas Vater. Ich wollte nachfragen, ob ich mit Paula sprechen kann?«
»Oh, das geht momentan leider nicht. Die Mädchen sind in die Stadt gefahren. Shoppen. Sie wissen doch, so was kann dauern«, erklärte die Frauenstimme mit heiterem Unterton. »Soll ich etwas ausrichten?«
»Sind Sie Anjas Mutter?«, fragte Trevisan vorsichtig. Er kannte die Frau nur flüchtig. Auf den Schulfesten waren sie sich ein paarmal begegnet.
»Ja. Ich habe die Mädchen heute um zehn nach Wilhelmshaven gefahren. Ich hole sie gegen Abend wieder ab. Ist etwas nicht in Ordnung?«
Trevisan überlegte. »Nein … Nein, ich glaube, das hat Zeit bis morgen. Vielen Dank. Auf Wiederhören.«
Trevisan legte den Hörer auf, ohne die Erwiderung abzuwarten. Sein Anruf war ihm plötzlich peinlich. Jetzt wusste er, dass Paula ihn wegen der Übernachtung nicht angelogen hatte, doch die Ungewissheit, ob Paula das Mädchen auf dem Parkplatz gewesen war, ließ ihm keine Ruhe. Paula war erst fünfzehn. Sie war ja noch ein Kind. Trevisan suchte nach seinem Handy. Dort hatte er Paulas Handynummer gespeichert. Bestimmt trug sie es bei sich.
Noch bevor Trevisan sein Handy gefunden hatte, klingelte das Telefon. Rief Paula etwa zurück? Er ging den Flur entlang und nahm den Hörer ab. »Trevisan«, sagte er erwartungsvoll.
»Hallo, ich bin es, Alex«, sagte Alex Uhlenbruch zögernd. »Ich störe nur ungern, aber ich brauche deine Hilfe.«
»Was ist los?«
»Du weißt, ich habe heute Bereitschaft. Aber ich kann leider nicht. Meine Schwester ist überraschend zu mir gekommen. Es … es gibt Probleme, familiär, du verstehst? Dietmar hat angerufen, wir haben einen Einsatz. Kannst du mich vertreten?«
Trevisan zuckte mit den Schultern. Eigentlich passte es ihm nicht ins Konzept. Schließlich war da ja noch die Sache mit Paula. »Ist Till oder Monika …?
»Ich habe es schon versucht, aber ich habe niemanden erreicht. Du bist meine letzte Rettung.«
Trevisan seufzte. »Also gut. Was ist passiert?«
»Ein Selbstmord in Horumersiel«, erwiderte Alex Uhlenbruch. »Dietmar ist in zwanzig Minuten auf der Dienststelle. Ich danke dir, du hilfst mir dadurch sehr.«
»Ist schon gut«, beendete Trevisan das Gespräch.
2
Trevisan schaute auf seinen Notizzettel. Hier irgendwo musste es links abgehen. Dann die Straße entlang über die Brücke, und schließlich immer geradeaus. Eine Gruppe von sieben kleinen Häusern mit Klinkerfassade. Das letzte Haus auf der rechten Seite, dort hatte sich die Tragödie ereignet. Er hatte die Wegbeschreibung aufgeschrieben, denn er traute sich selbst nicht mehr. Zu oft hatte er in der letzten Zeit etwas Wichtiges vergessen. Vielleicht hatte Angela doch recht? War es das Alter, das sich langsam bemerkbar machte? Die Abzweigung kam in Sicht. Trevisan wollte Dietmar Petermann gerade auf den Weg hinweisen, da setzte sein Kollege bereits den Blinker.
»Du kennst dich aus?«
»Ruhwedder hat mir den Weg erklärt«, antwortete Dietmar und schaltete in den zweiten Gang herunter. Auf der Kreisstraße 331 war wenig Verkehr an diesem späten Samstagnachmittag. Sie fuhren eine schmale Straße entlang, bis sie an die Brücke beim Schöpfwerk Wangerland kamen. Als sie die nächste scharfe Rechtskurve hinter sich gelassen hatten, kamen die Dächer einiger Häuser in Sicht.
»Ich hoffe, dass es heute nicht zu lange dauert. Wir begleiten mit unserem Chor morgen die Frühmesse«, sagte Dietmar Petermann, bevor er den Wagen vor dem letzten Haus in der Straße stoppte. Zweifellos waren sie hier richtig. In der Hofeinfahrt stand ein Streifenwagen.
»Wir werden sehen«, antwortete Trevisan und löste die Gurtschnalle.
Als er ausstieg, spürte er die bedrückende Stille, die in der Gegend herrschte. Keine Menschenseele war zu sehen. Vor die Sonne hatte sich eine dunkle Wolke geschoben. Trevisan wartete, bis auch Dietmar ausgestiegen war. Gemeinsam gingen sie auf das Haus zu, als ein uniformierter Polizist aus der Tür trat.
»Hallo, Martin, schöne Scheiße, was?« Es war Helge Ruhwedder, der Leiter der Polizeistation Wangerland. Trevisan kannte ihn noch aus vergangenen Tagen, als er selbst noch eine Uniform trug und in Wilhelmshaven auf Streife ging.
»Hallo, Helge, wie sieht es aus?«
»Ein junger Kerl, sechzehn Jahre alt. Hat sich ein Elektrokabel um den Hals geschlungen und ist dann einfach über das Geländer des ersten Stocks geklettert. Er sieht nicht gut aus. Eine grausame Art, sich das Leben zu nehmen.«
Trevisan schnürte es den Hals enger. Er dachte an Paula.
»Wisst ihr schon, wer der Junge war?« fragte Dietmar Petermann, als sie zusammen das Haus betraten.
»Er heißt Sven Halbermann und stammt aus Wilhelmshaven. Er hatte eine Geldbörse bei sich, darin befindet sich ein Führerschein für ein Moped. Seinen Eltern gehört das Haus. Sie leben in Neuengroden.«
Im Treppenhaus war es ungewöhnlich düster. Trevisan suchte nach einem Lichtschalter.
»Er liegt oben. Ich habe ihn mit den Sanitätern bereits abgehängt. Der Notarzt war schon da.«
»Wer hat ihn gefunden?« fragte Trevisan.
»Anna Telgte. Ihr gehört das Nachbarhaus.«
»Ist sie noch hier?«
»Sie ist drüben. Ich habe ihr gesagt, dass sie auf euch warten soll.«
Trevisan nickte. Gemeinsam gingen sie die Treppe hinauf in den ersten Stock. Im Flur lag der Tote. Ruhwedder hatte den Leichnam mit einem Stofftuch abgedeckt. Trevisan schlug das Laken zurück.
Die jugendlichen Gesichtszüge waren vom Todeskampf grausam entstellt. Seine Augen waren offen und sein Gesicht hatte die Farbe einer Wachspuppe angenommen. Er trug ein rotes T-Shirt und eine kurze Sporthose.
»Wo hat er gehangen?«, fragte Dietmar Petermann.
Helge Ruhwedder zeigte ihm die Stelle. An dem schwarz lackierten Geländer waren noch deutliche Kratzspuren zu erkennen. »Er ist einfach drüber weggeklettert. Der Arzt meinte, dass sein Adamsapfel durch das dünne Kabel zerquetscht wurde.«
»Gibt es einen Abschiedsbrief?«, fragte Trevisan mit brüchiger Stimme.
Ruhwedder nickte und deutete mit der Hand auf das gegenüberliegende Zimmer.
»Ich mach dann schon mal ein paar Fotos.« Dietmar Petermann ging zum Wagen, um die Kamera zu holen.
Trevisan folgte Ruhwedder in das Zimmer. Es war trotz seiner Dachschräge sehr geräumig. Trevisans Blick streifte die bunte Schlafcouch in der Ecke, daneben stand ein großer Kleiderschrank. Ein Tisch, eine Stereoanlage, ein Beistelltisch mit einem kleinen Fernseher und in der gegenüberliegenden Ecke ein Schreibtisch, der unter dem geöffneten Fenster stand, komplettierten die Ausstattung. Poster hingen an der Wand. Poster von Stars und Idolen, wie sie Trevisan auch in Paulas Zimmer hätte finden können. Ein Plakat hing neben dem Schreibtisch. Es warb für ein Computerspiel.
Trevisan schaute sich um. Unter der Stereoanlage standen mehrere Schallplatten in der Ablage. Ein Plattencover lag auf dem Tisch. Trevisan griff danach und hielt es zwischen seinen Fingerkuppen, um keine Spuren zu verwischen. Es war eine alte Plattenhülle der Gruppe Kansas. Trevisan erinnerte sich noch gut an ihre Musik.
Es war ungewöhnlich – Schallplatten! Die wenigsten Menschen hatten heute noch einen Plattenspieler.
»Die Platte lief noch, als ich kam«, erklärte Ruhwedder. »Die Abschaltautomatik des Tonarms hat vermutlich versagt, deshalb ist die Nadel immer wieder in die Endrille zurückgesprungen. Das hörte sich für Frau Telgte an, als ob jemand hämmerte. Deshalb ist sie herübergekommen. Sie vermutete, dass etwas nicht stimmte.«
Trevisan legte die Plattenhülle zurück auf den Tisch. »Wo liegt der Brief?«
»Drüben auf dem Schreibtisch.«
Auf der dunkelblauen Schreibunterlage lag ein Bogen Briefpapier mit Micky-Maus-Motiv an den Rändern. Ein Bleistift lag daneben. Die Handschrift auf dem Papier war krakelig.
Vater, warum? Sie war das Beste, das ich im Leben hatte. Warum hast du sie mir genommen? Für immer. Ich hasse dich.
In einigem Abstand darunter stand: Mutter, verzeih mir.
Die Zeilen waren eine einzige Anklage. Trevisan schluckte.
»Ich bin so weit!«, rief draußen Dietmar Petermann.
»Ich komme!« Trevisan kratzte sich an der Stirn. »Wissen die Eltern schon Bescheid?«
Ruhwedder schüttelte den Kopf. »Sie sind nicht zu Hause. Die Nachbarn sagen, dass sie verreist sind. Aber sie wissen nicht, wohin.«
Trevisan nickte gedankenverloren, dann ging er hinaus in den Flur.
Dietmar hatte bereits begonnen, den Jungen zu entkleiden. Trevisan trat hinzu. Gemeinsam suchten sie nach Verletzungen, nach Wunden, nach Prellungen oder Hautabschürfungen, die darauf hindeuteten, dass jemand beim Tod des Jungen nachgeholfen hatte. Routinearbeit. Außer den grässlichen Striemen und Bluteinfärbungen am Hals fanden sie nichts, es gab keine Hinweise auf einen vorausgegangenen Kampf. Doch das hatte Trevisan auch nicht erwartet.
»Eindeutig Selbstmord«, resümierte Petermann. »Jetzt brauchen wir nur noch das Motiv, dann können wir den Fall abschließen.«
Trevisan verzog seine Mundwinkel. Er hasste es, wenn Dietmar Petermann den Freitod eines Menschen auf das pure Aufnehmen der Personalien und die Motivsuche für den Staatsanwalt reduzierte. Doch eigentlich hatte er recht. Um mehr ging es bei der polizeilichen Ermittlungsarbeit nicht. Und das war schon schwierig genug, denn in den meisten Fällen von Selbstmord blieb das Motiv verborgen.
»Kann ich den Bestatter rufen?« fragte Ruhwedder.
Trevisan nickte. Er dachte an Paula. Der Junge war nur wenig älter als seine Tochter. Er hatte seinem Leben ein Ende gesetzt, obwohl er nur einen kleinen Teil davon gelebt hatte. Trevisan erschauderte.
Wie würde Paula reagieren, wenn er sie zur Rede stellte?
Kaum eine halbe Stunde später traf der Bestatter ein. Es dauerte eine geraume Weile, bis die Leiche des Jungen in den schwarzen Transportbeutel aus Kunststofffolie verpackt worden war. Trevisan schaute sich in der Zwischenzeit weiter im Zimmer des Toten um. Er öffnete die Schubladen des Schreibtisches, doch er wusste nicht, wonach er eigentlich suchte. Ein Tagebuch vielleicht, Aufzeichnungen, die den Selbstmord zumindest etwas durchschaubarer, etwas nachvollziehbarer machten. Wenngleich es für ihn dann immer noch unbegreiflich bliebe, dass ein Mensch überhaupt diesen Weg einschlagen konnte.
Dietmar Petermann stand neben ihm und hielt den Abschiedsbrief in der Hand, der inzwischen in eine Folie verpackt worden war.
»Tja, anscheinend die üblichen Probleme eines pubertierenden Jugendlichen mit seinen Eltern«, resümierte er, nachdem er die letzten geschriebenen Zeilen im Leben des Jungen überflogen hatte.
»Was meinst du damit?«, fragte Trevisan.
»Die drei ›L‹: Liebeskummer, Leistungsdruck, Lebenswandel. Irgendetwas in der Art!«
»Der Brief ist eine Anklage gegen den Vater und eine Entschuldigung an die Mutter. Ansonsten wissen wir gar nichts.«
Dietmar Petermann legte den Brief beiseite. »Wir wissen damit aber sicher, dass er es selbst getan hat. Den wahren Hintergrund werden wir wohl nie erfahren. Aber es ist augenfällig. Und meist sind es doch die Väter, die von ihren Kindern zu viel verlangen. Sie formen und erziehen wollen. Die Mütter sind gut für die Streicheleinheiten, oder?«
Trevisan wurde wütend. Er sah das Gesicht von Paula vor sich. Es war ihm, als stünde er seiner Tochter wegen bei Dietmar auf dem Prüfstand. Und ausgerechnet Dietmar Petermann musste so etwas von sich geben. Ein Mann, der immer nur den geraden Weg einschlug. Für den es nur Schwarz oder Weiß gab.
Trevisan erinnerte sich noch gut an das Familiengrillfest Anfang Mai in der Polizeiinspektion. Dietmars Junge hatte die ganze Zeit über still und brav am Tisch gesessen, während die anderen Kinder umhertollten und spielten. Erst gegen Abend hatte er verstohlen seinen Platz verlassen, um sich den anderen anzuschließen. Doch Dietmars kurzer, aber lauter Pfiff hatte ihn zurückbeordert, und der Junge war ihm gefolgt, wie ein gut erzogenes Hündchen.
»Was ist los mit dir?«
Dietmars Frage riss Trevisan aus seinen Gedanken. Er schob seine Wut beiseite. Er wusste, dass es sinnlos war, mit seinem Kollegen über solche Standpunkte zu diskutieren. Wo doch Dietmar gerne den Hobbypsychologen herauskehrte, der alleine die allgemeingültigen Wahrheiten und Charakteristiken der menschlichen Seele zu kennen glaubte.
»Hast du die Geldbörse und den Abschiedsbrief eingepackt?«
»Ja, eigentlich können wir gehen.«
»Du hast es verdammt eilig«, antwortete Trevisan.
»Ich hab dir doch erklärt, dass ich morgen früh ein Konzert habe. Bis der Bericht geschrieben ist, dauert es auch noch eine Weile.«
»Was genau willst du schreiben?«
»Was … wie … die Sache ist doch klar! Ein eindeutiger Selbstmord«, entgegnete Petermann erstaunt.
Typisch Dietmar, dachte Trevisan. Der tote Junge war nichts weiter als ein Aktenzeichen, das so schnell wie möglich vom Tisch sollte. Trevisan musste sich zwingen, seinen Gedanken nicht laut auszusprechen. »Ich übernehme die Sache, du kannst nach Hause gehen, wenn wir hier fertig sind«, sagte er stattdessen.
»Das ist schön, da habe ich ja noch Zeit, ein klein wenig zu üben«, erwiderte Dietmar erfreut.
Ruhwedder kam ins Zimmer. »Der Bestatter ist so weit. Wohin soll der Tote gebracht werden?«
»Direkt in die Rechtsmedizin«, entschied Trevisan.
Als Trevisan die Siegelmarke an die Haustür klebte, hatte er ein ungutes Gefühl. Er wusste nicht, warum, er wusste nicht, was ihn störte. Vielleicht war es auch der Umstand, dass ihm noch ein schwerer Gang bevorstand, denn Sven Halbermanns Eltern waren noch nicht vom Tod ihres einzigen Kindes unterrichtet.
*
»Ich mach mir echt Sorgen um ihn, er war in der letzten Zeit so still. Ich glaube, die Sache hat ihn ganz schön mitgenommen«, sagte Mike Landers nachdenklich.
Sie saßen auf einer alten, zerschlissenen Couch in einem der verlassenen Lagerschuppen am Banter Hafen. Vor zwei Jahren, nach der großen Pleite der DePa-Handelsgesellschaft, hatten sie sich den leeren Schuppen als Clubhaus eingerichtet. Das ehemalige Verwaltungsbüro hatten sie mit Teppichen ausgelegt und mit Möbeln vom Sperrmüll ausstaffiert. Dennoch wirkte das Zimmer gemütlich. Lediglich die Stereoanlage war neueren Datums. Sven hatte sie gestiftet. Aus unerfindlichen Gründen gab es noch immer Strom in diesem Schuppen.
Seit einem Jahr trafen sich die vier Jungs und das Mädchen regelmäßig hier. Sie kannten sich von Kindesbeinen an und waren alle im gleichen Alter. Nur Tommy war bereits achtzehn und besaß schon einen Führerschein.
»Wann hast du Sven das letzte Mal gesehen?«, fragte Tommy. Er und Luisa blickten Mike fragend an. Mike Landers war Svens bester Freund. Sie hatten schon zusammen im Sandkasten gespielt.
»Letzten Donnerstag, aber er wollte nicht mit mir reden«, antwortete Mike.
»Glaubt ihr, er hat sich echt in die verliebt?«, warf Jochen Eickelmann ein.
Tommy rümpfte die Nase. »Also mein Geschmack war sie nicht, und Sven wird schon ’ne andere finden«, witzelte er.
»Du bist doof«, erwiderte Luisa erbost. »Ich möchte wissen, wie du reagierst, wenn dir dein Vater deine Freundin wegnimmt.«
»Ich würde sie mir nicht wegnehmen lassen«, antwortete Tommy selbstsicher.
»Maria musste zurück nach Hause. Was hätte Sven machen sollen? Brasilien ist schließlich nicht Aurich!«
»Wenn er bis zum Mittag noch nicht hier ist, schaue ich noch einmal bei ihm zu Hause vorbei«, erklärte Mike.
Von draußen drang das Nebelhorn eines Kutters herein. Dunkle Wolken zogen vom Wasser auf das Festland zu. Bald würde es zu regnen beginnen.
*
Trevisan saß hinter seinem Schreibtisch. Der zweite Stock im Dienstgebäude war verwaist. Auch Dietmar Petermann war bereits gegangen, und Trevisan war sogar ein wenig froh darüber gewesen, denn dessen Kommentare trieben ihn in letzter Zeit immer öfter auf die Palme. Er spürte eine innere Unruhe und wusste nicht, ob dies an dem Selbstmord des Jungen lag oder ob Paulas Rendezvous die Ursache seines gestörten Seelenfriedens war. Noch immer hatte er keine Nachricht aus Neuengroden. Die Halbermanns waren noch nicht nach Hause zurückgekehrt.
Trevisan schaute auf die Uhr. Es war kurz nach neun. Draußen wurde es dunkel. Es hatte zu regnen begonnen. Er stöberte in den wenigen Habseligkeiten, die er aus dem Haus in Horumersiel mitgebracht hatte. In der Geldbörse befanden sich neben ein paar Groschen und einem Geldschein lediglich eine Scheckkarte, eine Karte für die Stadtbücherei und ein Jahresausweis für das Strandbad am Fliegerdeich. Trevisan öffnete das Seitenfach, doch es war leer. Schon wollte er die Geldbörse zur Seite legen, als er bemerkte, dass an der Innenseite des Seitenfaches ein Foto steckte. Es war ein einfaches Passbild in Schwarzweiß aus einem Automaten. Zwei übermütig lachende Gesichter blickten Trevisan an. Wange an Wange. Sven Halbermann auf der rechten Seite und daneben ein Mädchen. Sie war nicht viel älter als Sven. Ihr Gesicht hatte einen dunklen Teint. Eine Südländerin, vermutete Trevisan. Nachdenklich fuhr er sich durch die Haare. War dieses Mädchen der Grund für Sven Halbermanns Selbstmord? Wollte er sterben, weil er sie nicht haben konnte? Lehnte sein Vater eine Beziehung seines Sohnes mit einer Ausländerin ab?
Wieder kam ihm Paula in den Sinn. Er hatte einen Kloß im Hals. Schließlich erhob er sich, griff nach seiner Jacke und verließ das Büro.
Er fühlte er sich müde und abgespannt und fuhr nach Hause. Sein Blick fiel auf die Tankuhr. Die rote Nadel bewegte sich knapp über Reserve. An der Bismarckstraße bog er in die Tankstelle ab. Er tankte den Wagen voll und kaufte sich eine Flasche Rotwein. Wie würden die Eltern des toten Jungen auf die Nachricht reagieren? Sollte er einen Pfarrer hinzuziehen?
Vorsichtig fädelte er sich in den fließenden Verkehr ein. Doch er bog an der nächsten Kreuzung nicht links ab, sondern fuhr geradeaus weiter. Richtung Norden, nach Breddewarden. Er wusste nicht, warum er es tat, was er zu sehen hoffte. Er wusste nur, dass er jetzt gerne Paula in seiner Nähe hätte.
Eine Stunde später parkte er seinen Ford vor seinem Reihenhaus in Sande. Kurz vor dem Haus der Stendals war er umgekehrt. Es war kurz vor halb zehn gewesen. Viel zu spät, um zu klingeln und mit Paula zu sprechen. Er hatte gewendet und war die ganze Strecke wieder zurückgefahren.
Als er kurz vor Mitternacht zu Bett ging, beschäftigen ihn noch immer düstere Gedanken.
3
Ein immer wiederkehrendes Geräusch riss ihn aus einem unruhigen Schlaf. Trevisan brauchte eine Weile, bevor er realisierte, dass die sich wiederholenden Tonintervalle von seinem Telefon stammten. Schlaftrunken raffte er sich auf. Die Digitalanzeige seines Weckers stand auf kurz nach sechs Uhr.
Draußen graute der Morgen und der matte Schein des jungen Tages fiel durch die Ritzen der Jalousie. Er suchte nach seinen Hausschuhen. Das Telefon gab keine Ruhe. Mit unsicheren Schritten ging er die Treppe hinab.
»Trevisan«, meldete er sich mit belegter Stimme.
Die ersten Worte des Anrufers gingen in Trevisans Schläfrigkeit unter, deshalb verstand er den Namen nicht. Doch er konnte sich zusammenreimen, dass es seine Dienststelle war. »Moment, nicht so schnell«, beeilte er sich zu sagen.
»Sie wollten informiert werden, sobald Herr und Frau Halbermann zurückgekehrt sind«, wiederholte die männliche Stimme am anderen Ende der Leitung.
Das mulmige Gefühl kehrte zurück. »Hat schon jemand mit ihnen gesprochen?«, fragte Trevisan. Seine Müdigkeit war verflogen.
»Nein, Sie wollten doch selbst … auf alle Fälle sind sie zurück«, antwortete der Kollege vom Streifendienst.
»Gut, ich komme.« Trevisan legte auf. Für einen Moment blieb er regungslos vor dem Telefon stehen. Er atmete tief durch. Dann ging er ins Badezimmer.
Er hatte lange überlegt, ob es hilfreich war, einen Arzt oder einen Pfarrer hinzuziehen. Schließlich war er alleine mit dem Dienstwagen hinaus nach Neuengroden gefahren. Als er den Audi gegenüber der Villa geparkt hatte, blieb er einen Moment in Gedanken an den gestrigen Tag vertieft vor dem Grundstück stehen. Das weit ausladende Gelände wurde von einer halbhohen Mauer umfasst. Ein schmiedeeisernes Tor verwehrte den Zugang. Das Haus stand versteckt hinter hohen Büschen und drei riesigen Birken. Auf der gepflasterten Zufahrt stand ein dunkler Mercedes. Trevisan wusste, dass der Mercedes etwa so viel wie die Hälfte seines kleinen Reihenhäuschens gekostet hatte. Die Halbermanns waren ohne Zweifel eine reiche Familie.
Trevisan suchte nach dem Klingelknopf. Eine Sprechanlage befand sich darunter. Bevor er klingelte, versuchte er nochmals am Drehgriff, das Tor zu öffnen. Doch es war verschlossen. Erst nach dem vierten Klingeln drang eine undeutliche Stimme aus dem kleinen Lautsprecher, die Stimme eines müden und ungehaltenen Mannes. »Was soll das, zum Teufel?«
Trevisan schluckte. Sein Mund war trocken. »Trevisan ist mein Name. Ich bin Polizeibeamter und muss dringend mit Ihnen sprechen. Bitte, öffnen Sie!«, antwortete er bedrückt.
Erst jetzt bemerkte er die Kamera, die hinter dem Zugang an einen Mast montiert war und ihn mit ihrem kalten Linsenauge beobachtete.
»Die Polizei?«, hörte er noch, bevor der elektrische Türöffner summte.
Mit jedem Schritt überlegte er, wie er den Halbermanns beibringen sollte, dass sich ihr Sohn das Leben genommen hatte. Vor der Haustür blieb er stehen. Es vergingen ein paar Minuten, ehe ein großer Mann in Trevisans Alter in einem blendend weißen Bademantel öffnete. Das pechschwarze Haar des Mannes lag am Kopf an wie festzementiert. Es roch nach Veilchen oder ähnlichen Wiesenblumen. Trevisan bemerkte die dunklen Ränder um die tiefschwarzen Augen des Mannes. Das Gesicht war faltig. Er machte einen übernächtigten Eindruck.
»Guten Morgen. Hauptkommissar Trevisan von der Wilhelmshavener Polizei. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Herr Halbermann?« Trevisan reichte dem Mann die Hand.
Der Mann nickte nur und blickte Trevisan fragend an.
»Ich muss Ihnen leider mitteilen …«, fuhr Trevisan fort.
»Ist etwas passiert? Ein Unfall in der Firma?«
Trevisan hatte gehofft, dass ihn Halbermann ins Haus bitten würde, doch der dachte offensichtlich gar nicht daran.
»Simon, was ist los?«, hörte Trevisan eine Frauenstimme aus dem Dunkel des Flures fragen.
»Das wird uns der Herr bestimmt gleich erklären«, entgegnete Halbermann fordernd.
Trevisan überlegte, ob er um Einlass bitten sollte, doch er verwarf den Gedanken. Im Hintergrund tauchte eine rothaarige Frau in rosafarbenem Morgenmantel auf. Die Frau schien um einiges jünger und war trotz ihres verschlafenen Gesichtsausdruckes auch ungeschminkt eine Schönheit.
Trevisan atmete tief durch.
»Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Sohn sich gestern in Ihrem Ferienhaus in Horumersiel das Leben genommen hat.« Seine Stimme klang hölzern. Noch bevor sein letztes Wort verklungen war, hörte er einen spitzen Schrei. Dann sah er die Frau fallen. Sie stürzte zu Boden und blieb regungslos auf dem Läufer liegen.
*
Mike Landers war früh aufgebrochen, um sich im Yachthafen mit Tommy und Jochen zu treffen. Tommys Eltern hatten ein kleines Segelboot. Schon vor ein paar Tagen hatten sie ausgemacht, den Sonntag zu nutzen und einen kleinen Segeltörn hinüber zu den Inseln zu machen. Auch Sven Halbermann war bei dem Treffen dabeigewesen und hatte zugestimmt, nachdem Mike lange auf ihn eingeredet hatte. Wenngleich er bereits an diesem Tag schon verschlossen und abwesend gewirkt hatte. Doch Sven Halbermann kam nicht zum vereinbarten Treffpunkt.
»Es hat ihn stark mitgenommen, hoffentlich macht er keinen Quatsch«, sagte Mike, als er auf die Uhr blickte. Sieben Minuten nach acht. Sven war bereits eine halbe Stunde überfällig.
»Hast du ihn gestern Abend noch einmal besucht?«, fragte Jochen.
Tommys Rufen unterbrach die beiden. »Wollen wir noch lange warten? Es frischt auf. Er kommt bestimmt nicht!«
»Tommy hat recht«, erklärte Mike. »Ich glaube auch nicht daran, dass er noch kommt. Ich weiß überhaupt nicht, wo er sich herumtreibt. Ich bin gestern Abend noch bei ihm vorbeigegangen, aber er war nicht zu Hause. Es war überhaupt niemand zu Hause.«
»Na gut, dann lass uns ablegen. Ich glaube, der kriegt sich schon wieder ein. Das braucht nur etwas Zeit«, antwortete Jochen, ehe er sich am Tau zu schaffen machte. Kurze Zeit später schipperten die drei Jungs auf dem kleinen Jollenkreuzer aus dem Hafen.
*
Trevisan saß unruhig auf einer schwarzen Ledercouch im Wohnzimmer der Halbermanns. Das Zimmer war geschmackvoll eingerichtet. Der Vitrinenschrank aus Buche enthielt seltsame kleine Figürchen aus Halbedelsteinen, daneben in einer weiteren Vitrine waren Familienfotos in stilvollen, goldenen oder silbernen Rahmen ordentlich aufgereiht. Gegenüber an der Wand hing ein übergroßes Ölgemälde. Es zeigte ein abstraktes Gemisch aus Farbe, das sich kreisförmig um ein weißes Zentrum schmiegte. Je weiter die Farben sich vom Zentrum entfernten, desto dunkler wurden sie. An den Rändern herrschte tiefste Finsternis. Je länger Trevisan auf das Bild starrte, desto mehr gewann er den Eindruck, die Farben würden sich um dieses Zentrum bewegen. Die Schwärze und Dunkelheit schienen die frohen und hellen Farben einzuschließen, um sie immer mehr in die Enge zu treiben. Trevisan wandte den Blick ab, doch das Bild schien ihn zu verfolgen, anzuziehen wie ein Magnet. Es war mindestens doppelt so groß wie der Kandinsky-Druck, der in seinem Wohnzimmer eine Wand zierte.
Trevisan erhob sich und trat näher an das Bild heran. Kleine weiße Linien durchbrachen das tiefdunkle Schwarz am unteren Bildrand. Trevisan musste sich konzentrieren, um die Schrift lesen zu können. Das Universum/Adrian Lug.
»Entschuldigen Sie, aber ich musste noch telefonieren«, ertönte es in seinem Rücken. Trevisan fuhr herum.
Simon Halbermann stand im Zimmer. Er trug einen korrekt sitzenden Anzug, doch die Blässe in seinem Gesicht zeigte, dass ihn die Nachricht vom Tod seines Sohnes erschüttert hatte.
»Meine Frau schläft jetzt. Der Arzt ist noch bei ihr.«
Simon Halbermann ließ sich in den Sessel fallen. Einen Augenblick lang herrschte Schweigen.
»Setzen Sie sich doch!«, durchbrach Simon Halbermann die Stille. Die Worte klangen nicht wie eine Einladung, eher wie ein Befehl. Trevisan nickte und ging hinüber zur Couch.
»Ich kann es nicht fassen«, sagte Halbermann mehr zu sich selbst. »Der Junge. Ich habe ihm doch alles gegeben. Mehr noch sogar, einen festen Glauben, eine Zukunft, wo findet man das heute noch. Und dann wirft er einfach alles weg.«
Trevisan blickte Halbermann ins Gesicht. Einen Augenblick lang hatte er den Eindruck, Gefühlsregungen wie Fassungslosigkeit und Schwäche bei Simon Halbermann zu entdecken. Sekunden später hatte Halbermanns Gesicht wieder die harten und unnahbaren Züge angenommen.
»Bis wann können wir mit der Beerdigung rechnen?«, fragte Halbermann sachlich.
»Die Ermittlungen sind abgeschlossen. An der Selbsttötung bestehen keine Zweifel. Ich denke, dass Sie bis morgen mit der Freigabe des Leichnams rechnen können.«
»Gut, dann werde ich alles vorbereiten.«
Trevisan nickte zögerlich. »Es wäre da noch eine Frage.«
Halbermann blickte Trevisan hochmütig an.
»Uns beschäftigt nach wie vor das Motiv. Was bringt einen jungen Menschen dazu, sich das Leben zu nehmen?«, fragte Trevisan vorsichtig.
»Er ist tot. Was gibt es da noch zu sagen?«, erwiderte Halbermann barsch.
»Wir fanden einen Abschiedsbrief. Nicht viel, nur ein paar Zeilen. Kann es sein, dass er eine Freundin hatte?«
»Was soll diese Frage!«
»Gab es in der letzten Zeit irgendwelche Vorfälle, hat er sich ungewöhnlich verhalten, Ärger in der Familie, in der Schule oder mit Freunden?«
»Herr Trevisan, was wollen Sie überhaupt? Mein Sohn hat sich erhängt. Er selbst kennt den Grund dafür. Genügt das nicht? Ich glaube, die Unterredung ist an dieser Stelle beendet«, sagte Halbermann brüsk. Er erhob sich und ging zur Tür.
»Er hat in seinen letzten Zeilen von Ihnen gesprochen. Es ist eine Art Anklage. Er spricht davon, dass Sie ihm etwas weggenommen haben, das ihm sehr wichtig erschien. In seiner Geldbörse fand ich ein Bild, das Sven mit einem Mädchen zeigt. Ein dunkelhäutiges Mädchen. War das der Grund für einen Streit? Haben Sie ihm verboten, sich weiter mit seiner Freundin zu treffen?« Trevisan konnte Halbermanns abweisende Haltung nicht verstehen.
»Gehen Sie bitte. Verlassen Sie mein Haus!«, zischte Halbermann.
Trevisan nickte und erhob sich. Halbermanns harte und verschlossene Gesichtszüge verrieten, dass er von dem Mann keine Antworten auf seine Fragen bekommen würde.
Auf dem gepflasterten Weg zum Tor hinunter kam ihm eine Frau entgegen. Nur kurz streiften sich ihre Blicke. Sie mochte wohl nahe an die sechzig sein, trug ein einfaches Kostüm und hatte ihre grauen Haare hochgesteckt. Mit einem kurzen »Guten Morgen« ging sie an Trevisan vorüber. Als Trevisan vor seinem Wagen stand, blickte er sich noch einmal um. Er sah, wie die Frau im Haus verschwand.
*
Als Trevisan an diesem Sonntag das Büro verließ, hatte er bereits den Abschlussbericht geschrieben. Als Motiv trug er in das entsprechende Freifeld des Formulars auf der ersten Seite familiäre Probleme zwischen Vater und Sohn/wahrscheinlich Liebeskummer ein. Noch einmal las er das zweiseitige Dokument, das die Registriernummer 253/01-K1-Tr. erhalten hatte. Eigentlich war ihm klar, dass der Staatsanwalt nicht mehr als die erste Seite lesen würde, auf der die Personaldaten des Verstorbenen und in Kurzform die grundlegenden Feststellungen der Polizei festgehalten worden waren. Der Tod eines Menschen war verwaltungstechnisch auf drei Fragen reduziert. Die erste richtete sich nach den persönlichen Daten des Toten, die zweite Frage beschäftigte sich mit dem Problem, ob ein Fremdverschulden tatsächlich ausgeschlossen werden konnte und die letzte setzte sich mit dem Motiv des Selbstmörders auseinander.
Trevisan erinnerte sich noch gut an die Zeit, als aus einem Selbstmord noch eine Akte wurde, die neben einem Spurensicherungsbericht auch einen maschinengeschriebenen Abschlussbericht von meist vier bis fünf Seiten enthielt, in dem alle festgestellten Umstände ausgiebig dargestellt wurden. Doch seit betriebswirtschaftliche Grundsätze bis in die letzten Reihen der Polizei Einzug gehalten hatten, sprachen die Vorgesetzten nur noch von Optimierung und Abbau der Bürokratie. Sie hatten sogar recht damit. Mit der Zeitersparnis konnten heutzutage in der gleichen Zeit viermal so viele Selbstmorde abgearbeitet werden wie früher.
Trevisan blickte auf seine Uhr. Es war kurz nach Mittag und er verspürte ein deutliches Hungergefühl. Als er in seinen Wagen stieg, beschloss er, in einem Gasthaus essen zu gehen. Paula würde erst gegen zwei Uhr nach Hause kommen.
Es war ein sonniger und schöner Tag. Vielleicht würden sie den heutigen Nachmittag zusammen am Sander Badesee verbringen.
4
Trevisan hatte sich im Restaurant Fisch bestellt, doch trotz seines Hungers nur wenig davon angerührt. Anschließend war er nach Hause gefahren. Noch war Paula nicht eingetroffen.
Draußen war es warm. Das Thermometer zeigte 26 Grad Celsius. Trevisan stellte seinen Liegestuhl auf die Terrasse und legte sich ein Buch zurecht. Als er ein paar Seiten gelesen hatte, schlief er ein.
Schritte im Haus weckten ihn. Paula war zurück. Er hatte Durst und erhob sich. Als er in die Küche kam, stand Paula vor dem Kühlschrank.
»Hallo, Paps, wie geht es dir? Du siehst müde aus«, sagte sie im Vorübergehen.
»Mir geht es gut und dir? Wie war das Wochenende?«
»Toll!«, rief sie ihm zu, ehe sie im Badezimmer verschwand.
Trevisan schenkte sich ein Mineralwasser ein und ging hinaus auf den Flur. Sein Blick fiel auf die rote Sporttasche, die vor der Garderobe lag. Dann erschien Paula und verstaute ihr Badetuch darin.
»Willst du noch einmal weg?«, fragte Trevisan.
»Ich gehe mit Anja und ein paar anderen schwimmen. Aber keine Angst, du brauchst mich nicht zu fahren, ich werde abgeholt«, sagte sie, ehe sie auf der Treppe nach oben verschwand.
Trevisan blickte ihr nach. Die Betonung auf »abgeholt« gefiel ihm überhaupt nicht. »Aber ich dachte, wir könnten heute zusammen etwas unternehmen?« rief er ihr nach. Eine Antwort blieb aus.
Er überlegte, ob er sie fragen sollte, wo sie den gestrigen Mittag verbracht hatte, doch er verwarf den Gedanken. Stattdessen wiederholte er seine Frage. »Unternehmen wir was, wir beide?«
Paula kam die Treppe herab. Trevisan blickte sie mit großen Augen an. Hatte sie Lippenstift aufgetragen? Paula war groß geworden. Sie hatte viel von ihrer Mutter. Die schlanke Figur, die blonden Haare – jetzt rötlich eingefärbt – und die kleine, süße Stupsnase. Doch noch etwas war genauso wie bei Grit: ihr Gesichtsausdruck, wenn sie etwas verheimlichen wollte.
»Paps, heute geht es wirklich nicht. Ein anderes Mal vielleicht«, antwortete Paula gelassen, umarmte ihn und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Dann griff sie nach ihrer Tasche und rannte zur Tür.
Trevisan wusste nicht, was er sagen sollte. Er hatte das starke Bedürfnis, sie zurückzuhalten. Er wollte sie nicht verlieren, jetzt noch nicht, nicht so früh. Hatte er sie überhaupt richtig aufgeklärt, hatte er mit ihr darüber gesprochen? Er fühlte einen tiefen Stich in seinem Herzen.
Die Tür fiel in das Schloss und Trevisan wurde aus seinen Gedanken gerissen. Er eilte zum Küchenfenster und sah gerade noch, wie Paula hinter der Hecke verschwand. Eilends zog er sich seine Schuhe an und rannte zur Tür. Fast hätte er den Schlüssel vergessen. Vorsichtig schlich er sich zur Gartentür. Sie durfte ihn nicht sehen. Er wollte keinen Streit heraufbeschwören. Er schaute die Straße hinunter, doch Paula war bereits verschwunden. Er verließ das Grundstück und tastete sich an der Hecke entlang bis zur nächsten Querstraße. Dann hörte er das Aufheulen eines Motors. Das Geräusch wurde lauter. Panik keimte in ihm auf. Paula konnte nachtragend sein wie Grit. Wenn sie ihn jetzt entdeckte, würde sie wochenlang nicht mehr mit ihm reden. Er rannte auf die nächstgelegene offene Garage zu. Dann fuhr der schwarze Golf an ihm vorbei. Es war das Auto vom Bahnhof in Wilhelmshaven.
Er prägte sich das Kennzeichen ein und lief zum Haus zurück. Sein Weg führte ihn zum Telefon, doch er überlegte es sich anders, legte den Hörer wieder zurück und ging hinaus auf die Terrasse. Dort ließ er sich in den Liegestuhl sinken. Starr blickte er in die weißen Wolken, die an ihm vorüberzogen. Was sollte er tun?
*
Es war Viertel nach acht, als Trevisan am nächsten Morgen das Besprechungszimmer betrat. Monika Sander saß an der Stirnseite des Tisches und hatte bereits die Post aus dem Geschäftszimmer geholt. Der Postkorb quoll über.
»Hallo, Martin, wie geht es dir?«, fragte sie freundlich. Die Gespräche der anderen verstummten. Dietmar Petermann trug wie immer eine unpassende Krawatte zu seinem heute orangefarbenen Hemd. Till Schreier hatte sich eine neue Frisur zugelegt. Seine kurzen Stoppelhaare waren fast unsichtbar. Und Tina Harloff knabberte lustlos an einem Knäckebrot.
Martin Trevisan nickte stumm.
»Alex hat sich freigenommen. Er sagte, du wüsstest, warum«, erklärte Monika, als Trevisan nachdenklich auf den leeren Platz starrte. Trevisan setzte sich.
»Du bist heute nicht besonders gesprächig«, bemerkte Monika.
»Entschuldige, aber mir geht es nicht besonders. Gibt es etwas, das ich wissen sollte?« Trevisan zeigte auf den Postkorb.
»Nichts Besonderes. Der Obduktionsbericht zum Reitunfall in Accum ist gekommen. Außerdem jede Menge Ermittlungsersuchen. Am Wochenende war wieder einmal einiges los. Schlägereien, Einbrüche, Unfälle, aber für uns ist nichts dabei. Ach ja, bevor ich es vergesse, Beck möchte um zehn mit dir reden.«
Trevisan seufzte. Auf ein Treffen mit seinem Vorgesetzen legte er an diesem Morgen keinen Wert. Zumal Beck in der letzten Zeit immer nur von neuen Sparerlassen und Etatkürzungen zu berichten wusste.
»Ich habe gehört, die Halbermanns sind gestern zurückgekommen?«, meldete sich Dietmar Petermann zu Wort.
»Ich war bei ihnen«, bestätigte Trevisan.
»Dann kann ich den Fall heute wohl abschließen.«
»Schon erledigt, ich hatte gestern noch etwas Zeit«, erklärte Trevisan.
Eine halbe Stunde später war die Frühbesprechung vorbei. Trevisan betrat sein Büro, griff zum Telefon und wählte die Nummer der Datenstation. Es dauerte eine Weile, bis sich eine junge Frauenstimme am anderen Ende meldete.
»Trevisan, K1. Ich brauche eine Kennzeichenüberprüfung.« Er nannte Kennzeichen und Fabrikat und erhielt er die geforderte Auskunft. Der Wagen gehörte einem jungen Mann mit dem Namen Nikolas Ricken aus Wilhelmshaven. »Können Sie mir sagen, ob wir über ihn etwas in unseren Akten haben?«
Weitere zwei Minuten später wusste Trevisan alles, was aus polizeilicher Sicht über den Golffahrer zu sagen war. Neben mehreren Diebstählen, Schwarzfahrten und Körperverletzungen war Ricken zuletzt vor zwei Jahren bei einem Handtaschenraub als Mittäter in Erscheinung getreten. Und Paula musste sich ausgerechnet mit solch einem Kerl abgeben. Es war höchste Zeit, mit ihr zu sprechen.
Sie hatten sich in ihrem Clubhaus am Banter See versammelt. Mittlerweile wussten sie vom Tod ihres Freundes. In der Schule hatte sich die Nachricht schnell verbreitet. Sven Halbermann hatte sich das Leben genommen. Er würde nie mehr auf der durchgesessenen Couch neben der Stereoanlage sitzen und seine alten Platten auflegen, auf die er so stolz gewesen war.
Die Jungs schwiegen sich an. Um Luisas Augen lag ein roter Schatten. Wie die Corona einer Sonnenfinsternis. Sie blickten betreten zu Boden. Eine bedrückende Stille herrschte im Raum.
Mike Landers hielt einen Brief in der Hand. Sven Halbermann hatte mehr hinterlassen als die wenigen Zeilen auf dem weißen Papier in seinem Zimmer in Horumersiel. Was Mike in den Händen hielt, war eine einzige Anklageschrift. Das Vermächtnis eines Toten. Nun wussten sie, durch welche Hölle Sven Halbermann in den letzten acht Monaten gegangen war. Welche Schuldgefühle ihn gequält hatten. Am Ende hatte er erkannt, dass nicht er der Schuldige war, sondern ein anderer die Verantwortung für Marias Tod trug. Und eben diese Schuld sollten sie jetzt für ihn einfordern.
Sven Halbermann hatte sich in Maria Souza da Marques verliebt. Über ein Jahr hatte sie als Au-pair-Mädchen im Haushalt der Halbermanns gelebt. Dabei war es dann passiert. Sie hatte Svens Gefühle durcheinandergebracht. Doch Svens Vater wollte nichts davon wissen. Er mischte sich ein, beendete die Beziehung. Er schickte sie einfach zurück. Zurück in die Armut und in die menschenfeindliche Welt der Slums um Rio. Zumindest hatte Sven das geglaubt. Selbst nachdem sie fortgebracht worden war, hatte er versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Er hatte Briefe geschrieben. Sie blieben unbeantwortet. Er hatte das Institut angerufen, das die Vermittlung arrangiert hatte, doch dort hielt man ihn hin. Er hatte versucht, sie über die deutsche Botschaft ausfindig zu machen. Niemand konnte helfen. Sie blieb verschollen, untergetaucht in einem Moloch aus Armut, Menschenverachtung und Anonymität. Sie war verloren. Verloren für immer. So hatte er geglaubt. Schließlich hatte er das Bild gefunden. Das Bild und die Halskette mit dem Amulett, das er ihr geschenkt hatte. Das Bild zeigte ihr Gesicht. Zeigte ihre Augen. Die Augen lächelten. Sie lächelten in die Ewigkeit. Anfänglich hatte er noch geglaubt, sie hätte es seinetwegen getan. Nun wusste er, wer dahintersteckte. Simon Halbermann trug die Schuld an ihrem Tod.
Mike Landers blickte Luisa mitleidvoll an. Seine Tränen waren versiegt. Seine Augen waren leer geweint.
Der Brief enthielt mehr als nur den schrecklichen Verdacht, mehr als die bloße Anklage. Er enthielt eine klar formulierte Forderung.
Svens Vater sollte bezahlen. Er sollte die Rechnung begleichen. Er sollte die Angst empfinden, die auch Sven in seinen letzten Monaten empfunden hatte. Doch die Angst vor dem Tod war für den Vater nicht genug. Darüber würde der nur lachen. Simon Halbermann, der Ehrgeizige, der Reiche, der Selbstherrliche. Der mit Selbstverständlichkeit Macht über andere ausübte, es genoss, andere zu beherrschen. Er selbst sollte Angst davor empfinden, dass er alles verlieren könnte, was er aufgebaut hatte.
Sven Halbermann war Maria im festen Glauben gefolgt, in der anderen Welt wieder mit ihr vereint zu sein. Und sein Tod sollte etwas in Gang setzen, was er zu Lebzeiten nie erreicht hätte. Das war Svens Halbermanns Vermächtnis. Und das Bild und die Kette waren die Werkzeuge.
Hatte Sven wirklich recht, war Maria Souza da Marques tot? Gestorben, weil Svens Vater es wollte?
Es gab nur einen Weg, das herauszufinden. Wenngleich Mikes Idee abenteuerlich erschien.
»Die ist doch nur in Trance.« Jochen Eickelmann brach den Bann der Stille und legte das Bild zurück auf den kleinen Tisch. »Ich glaube nicht, dass sie tot ist. Wer weiß, vielleicht meditiert sie. An was glauben die Brasilianer, an Voodoo?«
»Wir sollten zur Polizei gehen«, mischte sich Luisa ein.
Mike Landers schüttelte den Kopf. »Die Polizei wird nichts unternehmen. Was beweisen das Foto und die Kette schon? Ich kenne Sven. Ich weiß, dass er recht hat.«
»Aber wir haben immer noch den Brief.«
»Der Brief … der Brief enthält keine Beweise«, entgegnete Tommy. »Sie werden glauben, er spinnt und ist seiner Angebeten in den Tod gefolgt.«
Sie wussten, was Tommy meinte. Kein normaler Mensch brachte sich um. Nur Irre taten das. Kranke, die mit sich selbst nicht klarkamen. Sven war nicht verrückt gewesen. Er hatte gewusst, was er tat. Und gewusst, warum er es tat.
»Wenn er das Geld übergibt, dann ist alles klar. Dann gibt er zu, dass er Maria ermordet hat«, sagte Mike nach einer Weile.
»Das ist Erpressung«, wandte Jochen Eickelmann ein. »Dafür wandern wir alle ins Gefängnis. Da habe ich keinen Bock drauf.« Hochrot war sein Kopf und seine Sommersprossen schienen fast zu glimmen.
»Ich will auch nicht ins Gefängnis«, bestätigte Luisa. Tränen kullerten ihr über das Gesicht.
»Und wie hast du dir das Ganze vorgestellt?«, fragte Tommy trocken.
Mike Landers überlegte einen Moment. »Wir schicken ihm einen Brief und legen ein Foto der Kette bei.«
»Tolle Idee«, schnaubte Tommy. »Und schicken ihm das Kuvert mit der Post. Hinterlassen dabei auf der Briefmarke unsere Spucke und sind noch am gleichen Tag auf dem Polizeirevier zu Gast.«
»Wie meinst du das?«, fragte Jochen vorsichtig.
»Ihr schaut wohl kein Fernsehen. In Amerika haben sie dadurch den Bombenleger von Oklahoma verhaftet«, erklärte Tommy wichtigtuerisch. »Wegen der DNA und dem ganzen Zeugs.«
»Dann werde ich den Brief eben selbst vorbeibringen«, erwiderte Mike Landers trotzig. »Mitten in der Nacht, wenn es sein muss.«
»Es gibt Fingerabdrücke, es gibt Schriftproben. Du weißt ja gar nicht, wodurch du dich alles verraten kannst.«
Jochen Eickelmann nickte.
»Wir landen alle im Gefängnis. Ich mache da nicht mit«, sagte Luisa und wischte sich die Tränen aus den Augen. »So sehr ich Sven auch vermisse, aber das kann er doch nicht von uns verlangen.«