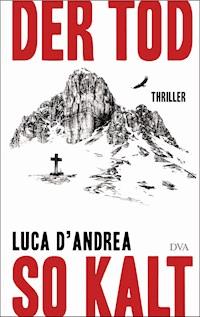
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Drei grausame Morde. Ein schweigendes Dorf. Ein Fremder, besessen von der Wahrheit
Südtirol, 1985. Tagelang wütet ein gewaltiges Gewitter über der Bletterbach-Schlucht. Drei junge Einheimische aus dem nahegelegenen Siebenhoch kehren von einer Wanderung nicht zurück – schließlich findet ein Suchtrupp ihre Leichen, aufs Brutalste entstellt. Den Täter vermutet man im Bekanntenkreis, doch das Dorf hüllt sich in eisiges Schweigen.
Dreißig Jahre später beginnt ein Fremder unangenehme Fragen zu stellen. Jeder warnt ihn vor den Konsequenzen, allen voran sein Schwiegervater, der die Toten damals gefunden hat. Doch Jeremiah Salinger, der seiner Frau in ihr Heimatdorf gefolgt ist, lässt nicht locker – und wird schon bald seine Neugier bereuen. Ein Fluch scheint alle zu verfolgen, die sich mit den Morden beschäftigen. Ist dort unten am Bletterbach etwas Furchtbares wieder erwacht? Etwas, so uralt wie die Erde selbst ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Drei grausame Morde
Ein schweigendes Dorf
Ein Fremder, besessen von der Wahrheit
Südtirol, 1985. Tagelang wütet ein gewaltiges Gewitter über den zerklüfteten Felsen der Bletterbach-Schlucht. Drei junge Einheimische aus dem nahe gelegenen Siebenhoch kehren von einer Wanderung nicht zurück – schließlich findet ein Suchtrupp ihre Leichen, aufs Brutalste entstellt. Den Täter vermutet man im Bekanntenkreis, doch das Dorf hüllt sich in eisiges Schweigen.
Dreißig Jahre später beginnt ein Fremder unangenehme Fragen zu stellen. Jeder warnt ihn vor den Konsequenzen, allen voran sein Schwiegervater, der die Toten damals gefunden hat. Doch Jeremiah Salinger, der seiner Frau in ihr Heimatdorf gefolgt ist, lässt nicht locker – und wird schon bald seine Neugier bereuen. Ein Fluch scheint alle zu verfolgen, die sich mit den Morden beschäftigen. Ist dort unten am Bletterbach etwas Furchtbares wieder erwacht? Etwas, so uralt wie die Erde selbst ...
Zum Autor
Luca D’Andrea wurde 1979 in Bozen geboren, wo er heute noch lebt. Der Tod so kalt ist sein erster Roman. Direkt zu Erscheinen stieg das Buch in die Top Ten der italienischen Bestsellerliste ein; die Übersetzungsrechte haben sich in rund 35 Länder verkauft. Die Geschichte führt nach Südtirol, in die Heimat des Autors, über die er auch journalistisch gearbeitet hat: Am bekanntesten ist seine TV-Produktion Mountain Heroes, in der er für das italienische Fernsehen die Bergrettung porträtierte.
Luca D’Andrea
Der Tod so kalt
Thriller
Aus dem Italienischen von Verena von Koskull
Deutsche Verlags-Anstalt
für Alessandra,meinen Kompass auf stürmischer See
So ist es immer im Eis. Zuerst hört man die Stimme der Bestie, dann stirbt man.
Gletscherspalten wie die, in der ich mich jetzt befand, waren voller Leichen von Kletterern, die dieser Stimme zuerst ihre Kräfte, dann ihren Verstand und schließlich ihr Leben geopfert hatten.
Ein Teil meines Hirns, der animalische, der das Grauen seit Jahrmillionen kannte, verstand, was die Bestie zischte. Ein einfaches Wort.
Elf Buchstaben: Verschwinde.
Ich brauchte etwas Vertrautes, etwas Menschliches, das mich der eisigen Einsamkeit des Gletschers entriss. Ich blickte empor, in der Hoffnung, jenseits der Schluchtkante die rote Silhouette des Ec135 der Bergrettung Dolomiten zu entdecken. Doch der Himmel über mir war leer. Ein fransiger Riss blendenden Blaus.
Das gab mir den Rest.
Ich fing an zu taumeln, keuchend, mit blutleeren Gliedern. Wie Jonas im Bauch des Walfischs stand ich allein vor Gott.
Und Gott fauchte: »Verschwinde.«
Um 14 Uhr 19 an diesem verdammten 15. September löste sich aus dem Eis eine Stimme, die nicht die der Bestie war. Es war Manny, sein roter Anorak leuchtete aus all dem Weiß hervor. Wieder und wieder sagte er meinen Namen, während die Seilwinde ihn langsam zu mir herabließ.
Fünf Meter.
Zwei.
Seine Hände und Augen suchten nach Verletzungen, die meinen Zustand erklärten. Seine Fragen waren zahllose Wies und Warums, auf die ich keine Antwort wusste. Die Stimme der Bestie war überlaut. Sie verschlang mich.
»Hörst du sie nicht?«, nuschelte ich. »Die Bestie, die …«
Die Bestie, wollte ich sagen, die Bestie, die dieses uralte Eis war, ertrug die Vorstellung nicht, ein warmes Herz in ihrem Inneren zu spüren. Mein warmes Herz. Und Mannys.
Und dann ist es 14 Uhr 22.
Die Verblüffung auf Mannys Gesicht, die sich in nackte Angst verwandelt. Das Seil der Winde, das ihn hochreißt wie eine Gliederpuppe. Manny, der nach oben schießt. Das Dröhnen der Hubschraubertriebwerke wird zu einem erstickten Heulen.
Und dann.
Der Schrei Gottes. Die Lawine löscht den Himmel aus.
Verschwinde!
Da erblickte ich sie. Allein, jenseits von Zeit und Raum, erblickte ich sie.
Die Finsternis.
Totale Finsternis. Doch ich starb nicht. O nein. Die Bestie spielte mit mir. Sie ließ mich am Leben. Sie raunte: »Du bleibst bei mir, für immer und ewig …«
Sie hat nicht gelogen. Ein Teil von mir ist immer noch dort.
Doch wie meine Tochter Clara mit ihrem unvergleichlichen Lächeln sagen würde, war das nicht das Z am Ende des Regenbogens. Es war nicht das Ende meiner Geschichte. Ganz im Gegenteil.
Es war erst der Anfang.
(We are) the Road Crew
1.
Im Leben wie in der Kunst zählt nur eines: die Wahrheit. Um zur Wahrheit über Evi, Kurt und Markus und die Nacht des 28. April 1985 zu kommen, müsst ihr alles über mich wissen. Denn es gibt nicht nur 1985 und das Massaker am Bletterbach, sondern auch 2014. Es gibt nicht nur Evi, Kurt und Markus, sondern auch Salinger, Annelise und Clara.
Alles hängt zusammen.
2.
Bis um 14 Uhr 22 am 15. September jenes Jahres, bis zu dem Moment also, als die Bestie mich fast getötet hätte, galt ich als Teil eines neuen, aufsteigenden Doppelsterns am Dokumentarfilmhimmel, der, wie ich fand, allerdings nichts als winzige Meteoriten und verheerende Flatulenzen hervorbrachte. Mike McMellan, der andere Teil nämlicher Konstellation, pflegte zu sagen, immerhin würden wir so als Helden verglühen. Nach dem dritten Bier war ich vollkommen seiner Meinung.
In Mike hatte ich den besten Freund gefunden, den man sich vorstellen kann. Nervig, großspurig und egozentrisch, ein Besessener, der sich mit der Zwanghaftigkeit eines gedopten Kanarienvogels in ein Thema verkrallen konnte. Aber auch der einzige wahre Künstler, dem ich je begegnet bin.
Wir waren das uncoolste Nichtskönner-Gespann an der New Yorker Film Academy (Mike lernte Regie, ich Drehbuch), bis Mike die Erleuchtung hatte, die unser Leben verändern sollte. Es war ein wahrhaft magischer Moment. Als es passierte, hockten wir gerade völlig gefrustet bei McDonald’s und stocherten in unseren Fritten, aber es war trotzdem einmalig. Glaubt mir.
»Scheiß auf Hollywood, Salinger«, hatte Mike gesagt. »Die Leute lechzen nach Realität. Wir müssen uns auf die gute alte, verlässliche Wirklichkeit stürzen. Hundert Prozent.«
Was Mike an diesem feuchten Novembertag vor vielen Jahren sagen wollte, war, dass ich meine (erbärmlichen) Drehbücher in die Tonne treten und mit ihm Dokumentarfilme machen sollte. Völlig irre.
»Mike …«, stöhnte ich. »Dokumentarfilmer sind alles Arschlöcher. Die horten sämtliche Nummern des National Geographic und haben Vorfahren, die auf der Suche nach den Quellen des Nils gestorben sind. Die glauben, sie könnten sich alles erlauben. Deren Familien schwimmen in Geld.«
»Salinger, manchmal bist du echt …« Mike schüttelte den Kopf. »Vergiss es, hör mir zu. Wir brauchen ein Thema. Ein starkes Thema für eine Doku, die alle umhaut. Etwas, das die Leute schon kennen, das wir ihnen aber so zeigen, wie sie es noch nie gesehen haben.«
Und ob ihr’s glaubt oder nicht: Ich hatte eine Idee. Ich weiß nicht, warum, aber als Mike mich mit finsterer Killermiene anstarrte und mir eine Million Gründe durch den Kopf schossen, ihn für bescheuert zu erklären, machte es in meinem Hirn plötzlich lautstark klick: Was konnte heißer, spannender und sexyer sein als der gute alte Rock ’n’ Roll?
Ein Kick, der Generationen verband. Millionen von Menschen betrachteten ihn als Religion. Es gab niemanden auf der Welt, der noch nicht von Elvis, Hendrix, den Rolling Stones, Nirvana, Metallica und der ganzen bunten Zirkuskarawane der einzig wahren Revolution des zwanzigsten Jahrhunderts gehört hatte. Rock ’n’ Roll war überall. Man musste nur die Kamera draufhalten.
Ganz einfach, oder?
Nun ja.
Rockmusik bedeutete auch schwarz gekleidete Muskelprotze mit Pitbullvisagen, die dafür bezahlt wurden, Leuten wie uns eins aufs Maul zu geben. Wahrscheinlich hätten sie es sogar gratis getan. Ergo: Wir sammelten mehr blaue Flecke als Material. Die Versuchung, alles hinzuschmeißen, war groß.
Da blickte der Gott der Rockmusik auf uns herab, sah unsere kläglichen Versuche, ihm zu huldigen, und wies uns mit mildem Blick den Weg zum Erfolg.
3.
Mitte April zog ich uns einen Job als Bühnenbauer in Battery Park an Land. Nicht für irgendeine Band, sondern für die umstrittenste, teuflischste und berüchtigtste Band aller Zeiten. Meine Damen und Herren: Kiss.
Wir schufteten wie die Ameisen, handelten uns aber weiterhin Prügel ein. Als wir nach einer Show wieder einmal ramponiert auf einer zugemüllten Parkbank saßen und völlig belämmert zusahen, wie sich die Zuschauermenge verlief, tauchten kräftige Kerle mit Hells-Angels-Bärten und Knastvisagen auf, die Boxen und Verstärker auf die Peterbilts der Band verluden. Das war der Moment, in dem der Gott des Hardrock aus seiner Walhalla hervorlugte und mir den Weg wies.
»Mike«, raunte ich. »Wir haben alles falsch gemacht. Wir müssen von der anderen Seite der Bühne filmen. Von der anderen Seite, Partner! Diese Typen sind die echten Rocker. Und«, fügte ich grinsend hinzu, »auf denen liegt kein Copyright.«
Die Roadies. Die Typen, die die Drecksarbeit erledigen, die achtachsigen Lkw beladen, sie kreuz und quer durchs Land kutschieren, sie entladen, die Bühne aufbauen, die Technik klarmachen, mit verschränkten Armen das Ende der Show abwarten, alles abtakeln, zusammenpacken und sich wieder auf den Weg machen. Wie heißt es bei Robert Frost: »Und Meilen noch, bevor ich endlich schlafen kann.«
Mike war wirklich unglaublich. Er schaffte es, einen zu Tode gelangweilten Tourmanager so hartnäckig mit Wahnsinnseinnahmen und Gratiswerbung zu ködern, bis er uns die Genehmigung gab, ein paar Aufnahmen zu machen. Die Roadies, die so viel Aufmerksamkeit nicht gewohnt waren, nahmen uns unter ihre Fittiche. Nicht nur das: Sie überredeten die Manager und Anwälte, dass wir sie (sie, nicht die Band – das war der entscheidende Joker) während der gesamten Tour begleiten durften. Und so entstand Zum Schwitzen geboren: Road Crew, die dunkle Seite des Rock ’n’ Roll.
Wir haben uns den Arsch aufgerissen. Sechs Wochen Wahnsinn, Migräne, Vollrausch und Schweiß, an deren Ende wir zwei Kameras geschrottet, uns mehrere Lebensmittelvergiftungen und einen verstauchten Knöchel zugezogen (ich war auf das Dach eines Wohnwagens geklettert, das brüchig wie Blätterteig war – ich war nüchtern, ich schwöre!) und zwölf verschiedene Betonungen von »fuck you« gelernt hatten.
Der Schnitt dauerte einen ganzen, vierzig Grad heißen Sommer, in dem wir einander vor dem kochend heißen Bildschirm fast umgebracht hätten, aber Anfang September 2003 hatten wir unseren Dokumentarfilm nicht nur fertig, sondern waren auch noch damit zufrieden. Wir zeigten ihn einem Produzenten namens Smith, der uns widerwillig fünf Minuten – fünf! – seiner Zeit gewährt hatte.
Es reichten drei.
»Ein Factual«, konstatierte der Zampano. »Zwölf Folgen à fünfundzwanzig Minuten. Und zwar bis Anfang November. Schafft ihr das?«
Lächeln und Handschläge. Dann brachte uns ein stinkender Bus nach Hause. Ratlos schauten wir auf Wikipedia nach, was, zum Henker, ein Factual war. Die Antwort lautete: ein Mittelding aus Fernsehserie und Dokumentarfilm. Wir hatten weniger als zwei Monate, um alles neu zu schneiden.
Unmöglich?
Also, bitte!
Anfang Dezember desselben Jahres ging Road Crew auf Sendung. Die Einschaltquoten waren gigantisch.
Plötzlich waren wir in aller Munde. Professor »Ihr könnt mich Jerry nennen« Calhoun, der verbitterte Exhippie, der unsere ersten Machwerke mit Hingabe in der Luft zerrissen hatte, ließ sich fotografieren, während er uns eine Auszeichnung für besonders verdienstvolle Studenten überreichte. Die Blogs sprachen über Road Crew, die Zeitungen sprachen über Road Crew.MTV brachte ein Special mit Ozzy Osbourne, der zu Mikes großer Enttäuschung nicht eine einzige Fledermaus verspeiste.
Doch es war nicht alles eitel Sonnenschein. Maddie Grady vom New Yorker hackte uns mit einer stumpfen Axt in Stücke – fünftausend Wörter, die mir monatelang nachgingen. Laut GQ waren wir frauenfeindlich. Life hielt uns für Misanthropen. Für Vogue waren wir die fleischgewordene Rache der Generation X. Das traf uns wirklich tief.
Im März des folgenden Jahres ließ uns Smith den Vertrag für eine zweite Staffel Road Crew unterschreiben. Die Welt gehörte uns. Dann, kurz vor dem Drehstart, passierte etwas, das alle und vor allem mich selbst überraschte.
Ich verliebte mich.
4.
So seltsam es klingen mag, schuld an allem war »Ihr könnt mich Jerry nennen« Calhoun. Er hatte eine Sondervorführung von Road Crew organisiert, gefolgt von der unvermeidlichen Podiumsdiskussion mit seinen Studenten. »Podiumsdiskussion« stank verdächtig nach Falle, aber Mike (der vielleicht hoffte, sich an unserem ehemaligen Lehrer und an der ganzen Welt rächen zu können) bestand auf der Sache, und ich hatte mich gefügt wie immer, wenn Mike sich etwas in den Kopf gesetzt hatte.
Das Wesen, das mein Herz eroberte, saß in der dritten Reihe, halb verdeckt von einem drei Zentner schweren Fettsack (ein Blogosphären-Fan, durchschoss es mich sofort), in Calhouns gefürchtetem Hörsaal.
Am Ende der Vorführung wollte der Fettsack als Erster etwas vom Stapel lassen. Das, was er in seinem fünfunddreißig Minuten langen Redeschwall von sich gab, lässt sich wie folgt zusammenfassen: »Scheiße hier, Scheiße da, in allen vier Ecken soll Scheiße drin stecken.« Dann wischte er sich zufrieden einen Spuckefaden von den Lippen, setzte sich hin und verschränkte mit einem herausfordernden kleinen Grinsen auf seinem Pfannkuchengesicht die Arme.
Ich war drauf und dran, ihm eine Tirade politisch höchst unkorrekter Bemerkungen an den Kopf zu werfen, als das Unmögliche geschah.
Das blonde Mädchen hob die Hand, und Calhoun erteilte ihr erleichtert das Wort. Sie stand auf (sie war wirklich bezaubernd) und sagte mit heftigem deutschen Akzent: »Was ich Sie fragen wollte. Wie lautet die korrekte Übersetzung für ›Neid‹?«
Ich musste lachen und dankte meiner lieben teutonischen Mutter insgeheim für ihren Deutschunterricht. Plötzlich erschienen die Stunden, die ich mir die Zunge verrenkt, Vokale aspiriert und rs gerollt hatte, als hätte ich einen Ventilator verschluckt, in einem ganz neuen Licht.
»Meine Dame«, hob ich an und freute mich über den Anblick der aufgeschreckten Studenten, die große Augen machten (der Fettsack eingeschlossen). »Sie sollten nicht nach dem Wort für ›Neid‹ fragen, sondern nach dem für ›Idiot‹.«
Sie hieß Annelise.
Sie war neunzehn und seit gut einem Monat in den Staaten. Annelise war weder Deutsche noch Österreicherin oder Schweizerin. Sie kam aus einer winzigen norditalienischen Provinz, deren Bevölkerung größtenteils Deutsch sprach. Alto Adige / Südtirol nannte sich dieses seltsame Fleckchen Erde.
In der Nacht, ehe Mike und ich zur Tour aufbrachen, schlief sie mit mir, während Springsteen im Hintergrund Nebraska spielte, was mich ein wenig mit dem Boss versöhnte.
Der nächste Morgen war hart. Ich glaubte, ich würde sie nie mehr wiedersehen. Doch dem war nicht so. Die süße Annelise aus dem achttausend Kilometer entfernten Alpenland machte aus ihrem Gastsemester einen Studienaufenthalt. Ich weiß, es klingt verrückt, aber Annelise liebte mich, und ich liebte sie. 2007, als Mike und ich uns auf den Dreh der dritten und (so hatten wir es uns geschworen) letzten Staffel von Road Crew vorbereiteten, hielt ich in einem kleinen Restaurant in Hell’s Kitchen um Annelises Hand an. Sie sagte so überschwänglich Ja, dass ich ziemlich unmännlich in Tränen ausbrach.
Was blieb mir noch zu wünschen übrig?
2008. Denn 2008, während Mike und ich uns nach der Ausstrahlung der dritten Staffel unseres Fuck-tuals eine wohlverdiente Pause gönnten, wurde an einem lauen Maitag in einem Krankenhaus mitten im grünen New Jersey unsere Tochter Clara geboren. Darauf folgten: Berge von Windeln, schlaflose Nächte, Anrufe meiner Mutter, die mich zum ängstlichsten Mann des Planeten machten, und Stunden, die ich damit zubrachte, Clara dabei zu beobachten, wie sie die Welt kennenlernte. Nicht zu vergessen Mike, der mit seiner aktuellen Freundin (sie hielten jeweils nur zwei bis vier Wochen, höchstens sechs) zu Besuch kam und alles daransetzte, meiner Tochter seinen Namen beizubringen, ehe sie »Papa« sagen konnte.
Im Sommer 2009 lernte ich Annelises Eltern kennen, Werner und Herta Mair. Wir wussten nicht, dass die »Müdigkeit«, mit der Herta ihre Blässe und ihre Schwindelanfälle erklärte, ein Tumor im fortgeschrittenen Stadium war. Wenige Monate darauf, kurz vor Jahresende, starb sie. Annelise wollte nicht, dass ich sie auf die Beerdigung begleitete.
2010 und 2011 waren wunderschöne und frustrierende Jahre. Wunderschön, weil: Clara lernt laufen, Clara fragt »Was ist das?« in drei verschiedenen Sprachen (Italienisch war die dritte, Annelise brachte es auch mir bei, und ich war ein ziemlich guter Schüler, motiviert von meiner umwerfend sexy Lehrerin), Clara wächst und wächst. Frustrierend, weil: Nachdem wir Smith gefühlte hunderttausend Projekte vorgeschlagen hatten (allesamt abgeschmettert), machten wir uns Ende 2011 an die Dreharbeiten für die vierte Staffel Road Crew, von der wir uns geschworen hatten, dass es sie niemals geben würde.
Alles lief schief, der Zauber war dahin, und das wussten wir. Es wurde ein langer, quälender Abgesang auf das Ende einer Ära. Doch wie Generationen von Drehbuchautoren wissen, will das Publikum nichts lieber, als sich traurig zu fühlen. Die Einschaltquoten der drei vorangegangenen Staffeln wurden noch übertroffen. Selbst der New Yorker beweihräucherte uns und schrieb von einem »offenen Auges zerbrechenden Traum«.
Mike und ich waren ausgelaugt, antriebslos und deprimiert. Die Arbeit, die wir für die schlechteste unserer gesamten Laufbahn hielten, wurde selbst von denen in den Himmel gelobt, die uns kurz zuvor noch wie üble Aussätzige behandelt hatten. Und so ging ich am Ende des Jahres auf Annelises Vorschlag ein, ein paar Monate in ihrem Heimatdorf zu verbringen, einem winzigen Flecken namens Siebenhoch, Alto Adige, Südtirol, Italien. Weit weg von allem und jedem. Eine gute Idee, so schien es mir damals.
Die Helden der Berge
1.
Die Bilder, die Annelise mir von Siebenhoch gezeigt hatte, wurden dem kleinen, eintausendvierhundert Meter hoch gelegenen Dorf nicht gerecht. Zugegeben, die Fenster mit den Geranien waren dieselben und auch die engen Straßen, in denen sich die Wärme fing. Ringsum verschneite Berge und Wälder – postkartenreif. Aber in Wirklichkeit war es … anders.
Es war fantastisch.
Ich mochte die kleine Kirche inmitten des Friedhofs, der nicht an den Tod, sondern an die in Gebeten beschworene ewige Ruhe denken ließ. Ich mochte die spitzen Giebel, die gepflegten Beete, die tadellosen Straßen, ich mochte den zuweilen unverständlichen Dialekt, der die Sprache meiner Mutter (und die meiner Kindheit) zu einem misstönenden, abgehackten Pidgin verstümmelte.
Sogar der verschlafene Despar-Supermarkt auf einer dem Wald entrissenen Brache unweit des Dorfes gefiel mir, wie auch das Geflecht aus Land- und Bundesstraßen und die von Buchen, Farn und Fichten überwachsenen Saumpfade.
Ich mochte den Gesichtsausdruck meiner Frau, wenn sie mir etwas Neues zeigte. Ein Lächeln, das sie wieder zu dem kleinen Mädchen machte, das, so stellte ich mir vor, durch diese Wälder gestreift war, Schneeballschlachten geschlagen hatte, diese Gassen entlanggelaufen und dann, kaum erwachsen, über den großen Teich in die USA und in meine Arme gekommen war.
Ich mochte Speck, vor allem den reifen, den mein Schwiegervater mit nach Hause brachte, ohne je zu verraten, woher er ihn bezog – bestimmt nicht bei den Läden, die er als »Touristenbuden« bezeichnete –, und die auf rund vier Dutzend verschiedene Arten zubereiteten Knödel. Ich verschlang Kuchen, Strudel und Co., legte vier satte Kilos zu und fühlte mich kein bisschen schlecht dabei.
Das Haus, in dem wir wohnten, gehörte Werner, Annelises Vater. Es lag am westlichen Ortsrand von Siebenhoch (wenn man bei einem Siebenhundert-Seelen-Dorf von Ortsrändern sprechen kann), dort, wo die Berge schroff in den Himmel ragten. Im oberen Stockwerk gab es zwei Schlafzimmer, ein kleines Arbeitszimmer und ein Bad. Im Erdgeschoss befand sich die Küche, eine Kammer und das, was Annelise die gute Stube nannte, auch wenn »Stube« eine glatte Untertreibung war. Der Raum war gigantisch, mit einem Tisch in der Mitte und Möbeln aus Buche und Zirbelkiefer, die Werner eigenhändig gebaut hatte. Durch zwei riesige Fenster, die auf eine Wiese hinausgingen, fiel das Licht herein, und gleich am ersten Tag schob ich einen Sessel davor, um die Weite, die Berge und das Grün (das bei unserer Ankunft unter einer dicken Schneedecke begraben lag) in mich aufzunehmen.
Ich saß gerade in besagtem Sessel, als ich am 25. Februar den Hubschrauber im Himmel über Siebenhoch auftauchen sah. Er leuchtete feuerrot. Ich war wie verhext. Die ganze Nacht ging er mir nicht mehr aus dem Kopf. Am nächsten Tag hatte sich der Hubschrauber in eine Idee verwandelt. In eine fixe Idee. Mir wurde klar, dass ich mit jemandem sprechen musste, der sich auskannte. Der mich verstand.
2.
Werner Mair wohnte ein paar Kilometer Luftlinie von uns entfernt in einem spartanischen Gehöft, das die Einheimischen Welschboden nannten. Er war ein knorriger Kerl, der selten lächelte (ein Wunder, das hervorzuzaubern nur Clara mühelos gelang), mit weißem, an den Schläfen schütterem Haar, durchdringenden blaugrauen Augen, scharfer Nase und tiefen, narbenartigen Falten.
Obwohl er auf die Achtzig zuging, war er topfit, und trotz der frostigen Temperaturen traf ich ihn hemdsärmelig beim Holzhacken an.
Als er mich sah, legte er die Axt auf eine Raufe und grüßte mich. Ich stellte den Motor ab und stieg aus. Die Luft war klar und prickelnd. Ich atmete tief ein. »Noch mehr Holz, Werner?«
Er hielt mir die Hand hin. »Holz hat man nie genug. Kaffee?«
Wir gingen hinein.
Ich schälte mich aus Jacke und Mütze und setzte mich an den Kamin. Der Rauch roch angenehm harzig.
Werner setzte die Bergvariante des italienischen Espresso auf, ein pechschwarzes Gebräu, das einen wochenlang wach hielt, und nahm Platz. Mit einem Augenzwinkern zog er einen Aschenbecher aus einem Schränkchen. Offiziell hatte er mit dem Rauchen aufgehört, und wenn Annelise ihn mit einer Zigarette erwischt hätte, hätte sie ihm das Fell über die Ohren gezogen. Während Werner mit dem Daumennagel ein Streichholz anriss, fühlte ich mich zwar ein wenig schuldig, ihn durch meine Anwesenheit (und weil ich den Mund hielt) dazu zu ermutigen, doch zugleich kam mir die Nikotinsucht meines Schwiegervaters sehr gelegen. Bei einem Männergespräch gibt es nichts Besseres als ein bisschen Tabakqualm.
Ich holte weit aus. Wir plauderten ein wenig über dies und das. Das Wetter, Clara, Annelise, New York. Wir rauchten. Wir tranken den Kaffee und ein Glas Welschboden-Wasser gegen den bitteren Nachgeschmack.
Dann kam ich zur Sache.
»Ich hab einen Hubschrauber gesehen«, fing ich an. »Einen roten.«
Werner musterte mich eindringlich. »Würde sich gut im Fernsehen machen, was?«
Nicht gut: perfekt. Dieser Hubschrauber wäre ein Quotenrenner.
Werner schnippte die Asche auf den Fußboden. »Hattest du schon einmal eine Idee, die dein Leben verändert hat?«
Ich dachte an Mike.
An Annelise. Und an Clara.
»Sonst wäre ich nicht hier«, entgegnete ich.
»Als ich meine Idee hatte, war ich jünger als du. Sie kam mir nicht zufällig, sondern aus Trauer. Es ist nicht gut, wenn Ideen aus Trauer entstehen, Jeremiah. Aber es passiert, da kann man nichts machen. Ideen kommen nun einmal. Manche gehen wieder, aber andere schlagen Wurzeln. Wie Pflanzen. Und sie wachsen und wachsen. Sie führen ein Eigenleben.« Werner starrte auf seine glühende Zigarette und warf sie in den Kamin. »Wie viel Zeit hast du?«
»So viel, wie ich brauche.«
»Falsche Antwort. Du hast die Zeit, die deine Frau und deine Tochter dir lassen. Das muss das oberste Gebot für einen Familienvater sein. Immer.«
»Da hast du wohl recht …«, erwiderte ich und errötete leicht.
»Wie auch immer, die Geschichte ist schnell erzählt. Siehst du dieses Foto da?« Er deutete auf einen gerahmten Schnappschuss, der unter dem Kruzifix hing. Er stand auf und strich mit den Fingerspitzen darüber. Wie vielen Bergbewohnern fehlten ihm ein paar Fingerglieder, bei ihm waren es die Kuppe des kleinen Fingers und die des Ringfingers der rechten Hand.
Auf der Schwarz-Weiß-Fotografie waren fünf junge Männer zu sehen. Der ganz links mit den störrischen Locken in der Stirn und dem Rucksack über der Schulter war Werner.
»Das war 1950. Den Monat weiß ich nicht mehr genau. Aber an die Jungs erinnere ich mich noch. Und an den Spaß, den wir hatten. Den vergisst man selbst im Alter nicht. Geburts- und Jahrestage schon. Gesichter auch. Und glücklicherweise auch Schmerz und Leid. Aber der Spaß, den man hatte … der bleibt einem.«
Ich bezweifelte, dass Werners Gedächtnis ihn je im Stich ließ. Er gehörte zu der Sorte Gebirgler, die nicht kleinzukriegen sind. Doch ich begriff, was er mir sagen wollte.
»Das Leben hier oben war hart. Morgens Schule im Tal, nachmittags schuften auf Feldern und Almen, im Wald und in den Ställen, bis spät in die Nacht. Ich hatte Glück, mein Vater hatte das Grubenunglück überlebt. Viele meiner Freunde waren Waisen, und in jener Zeit in Südtirol ohne Vater aufzuwachsen war kein Zuckerschlecken.«
»Das kann ich mir vorstellen.«
»Vorstellen vielleicht«, entgegnete Werner, ohne den Blick von dem Foto abzuwenden. »Aber ich glaube nicht, dass du es wirklich verstehen kannst. Hast du jemals hungern müssen?«
Einmal war ich von einem Junkie ausgeraubt worden, der mir eine Spritze an den Hals gehalten hatte, und ein guter Freund von mir war auf dem Rückweg von einem Konzert im Madison Square Garden niedergestochen worden, aber, nein, Hunger gelitten hatte ich nie.
Also sagte ich nichts.
»Wir waren jung und arglos, wenn du verstehst, was ich meine. Am liebsten gingen wir klettern.« Ein halb wehmütiger, halb spöttischer Ausdruck huschte über sein Gesicht. »Bergsteigen war etwas für Spinner und Träumer. Kein Breitensport. In gewisser Weise waren wir Pioniere. Heute ist der Tourismus die größte Einnahmequelle Südtirols.«
Er hatte recht. Überall gab es Hotels, Restaurants und Seilbahnen, die einem den Aufstieg zu den Gipfeln erleichterten. Im Winter tummelten sich die Touristen in den Skigebieten, im Sommer gingen sie wandern. Ich konnte es ihnen nicht verdenken.
»Ohne den Tourismus«, fuhr Werner fort, »wäre Südtirol eine arme, von greisen Bauern bevölkerte Gegend. Und Siebenhoch würde es nicht mehr geben.«
»Das wäre schade.«
»Und ob.« Er blinzelte. »Wie auch immer … In den Bergen arbeitete man. Kühe auf die Alm treiben, Feuerholz machen. Das Land bestellen. Für uns hingegen bedeuteten die Berge Spaß. Aber wir waren leichtsinnig. Zu leichtsinnig. Wir wetteiferten miteinander, wer die steilste Wand bezwang, wir stoppten unsere Zeit. Wir forderten das Wetter heraus. Und die Ausrüstung?« Werner schlug sich auf den Schenkel. »Hanfseile. Kannst du dir vorstellen, was es heißt, nur mit einem Hanfseil gesichert abzustürzen?«
»Keinen Schimmer.«
»Die heutigen Seile aus Nylon oder dergleichen geben nach und fangen dein Gewicht ab. Mit Hanf ist das was ganz anderes. Man riskiert, als Krüppel zu enden. Oder schlimmer. Und dann … Die Kletterhaken, Pickel und so weiter waren selbst gemacht, vom Dorfschmied. Das Eisen war mehr als brüchig.« Werner räusperte sich. »Aber wir fühlten uns unsterblich.«
»Und das wart ihr nicht.«
»Niemand ist unsterblich. Wenige Monate nachdem dieses Foto entstanden ist, gab es einen Unfall. Wir waren zu viert aufgestiegen. Croda dei Toni, Zwölferkofel, warst du mal dort? ›Croda dei Toni‹ bedeutet ›Donnerkrone‹ im Belluneser Dialekt, denn wenn es regnet und die Blitze runterkommen … Bei dem Anblick bekommt man Gänsehaut. Schön ist es dort. Aber das macht den Tod nicht weniger bitter. Tod ist Tod, alles andere zählt nicht.«
Ich konnte ihm ansehen, dass er an Herta dachte, die von einem Monster im Hirn verschlungen worden war. Ich wartete ab, bis er sich wieder gefasst hatte.
»Drei von uns schafften es nicht. Dass ich davongekommen bin, war reines Glück. Josef starb in meinen Armen, während ich wie besessen um Hilfe schrie. Aber selbst wenn mich jemand gehört hätte … Es waren zwanzig Kilometer von dort, wo das Seil riss, bis ins nächste Krankenhaus. Unmöglich, ihn zu retten. Unmöglich. Ich wartete, bis der Tod ihn holte, sprach ein Gebet und kehrte heim. Und da kam mir die Idee. Oder besser, die Idee kam zu mir. Nach den Beerdigungen saßen wir zusammen, um auf die Toten zu trinken. Du hast bestimmt schon bemerkt, dass hier bei uns gern getrunken wird. An dem Abend soffen wir wie die Löcher. Wir sangen, lachten, weinten, fluchten. Dann, als der Morgen graute, erzählte ich von meiner Idee. Auch wenn niemand es aussprach, es war klar, dass alle uns für leichtsinnige Spinner hielten. Niemand hätte uns helfen können oder wollen, wenn uns dort oben etwas passierte.«
»Ihr konntet nur auf euch selbst zählen.«
»Ganz genau. Und so gründeten wir den Bergrettungsdienst Dolomiten. Wir hatten weder Geld noch politische Unterstützung und mussten die gesamte Ausrüstung aus eigener Tasche zahlen, doch es funktionierte.« Werner schenkte mir ein seltenes Lächeln. »Stefan kaufte ein Erste-Hilfe-Handbuch. Er arbeitete es durch und brachte uns die wichtigsten Wiederbelebungstechniken bei. Mund-zu-Mund-Beatmung, Herzmassage. Wir lernten, wie man einen Bruch schient und woran man ein Schädel-Hirn-Trauma erkennt. Solche Sachen. Doch das reichte nicht. Die ersten Sommerfrischler, wie man sie damals nannte, trafen ein, ungeübt und schlecht ausgerüstet, und mit ihnen stiegen die Rettungseinsätze. Immer zu Fuß. ’65 legten wir uns ein Einsatzfahrzeug zu, aber das war eine Klapperkiste, die uns nur bis zu einem gewissen Punkt brachte. Danach musste man es wieder auf die gute alte Art machen und die Verletzten huckepack tragen. Und allzu häufig auch die Toten.«
Ich versuchte es mir vorzustellen. Ich schauderte. Doch so schwer es mir fällt, es einzugestehen: Es waren nicht nur Schauder des Entsetzens. Denn meine Idee nahm Form an.
»Wir bargen die Leiche, sprachen ein Gebet, und dann ließ der Älteste in der Gruppe ein Fläschchen Cognac oder Schnaps kreisen, ein Schluck pro Nase, und der Jüngste lud sich den Toten auf den Buckel. Dann kehrte man zur Basisstation zurück, die nichts anderes war als das Wirtshaus in Siebenhoch, der einzige Ort, an dem es ein Telefon gab.«
»Verdammt«, murmelte ich.
»Um es kurz zu machen. Hier in Siebenhoch ist es mit dem Tourismus Anfang der Neunziger losgegangen, als Manfred Kagol die Idee mit dem Besucherzentrum hatte, aber in anderen Tälern hatten sie mit den Touristen bereits alle Hände voll zu tun. Touristen bringen Geld. Und sobald der Rubel rollt, sind, wie du weißt, auch die Politiker nicht fern, und wenn man nicht ganz dämlich ist, kann man die nach seiner Pfeife tanzen lassen.«
Ich hätte nicht in der Haut des Politikers stecken wollen, der Werner Mair dumm kam.
»Und so flossen die Geldmittel. Wir taten uns mit dem Zivilschutz und dem Roten Kreuz zusammen. Ende der Siebziger stellte uns die Armee ihre Hubschrauber für Sondereinsätze zur Verfügung. Mit verblüffendem Ergebnis. Hatten bis dahin drei von sieben einen Unfall überlebt, waren es mit dem Hubschrauber sechs von zehn. Nicht schlecht, oder?«
»Kann man wohl sagen.«
»Aber wir wollten mehr. Erstens«, Werner hob den Daumen, »wollten wir einen Hubschrauber, der uns rund um die Uhr zur Verfügung stand, ohne dass wir uns jedes Mal mit irgendeinem Obersten herumschlagen mussten. Zweitens«, es folgte der Zeigefinger, »wollten wir die Statistik erhöhen. Wir wollten gar keine Toten mehr. Also …«
»Ihr wolltet einen Arzt an Bord.«
»Ganz genau. Der Hubschrauber spart Zeit, der Arzt stabilisiert den Patienten. ’83 bekamen wir unseren ersten Hubschrauber. Eine Alouette, die nichts anderes war als zwei zusammengeschweißte Rohre und ein Rasenmähermotor. Wir verlegten die Basis von hier nach Pontives, unweit von St. Ulrich, weil wir dort einen Hangar und einen Hubschrauberlandeplatz bauen konnten. Der Arzt an Bord kam erst später, als Herta und ich aus Siebenhoch weggezogen waren.«
»Wieso seid ihr weg?«
Werner verzog das Gesicht. »Das Dorf starb aus. Der Tourismus war noch nicht angekommen. Das Besucherzentrum existierte bis dahin nur in Manfreds Kopf … Und ich hatte ein Kind, das ich satt kriegen musste.«
»Du hättest doch als Helfer bleiben können.«
»Hast du den Anfang unserer Unterhaltung schon vergessen?«
»Ähm …«, stammelte ich.
»Familie sollte immer als Erstes kommen, Jeremiah. Als Annelise geboren wurde, war ich zwar noch nicht alt, aber auch kein junger Hüpfer mehr. Herta war zwar zwanzig Jahre jünger und daran gewöhnt, dass ich nächtelang fortblieb, um irgendeinen in Not geratenen Bergsteiger vom Gipfel zu pflücken, aber die Geburt unseres Kindes hatte alles verändert. Ich war Vater geworden, verstehst du?«
Ja, das verstand ich.
»Ein Freund hatte mir eine Stelle in einer Druckerei in Cles unweit von Trient besorgt, und als Annelise wenige Monate alt war, zogen wir um. Erst als sie mit der Schule fertig war, beschlossen wir zurückzukommen. Sie war es, die immer wieder darum bat. Sie liebte dieses Dorf. Hier hatte sie ihre Ferien verbracht, und irgendwie hing sie daran. Der Rest ist, wie man so schön sagt …«
»… Geschichte.«
Werner sah mich lange an.
»Wenn du dir deiner Sache sicher bist, kann ich ein paar Leute anrufen. Den Rest musst du allein schaffen.«
Die Idee.
Ich sah bereits alles vor mir. Schnitt. Voice-over. Alles. Ein Factual wie die Road Crew, aber hier in den Bergen gedreht, mit den Männern der Bergrettung Dolomiten. Ich wusste, Mike würde begeistert sein. Einen Titel hatte ich auch schon: Mountain Angels, und es würde ein Bombenerfolg werden. Ich wusste es.
Ich spürte es.
»Aber ich muss dich warnen. Es wird nicht so sein, wie du es dir vorstellst, Jeremiah.«
Die Stimme der Bestie
1.
Ein paar Tage später sprach ich mit Annelise. Dann rief ich Mike an.
Am 4. April kam Mike nach Siebenhoch. Er trug eine Fellmütze über den Ohren und einen Harry-Potter-Schal um den Hals. Clara rief: »Onkel Mike! Onkel Mike!«, und klatschte in die Hände, wie sie es zum Stolz meines Partners schon als Winzling getan hatte.
Aufgekratzt wie Quarterbacks beim Super Bowl begannen wir am 6. April in Pontives, Grödnertal, dem Sitz der Bergrettung Dolomiten, mit den Dreharbeiten zu Mountain Angels.
2.
Die Basisstation Pontives war ein schlichtes zweistöckiges Gebäude im Grünen. Modern, komfortabel und blitzsauber.
Moses Ploner, der die Leitung der Bergrettung Dolomiten von Werner übernommen hatte, führte uns herum und stellte uns dem Rest des Teams vor. Leute, auf deren Konten geretteter Leben eine Zahl mit mehreren Nullen stand.
Ich gebe offen zu: Wir waren ganz klein mit Hut.
Bis zehn Uhr morgens wurden wir auf die Folter gespannt, dann verwandelte sich das Quaken des Funkgerätes in eine monotone Stimme.
»Little Sister an Bergrettung Dolomiten.«
Little Sister stand für »Leitstelle«.
»Hier Bergrettung Dolomiten, ich höre, Little Sister«, antwortete Moses und beugte sich zum Mikro.
»Wir haben einen Urlauber auf der Ostseite der Seceda, nicht weit von der Margheri-Hütte. Bitte kommen.«
»In Ordnung, Little Sister, Ende.«
Als die Dreharbeiten näher rückten, war in meinem Kopf ein Film losgegangen, in dem Typen mit kantigen Navy-Seal-Visagen zu gellendem Alarm und roten Blinklichtern wie Flipperkugeln hin und her rannten und Sprüche brüllten wie »Los, ihr Memmen, bewegt euren Arsch!«.
Stattdessen: von Aufregung nicht die Spur.
Schon bald sollte ich erfahren, wieso. Das Gebirge ist eines der letzten Fleckchen, wo zwischen Führungsstärke und Autorität noch unterschieden wird.
Doch an jenem 6. April blieb mir keine Zeit, mich darüber zu wundern. Mit (wie mir schien) geradezu quälender Langsamkeit drehte Moses Ploner sich zu Mike um.
»Magst du mitkommen?«
Ganz langsam stand Mike auf. Ganz langsam schulterte er seine Sony-Kamera. Er warf mir einen panischen Blick zu und kletterte in den Ec135, dessen Motorengedröhn um eine Oktave stieg. Ich stellte mich ans Hangartor, wo ich vom Abwind der Rotorblätter zurückgedrückt wurde, und schon war die rote Silhouette des Ec135 verschwunden.
Nach rund einer halben Stunde kehrten sie zurück. Es war ein Routineeinsatz gewesen. Der Helikopter hatte den Unfallort erreicht, der Arzt hatte die Verletzung untersucht (eine Verstauchung), der Pechvogel war an Bord genommen und ins Krankenhaus nach Bozen gebracht worden, und dann hatte sich der Ec135 auf den Rückweg gemacht. So hatte Mike seine Lufttaufe bekommen.
»Wir haben Luftwaffe gespielt, und Mike …« Christoph, der Rettungsarzt, grinste und hielt eine vollgekotzte Plastiktüte hoch, derweil mein leichenblasser Partner Richtung Klo rannte.
Herzlich willkommen bei der Bergrettung Dolomiten.
3.
Die beiden folgenden Monate erscheinen mir rückblickend wie ein Film im Zeitraffer. Vor allem die Gesichter der Verletzten verschwimmen miteinander.
Der Ec135, der bei Sichtweite null startet und das Gefrotzel zwischen Mike und Ismaele, dem Piloten (Ismaele war Moses’ Bruder, Mutter und Vater Ploner waren offenbar Bibelfans): »Hast du nicht gesagt, die Sichtweite muss mindestens zweihundert Meter betragen?« – »Aber das sind doch zweihundert Meter. Sogar dreihundert, wenn ich die Augen zumache.«
Die Angst im Blick eines von Panik gelähmten Jungen. Der Schmerz eines Hirten, dem ein Steinschlag das Bein gebrochen hat. Der halb erfrorene Tourist. Das Pärchen, das sich im Nebel verlaufen hat. Endlos viele gebrochene Knochen, ausgerenkte Hüften, zerschmetterte Gelenke, Blut, Schweiß. Viele Tränen, wenig Dank. Mike, der von dreizehn verschiedenen Mückenarten gestochen wird und nachts nur vier Stunden schläft, ausgelaugt vom Adrenalin. Die Funksprüche, bei denen sich der Magen zusammenzieht. Mein Initiationsritus: eingezwängt in einem Vakuumsack, der Platzangst hilflos ausgeliefert. Mike, der den Kopf schüttelt, um mir zu sagen, besser keine Interviews, ist nicht der richtige Moment. Die Frage nach »Notfallseelsorge«, die einen Tag und Nacht quält.
Und natürlich die Regeln.
Die Männer von der Bergrettung Dolomiten hatten nur einen Propheten (Moses Ploner) und einen feurigen Wagen, um in das Himmelreich zu gelangen (den Ec135), aber mindestens zweihunderttausend mündlich überlieferte Regeln und Gesetze. Man kam kaum hinterher. Sie schossen wie Pilze aus dem Boden.
Die Essensregel ist wohl die schrägste (und verstörendste). Egal, ob sieben Uhr morgens oder vier Uhr nachmittags, kaum setzt man sich zum Essen, ertönt der Alarm und die Mannschaft wird zu einem Einsatz gerufen. Beim ersten Mal hatte ich es für reinen Zufall gehalten. Beim zweiten Mal für einen schlechten Scherz. Nach dem zehnten Mal hatte ich angefangen, Gott und die universelle Entropie verantwortlich zu machen. Nach zwei Monaten Drehzeit fiel es mir gar nicht mehr auf.
Es war so, und basta. Wieso sich den Kopf zerbrechen?
Für mich als Autor, der nicht unmittelbar in die Geschehnisse involviert war (um es mit den unsterblichen Worten von Mike McMellan zu sagen: »Du musst nur checken, wie wir den ganzen Mist zusammenstricken, alles andere macht die Sony«), hatte die Essensregel unverhofft erfreuliche Effekte. Der Alarm summte los, die Mannschaft stieg in den Hangar hinunter, der Helikopter hob ab, und ich konnte mich gemütlich in den Funkersessel setzen und das Eis oder den Nachtisch der anderen aufessen.
Zumindest bis zum 15. September.
4.
Schon seit ein paar Tagen hatte Mike Ermüdungserscheinungen gezeigt. Er war blass und angespannt.
Der erste Einsatz des Tages war glattgegangen. Das Wetter war gut, der Mailänder Tourist hatte nur Bammel gekriegt und den Rettungshubschrauber für eine Art Shuttleservice gehalten, der einen bequem ins Tal zurückbrachte. Der zweite Einsatz war gespuckt wie der erste, nur dass es diesmal nicht zum Weißhorn, sondern zum Langkofel ging.
Als sie wieder zurück waren, schlurfte Mike herein, wechselte den Akku der Kamera (unser oberstes Gesetz) und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Binnen weniger Minuten war er mit der Sony auf der Brust eingeschlafen.
Gegen eins beschloss Moses unter Zustimmung sämtlicher knurrender Mägen, dass es Zeit sei, die Essensregel herauszufordern. Schmorbraten. Erdäpfel. Strudel. Bis zum Strudel sollten wir nie kommen. Ein Jammer, er sah wirklich gut aus.
Wir hatten gerade angefangen, uns die Teller vollzuladen, als der Alarm losging. Mike sprang auf, umklammerte die Kamera und klappte röchelnd wieder auf seinem Stuhl zusammen.
Christoph genügte ein Blick – Paracetamol, heiße Decken, Omas Hühnerbrühe und Gute Nacht.
Mike rappelte sich hoch und schüttelte den Kopf. »Mir geht’s prima, alles easy.«
Er wollte gerade die Kamera schultern, als Moses seinen Arm griff und ihn zurückhielt.
»Du kommst nicht mit. Schick ihn, wenn du willst. Aber du steigst nicht in den Hubschrauber.«
Mit »ihn« war ich gemeint.
Dann drehte er sich um und ging die Treppe hinunter.
Mike und ich wechselten einen Blick.
Ich versuchte souverän zu klingen. »Gib mir die Sony, Partner, und ich sorge dafür, dass du ’nen Oscar kriegst.«
»Oscars gibt’s nur für Kinofilme«, knurrte Mike. »Wir machen Fernsehen, Salinger.« Widerstrebend gab er mir die Kamera. Sie war schwer. »Halt die REC-Taste gedrückt.«
»Amen.«
Christophs Stimme von unten. »Kommst du?«
Ich ging.
Ich war noch nie in den Ec135 gestiegen. Mikes Platz war winzig. Der Ec ist nicht eines von diesen Hollywood-Ungetümen, sondern klein, wendig und leistungsstark. Für Rettungseinsätze in den Dolomiten gibt es nichts Besseres, aber wenn man drehen will, ist er verdammt unbequem.
Als Ismaele Gas gab, rutschte mir der Magen in die Kniekehlen. Nicht nur wegen der Beschleunigung. Nennt es ruhig Schiss. Aus dem Fenster schauen half auch nicht. Ich sah die Basis von Pontives kleiner werden und schluckte ein paarmal, um mich nicht zu übergeben. Manny, der Bergretter neben mir, drückte meine Hand. Sie war so groß wie mein ganzer Unterarm. Eine Gebirglergeste, die bedeutete: Ganz ruhig. Es half.
Keine Angst mehr. Nur der glasklare Himmel.
Gott, war das schön.
Christoph zwinkerte mir zu und bedeutete mir, die Kopfhörer aufzusetzen.
»Wie geht’s, Salinger?«
»Super.«
Ich wollte noch etwas sagen, aber Moses’ Stimme kam mir zuvor.
»Bergrettung Dolomiten an Little Sister«, knarzte er in die Sprechanlage, »habt ihr Informationen für uns?«
Ich fing an zu filmen und hoffte, Mike würde keinen Ausschlag bekommen, wenn er meine Aufnahmen sah. Wenn er es darauf anlegte, konnte er ein richtiger Fiesling sein.
»Hier Little Sister. Es handelt sich um eine deutsche Touristin auf dem Ortler«, kam die Stimme der Notrufzentrale aus dem Funkgerät. »Sie ist auf dreitausendzweihundert Metern in eine Gletscherspalte gestürzt. An der Schückrinne.«
»Verstanden, Little Sister. Wir sind in …«
»Sieben Minuten«, sagte Ismaele.
»… sieben Minuten da. Ende.«
Moses legte das Funkgerät weg und drehte sich zu mir um. Ich hob die Kamera und machte eine schöne Großaufnahme von ihm.
»Kennst du den Ortler?«, fragte er unvermittelt.
»Nur von Fotos.«
Moses nickte nachdenklich. »Das wird ein schöner Einsatz, du wirst sehen.«
Dann wandte er mir den Rücken zu und beachtete mich nicht mehr.
»Was ist die Schückrinne?«, fragte ich Christoph.
»Es gibt verschiedene Aufstiege zum Ortlergipfel«, sagte er grimmig. »Der einfachste ist der Normalweg am Nordgrat, aber man muss fit sein, der hat’s in sich. Aber wer, bitte, geht schon auf einen Gletscher, wenn er keine Ahnung hat?«
»Einmal haben wir da einen Kerl in Flipflops hochgezogen«, schaltete sich Ismaele fröhlich ein.
»Flipflops?«
»Auf dreitausend Metern«, feixte er. »Die Leute sind schräg, oder?«
Ich konnte ihm nur recht geben.
»Die Schückrinne ist der heikelste Aufstieg«, fuhr Christoph fort. »Der Stein ist morsch, manche Steilwände haben ein Gefälle von fünfundfünfzig Grad, und das Eis … Man weiß nie, was für Zicken es macht. Eine tückische Gegend, selbst für erfahrene Cracks. Little Sister hat gesagt, die Touristin ist in eine Gletscherspalte gestürzt, üble Geschichte.«
»Wieso?«
»Weil sie sich ein Bein gebrochen haben könnte. Oder beide. Und vielleicht auch das Becken. Sie könnte sich den Kopf verletzt haben. Und der Grund einer Gletscherspalte ist kein Spaß, da ist Wasser. Es ist …« Christoph suchte nach dem richtigen Vergleich. »Es ist, als wäre man in einem Glas Granita gelandet.«
»Das wird bestimmt lustig«, sagte Ismaele und schenkte der Kamera sein typisches Grinsen, eine Mischung aus ausgesetztem Hundebaby und Rotzlöffel.
Noch eine Regel der Bergrettung. Nichts ist schwierig. Niemals. Denn, wie Moses Ploner so schön sagt: »Schwierig ist nur das, was man nicht hinbekommt.« Mit anderen Worten: Wenn es schwierig ist, bleib zu Hause.
Die deutsche Touristin hätte gut daran getan, sich an Moses’ Regel zu halten, überlegte ich. Dass auch ich gut daran getan hätte, kam mir nicht in den Sinn.
Sieben Minuten später kreiste der Ec135 am weißen Grat des Ortler. Bis zu jenem Tag hatte ich noch nie einen Gletscher gesehen und war begeistert.
Schon bald sollte ich meine Meinung ändern.
Moses öffnete die Schiebetür, und ein eisiger Windstoß erfasste mich.
»Da ist sie.«
Ich versuchte die Kamera auf den Punkt zu halten, auf den der Chef der Bergrettung Dolomiten deutete.
»Siehst du die Gletscherspalte? Dort ist die Touristin.«
Es war mir schleierhaft, wie sich Moses seiner Sache so sicher sein konnte. Dort, wo er hinzeigte, gab es mindestens drei oder vier Gletscherspalten.
Der Ec135 vibrierte wie ein Mixer. Ismaele ging ein paar Hundert Meter hinunter, bis die Sony den Hinweis erfasste, den Moses’ Augen vor meinen erspäht hatten: Fußspuren im Schnee, die abrupt endeten.
Der Ec135 blieb in der Luft stehen.
»Wir können nicht landen, Jungs, unmöglich« sagte Ismaele.
Mir fiel die Kinnlade herunter.
Ismaele war kein Pilot. Er war der Schutzheilige aller Hubschrauberpiloten. In Mikes Aufnahmen hatte ich ihn auf Bergspitzen landen sehen (er nannte es »parken«), die kaum größer waren als ein Apfel, er war auf Luftströmungen gesurft, die selbst den Roten Baron zum Absturz gebracht hätten, und hatte den Ec135 so dicht an Felswände heranmanövriert, dass man fürchten musste, die Rotorblätter würden gleich abrasiert. Und immer mit dieser verschmitzten Lässigkeit. Dieser Ismaele war jetzt besorgt.
»Manny? Geh mit der Winde runter. Du sammelst sie ein und bringst sie gleich hoch. Ich setze niemanden ab. Es ist zu beschissen warm. Und dieser Wind …«
Ich begriff nichts. Wir waren doch auf einem Gletscher, oder? Eis ist kalt, oder irre ich mich? Was zum Teufel sollte das heißen, »zu beschissen warm«? Und was hatte der Wind damit zu tun?
Es war nicht der richtige Moment, um Fragen zu stellen. Manny sicherte sich bereits an der Winde.
Ich sah ihn an, und mein Herz pumpte plötzlich Adrenalin. Während der Ec135 zwischen zwei Gebirgskämmen über der Eiskluft schwebte, kamen die Worte aus meinem Mund, die mein Leben ändern sollten. »Kann ich mit dir runter?«
Manny, der schon auf der Kufe stand, die Winde fest in der lederbehandschuhten Rechten, warf Moses einen Blick zu.
»Was?«
»Kann ich mit Manny runter? Ich zeichne alles auf.«
»Wir können nicht drei raufziehen. Zu windig«, sagte Ismaele. »Und außerdem ist die Temperatur …«
Scheiß auf die Temperatur. Scheiß auf alles. Ich wollte runter.
»Ich kann unten bleiben. Manny zieht die Touristin hoch, und dann holt er mich.« Ganz einfach, oder?
Moses zögerte. Manny grinste. »Also, ich glaube, das ist machbar.«
Moses musterte mich. »Okay«, sagte er widerwillig. »Aber beeilt euch.«
Ich verließ meinen Platz (es war nicht mehr Mikes Platz, sondern meiner), Christoph reichte mir einen Klettergurt, ich zog ihn an und machte mich an Manny fest. Wir lehnten uns aus der Luke, die Füße auf der Kufe des Ec135. Christoph zeigte mir den hochgereckten Daumen. Manny gab mir einen Klaps auf den Helm.
Drei, zwei, eins.
Die Leere verschluckte uns.
Ich hatte Angst. Ich hatte keine Angst. Ich hatte Panik. Ich hatte keine Panik.
Noch nie hatte ich mich so lebendig gefühlt.
»Zehn Meter …«, hörte ich Manny rufen.
Ich sah nach unten.
In der Kluft war es zu dunkel, um etwas zu sehen. Ich hielt die Kamera drauf und drehte weiter.
»Ein Meter.« Manny stützte sich am Gletschersaum ab. »Stopp.«
Die Seilwinde blieb stehen.
Manny schaltete seine Helmlampe ein. Der Lichtbalken durchschnitt die Finsternis. Wir sahen die Frau sofort. Sie trug eine neonorangefarbene Jacke. Sie lehnte an der Eiswand und hob die Hand.
»Dreißig Meter, Moses«, sagte Manny. »Ganz langsam runter.«
Die Seilwinde fing wieder an zu surren.
Die schillernde Oberfläche des Ortler verschwand, und ich sah nichts mehr, während Manny die Abfahrt kontrollierte. Immer wieder musste ich blinzeln, um mich an die Dunkelheit zu gewöhnen.
»Fünf Meter«, sagte Manny. »Drei.«
Ein eigentümliches Leuchten herrschte dort unten. Das sich flimmernd in zahllosen Halos und Funken brechende Sonnenlicht erschwerte die Sicht.
Auf dem Grund der zweieinhalb Meter breiten Spalte stand Wasser. Eisbrocken dümpelten darauf, genau wie Christoph es gesagt hatte: als säße man in einem Glas Granita.
»Stopp.«
Manny hakte erst sich und dann mich vom Gurt.
Ich stand bis zu den Knien im Eiswasser.
»Sind Sie allein, Signora?«
Die Frau schien die Frage nicht zu verstehen. »Bein.«
Sie nuschelte.
»Sie steht unter Schock«, konstatierte Manny. »Tritt so weit wie möglich zurück. Beeilen wir uns.«
Ich drückte mich mit dem Rücken gegen die Gletscherwand. Mein Atem kondensierte zu kleinen Wölkchen. Hoffentlich sah man das auf den Aufnahmen nicht.
Die Touristin sah erst Manny und dann ihr Bein an. »Tut weh.«
»Sehen Sie den Hubschrauber? Dort ist ein Arzt, der wird Ihnen eine ordentliche Dosis Schmerzmittel geben.«
Die Frau schüttelte wimmernd den Kopf.
Manny hakte sich an die Winde, spannte das Seil und befestigte es am Klettergurt der Frau.
»Winde, Moses.«
Die beiden wurden hochgezogen.
Die Frau schrie aus Leibeskräften. Am liebsten hätte ich mir die Ohren zugehalten, aber dann wäre die Kamera in der Eispampe gelandet, und Mike hätte mich umgebracht. Langsam und qualvoll.
Die Winde funktionierte wie aus dem Lehrbuch. Das straff gespannte Seil sah aus wie mit schwarzer Tusche gezogen.
Ich sah, wie Manny und die Frau immer weiter emporschwebten und schließlich aus der Kluft verschwanden.
Ich war allein.
5.
Was zeigen die Bilder der Sony ab diesem Moment?
Die Wände der Gletscherspalte. Schillernde Schattierungen, die in das schwärzeste Schwarz übergehen. Der Lichtstrahl der Kamera, der sich hin und her bewegt, manchmal langsam, manchmal hektisch. Funkelnde Eisklumpen, die im Tümpel um meine Beine schwimmen. Der Widerschein meines Gesichts auf dem Eis. Zuerst lächelnd, dann angestrengt lauschend, schließlich verzerrt, mit dem panischen Blick eines gefangenen Tiers, die vor Kälte blauen Lippen zu einem Grinsen gefletscht, dass ich noch nie an mir gesehen hatte. Eine mittelalterliche Totenmaske.
Und über allem: die Stimme des Ortler. Das Knistern des Eises. Das Flüstern der Ortler-Masse, die sich bewegte wie seit zweihunderttausend Jahren.
Die Stimme der Bestie.
Manny, der besorgt herunterschwebt. Mein mehrfach gerufener Name.
Der Schrei Gottes, der Manny verschluckt.
Das Verrinnen der Sekunden. Die grauenerregende Erkenntnis, dass die Zeit des Eises keine menschliche ist. Sondern eine andersartige, feindliche Zeit.
Und die Dunkelheit.
Ich versank in der Finsternis, die die Welten verschluckt. Haltlos trieb ich in den Tiefen des Raums. Eine einzige, riesige, endlose, gespenstisch weiße Nacht.
Und dann die Rettung.
Zu warm, hatte Moses gesagt. Zu warm bedeutete: Lawine. Der Schrei Gottes. Und die Lawine hatte sich Manny geholt. Und mit Manny, der am Seil der Winde hing, hatte sich die Bestie den Ec135 gekrallt, ihn zu Boden gezogen und zerschmettert wie ein lästiges Insekt.
Wieso hatte Moses das Seil nicht gekappt? Diese Frage stellten sich Carabinieri und Journalisten gleichermaßen. Nicht aber die Helfer, die mich retteten. Sie wussten es. Es steht alles in den Regeln.
Das Seil der Winde wird nicht gekappt, weil man in den Bergen niemanden zurücklässt. Niemals. So ist es, und so muss es sein.
Von Moses, Ismaele, Manny, Christoph und der Touristin blieb nichts. Die Wucht der Lawine, die sich wegen der Wärme und des Windes gelöst hatte, hatte sie fortgerissen und ihre Körper zermalmt. Der Ec135 lag als rotes Gerippe im Tal.
Doch der Unfall auf dem Ortler bedeutete nicht das Ende der Bergrettung Dolomiten und auch nicht das Ende meiner Geschichte.
Wie gesagt: Es war erst der Anfang.
Vor zweihundertachtzig Millionen Jahren
1.
Mein Körper erholte sich schnell. Nicht einmal eine Woche lag ich im Krankenhaus. Ein paar kleine Nähte, ein paar Infusionen wegen der Hypothermie, und das war’s. Die schlimmsten Verletzungen trug ich in mir. »PTBS« stand in meiner Krankenakte. Posttraumatische Belastungsstörung.
Ehe mich der Arzt des Bozener San-Maurizio-Krankenhauses mit einem Händedruck und einem »Passen Sie gut auf sich auf« entließ, verschrieb er mir Psychopharmaka und Schlafmittel und riet mir eindringlich, sie regelmäßig zu nehmen. Es sei wahrscheinlich, hatte er hinzugefügt und mich dabei streng angesehen, dass ich in nächster Zeit von Albträumen und leichten, von plötzlichen Flashbacks begleiteten Panikattacken heimgesucht würde, genau wie Kriegsveteranen.
»Leichte« Panikattacken?
Es gab Augenblicke, in denen die Stimme der Bestie (es waren auditive Flashbacks, Gott sei Dank litt ich nie an Halluzinationen) so heftig in meinem Kopf dröhnte, dass ich meine Hände gegen die Schläfen presste und schluchzend wie ein Kind zusammenbrach. Dennoch hatte ich mir geschworen, dass ich es ohne Psychopharmaka schaffen und die Schlafmittel nur im äußersten Notfall nehmen würde. Jeder Laienpsychologe hätte sofort gewusst, was dahintersteckte. Ich wollte leiden. Und ich wollte es, weil ich es musste. Denn ich hatte die schwerste Schuld überhaupt auf mich geladen.
Ich hatte überlebt.
Dafür musste ich bestraft werden.
Erst später begriff ich, dass ich nicht nur mich selbst bestrafte. Annelise war in wenigen Tagen um Jahre gealtert und weinte, während ich benommen durch die Wohnung schlich. Clara hockte stundenlang in ihrem Kinderzimmer und vergrub sich in ihre Bilderbücher. Sie aß wenig und hatte Augenringe, wie sie kein Kind haben sollte.
Annelise und Werner taten alles, um mir zu helfen. Aber ich hockte nur apathisch in meinem Lieblingssessel und sah zu, wie die Bäume sich rot färbten und der Himmel seine für diese Gegend typische Herbsttönung annahm, ein schimmerndes Farbenspiel aus Blau und Violett. Wenn es Abend wurde, stand ich auf und ging ins Bett. Ich aß nicht, trank nicht und zwang mich, nicht nachzudenken. Die winzigste Kleinigkeit ließ mich zusammenfahren. Noch immer hörte ich dieses Geräusch. Dieses verdammte Zischen. Die Stimme der Bestie.
Die Nächte waren noch unerträglicher als die Tage. Ich wachte brüllend auf, in der festen Überzeugung, dass das, was nach dem 15. September passiert war, ein Irrtum sein musste. Als hätte sich die Welt in zwei Hälften geteilt. Die falsche Hälfte, die ich Welt A nannte, hatte sich einfach weitergedreht, als wäre nichts geschehen, derweil die richtige Hälfte namens Welt B am 15. September um 14 Uhr 22 mit dem Nachruf auf Jeremiah Salinger zu Ende gegangen war.
Ich weiß noch, wie Mike mich besuchen kam. Blass, mit rot geränderten Augen. Er erklärte mir, was er vorhatte, und wir redeten darüber. Der Sender hatte Mountain Angels gestrichen, aber wir konnten unser Material für eine Doku über die Bergrettung Dolomiten und das, was in der Gletscherspalte am Ortler passiert war, verwenden. Mike hatte auch schon einen Titel im Sinn: Im Bauch der Bestie. Grenzwertig, aber treffend. Ich gab ihm mein Okay, dann brachte ich ihn an die Tür und verabschiedete ihn mit einem Lebewohl.
Mike hielt das für einen Witz, doch da irrte er sich. Ich meinte es ernst. Dies sollte das letzte Mal sein, dass Batman und Robin sich trafen. Ich hing in einer höllischen Endlosschleife, und so, wie ich es sah, gab es nur zwei Möglichkeiten, da rauszukommen: Explodieren oder mich von irgendeinem Felsen stürzen. Explodieren bedeutete, Annelise und Clara wehzutun. Undenkbar. Mir Trottel erschien die zweite Möglichkeit weniger schmerzhaft. Sogar das Wo, Wie und Wann malte ich mir aus.
Ergo: Lebewohl, Partner.
Dann, Mitte Oktober, kam Clara zu mir.
2.
Ich hing im Sessel, ein Glas lauwarm gewordenes Wasser in der rechten Hand, die Linke um eine leere Zigarettenschachtel geklammert, und starrte ins Unendliche. Clara setzte sich auf mein Knie, ein Buch vor die Brust gedrückt, wie sie es immer tat, wenn ich ihr etwas vorlesen sollte. Es dauerte einen Moment, bis ich ihr kleines Gesicht in den Fokus bekam.
»Hallo, Süße.«
»Hallo, Vier Buchstaben.«
Das war Claras Lieblingsspiel, das Zahlen-und-Buchstaben-Spiel.
Ich zwang mich zu einem Lächeln.
»Betonung auf dem zweiten Buchstaben?«
»Ganz genau.«
»P-a-p-a«, sagte ich und wunderte mich, wie fremd diese Anrede noch immer klang. »Was hast du da?«
»Zehn Buchstaben.«
»Bilderbuch?«
Clara schüttelte den Kopf, und ihr Haar verwandelte sich in eine blonde Wolke. Der Duft ihres Shampoos stieg mir in die Nase, und etwas rührte sich in meiner Brust. Eine Ahnung von Wärme. Wie ein Feuer, das man während eines Schneesturms in der Ferne sieht.
»Falsch«, antwortete sie entschieden.
»Bist du sicher, dass es kein Bilderbuch ist?«
»Es ist ein ›W-a-n-d-e-r-b-u-c-h‹.«
Ich zählte an den Fingern ab. Zehn Buchstaben. Sie hatte nicht geschummelt. Mein Lächeln kam fast wie von selbst.
Clara legte den Finger an die Lippen, eine Geste, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte. »Auf dem Thermometer steht siebzehn Grad. Siebzehn Grad um diese Uhrzeit ist nicht kalt, oder, Vier Buchstaben mit Betonung auf dem zweiten?«
»Nein, ist es nicht.«
»Mama hat gesagt, du hast dir am Kopf wehgetan. Im Kopf«, verbesserte sie sich. »Deshalb bist du immer so traurig. Aber an den Beinen hast du dir nicht wehgetan, oder?«
So einfach war’s. Papa hatte sich im Kopf wehgetan, und deshalb war er traurig geworden.
Ich ließ sie auf meinen Knien reiten. Schon bald würde sie diese Scherzchen langweilig und in wenigen Jahren sogar peinlich finden. Die Zeit flog, meine Tochter wurde größer, und ich verplemperte die Tage damit, den Blättern beim Fallen zuzusehen.
»Da hast du wohl recht, Sieben Buchstaben.«
Clara runzelte die Stirn und zählte konzentriert ihre Finger.
»›Süße‹ hat vier.«
»›Tochter‹ hat sieben. Ein Punkt für mich, Tochter.«
Clara warf mir einen finsteren Blick zu (sie hasste es, zu verlieren), dann schlug sie den Wanderführer auf. Zwischen manche Seiten hatte sie reizende kleine Lesezeichen gesteckt.
»Mama schmiert uns Brote, wir nehmen Wasser mit, aber nicht zu viel, weil ich im Wald nicht gern Pipi mache«, erklärte sie flüsternd. »Ich fürchte mich vor den Spinnen.«
»Spinnen«, sagte ich mit vor Rührung erstickter Stimme. »Bääh.«
»Genau, bääh. Wir gehen hier los«, sie zeigte auf die Karte. »Und hier biegen wir ab, siehst du? Da, wo der kleine See ist. Vielleicht ist schon Eis drauf.«
»Vielleicht …«
»Sehen wir dann eingefrorene Fische?«
»Kann sein.«
»Und dann gehen wir zurück nach Hause. Dann kannst du wieder die Wiese anschauen. Ist die Wiese denn so interessant, Papa?«
Ich nahm sie in die Arme. Ganz fest.
3.
Und so begannen wir mit unseren Wanderungen. Jeden Abend kletterte Clara mit dem Wanderführer in der Hand auf meine Knie, und wir planten einen Ausflug.
Der Herbst war angenehm warm, und diese Wanderungen, aber vor allem Claras Gesellschaft und ihr endloses Geplapper, unter dem sie mich begrub, waren wirkungsvoller als jedes Psychopharmakon.
Ich hatte noch Albträume, und manchmal vernahm ich das lähmende Zischen, doch immer seltener und in größer werdenden Abständen. Ich schaffte es sogar, Antwortmails an Mike zu schreiben, der nach New York zurückgekehrt war, um Im Bauch der Bestie zu schneiden. Obwohl ich mich weigerte, mir auch nur einen Ausschnitt davon anzusehen, tat es gut, ihm ein paar Ratschläge zu geben. Ich fühlte mich wieder lebendig. Ich wollte gesund werden. Die Welt B, in der ich tot war, hatte mich nicht mehr in ihrem Bann. Sie war nicht wirklich. Ob ich wollte oder nicht, ich hatte überlebt.
Es hatte ein fünfjähriges Mädchen gebraucht, um mich das begreifen zu lassen.
4.
Es war schon fast Ende Oktober, als Clara sich auf meinen Schoß setzte und mich, statt mir den Wanderführer zu zeigen, mit großen, ernsten Augen ansah.
»Ich will jemanden besuchen gehen.«
»Soso. Und wer soll das sein?«
»Ein Freund.«
»Ein Freund?«
»Er heißt Yodi.«
»Was ist das denn für ein Name?«, fragte ich ratlos.
»Yodi ist sehr lieb. Und sehr alt.« Sie senkte die Stimme. »Aber sag ihm das nicht. Yodi ist wie Opa, er mag das Wort nicht.«
»Drei sehr heikle Buchstaben.«
»Was bedeutet ›heikel‹?«
Annelise antwortete. »›Heikel‹ bedeutet, dass es ein bisschen verletzend sein kann. Auf Deutsch sagt man auch empfindlich, auf Englisch …«
»Sensitive«, vervollständigte ich den Satz.
Nach einer langen Pause sagte Clara: »Neun. Neun Buchstaben, Papa.«
»Beeindruckend. Aber du hast gerade von Yodi geredet.«
»Wenn du willst, zeige ich ihn dir.«
»Hast du ein Foto?«
Ohne zu antworten flitzte Clara in ihr Zimmer und war so schnell wieder zurück, dass Annelise und ich uns nur einen verdutzten Blick zuwerfen konnten.
»Das ist Yodi. Ist er nicht süß?«, fragte Clara und hielt mir ein Buch hin.
Yodi war ein Fossil. Ein Ammonit, um genau zu sein.
»Gehen wir ihn besuchen, Papa?«
»Sehr gern, wer weiß, wie viel er in seinen …«, ich las die Bildunterschrift, »zweihundertachtzig Millionen Jahren gesehen hat. Aber wo genau ist denn unser neuer Freund?«
»Ich weiß es«, sagte Annelise belustigt. »Am Bletterbach.«
»Und was, zum Teufel, ist bitte der Bletterbach?«
Annelise und Clara glotzten mich an, als wäre das die dämlichste Frage der Welt. Der Bletterbach war überall um uns herum, er war die Touristenattraktion, die Geld in die umliegenden Gemeinden pumpte. Nicht nur nach Siebenhoch, das am meisten von diesem Geldfluss profitierte, weil es gleich neben dem Besucherzentrum lag, sondern auch in die Dörfer Aldein, Salurn, Cembra und Cavalese, Auer, Deutschnofen, Welschnofen und in zahllose andere winzige Flecken und Kirchdörfer (Hittlen und Kirchln im Dialekt).
Die Gegend um Siebenhoch, rund sechstausend Hektar voller Wälder und Felsen, gehörte zum Naturpark Trudner Horn. Inmitten des Parks unterhalb des Trudner Horns, genauer gesagt des Weißhorns, einem über zweitausend Meter hohen Gipfel, befand sich eine acht Kilometer lange und über vierhundert Meter tiefe Kluft. Dort fließt der Wasserlauf, dem sie ihren Namen verdankt: der Bletterbach.
Der Fels dieser Gegend und der gesamten Dolomiten besteht aus einem seltsamen Kalkstein-Magnesium-Gemisch, ein mürber Stein, in den der Bach einen Canyon geschnitten und dabei tonnenweise Fossilien zutage befördert hat: Muscheln, Ammoniten (wie Yodi) und Reste von Fauna und Flora, bei denen man vor Staunen Gänsehaut kriegt und einem die Kinnlade herunterfällt.
Die Bletterbach-Schlucht ist eine 3-D-Doku, die vor zweihundertachtzig Millionen Jahren beginnt, in einem Zeitalter namens Perm, und bis in die Trias hundert Millionen Jahre später reicht: vom großen Sterben der Meeresbewohner und Amphibien bis zur Ära der großen Saurier. Ein prähistorischer Zoo, zu dem ich mit Clara, die mit blonden Zöpfchen und pastellfarbenen Wanderschuhen auf dem Beifahrersitz saß, an jenem frühen Oktobernachmittag in dem guten Glauben aufbrach, dass die Dinge allmählich wieder auf die Schiene kamen.
5.
Wir wurden von einer jungen Frau empfangen, der ich in Siebenhoch schon ein paarmal über den Weg gelaufen war, doch an deren Namen ich mich beim besten Willen nicht erinnern konnte. Sie fragte mich, ob ich mich von meinem Unfall erholt hätte. Zu meiner Erleichterung beließ sie es dabei.





























