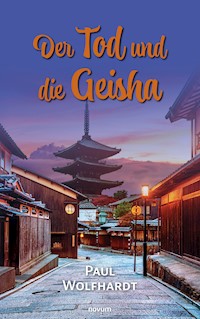
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein österreichischer Student in Tokyo, der seiner großen Leidenschaft nachgeht: Karate. Nachdem er den obligatorischen Kulturschock überwunden hat, bleibt er länger als geplant in Japan – und verfällt einer noch größeren Leidenschaft: Yuka. Sie arbeitet allabendlich im "Bourbon", der Bar von Mama-san. Doch für die Gäste heißt sie dort Mary. Ist sie tiefer ins horizontale Gewerbe verstrickt, als sie zugibt? Und ist die Bedrohung durch die Yakuza, die berüchtigte japanische Mafia, wirklich so groß, oder machen ihm die beiden Frauen nur etwas vor, um ihn als Guardman für die Bar zu gewinnen? Ein Stoff zu einem hintergründigen Roman, der von Haruki Murakami stammen könnte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum 2
I 3
II 47
III 102
IV 125
V 157
VI 192
VII 210
VIII 228
IX 280
X 349
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2022 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99131-633-6
ISBN e-book: 978-3-99131-634-3
Lektorat: Volker Wieckhorst
Umschlagfoto: Tawatchai Prakobkit | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
I
Als ich die Augen aufschlug, fühlte ich mich wie genesen nach lang andauernder Krankheit. Schwach und matt, verspürte ich keinen Schmerz, nur eine gewisse Schwere steckte mir in den Gliedern.
Ich lag in meinem Zimmer. Auf den ersten Blick alles wie sonst, und doch kam mir alles so anders, so ungewohnt vor. Gerade so, als erwachte ich zum ersten Mal seit Langem wieder in meinem Bett.
Ich versuchte, mich zu besinnen, doch erinnerte ich mich an nichts. Ich wusste nichts von gestern oder vorgestern. Auch mein Zeitgefühl ließ mich im Stich, und der Wecker auf meinem Nachtkästchen war stehen geblieben.
Morgenlicht fiel durchs Fenster. Es war wohl zwischen neun und zehn. Ich richtete mich auf, um nach draußen zu sehen. Da erfasste mich ein Schwindelgefühl, mir wurde schwarz vor Augen, und ich musste mich wieder hinlegen.
Nach einer Weile hatte ich mich so weit erholt, dass ich die Augenlider öffnen konnte. Es wunderte mich, dass am Nachtkästchen so viel Staub lag. Und wie kam der Schlüsselbund hierher? Was war das für ein Anhänger? Gehörte der überhaupt mir?
Es gab nichts, keinen Anhaltspunkt, der mir auf die Sprünge geholfen hätte. Ich hatte keine Ahnung, was mit mir geschehen war, nur das dumpfe Gefühl, mit knapper Not einer Gefahr entronnen zu sein. Und nun gähnte mich das Vergangene an wie ein schwarzer Schlund, in dem alles begraben war, was hinter mir lag.
Nicht, dass ich mich an gar nichts mehr erinnert hätte. Es war mir durchaus noch präsent, wie ich zu Beginn meines Studiums hier eingezogen war. Mein Gedächtnis war daher nicht völlig ausgelöscht, es fehlte mir nur der Zugang zum letzten Lebensabschnitt.
Wenn ich die Augen schloss, tauchten nebelhafte Bilder auf. Doch kaum versuchte ich, sie ans Licht zu ziehen, zerflossen sie ins Nichts. Stammten sie aus Fieberträumen oder aus meiner verlorenen Vergangenheit? Sie schienen wie dunkle Schatten aus einer fernen Welt, in der mir alles fremd war, und weckten dumpfe Assoziationen. Doch keine war konkret genug, um sich zu einer klaren Erinnerung zu manifestieren.
Nach einer Weile bekam ich Lust auf ein Frühstück. Also stand ich auf. Alles in der Küche war an seinem Platz, als ob ich nie weg gewesen wäre, nur fand ich keine Lebensmittel. Der Kühlschrank war leer und auch das Stromkabel ausgesteckt, als wäre er schon seit Langem nicht mehr in Betrieb.
Es blieb mir nichts anderes übrig, als mich anzuziehen und hinunter auf die Straße zu gehen. Gleich um die Ecke gab es einen Supermarkt, wo ich mir etwas besorgen konnte. Wieder daheim, machte ich mir Kaffee und aß dazu Croissants.
Da ich immer noch Hunger hatte, fing ich nach einer Weile an, mir Spaghetti zu kochen. Die waren zwar erst für Mittag gedacht, aber auf der Uhr im Supermarkt war es schon kurz vor elf gewesen, also wurde es langsam Zeit. Erst nachdem ich gegessen und getrunken hatte, fühlte ich mich halbwegs satt.
Danach wurde ich schläfrig, es überfiel mich eine lähmende Müdigkeit, sodass ich kaum die Augen offenhalten konnte. Mir war nicht klar, woran das lag. Ich war doch erst vor Kurzem aufgestanden. Aber da ich ohnehin nicht wusste, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte, ging ich ins Schlafzimmer und legte mich hin.
Eigentlich hatte ich nur ein kurzes Mittagsschläfchen halten wollen, doch erwachte ich erst wieder am nächsten Morgen. Es war sehr früh, kurz nach fünf. Ich hatte vor dem Einschlafen meinen Wecker wieder aktiviert und die richtige Uhrzeit eingestellt. Demnach musste ich rund sechzehn Stunden durchgeschlafen haben. Ich hatte keine Erklärung, was mit mir los war, aber im selben Rhythmus ging es weiter, ein Tag wie der andere.
Früher war ich ein notorischer Langschläfer gewesen, jetzt wachte ich immer sehr zeitig auf und wurde dafür schon am Nachmittag müde. Ich fühlte mich nicht schlecht, im Gegenteil, es ging mir gut. Aber ich kam mir vor, als existierte ich nur wie mechanisch, essen, trinken, schlafen. Geistig beschäftigte mich nichts.
Sobald ich mich niederlegte, sank ich in tiefen traumlosen Schlaf. Erst im Halbschlaf kurz vor dem Aufwachen zeigten sich ab und zu Traumbilder. Meist schemenhafte Landschaften, einmal am Meer, ein anderes Mal in den Bergen. Die Gegenden waren immer menschenleer, aber sie kamen mir so bekannt vor, als hätte ich sie schon mal gesehen, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wo das gewesen sein könnte.
Besonders eins der Traumbilder, das mir eine felsige Flusslandschaft zeigte, ging mir nicht aus dem Sinn und beschäftigte mich tagelang. Es weckte Emotionen in mir, die ich mir nicht erklären konnte. Die Gegend wirkte wie tot und ausgestorben, es floss kein Wasser, nur große, weiße Kiesel lagen im trockenen Flussbett. Dennoch war mir im Traum, als wäre von fern her ein Rauschen zu hören, und ich verband damit die Hoffnung auf eine Belebung der Landschaft, doch kein Wasser kam. Ich erwachte in einer schwermütigen Stimmung und wünschte mir, tot zu sein.
Und noch etwas anderes war seltsam. Manchmal kannte ich mich morgens im Spiegel selbst kaum wieder. Es war zwar nicht so, dass mir ein völlig fremdes Gesicht entgegenstarrte, aber irgendwie fühlte ich mich nicht als der, den mir das Spiegelbild zeigte. Ich begann mich zu fragen, wer ich denn eigentlich war, ohne darauf eine Antwort zu finden.
***
Es tauchten auch noch andere Bilder im Halbschlaf auf. Albtraumhafte Szenen, die sich in verschiedenen Variationen wiederholten. Einmal steckte ich in einem Behältnis fest, das ich für eine Raumkapsel hielt. Es umgab mich ein bläuliches Licht, und ein klaustrophobisches Gefühl umfing mich. Ich war in der Röhre von allen Seiten so eingezwängt, dass ich nicht wusste, ob ich stand oder lag. Dann begann ein Dröhnen und Vibrieren, das Ding geriet in Bewegung. Erst schien es mir, als stiege die Kapsel wie eine Rakete in die Höhe. Kurz darauf wurde mir aber bewusst, dass es nach unten ging. Ich spürte einen Druck in den Ohren, dann auch in den Schläfen. Und beim Fall ins Bodenlose wuchs meine Angst vor einem Aufprall, bis ich atemlos und schweißgebadet erwachte.
In einer ähnlichen Traumszene befand ich mich in einem dunklen Zimmer. Ich blickte von hoch oben aus einem Fenster in die Tiefe. Es war Nacht, und unten leuchteten unzählige Lichter. Eine riesige Stadt lag mir zu Füßen, aber ich war kein Teil von ihr. Alles ging in den Straßen seinen Gang ohne mich. Daraufhin war es, als zöge sich der Raum zusammen. Die Wände rückten von allen Seiten näher, und am Ende stand ich mit dem Gesicht gegen das Fenster gepresst und fühlte mich wieder wie in ein Behältnis eingeschlossen. Diesmal ging es aber von Anfang an senkrecht nach unten, als hätte jemand in einer Aufzugskabine den Abwärtsknopf gedrückt. Und je schneller es in die Tiefe ging, desto unbehaglicher wurde mir zumute. Es hob mir den Magen aus, und ein Schwindel ergriff mich, denn die Lichter der Stadt kamen immer näher. Ich schloss die Augen, doch das grelle Licht stach mir durch die Lider. Wieder erwartete ich einen Aufprall, der nicht kam, stattdessen erwachte ich.
Wenn ich aus solchen Träumen hochschreckte, brauchte ich immer eine Weile, bis ich mich in der Realität wieder zurechtfand. Auch wenn ich wusste, dass ich bei mir daheim im Bett lag, war mir immer, als wäre ich in dem Moment aus einer fernen Welt zurückgekehrt. Ich hatte dann den Eindruck, als stünde das Tor zur Vergangenheit einen Spalt weit offen, und ich bräuchte es nur aufzudrücken. Doch so sehr ich mich auch mühte, es gelang mir nicht, die dunklen Erinnerungen festzuhalten, sie verloren sich wieder, und alles verschwamm mir vor Augen.
***
Ich kannte das Mietshaus, in dem ich wohnte. Der Geruch im Stiegenhaus war mir ebenso vertraut wie das Knirschen der Haustür. Doch war ich wohl lange weg gewesen, denn zur Vertrautheit gesellte sich ein Gefühl, als wäre nicht alles wie früher. Von den Nachbarn kannte ich die meisten Gesichter, doch einige kamen mir fremd vor. Wenn mich wer grüßte, erwiderte ich den Gruß, doch als mich einmal ein älterer Mann ansprach und fragte: „Na, wieder im Lande? Wo waren Sie denn so lange?“, fiel meine Antwort schmallippig aus. Was sollte ich erwidern? Dass ich es nicht wusste? Das wäre nicht nur unglaubwürdig gewesen, er hätte auch meinen können, ich machte mich lustig über ihn. Oder schlimmer noch, wenn er dächte, ich hätte nicht alle Tassen im Schrank. Daher wich ich ihm in den folgenden Tagen aus. Besser für einen Sonderling als für verrückt gehalten zu werden.
Abgesehen von solchen Ereignissen wunderte es mich selbst, wie problemlos ich den Alltag meisterte. Ich fand mich überall zurecht, als wäre ich dieses Leben seit Jahren gewohnt. Die äußere Sicherheit gab mir auch Halt in meiner inneren Verunsicherung. Solange ich den vertrauten Kreis nicht verließ, fühlte ich mich sicher und geborgen. Wagte ich mich jedoch nur ein Stück über die selbst gesteckten Grenzen hinaus, fürchtete ich, die Orientierung zu verlieren und nie mehr zurückzufinden.
Auch die Gedankenwelt, in der ich mich bewegte, überstieg den engen Radius nicht. Jeder Versuch, in unbekanntes Terrain vorzustoßen, schien in vermintes Gelände zu führen. Mir war, als genügte ein einziger falscher Schritt, und ich verlöre den Boden unter den Füßen. Die diffuse Angst, die mich daran hinderte, meiner Vergangenheit nachzuforschen, rührte wohl daher, dass ich fürchtete, unliebsame Wahrheiten zu erfahren. Es war bequemer, alles in der Schwebe zu lassen, auch wenn es bedeutete, gefangen in einem Niemandsland ohne Vergangenheit und Zukunft leben zu müssen.
Eines Tages entdeckte ich einen Pass in einer Lade meines Nachtkästchens. Das Foto und alle anderen Angaben passten auf mich. Es schien sich unzweifelhaft um meinen Pass zu handeln. Ich war sogar froh, damit ein Dokument zu haben, das mir eine offizielle Identität gab. Doch beim Foto erging es mir wie beim Blick in den Spiegel. Trotz aller Ähnlichkeit fiel es mir schwer zu glauben, dass ich das sein sollte, auch der Name sagte mir nichts. Vielleicht war der Pass gefälscht. Ich unternahm allerdings nichts, um eine Antwort darauf zu finden.
Oder ein anderes Beispiel: Es gab ein Telefon im Vorzimmer. Erst merkte ich gar nicht, dass der Apparat einen regulären Anschluss hatte, bis mich eines Abends, als ich schon im Bett lag, ein Läuten hochschrecken ließ. Am nächsten Morgen läutete es wieder, doch die ersten Male ging ich nicht ran. Nur als ich zufällig einmal neben dem Telefon stand, als wieder ein Anruf kam, hob ich aus Neugier ab. Eine Frau war dran, die Englisch mit fremdem Akzent sprach und sich als Yuko vorstellte. „Welche Yuko?“, fragte ich. Sie sprach mich mit demselben Namen an, der im Pass stand. Trotzdem erwiderte ich: „Sorry, wrong number!“ Ich hörte sie noch sagen: „I’m sure it’s you, I know your voice“, da legte ich auf. Die Bemerkung hatte mich getroffen, ich fühlte mich wie ertappt. Ich bereute aber auch aus einem anderen Grund, die Verbindung vorschnell unterbrochen zu haben. Wenn sie mich kannte, hätte ich vielleicht von ihr all das in Erfahrung bringen können, was mir in den letzten Tagen Rätsel aufgab. Aber wollte ich das wirklich wissen?
Ich zermarterte mir das Hirn, wer die Anruferin gewesen sein könnte. Ich überlegte mir auch, wie ich reagieren sollte, falls sie nochmals anriefe. Doch sie meldete sich nicht wieder, diese Chance war vertan. Trotzdem ging mir der Anruf nicht mehr aus dem Sinn. Es tauchten nämlich in dem Zusammenhang all die Fragen, die ich mir zuletzt aus verschiedensten Anlässen gestellt hatte, wieder auf, und diesmal gelang es mir nicht mehr, sie zu verdrängen. Daher entschied ich mich, den Kopf nicht länger in den Sand zu stecken und meiner Vergangenheit nachzuforschen. Ich wollte den Rätseln, die mich umgaben, auf den Grund gehen.
Ich sah das Brieffach durch, das von Postsendungen überquoll. Es waren aber nur zwei persönliche Briefe dabei, das andere war Reklame. Dennoch widerstrebte es mir, die Kuverts, adressiert an den ominösen Namen, zu öffnen. Ich konnte mich nach wie vor nicht damit identifizieren. Etwas sträubte sich in mir gegen die Erkenntnis, dass ich das sein sollte.
Schließlich überwog aber meine Hoffnung, in den Briefen Informationen zu finden, die mir weiterhelfen könnten. Es waren zwei Mitteilungen, eine kam von einer Bank, eine von der Hausverwaltung, beide die Miete betreffend. Die war bisher mittels Einziehungsauftrag von einem Konto abgebucht worden, doch das war seit Monaten überzogen, daher hatte man die automatischen Überweisungen gestoppt.
Unter den anderen Zusendungen fanden sich auch mehrere Ausgaben eines Magazins über Kampfsport. Aus Langeweile blätterte ich darin und las einen Artikel über den Begründer des modernen Karate, einen Japaner namens Funakoshi. Er definierte die Kunst desKaratedoals „Weg der leeren Hand“. Einem Gegner ohne Waffe gegenüberzutreten, bedeute nicht, wehrlos zu sein. Der Körper des Kämpfers stelle die Waffe dar, die im Training geschmiedet und vom Geist geschliffen werden müsse. Das Ziel sei nicht die Vorbereitung auf den Kampf, sondern das Erreichen absoluter Selbstbeherrschung. Dieses Streben nach der Einheit von Körper und Seele solle sowohl die Überwindung aller inneren Widersprüche als auch die Lösung aller Konflikte mit der Außenwelt herbeiführen. Nur so werde das eigene Ich mit der Welt in harmonischen Einklang gebracht, in der nichts den inneren und äußeren Frieden störe. Das Ideal wäre ein Zustand innerer Ruhe, der einer inneren Leere gleichkäme.
Das klang sehr esoterisch, doch fühlte ich mich von dieser Philosophie angesprochen, sie berührte eine Saite in mir. Denn bei mir konnte von einer Einheit zwischen Körper und Geist keine Rede sein, die zerfielen quasi in zwei Teile. Die erwähnte „innere Leere“ war das genaue Gegenteil von der Leere, die ich in meinem derzeitigen Leben empfand. Ich lag zwar nicht im Konflikt mit der Welt, doch von harmonischem Einklang keine Spur. Ich wandelte durch die Gegend wie einer, der nirgends dazugehörte und überall fremd war.
***
Um sich bestmöglich auf das Turnier in Tokyo vorzubereiten, unterbrach er sein Studium und reiste einen Monat zuvor nach Japan. Einerseits, um sich auf den Klimawechsel einzustellen, andererseits, um sein Training zu intensivieren. Man hatte ihm und den anderen, von auswärts anreisenden Teilnehmern eine preiswerte Unterkunft sowie auch eine Gelegenheit zum Training in einem nahegelegenen Dôjô angeboten, und von dieser Möglichkeit hatte er Gebrauch gemacht.
Als das Turnier begann, traf er in den Vorrunden durchwegs auf Nichtjapaner. Im ersten Kampf war ein Brasilianer sein Gegner. Im zweiten traf er auf einen Russen, der zwei Meter groß und über neunzig Kilo schwer war. Dank seiner technischen und taktischen Fähigkeiten konnte er beide Begegnungen für sich entscheiden. Doch die kräfteraubenden Vorkämpfe zehrten an seiner Substanz. Seine späteren japanischen Gegner waren alle über leichtere Kämpfe in die Endrunden gekommen. Es wurden daher Vorwürfe laut, dass die Japaner bei der Auslosung bevorzugt worden wären. Es schien kein Zufall zu sein, dass durch die Kämpfe zwischen Ausländern schon in den Vorrunden einige der stärksten Brocken ausschieden, bevor sie auf die japanischen Favoriten trafen.
Allerdings ging er gestärkt aus den Vorrundenkämpfen hervor, sein Selbstvertrauen war dadurch gestiegen. Er war nur als Außenseiter angereist, der sich durch den Sieg bei einem Studententurnier für die Teilnahme qualifiziert hatte. Obwohl er gleich zu Beginn auf hochkarätige Gegner traf, machte er die Erfahrung, dass er hinsichtlich Kondition und Kampftechnik seinen Kontrahenten ebenbürtig war. Mehr noch, mit seiner im Vergleich zum schulmäßigen Karate unorthodoxen Kampfweise gelang es ihm, seine Gegner oft zu verunsichern und in Schwierigkeiten zu bringen. Denn sie kamen mit seinen unerwarteten Positionswechseln, blitzschnellen Körperdrehungen sowie seiner Reaktionsschnelligkeit nur schwer zurecht. Bedingt durch sein gutes Auge, gelang es ihm, Angriffen schon im Ansatz auszuweichen und mit Gegenschlägen die Angreifer aus dem Konzept zu bringen. Seine bevorzugte Taktik, durch fingierte Attacken die Gegner zu Kontern zu verleiten und dann aus der Defensive heraus entscheidend zu punkten, ging immer wieder auf. Der unkonventionelle Stil half ihm auch, seinen Mangel an Erfahrung im Kampf mit japanischen Gegnern auszugleichen. So brachte er das Kunststück zuwege, als einziger Ausländer bis ins Halbfinale vorzustoßen.
Anfangs hatte man ihn als Nobody unterschätzt, doch je mehr Respekt er den Japanern abnötigte, umso besser bereiteten sie sich gegen ihn vor, und umso verbissener kämpften sie. Da sie den Sport als ihre Domäne ansahen, sollte der Einzug eines Ausländers ins Finale verhindert werden. Sie wollten den Turniersieg unter sich ausmachen, alles andere galt als nationale Schande.
So kam es, dass sein Gegner im Halbfinale wilde Attacken gegen ihn ritt. Er wollte den Sieg erzwingen. Doch seine scheinbare Überlegenheit nützte ihm nichts, denn den entscheidenden Treffer konnte er nicht anbringen, und in der Schlussphase des Kampfes geriet er sogar ins Hintertreffen. Daraufhin versuchte er, durch eine Serie von Kicks um jeden Preis eine Entscheidung herbeizuführen. Da seine ungestümen Angriffe aber leicht auszurechnen waren, gingen sie alle ins Leere. Er gab dennoch nicht auf. Selbst als schon das Zeichen zum Ende des Kampfes fiel, trug er noch eine letzte Attacke vor und traf in dem Augenblick seinen Gegner mit der Ferse am Kopf.
Trotz der Tatsache, dass der Niederschlag nicht zählte, weil er nach Ablauf der regulären Kampfzeit erfolgt war, hatte er zu einem schweren k. o. geführt. Angesichts dessen war an ein Antreten zu einem weiteren Kampf an diesem Tag nicht zu denken. Es dauerte eine Stunde, bis er das Bewusstsein wieder erlangte, und er musste in eine Klinik gebracht werden. Das Turnier lief unterdessen weiter. Das zweite Halbfinale war nach dem ersten angesetzt, und der Endkampf sollte am Abend über die Bühne gehen. Die Organisatoren berieten hinter den Kulissen, wie das Turnier trotz des Vorfalls zu einem termingerechten Abschluss gebracht werden könnte, denn dem Publikum sollte heute noch ein Sieger präsentiert werden.
So wurde entgegen dem Reglement der Unterlegene aus dem ersten Halbfinale, der eigentlich disqualifiziert hätte werden müssen, dem Sieger des zweiten gegenübergestellt. Ein eingelegter Protest wurde zwar abgewiesen, aber der Optik tat es gut, dass er im Finale nicht nur verlor, sondern sang- und klanglos unterging. Er hatte sich im Kampf zuvor zu sehr verausgabt, und es schien der Makel des nicht regelkonformen Antretens getilgt. Es kam zum erwünschten Ergebnis, ein Japaner stand als Turniersieger fest.
Dem Vordringen des Ausländers ins Halbfinale wurde zwar von allen Beobachtern großer Respekt gezollt, sein unglückliches Ausscheiden bedauert, doch nach gängiger Meinung hätte das am Ausgang des Turniers nichts geändert. Als Wiedergutmachung sollte ihm aber eine Möglichkeit zur Revanche gegeben werden, und man versprach, ihn nächstes Jahr erneut nach Japan einzuladen.
***
In einer anderen Ausgabe des Magazins fand ich einen weiteren Artikel, und als ich den las, hatte ich das Gefühl, mich dunkel erinnern zu können. Es schloss daran ein Traum an, in dem mir war, als läge ich im sterilen, weißen Zimmer einer Klinik in einem Bett. Eine schwere Bettdecke aus weißem, glattem Kunststoff drückte mich nieder. Ich fühlte mich darunter plattgepresst wie eine Flunder, unfähig, mich zu rühren. Mein linker Arm lag kraftlos am Bettrand in einer feuchten Lache. Ich sah, dass neben mir ein Infusionsbeutel mit einer milchigen Essenz an einer Stange hing. Die Verbindung des Schlauchs zur Einstichstelle an meinem Arm war aber unterbrochen. Die Flüssigkeit floss nicht in meine Venen, sondern lief aus und sammelte sich auf dem gummierten Leintuch.
Da kamen Leute ins Zimmer, und einer im weißen Ärztekittel beugte sich zu mir und redete mich an. Es war eine fremde Sprache, die ich nicht verstand. Eine ebenfalls weiß gekleidete Krankenschwester kümmerte sich derweil um die Infusion. Da stand aber noch eine junge Frau mit langem schwarzen Haar. Sie schien nicht zum Klinikpersonal zu gehören, und ich fragte mich, wer sie war.
Die junge Frau tauchte auch in einem anderen Traum auf. Da folgte ich ihr durch eine weite Halle. Dann ging es über steile Treppen hinunter in ein Tunnelsystem. Es kam mir vor, als wiese sie mir den Weg durch ein Labyrinth. Entgegenkommende Menschen drängten sich zwischen uns. Ich musste aufpassen, sie nicht aus den Augen zu verlieren. Ohne sie wäre ich in der Menge verloren.
Am Ende kamen wir zu einem Bahnsteig, an dem ein Zug hielt. Die Türen sprangen auf, es gab ein Geschiebe, aber wir schafften es hinein, hinter uns schloss sich die Tür. Drinnen war es dunkel, eng und kühl, und ehe wir noch unsere Plätze gefunden hatten, fuhr der Zug schon wieder an. Ich geriet ins Taumeln und verlor den Halt, aber da kam ich auf einem freien Platz zu sitzen, und sie saß neben mir.
Ich lehnte mich zurück und sah aus dem Fenster. Erst ging es durch dicht verbautes Gebiet. Dann wurden die Abstände zwischen den Häusern größer, dazwischen breiteten sich Felder aus. Vereinzelt gab es auch kleine Wäldchen wie Bauminseln im flachen Land. In der Ferne zeigte sich eine hohe Bergkette, der wir uns näherten. Irgendwann lag die Ebene hinter uns, und es ging durch ausgedehnte Wälder. Die Gegend wurde schroffer, Geröll und Gestein säumten das Gleisbett. Auf einer Seite ragten steile Felsen auf, auf der anderen gab es eine tiefe Schlucht. Die Bahn krallte sich in die Felswand, bis sie eine Hochebene erreichte. Dort gab es Reisfelder, deren Ähren in der goldenen Sonne leuchteten. Dann tauchten vereinzelte Häuser auf. Wir kamen in eine Stadt. Schließlich fuhr der Zug in den Bahnhof ein.
***
Mein Bruder war auch Teilnehmer an dem Karate-Turnier, und da ich damals in Tokyo studierte, sah ich mir seine Kämpfe an. Zwar schied er schon in der Vorrunde aus, doch da mein Interesse geweckt war, verfolgte ich den Fortgang des Turniers. Der Ausländer, der alle seine Vorkämpfe gewonnen hatte, erregte allgemeine Aufmerksamkeit. Sein Kampfstil war eleganter als der seiner Gegner. Er kämpfte nicht so verbissen, sondern wartete auf seine Chancen. Es sah sogar danach aus, als könnte er das Finale erreichen, doch im Halbfinale war Schluss für ihn. Nach einem schweren Niederschlag wurde er in eine Klinik gebracht, dort besuchten wir ihn am nächsten Tag.
Mein Bruder machte ihm den Vorschlag, sich gemeinsam mit ihm auf das Turnier im nächsten Jahr vorzubereiten. Wenn er zu uns nach Yamagata käme, hätte er die Chance, im Dôjô eines japanischen Trainers zu trainieren. Dort könnte er seine Technik verbessern und Erfahrungen sammeln, dann stünden seine Chancen auf einen Sieg beim nächsten Turnier sehr gut. Das Einverständnis unserer Eltern vorausgesetzt, könnte er in dieser Zeit auch bei uns im Haus wohnen.
Ich fand die Idee gut, und weil das Englisch meines Bruders zu wünschen übrig ließ, begleitete ich ihn in die Klinik, um ihn zu unterstützen. Zuerst lehnte der Ausländer ab. Er sagte, er wolle nicht in Japan bleiben. Erstens, weil er seinen Rückflug schon gebucht hatte, zweitens, weil er vom Verlauf des Turniers enttäuscht war und sich um seinen Sieg betrogen fühlte. Es gelang uns aber doch, ihm unseren Vorschlag schmackhaft zu machen und ihn zum Bleiben zu bewegen. Am Ende überwog sein sportlicher Ehrgeiz, und er brannte auf Revanche.
***
Da war ein Haus am Stadtrand, umgeben von Reisfeldern. Ein schmaler Gang führte in verschachtelten Windungen ins Innere. Ich ging in Socken über polierte Holzbohlen, die sich glatt und kühl anfühlten. Durch eine breite Fensterfront, die bis zum Boden reichte, sah man in einen Innenhof mit einem kleinen Garten. Darin ein Teich mit Wasserpflanzen, umgeben von pelzigem Moos und einigen Zierbäumchen.
Von irgendwo war Sprechen und Lachen zu hören. Eine Schiebetür ging auf, und in einem geräumigen Zimmer saßen da Leute am Boden rund um einen mit Tellern und Schüsseln gedeckten Tisch. Es war anheimelig warm, und es roch nach Suppe und Alkohol. Man machte mir Platz, und ich setzte mich im Schneidersitz hin. Neben mir saß die junge Frau mit den langen schwarzen Haaren, auf der anderen Seite eine ältere Frau. Ich verstand nichts von dem, was geredet wurde, aber die ältere Sitznachbarin half mir aus der Verlegenheit. Sie schob mir einen Teller zu und deutete mir, mich zu bedienen. Sie sah mich mit breitem Lächeln an und zeigte dabei eine Reihe von Goldzähnen. Da ich nicht wusste, was ich mir nehmen sollte, schöpfte sie mir aus einem Suppentopf, der in der Mitte des Tisches über einer Gasflamme stand, eine Schale voll und drückte mir dazu Stäbchen in die Hand. Da ich mich damit aber ungeschickt anstellte, gab sie mir stattdessen einen klobigen Löffel. Dann schenkte sie mir aus einer großen Flasche, die neben ihr am Boden stand, ein Gläschen voll. Ich wusste nicht, was das war, was ich da aß und trank, aber es schmeckte mir.
Die zumeist älteren Männer am Tisch unterhielten sich in einer kehligen Sprache. Es hatte den Anschein, als erkundigten sie sich, wer ich war. Es trafen mich fragende Blicke, aber da ich die Fragen nicht verstand, antwortete die junge Frau an meiner Stelle, während ich dazu freundlich lächelte. Die ältere Frau versuchte erst gar nicht, mich anzureden, wir begnügten uns mit Gebärdensprache. Sie legte mir noch andere Speisen vor, schenkte mir auch immer weiter ein und deutete: „Trink!“ Ich griff ungeniert zu, und je mehr ich aß und trank, desto mehr legte sich meine anfängliche Befangenheit.
***
Meine Eltern wollten erst nicht zugeben, dass sie nicht davon erbaut waren, einen Ausländer beherbergen zu müssen, noch dazu ein Jahr lang. Zu Beginn hatte es ihnen zwar geschmeichelt, dass die Ankündigung seines Erscheinens in der Nachbarschaft Aufsehen erregte. Zu seiner Ankunft hatten sie daher Verwandte und Freunde eingeladen, um den Gast wie eine Trophäe vorzuführen. Doch im Grunde widerstrebte es ihnen, einen Fremden für so lange Zeit im Haus zu haben.
Das Hauptproblem war die Kommunikation. Die scheiterte daran, dass er kein Japanisch konnte und sie kein Englisch. Er bemühte sich zwar, einzelne Vokabeln aufzuschnappen, aber es sah nicht so aus, als ergäbe das in absehbarer Zeit eine Basis zur Verständigung. Wenn ich dabei war, ließen sich alle Missverständnisse lösen, doch außer mir gab es niemanden im Haus, der dolmetschen konnte.
Die Probleme begannen sich zu häufen, als ich im Herbst zu Semesterbeginn wieder nach Tokyo musste. Meine Eltern fühlten sich in seiner Gegenwart unwohl, weil sie sich mit ihm nicht unterhalten konnten. Und da mein Bruder kein kommunikativer Typ war, erwies er sich nicht als große Hilfe. Beim Karate bemühte er sich zwar gelegentlich, über seinen Schatten zu springen, aber zu Hause zeigte er wenig Lust, mit seinem rudimentären Englisch zu glänzen und verschwand meist auf sein Zimmer. Meine Eltern bereuten daher sehr bald, ihre Zustimmung gegeben zu haben und fanden immer mehr Gründe, warum es ihrer Ansicht nach unmöglich wäre, den Ausländer bis zum nächsten Sommer zu beherbergen. Am Ende setzten sie mir und meinem Bruder eine zweiwöchige Frist, in der wir uns für ihn um eine andere Bleibe umsehen sollten.
Zum Glück zeigte sich eine Verwandte, die ihn bei uns kennengelernt hatte, so angetan von ihm, dass sie sich bereit erklärte, ihn bei sich aufzunehmen. Sie war verwitwet, hatte aber früher mit ihrem Mann in ihrem Haus eine Pension geführt, in der ab und zu auch Ausländer abgestiegen waren, darum hatte sie keine Berührungsängste. Außerdem kam ihr ihr Talent, mit Händen und Füßen zu reden, zugute, sodass sie sich auch ohne Worte verständlich machen konnte.
***
Noch ein anderes Haus tauchte in meinen Traumbildern auf. Es war eins von mehreren drei- bis vierstöckigen Holzgebäuden, die sich beidseitig an die Felswände eines Tales schmiegten. Durch die Siedlung floss ein Bach, über den mehrere Brücken gingen. Das klare Wasser kam aus einer nahen Klamm, von deren Ausgang das Rauschen eines Wasserfalls im ganzen Ort zu hören war.
Am Rand des Wasserfalls führte ein schmaler Steg über Leitern zu einem alten, aufgelassenen Bergwerk. Der Eingang war verbarrikadiert, und ein Schild warnte bei unbefugtem Eintritt vor Lebensgefahr. In der waldigen Umgebung befanden sich aber Felsspalten, denen ein kalter Hauch entstieg, und durch sie gelangte man in das verzweigte Stollensystem. Drinnen empfing einen ein dunkles Schattenreich, in dem man sich wie von tausend Augen beobachtet fühlte. Dazu kam ein Flügelschlagen, als umschwirrten einen Fittiche des Todes. Erst wenn sich das Auge ans Dunkel gewöhnte, nahm man die Scharen von Fledermäusen wahr, die in dicken, schwarzen Trauben in den Felsnischen hingen. Solange sie sich nicht in ihrer Ruhe gestört fühlten, hielten sie still. Nur hier und da griff ein nackter Arm aus und hangelte sich ein Stück voran. Doch einmal aufgeschreckt lösten sich alle zugleich von den Wänden und flatterten dem Ausgang zu. Und wenn der Schwarm in der engen Höhle über einen hinwegflog und einen links und rechts die Flügel streiften, fiel es schwer, die Nerven zu bewahren.
Ich weiß nicht – war es im Bergwerk oder anderswo? Da gab es eine Grotte mit heißer Quelle. Dort war es dumpfig, feuchtwarm, und es tropfte von den Wänden. Im Licht einer Lampe waren in den Fels geschlagene Stufen zu sehen, die zu einem niedrigen Natursteinbecken führten. Das Thermalwasser war milchig trüb, und es entstieg ihm ein Dampf, der in Schwaden über dem Becken hing und einem das Atmen schwer machte.
Ging man die Stufen hinauf, kam man durch einen dunklen Gang in einen Keller. Dort standen Regale, und es lag allerlei Gerümpel herum. Es führte aber eine Treppe weiter ins Erdgeschoss. Dort befand sich der Hauseingang von der Straße her, und es gab eine Art Empfangsraum. Die Treppe ging dann noch über mehrere Stockwerke hinauf in ein kleines Mansardenzimmer. Drinnen war es eng und kühl, und der herbe Geruch der frischen Reisstrohmatten lag in der Luft.
***
Er glaubte, Japan zu kennen. Er hatte von Jugend an Karate trainiert und fühlte sich vom Samurai-Geist durchdrungen. In Wirklichkeit hatte er wenig Ahnung, denn er bezog sein Wissen nur aus Büchern. Da er nie zuvor hier gewesen war, hatte er nur ein klischeehaftes Bild „vom Land der aufgehenden Sonne, das sich trotz Anpassung an die Moderne seine Traditionen bewahren konnte.“ Als er dann das wirkliche Japan kennenlernte, zeigte er sich zwar einerseits beeindruckt, andererseits aber, wenn nicht alles seinen Erwartungen entsprach, auch wieder enttäuscht. Sein größtes Handicap war jedoch, dass er abgesehen von ein paar Brocken kein Japanisch verstand.
Anfangs überwog noch ein positiver Eindruck, der begann aber mit der Zeit zu bröckeln, und der Ausgang des Turniers desillusionierte ihn vollkommen. Da schien der Geist der Samurai keine Rolle mehr zu spielen, und so war er am Ende nicht nur bitter enttäuscht, sondern fühlte sich, als wäre ihm der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Am liebsten wäre er sofort abgereist, und es war nicht einfach, ihn zum Bleiben zu bewegen. Nachdem er mit uns aufs Land gekommen war, schien er sich aber wieder wohler zu fühlen. Hier war vieles anders als in einer Großstadt wie Tokyo, so konnte er sich ein paar seiner Illusionen von Japan bewahren.
Er nahm mit meinem Bruder regelmäßig am Training teil und glaubte hier noch etwas vom Samurai-Geist zu finden, den er in Tokyo vermisst hatte. Das lag vor allem am Trainer, einem ehemaligen, sehr erfolgreichen Karatekämpfer, der sich bewusst in die Provinz zurückgezogen hatte. Von außen sah sein Dôjô aus wie ein alter Holzschuppen, drinnen roch es nach Schweiß, aber es war ihm gelungen, dort eine gute Sportschule aufzubauen. Er wollte nur mit wenigen, aber guten Leuten arbeiten. Dazu hatte er eine Handvoll junger Sportler um sich geschart, die bedingungslose Hingabe ans Karate auszeichnete. Und mit dem Ehrgeiz, den jeder von ihnen an den Tag legte, motivierten sie sich gegenseitig.
Der Trainer hatte neben meinen Bruder noch einen weiteren Teilnehmer am Turnier in Tokyo betreut, und bei der Gelegenheit hatte er auch die Kämpfe des Ausländers gesehen. Er war von seinem Kampfstil angetan, da er sich von den Haudraufmethoden der anderen ausländischen Kämpfer unterschied. Und dass er bei seinem ersten Turnier in Japan auch gegen japanische Kämpfer eine gute Figur machte, rang ihm große Anerkennung ab. Als ihm mein Bruder vorschlug, den Ausländer in sein Dôjô aufzunehmen, stimmte er daher ohne Vorbehalt zu.
Zu Beginn hielt er zu ihm noch Distanz, das lag aber nicht daran, dass er Ausländer war, das machte er bei allen neuen Schülern so. Er fasste ihn nur mit Glacéhandschuhen an und kritisierte ihn selten. Gleichwohl sah er beim Training deutlich, was ihm noch fehlte. Und als er erkannte, dass er keinen Sonderstatus beanspruchte, sondern bereit war, wie ein Japaner zu trainieren und zu kämpfen, nahm er ihn beim Training genauso hart ran wie alle anderen.
Der Trainer galt als schwieriger Charakter, er war kein Mann großer Worte, aber mit festen Prinzipien. Hinsichtlich der Dinge, die ihm wichtig waren, ließ er überhaupt nicht mit sich reden und machte keine Kompromisse. Das war auch der Grund, warum er nur eine kleine Zahl von Schülern hatte. Er wollte eine verschworene Gemeinschaft um sich haben, die seine Regeln akzeptierte. Er betrieb Karate wie eine Religion, sein Dôjô glich einer Sekte. Er verlangte von allen absolute Disziplin, nicht nur beim Training sondern auch privat. Jeder sollte so asketisch leben wie er, das hieß, keine Zigaretten, kein Alkohol, natürlich auch keine Drogen und keine Frauen. So etwas war im Kreis junger Männer natürlich nicht jedermanns Sache, aber wer sich nicht daran hielt, der ging entweder von selbst oder wurde gegangen.
Er hatte auch sehr eigenwillige Trainingsmethoden. So jagte er seine Schützlinge zum Konditionstraining nicht nur steile Berge hinauf, sondern es konnte ihm auch einfallen, sie aufzufordern, sich von einem hohen Wasserfall ins schmale Wasserbecken darunter zu stürzen. Oder er ließ sie im Winter zehn Minuten auf einer Klippe unter dem eiskalten Wasserstrahl stehen. Ein anderes Mal, als gerade der erste Schnee gefallen war, ließ er alle mit nackten Sohlen über die verschneiten Felder rennen. Und im Herbst verlangte er nach der Erntezeit von ihnen, barfuß über die Stoppeln der abgebrannten Reisfelder zu laufen.
Die Philosophie, die dahinter stand, war, dass jeder seiner Schützlinge, egal in welcher Situation, immer mental dazu bereit sein sollte, sich spontan einem Risiko oder einer Gefahr zu stellen. Weder Hitze noch Kälte dürften einem dabei etwas ausmachen. Mit Karate hatte das nur bedingt zu tun, seine Trainingsmethoden zielten darauf, die Kämpfer über die Erfordernisse ihres Sports hinaus geistig und körperlich zu stählen.
***
Einmal befand ich mich allein auf einem Waldlauf. Es schien zu Beginn der Winterzeit zu sein. Die knorrigen Bäume ringsum waren alle kahl, nur ein paar Nadelbäume gab es und dazwischen glitschiges Wurzelwerk. Der Himmel war wolkenverhangen, es war kalt und trüb, und plötzlich begann es in dicken Flocken zu schneien. Obwohl der nasse Schnee den Boden noch mehr aufweichte, ließ ich mich nicht davon abhalten weiterzulaufen. Stellenweise watete ich knöcheltief im Morast, der an meinen Sohlen kleben blieb, sodass mir so war, als hätte ich Bleigewichte an den Füßen. Schließlich hielt ich inne, denn mir schien, ich wäre vom Weg abgekommen.
Eine sonderbare Stille herrschte ringsum. Der lautlos fallende Schnee dämpfte jegliches Geräusch, ich hörte nur meinen keuchenden Atem. Es kam mir so vor, als wäre ich in dieser unwirtlichen Gegend der einzige Mensch.
Die meiste Zeit war ich quer durch den Wald gelaufen, aber auf einmal standen die Bäume so dicht, dass ich nicht mehr wusste, wo ich war. Bevor ich mich ganz verirrte, wollte ich nach einem gangbaren Weg suchen. Und als ich nach einigen hundert Metern auf eine Forststraße stieß, beschloss ich, dort meinen Waldlauf fortzusetzen.
Ich war noch gar nicht weit gekommen, da versperrte plötzlich ein dunkler SUV den Weg. Es war niemand in der Nähe, aber das Fahrzeug konnte noch nicht lange da stehen, denn die Motorhaube war noch warm. So wie der Wagen da stand, das Heck in der Höhe, die Vorderräder im Morast, sah es so aus, als wäre er bei einem Wendemanöver hängen geblieben.
Vielleicht war der Fahrer weggegangen, um Hilfe zu holen. Doch als ich um den Wagen herumging, sah ich neben der geöffneten Fahrertür jemanden am Boden liegen. Es war eine Frau, die verrenkt wie eine weggeworfene Gliederpuppe da lag, halb auf dem Rücken, den Kopf zur Seite gedreht. Ihr Körper war zierlich und schlank, ihr Gesicht vom langen Haar verdeckt, darin Schneeflocken. Unter einer grauen Pelzjacke trug sie einen weißen Angorapulli, dazu einen schwarzen Lederrock, schwarze Strümpfe, schwarze Lackschuhe, deren Absätze so hoch waren, dass sie damit im Wald keinen Schritt hätte tun können.
Ich beugte mich über sie und berührte ihre Hand. Die fühlte sich eiskalt an. Ich strich ihr das nasse Haar aus dem Gesicht. Die Frau war jung, schön und wie eine Puppe geschminkt. Bei dem Gedanken, dass sie tot sein könnte, gab es mir einen Stich.
Ich hatte keine Ahnung, was mit ihr los war. Eine sichtbare Verletzung hatte sie nicht, aber sie gab auch kein Lebenszeichen von sich, lag einfach nur da, reglos, besinnungslos, wie tot. Sie atmete aber noch, wenn auch schwach. Ich fühlte ihren Puls, der ging sehr langsam. Ich versuchte, sie zum Bewusstsein zu bringen, rüttelte sie, sprach sie an. Keine Reaktion. Ich tätschelte ihre Wange. Die war kalt wie die einer Toten.
Mir war klar, dass ich sie so nicht liegen lassen konnte, sie würde sonst erfrieren. Sie war jetzt schon unterkühlt. Aber was sollte ich tun? Ein Handy lag neben ihr. Ich hob es auf und wählte nach einigem Zögern den Notruf. Eine weibliche Stimme meldete sich und fragte, von wo ich anriefe und was passiert wäre.
Darauf wusste ich keine Antwort. Ich sagte, ich stände irgendwo mitten im Wald und hätte eine Frau gefunden, die wie leblos neben ihrem Wagen lag. Nach einem Unfall sah es nicht aus, eher nach einer Panne. Warum sie das Bewusstsein verloren haben könnte, dafür hatte ich auch keine Erklärung. Ich versuchte die Situation, in der ich sie vorfand, zu schildern, aber da war eine Störung in der Leitung und am Ende war sie ganz unterbrochen.
Ich rief ein zweites Mal an. Diesmal war die Verbindung besser. Nun war ein Mann dran. Er fragte mich, ob ich die Frau eventuell mit dem Auto in die Notaufnahme bringen könnte. Der Vorschlag war naheliegend. Warum hatte ich nicht gleich daran gedacht? Ich warf einen Blick ins Wageninnere. Der Schlüssel steckte, die Schaltung, eine Automatik, stand auf Leerlauf, es sprach also nichts gegen einen Versuch.
Ich hob die Bewusstlose auf, trug sie um den Wagen herum, um sie auf den Beifahrersitz zu setzen. Danach klemmte ich mich hinters Steuer, startete, schaltete aufDriveund stieg aufs Gas. Es tat sich jedoch nichts. Ich legte den Rückwärtsgang ein und probierte es noch einmal. Wieder vergeblich. Irgendwie steckten die Vorderräder fest. Ich wurde nervös, aber mir war klar, dass sich bei dem Automatikgetriebe nichts mit Gewalt ausrichten ließ. Ein verstärktes Gasgeben führte nur dazu, den Motor abzuwürgen.
Ich stieg aus, um mir die Sache genauer anzusehen. Das eine Vorderrad hing in der Luft, das andere steckte in glitschigem Wurzelwerk. Die Hinterräder hatten aber festen Bodenkontakt, mit Allradantrieb müsste es möglich sein, da rauszukommen.
Ich stieg wieder ein, gab nur in kurzen Abständen Gas und versuchte durch ein Vor-und-Zurück-Schaukeln den festsitzenden Wagen in Gang zu bringen. Nach einer Weile gelang es. Ein Ruck und alle vier Räder standen auf dem Forstweg. Um beim Reversieren nicht nochmal in dieselbe Lage zu kommen, schob ich einfach verkehrt zurück. Da ich den Wagen nicht gewohnt war, geriet ich mehrmals in Gefahr, vom Wege abzukommen, aber es gelang mir, nach ein paar hundert Metern eine asphaltierte Straße zu erreichen. Von dort war das Fahren kein Problem mehr.
Ich fuhr schnell, bei der schlechten Witterung auf der engen Waldstraße wahrscheinlich zu schnell. Aber mich trieb die Furcht, ich könnte es nicht mehr rechtzeitig in die Klinik schaffen. Immer wieder tastete ich nach ihr und versuchte, mich zu vergewissern, dass sie noch atmete. Sie fühlte sich wärmer an als vorhin, immerhin hatte ich die Heizung voll aufgedreht, doch hing sie nach wie vor schlaff und reglos auf ihrem Sitz.
Endlich kamen wir aus dem Wald und erreichten die ersten Ausläufer der Stadt. Von hier konnte es nicht mehr weit sein. Ich rief nochmals an, um mich wegen des Wegs in die Klinik zu erkundigen. Es dämmerte schon, aber es schneite immer noch. Nur hier war es, anders als oben auf dem Berg, mehr eine Art Schneeregen. Dicke Batzen fielen auf die Scheibe und nahmen mir die Sicht. Entgegenkommende Scheinwerfer blendeten mich. Einmal bog ich falsch ab und fand nicht mehr auf die Hauptstraße zurück. Ich achtete kaum noch auf den Verkehr, sondern war nur noch darauf bedacht, den richtigen Weg zu finden.
Doch dann, ich wusste selbst nicht wie, hatte ich es geschafft, auf einmal kam die Klinik in Sicht. Am Eingang wartete man schon und war bereit, sich um den Notfall zu kümmern. Man stellte mir Fragen zum Zustand der Frau, ob sie Medikamente oder Drogen genommen hatte. Aber ich wusste nichts von ihr. Ich war nur froh, sie hier lebend abgeliefert zu haben. Dass sie unterwegs sterben könnte, war meine größte Sorge gewesen.
***
Einige Tage später erfuhr ich, dass sie sich auf dem Weg der Besserung befand und war erleichtert. Sie hatte sich erholt und nach dem, was man mir sagte, stand es nicht schlimm um sie. Angeblich hatte sie sich auch nach mir erkundigt, weil sie wissen wollte, wer sie in die Klinik gebracht hatte. Meiner Bitte, sie sehen zu dürfen, wurde entsprochen.
Als ich in die Klinik kam, führte mich eine Krankenschwester hinauf. Sie hatte ein eigenes Zimmer, doch nach der Ankündigung meines Besuchs ließ sie mir ausrichten, sie würde aufstehen und nach draußen kommen.
Es dauerte eine ganze Weile, bis sie wirklich erschien. Die Krankenschwester war schon wieder weg, und ich stand allein auf dem nüchternen, kahlen Gang. Nachdem die Tür aufging, traf mich ein erstaunter Blick, so, als hätte sie jemand anderen erwartet. Verwundert sah sie sich um, aber es war keiner da außer mir. Allem Anschein nach hatte ihr niemand gesagt, dass ich Ausländer war.
Aber ich war ebenso überrascht. Von Krankheit oder Schwäche war ihr auf den ersten Blick nichts anzumerken. Auch sonst sah sie sehr verändert aus, ich hatte sie ganz anders in Erinnerung. Zum Teil lag das natürlich daran, dass sie nun im Pyjama erschien und darüber nur einen Schlafrock trug. Doch ihr Gesicht sah ebenfalls anders aus, ohne Schminke war ihr Teint nicht so blendend weiß, und es wirkte rundlicher als bei unserer ersten Begegnung. Ursprünglich hatte ich sie auch jünger geschätzt, vielleicht Anfang zwanzig. Heute dagegen erschien sie mir älter und machte auf mich einen fraulicheren Eindruck.
Nach einem ersten Moment der Sprachlosigkeit fragte sie mich, ob ich der Mann wäre, der sie im Wald gefunden und hierher gebracht hätte. Nachdem ich ihre Frage bejaht hatte, sagte sie etwas, was ich nicht verstand, und verbeugte sich sehr förmlich vor mir. Ich vermutete, dass sie mir auf diese Weise danken wollte. Da ich aber nicht wusste, wie ich darauf reagieren sollte, erwiderte ich nur stumm ihre Verbeugung.
Auch danach wollte die Befangenheit zwischen uns nicht weichen. Sie stand mit gesenktem Blick da, während ich noch überlegte, was ich sagen sollte. Um der peinlichen Situation zu entgehen, trat sie einen Schritt auf mich zu und nahm meine Rechte in ihre beiden Hände. Darauf hob sie den Kopf, sah mir kurz in die Augen und verbeugte sich nochmals.
Es war nur ein kurzer Moment, danach richtete sie das gesenkte Haupt wieder auf. Doch im Gegensatz zu dem förmlichen Dank von vorhin schien mir diese Geste aus ihrem Herzen zu kommen. Sie hatte ein wenig unbeholfen, zugleich aber auch sehr berührend auf mich gewirkt. Die Wärme ihrer weichen Hände überraschte mich. Bei unserer ersten Begegnung hatten sie sich starr und kalt angefühlt. Aber das war der Beweis, dass sie ins Leben zurückgekehrt war. Ich konnte nicht beurteilen, woran es lag, dass sie sich so schnell erholt hatte. Noch vor wenigen Tagen schien sie mir dem Tod nahe, und ihre Totenkälte hatte mir Schauer über den Rücken gejagt.
Nachdem sie meine Hand losgelassen hatte, hätte ich sie gerne umarmt. Doch sie trat einen Schritt zurück, um die ursprüngliche Distanz zu wahren. Trotzdem spürte ich, dass das Eis zwischen uns gebrochen war. Sie deutete auf eine Sitzbank, die in einiger Entfernung stand, und lud mich ein, dort Platz zu nehmen. Während wir die paar Meter gingen, beobachtete ich sie von der Seite. Sie wollte sich zwar nichts anmerken lassen, aber ihre Schritte wirkten steif und unsicher. Ganz wiederhergestellt war sie wohl doch nicht. Als sie merkte, dass mir das auffiel, ergriff sie meinen Arm und ließ sich von mir führen. Es war wie das stumme Eingeständnis, dass wir keine Geheimnisse voreinander zu haben brauchten.
Beim Niedersetzen ließ sie meinen Arm wieder los. Dann lehnte sie sich zurück, streckte ihre Beine aus, bewegte erst ihre Zehen und ließ dann ihre kleinen Füße einige Male kreisen. Offenbar war das eine Übung, die man ihr hier empfohlen hatte. Ich beobachtete sie von der Seite und war noch immer verblüfft, welche Wandlung mit ihr vorgegangen war. Im Wald hatte sie wie eine geschminkte Puppe ausgesehen, ihr dickesMake-upwar mir wie eine Maske erschienen. Heute wirkte sie dagegen auf mich wie eine Frau aus Fleisch und Blut.
Als ich sie fragte, was damals eigentlich mit ihr los gewesen wäre, wollte sie nicht so recht mit der Sprache heraus. Sie sagte, sie hätte einenBlack-outgehabt, weil sie zwei verschiedene medizinische Präparate eingenommen hatte, die sich in ihrer Wirkung beeinträchtigten. Was das für Mittel waren, wollte sie sich aber nicht entlocken lassen, darum drang ich nicht weiter in sie. Auf die Frage, was sie denn bei dem Wetter im Wald gewollt hätte, antwortete sie, sie wäre auf dem Weg zu einer Verabredung gewesen, hätte sich aber verfahren. Nachdem sie beim Umdrehen auf dem Forstweg hängengeblieben war, hätte sie versucht, per Handy Hilfe zu holen. Doch dann wäre ihr schlecht geworden, und sie hätte das Bewusstsein verloren. Was danach war, daran könne sie sich nicht mehr erinnern. Erst in der Klinik wäre sie wieder zu sich gekommen.
Als ich ging, begegnete ich zufällig dem Arzt, der mich an dem Tag, als ich sie herbrachte, gefragt hatte, ob sie vielleicht unter dem Einfluss von Drogen stand. Ich wollte wissen, ob sie eventuell drogenabhängig wäre. Doch darüber verweigerte er mir die Auskunft. Er entschuldigte sich damit, dass er gegenüber Fremden über den gesundheitlichen Zustand von Patienten Stillschweigen bewahren müsste.
***
Als ich erfuhr, dass er ein Verhältnis mit einer anderen Frau hatte, war ich enttäuscht. Er musste ihr in der Zeit begegnet sein, als er im Haus meiner Großtante wohnte. Da ich damals in Tokyo war, hörte ich aber erst viel später davon. Doch auch mein Bruder, der täglich mit ihm trainierte, hatte nichts davon gewusst.
Es war nicht ganz nachvollziehbar, wie der Kontakt zustande kam. Die Lebenssphäre dieser Frau und die seinige lagen so weit auseinander, dass sie sich unter normalen Umständen niemals kennengelernt hätten. Auch blieb es rätselhaft, was ihn – abgesehen von der erotischen Anziehung – mit ihr verband. Erst als sich die Sache herumsprach, wurden einige Details bekannt. Alle waren natürlich entsetzt, wie es so weit mit ihm hatte kommen können. Meine Eltern waren im Nachhinein froh, ihn nicht aufgenommen zu haben, und machten mir und meinem Bruder sogar Vorwürfe, dass wir ihn ins Haus gebracht hatten.
Ich versuchte, ihn anfangs noch in Schutz zu nehmen, denn ich konnte mir sein Verhalten nur so erklären, dass er in die Sache reingeraten war, weil er die Gepflogenheiten der japanischen Gesellschaft nicht kannte. Ihm war wohl nicht klar gewesen, worauf er sich mit dieser Frau einließ, und später war es zu spät, da wieder herauszukommen, da hatte sie ihn schon zu tief in ihre Netze verstrickt.
Er, der bis dahin nur für seinen Sport gelebt und dafür auf Frauen und Alkohol verzichtet hatte, war wohl zu naiv, um zu durchschauen, wie raffiniert er von dieser Frau getäuscht wurde. Dabei deutete alles darauf hin, dass sie ihr Leben gar nicht mehr im Griff hatte. Sie war nicht nur psychisch labil, sondern nahm auch noch Drogen. Das allein hätte bei ihm alle Alarmglocken schrillen lassen müssen.
***
Einige Tage nach ihrer Entlassung aus der Klinik rief sie mich an und lud mich in ein kleines Restaurant ein. Es war ein etwas beengtes Lokal mit wenigen Tischen, daher wirkte es trotz der geringen Zahl von Gästen ziemlich voll. Da sie aber vorbestellt hatte, bekamen wir einen gemütlichen Ecktisch.
„Hierher komme ich nur mit guten Freunden“, sagte sie und lächelte mich an, „denn hier fühle ich mich frei und unbeschwert.“ Sie hatte sich an dem Abend hübsch gemacht, sie war geschminkt, aber nur ein wenig, trug einen hellen Pullover und einen dunkelbraunen Rock. Um den Hals hatte sie eine Kette mit auffallend großen Steinen und dazu passende Ohrgehänge. Außerdem war sie beim Friseur gewesen, und ihre Nägel waren frisch manikürt. Was mir aber besonders auffiel, war, wie ihre Augen glänzten. Keine Spur mehr von den müden Schatten, die ihre Augen in der Klinik umgaben. Wenn ich sie so ansah, erschien sie mir wie ein menschliches Chamäleon, jedes Mal, wenn ich ihr begegnete, war sie anders.
„Sieh mich nicht so an“, sagte sie, weil ich den Blick nicht von ihr abwenden konnte, und verbarg dabei ihr Gesicht kokett hinter der Speisekarte. Dann aber zeigte sie mir die Karte, und erklärte mir, was es hier alles gab. Sie schlug vor,Hot Pot, eine Spezialität des Hauses, zu bestellen. Es war ein Gericht für zwei Personen, und dazu empfahl uns der Kellner eine Flasche Wein. Als ich einwandte, dass es in meinem Sport besser wäre, nichts zu trinken, ließen wir den Wein weg und blieben bei Wasser und Tee.
Bei der folgenden Unterhaltung über Karate gab sie sich interessiert, offenbarte dabei aber, dass sie von dem Sport keine Ahnung hatte. Ich erzählte ihr von meinem japanischen Trainer und wie ich in der kurzen Zeit schon bei ihm profitiert hätte. Sie fragte mich aber nur nach lächerlichen Dingen, ob die Kämpfer unter dem Karateanzug Unterwäsche trügen und wie oft die Sportkleidung gewaschen würde. Ich nahm es ihr nicht übel, es war ihre Art, das Gespräch am Laufen zu halten. Sie warf alles Mögliche ein, was ihr gerade einfiel, und stellte auch sehr persönliche Fragen. Umgekehrt mochte sie es gar nicht, wenn man sie private Dinge fragte. Das war mir schon in der Klinik aufgefallen. Man konnte sich mit ihr gut unterhalten, solange alles Gesagte unbestimmt blieb. Was sie nicht von sich preisgeben wollte, beantwortete sie ausweichend. Es ging ihr darum, ein hübsches Bild von sich zu zeichnen und alles zu vermeiden, was das gefällige Image ankratzen könnte. Darum hielt sie jedes Gespräch, egal zu welchem Thema, möglichst an der Oberfläche und ließ sich nichts entlocken, was tieferen Einblick gewährt hätte. Das ständige Changieren zwischen gespielter Offenheit und spürbarer Distanz empfand ich an jenem Abend als sehr irritierend.
Endlich kam das Essen. Es bestand aus einem Suppentopf, in dem die Zutaten erst am Tisch gegart wurden. Etwas Ähnliches hatte ich schon mal gegessen, aber das hier war angeblich eine taiwanesische Spezialität. Sie übernahm die Aufgabe, mit den Stäbchen mal dies, mal das in die Suppe zu tun und dann wieder herauszufischen, um es mir vorzulegen. Es waren verschiedene Meeresfrüchte, aber auch aus Fischmehl hergestellte Produkte. Während ich kostete, versuchte sie an meiner Miene abzulesen, wie es mir schmeckte. Meine Begeisterung hielt sich zwar in Grenzen, weil der Sud so einen eigenartigen Geschmack hatte, der auf alles durchschlug. Aber sie war eine gute Lehrmeisterin in der Verstellung, ich lobte alles und ließ mir nicht anmerken, dass es mir nicht so mundete. Immerhin hatte sie mich eingeladen, noch dazu in ihr Lieblingslokal, wie sie sagte, da wollte ich sie nicht enttäuschen.
Sie selbst aß allerdings auch auffallend wenig, es mochte sein, dass der Suppentopf auch nicht so ganz ihren Geschmack traf. Schließlich ging aus einer Bemerkung von ihr sogar hervor, dass sie heute erst zum zweiten Mal hier war. Das Restaurant gab es ungefähr seit einem Jahr, und ein Bekannter hatte sie nach der Eröffnung einmal hierher mitgenommen. So kurz ich sie auch kannte, so fiel mir nun schon des Öfteren auf, dass man vieles von dem, was sie sagte, nicht für bare Münze nehmen konnte. Auf Nachfragen relativierte sie so gut wie jede Äußerung, weil sie sich nicht festnageln lassen wollte. Bisher hatte ich mir nichts bei diesem Gehabe gedacht, aber den Schwindel mit dem Lieblingslokal nahm ich ihr nun doch übel. Sie merkte es und versuchte, es als Scherz abzutun. Ich konnte aber ein ungutes Gefühl dabei nicht unterdrücken. Im Grunde war es eine lächerliche Kleinigkeit, aber ich fragte mich, was von ihrem Gerede man überhaupt noch ernst nehmen konnte.
Wir hatten bis dahin sehr locker und entspannt geplaudert. Wenn ihr die eine oder andere Frage zu persönlich wurde, sodass sie darüber nicht sprechen wollte, ließ ich sie wieder fallen, und so war es uns gelungen, alle Klippen zu umschiffen. Nun vertieften ihre Versuche, ihre Schwindelei vergessen zu machen, meine Verstimmung nur noch weiter. Ich konnte es mir selbst nicht erklären, bei jeder anderen Frau wäre mir das egal gewesen, doch von ihr fühlte ich mich getäuscht. Unsere Unterhaltung begann daraufhin zu stocken und kam nicht mehr in Gang. Der Abend mit ihr schien unter keinem guten Stern zu stehen. Nicht, dass ich was Besonderes erwartet hätte, aber so hatte ich es mir auch nicht vorgestellt. Aus Verlegenheit holte sie ein Zigarettenetui aus ihrer Handtasche. Dann fragte sie, ob es mich störe, wenn sie rauchte, was ich verneinte. Doch weil sie den Rauch danach immer so betont mit der Hand von mir wegwehte, entstand bei mir noch mehr als zuvor der Eindruck, dass sie mich auf Distanz halten wollte. Außerdem redete sie, seit sie rauchte, überhaupt nicht mehr mit mir.
Nachdem sie ihre Zigarette ausgedämpft hatte, fragte sie, ob ich schon gehen wolle. Ich hätte tatsächlich nichts dagegen gehabt, aufzubrechen, aber ich wollte mich nicht auf diese Weise von ihr trennen. Ich gab daher die Frage zurück, doch sie versicherte mir, sie fühle sich in meiner Gesellschaft wohl und hätte schon lange keinen so schönen, anregenden Abend mehr verbracht. Offensichtlich war auch das eine Lüge, aber wie sollte ich ihr das zum Vorwurf machen, schließlich meinte sie es gut und wollte mir nur etwas Freundliches sagen.
In dem Moment kam das Dessert. Scherbett mit Mangogeschmack, und die Nachspeise war das Beste am heutigen Abendessen. Ihr widersprüchliches Verhalten bewog mich schließlich zu der Bemerkung, dass ich mich bei ihr nicht auskennen würde. Ich hätte ihr schon so viel über mich erzählt, wüsste bis jetzt aber noch gar nichts von ihr. Sie gab sich verwundert und fragte: Warum denn? Sie wirkte echt betroffen, aber wie mir schien weniger darüber, nicht aufrichtig genug gewesen zu sein, sondern weil sie ihre Rolle als Unterhalterin nicht gut genug gespielt hatte. Sie beeilte sich, ihrenFauxpaszu korrigieren, indem sie sagte, ihr Interesse für mich hätte sie vergessen lassen, mehr von sich zu erzählen. Da unsere Bekanntschaft aber noch sehr jung wäre, ergäbe sich sicher dazu noch Gelegenheit.
Und dann zählte sie auf, welche Orte sie in nächster Zeit mit mir gern besuchen würde. Einen angeblich tausend Jahre altenKeyaki-Baum im Hof ihrer ehemaligen Schule wollte sie mir zeigen und dann mit mir in die Berge fahren, um eine alte Tempelanlage zu besichtigen. Es gäbe auch einen Kratersee in einem erloschenen Vulkan, den wir uns an einem schönen Tag ansehen könnten. Und im Frühling zur Kirschblüte wollte sie mit mir einen Park besuchen, wo sie als Kind oft mit ihren Eltern spazieren gegangen war. Dabei blickte sie mich erwartungsvoll an und wirkte, als sähe sie all diese Ausflüge schon im Geiste vor sich. Ich sagte, ich würde mich darauf freuen, aber sie bräuchte für mich nicht die Fremdenführerin zu spielen, ich wünschte mir nur etwas mehr Offenheit von ihr.
Darauf verfiel sie erneut in Schweigen, und ihr Blick schweifte gedankenvoll ins Leere. Das künstliche Lächeln, das sie fast den ganzen Abend zur Schau getragen hatte, verschwand, ihre Miene nahm einen melancholischen Ausdruck an. Es umgab sie für kurze Zeit eine Aura tieftrauriger Einsamkeit, als würde ihr erst in diesem Augenblick bewusst, welcher Graben uns trennte. Doch dann fasste sie sich wieder und sah mich an, als ob ihr etwas auf der Zunge läge. Gespannt wartete ich darauf, was sie sagen wollte, allerdings blieb sie stumm und sprach das, was ihr durch den Kopf ging, nicht aus.
Ihr eigenartiges Mienenspiel verriet aber mehr als Worte. Es offenbarte mir, dass ihr stetiges Lächeln, so liebenswürdig ich es auch empfand, nichts anderes als eine Maske war. Nun hatte sie ihre Maskierung kurz fallen lassen und mir doch ein wenig von ihrem Inneren gezeigt. Und auch wenn sie sich nicht dazu durchringen konnte, auszusprechen, was sie bewegte, fasste ich doch wieder Vertrauen und fühlte mich ausgesöhnt mit ihr.
Nach der letzten Tasse Tee standen wir auf und verließen das Lokal. Draußen schneite es leicht, und sie bot mir an, mich in ihrem Wagen mitzunehmen. Alle Schäden von der Fahrt durch den Wald vor zwei Wochen waren beseitigt, er blitzte aus- und inwendig. Als ich sie, nachdem wir eingestiegen waren, darauf ansprach, erzählte sie mir, dass ein Bekannter von ihr das Auto nicht nur durch eine Waschstraße geschickt, sondern auch alle Kratzer an der Karosserie beseitigt hätte. Als ich fragte, wer denn der Bekannte wäre, sagte sie, der Besitzer einer Werkstatt, er hätte ihr das Auto vor einem Jahr günstig überlassen. Sonst sprachen wir während der Fahrt nicht viel, und als sie mich an einer Kreuzung aussteigen ließ, fiel der Abschied kurz und förmlich aus. Ich hatte sie eigentlich noch fragen wollen, wann wir uns wiedersehen könnten, aber dazu ergab sich keine Gelegenheit mehr.
Als ihr Wagen im Dunkeln verschwand, blieb ich mit einem zwiespältigen Gefühl zurück. Allem Anschein nach hatte sie es eilig, aber sie hatte mir nicht sagen wollen, wohin sie zu dieser späten Stunde noch fuhr. Auf dem Heimweg war sie nicht, hatte sie etwa mit jemand anderem noch eine Verabredung? Ich wollte nicht daran denken, aber das half mir nichts. Die Verstimmung, die ich im Lauf des Abends schon einmal gespürt hatte, kehrte wieder, und nun mischte sich darein auch ein Gefühl der Eifersucht.
Ich hatte noch ein Stück zu meiner Wohnung zu gehen. Während ich unterwegs war, musste ich die ganze Zeit an sie denken. Ich empfand den Heimweg im abendlichen Schneefall als sehr stimmungsvoll und versuchte, nur das Schöne dieses Abends im Gedächtnis zu behalten, alle anderweitigen Gedanken abzuschütteln, doch das gelang mir nicht. Es bemächtigte sich meiner ein Gefühl der Verlorenheit. Und als ich zu Hause das kalte, einsame Zimmer betrat, verstärkte sich diese triste Stimmung noch. Ich hatte mich auf den Abend mit ihr gefreut, weil ich hoffte, aus unserer Bekanntschaft könnte mehr werden. Nun schien es mir, als wäre nach dem ersten Mal schon alles aus.
Zwar hatte ich keinen Grund zum Pessimismus, sie hatte nichts davon gesagt, dass es kein Wiedersehen geben würde. Im Gegenteil, sie hatte sogar Vorschläge gemacht, was wir alles zusammen unternehmen könnten. Hieß das nicht, dass sie unsere Bekanntschaft fortsetzen wollte? Aber vielleicht war das auch nur so dahingesagt, da konnte man bei ihr nicht sicher sein. In einem ersten Impuls wollte ich sie auf der Stelle anrufen, um gleich ein Treffen mit ihr zu vereinbaren, aber dann ließ ich es doch bleiben. Ich fürchtete, ihr lästig zu fallen, oder schlimmer noch: mich vor ihr lächerlich zu machen.
***
Von Tokyo aus gelang es mir nicht, Genaueres in Erfahrung zu bringen. Erst als ich über Neujahr und dann in den Semesterferien bei meiner Familie war, bekam ich die Gerüchte zu hören, die inzwischen kursierten. Trotzdem blieb es mir noch lange ein Rätsel, was sich zwischen ihm und ihr abgespielt hatte. Wie das Ganze anfing, erfuhr ich erst viel später, und zwar aus einem Zeitungsbericht. Darin fanden sich dann auch noch andere Einzelheiten darüber, in was für gefährliche Kreise er mit ihr geraten war.
Hellhörig hätte ich schon werden können, als die Tante davon sprach, dass er von einem Tag auf den anderen bei ihr ausgezogen war. Dass damals bereits das Unheil seinen Lauf nahm, ahnte aber auch mein Bruder nicht. Er hatte nur erzählt, der Trainer wäre mit dem neuen Schüler unzufrieden gewesen, weil der das Training zu vernachlässigen begann. Er hatte ihn im Dôjô





























