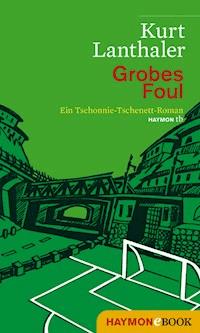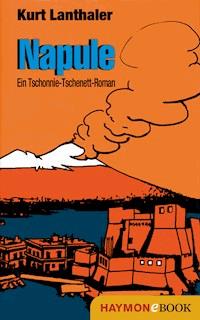Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Tschonnie-Tschenett-Roman
- Sprache: Deutsch
TSCHONNIE TSCHENETTS ERSTES ABENTEUER - DER STARTSCHUSS ZU KURT LANTHALERS KULT-KRIMI-REIHE. Eine alte Tunnelbauregel besagt: Jeder Kilometer fordert einen Toten. In Kurt Lanthalers Kult-Krimi ist die Leiche schon vor dem Tunnel da: Bei Bauarbeiten für einen Eisenbahntunnel am Brenner wird aus dem massiven Felsen eine Leiche freigesprengt. Keiner kann sich erklären, wie sie dorthin gekommen ist. Die einzigen Hinweise liegen im Aktenkoffer des Toten. Und den hat Tschonnie Tschenett, Aushilfs-LKW-Fahrer mit dem Hang, seine Nase in allerlei obskure Dinge zu stecken. Kein Wunder, dass er sich und seine Freunde auch diesmal in Schwierigkeiten bringt. Schon bald bekommt es Tschonnie Tschenett mit Grundstücksspekulanten, Nazis und anderen üblen Gesellen zu tun. Und entdeckt, dass große Bauvorhaben lange Schatten vorauswerfen - eine Ahnung, die sich mit dem Baubeginn des Brennerbasistunnels über 15 Jahre nach der Erstauflage nur bestätigen lässt. WEITERE KRIMIS AUS DER TSCHONNIE-TSCHENETT-REIHE: - Der Tote im Fels - Grobes Foul - Herzsprung - Azzurro - Napule LESERSTIMME: "Der Antiheld Tschonnie Tschenett nimmt gemeinsam mit seinem Kumpel dem Dorfpolizisten Beweismaterial vom Fundort in Augenschein und verstrickt sich immer weiter in einen Mordfall. Bis er selbst versucht den Fall zu lösen. Skurril, schräg und lesenswert!" "Dieser Krimi macht das Italienische in Südtirol rund um den Brenner spürbar. Italienische Redewendungen lockern den Krimi auf und sorgen für eine gehörige Portion Lokalkolorit. Sehr unterhaltsam!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Kurt Lanthaler
Der Tote
im Fels
Ein Tschonnie-Tschenett-Roman
Mit einem aktualisierten Glossar
Hinweis
Vom Autor vollständig neu durchgesehene, überarbeitete und erweiterte Taschenbuchausgabe.
Ähnlichkeiten mit lebenden und verstorbenen Personen, Zuständen und Geschehnissen sind zufällig.
Widmung
Für Berta
1
Als ich ihn zum ersten Mal sah, war er tot.
Als ich ihn zum zweiten Mal sah, war er immer noch tot. Und mir ziemlich gefährlich geworden.
In den Tagen dazwischen sollte ich, nicht ganz unfreiwillig und nicht eben im Zustand völliger Unschuld, noch anderes zu sehen bekommen. Genug, um weder die Toten noch die Lebenden zu beneiden.
Der hier war einfach tot. So weit vom Leben entfernt wie sonst nie. Aber was konnte man von dem Mann auch anderes verlangen.
Sie hatten soeben fünf Kubikmeter bestes, massives Alpengestein abgesprengt in diesem Tunnel. Dazu waren sie schließlich da. Man hatte sie ins Pflerschtal geschickt, um ein Loch durch den Berg zu wühlen. Einen Tag nach dem anderen. Sie hatten den Berg mit kleinen Nadelstichen angebohrt, Sprengstoff hineingestopft. Und die Löcher scharf gemacht. Dann war der Tunnel geräumt worden. Die Druckwelle hatte Staub die Röhre hinausgeblasen. Entwarnung. Sie waren eingerückt, um das Gestein abzubauen. Der Hund am Nachbarshof beruhigte sich wieder. Bis zum nächsten Mal.
Ich hatte das oft genug miterlebt auf dieser Tunnelbaustelle. Weil ich mir hier schon oft genug die Füße platt getreten hatte. Bestellt, und nichts zum Abholen da.
Es ist immer dasselbe, langweilige Spiel. Wenn die Fuhrunternehmer einen wie mich überhaupt anheuern, dann nur, weil sie mit ihren Terminen in ärgsten Schwierigkeiten sind. Dann nehmen sie sogar so ungeliebte Idioten wie mich. Hauptsache, einer schafft es auf die Zugmaschine. Wie, ist egal. Einen solchen Job anzunehmen bedeutet: heute laden, vorgestern abliefern. Und dann bringt irgendein Büromensch die Termine durcheinander. Und man steht gratis und stundenlang neben einem leerenLKWund wartet darauf, daß sie ihn endlich volladen.
An sowas gewöhnt man sich. An anderes nicht.
Diesmal gab es Geschrei. Und alles lief. Richtung Tunnel.
Es ging mich eigentlich nichts an. Aber ich kannte einige der italienischen Arbeiter hier ziemlich gut. Vom Kartenspielen her. Also lief ich mit in die Tunnelröhre hinein. Gute fünf Minuten. Ein dunkles Loch. Als wir endlich angekommen waren, lag, am Ende des Tunnels, unter kniehohen Steintrümmern, ein Mann im schwarzen Anzug. Lag da, wo eigentlich nur freigesprengter Felsen liegen sollte.
Viel war von dem Mann zuerst nicht zu sehen. Die Arbeiter räumten mit bloßen Händen die kleineren Felsbrocken zur Seite. Ich wollte mich nicht einmischen, hier waren sie zuständig. Zeit genug für mich, um genauer hinzuschauen.
Das, was man von dem Mann jetzt erkennen konnte, sah nach einem Abspüler mit dazugehöriger fünfzehnjähriger Karriere in der transalpinen Hotellerie aus. Hoffnungslos gezeichnet. Und er trug immer noch seinen Erstkommunionsanzug. Seit zwanzig Jahren. Gestreift, und an den Ärmeln um ein paar Zentimeter zu kurz. Das Gesicht war staubbedeckt. Wie das einer reichlich alternden Dame von einer dicken Puderschicht überzogen. Ich kannte ihn nicht.
Es war wie immer: Angesichts eines Toten wurde ich ruhig; und wurde die Kotzgefühle nicht los.
„Himmel“, sagte ich, „wozu denn das?“
„Dai Tschenett, non gridare“, sagte Santini, der Vorarbeiter, hinter mir.
In der feuchten Dunkelheit hier drin hatte ich ihn noch gar nicht bemerkt.
Non gridare, dachte ich. Und ob, Santini. Immerhin hatte ich vor ein paar Tagen genug Geld an ihn verloren, um hier tagelang herumschreien zu dürfen.
„Non serve a niente“, sagte Santini, „bringt nichts.“
Dasselbe hatte er gesagt, als ich mir Geld leihen wollte, um weiterspielen zu können. Für einen Italiener kann Santini verdammt trocken sein. Diesmal mußte ich ihm recht geben. Hier konnte wirklich nichts mehr helfen. Jedenfalls nicht im Augenblick.
Der Tote hatte einen Aktenkoffer in der Hand. Nicht einmal mehr sterben schien man zu können ohne diese grauslichen Dinger.
Die Arbeiter versuchten, mit Stangen die größeren Felsbrocken zu bewegen, um die Leiche frei zu bekommen. Wenn man dem Toten nicht alle Knochen brechen wollte, war das eine verdammt komplizierte Angelegenheit. Und aus irgendeinem Grund wollten sie ihn so unbeschädigt wie möglich da herausbekommen. Vielleicht war es einfach ihre Art von Mitleid.
Die Luft war feucht hier drin und warm. Man schwitzte vom Nichtstun. Ich jedenfalls. Es war mir ein Rätsel. Was wir alle nicht verstanden: Wie, verdammt, wie war der Tote in den Fels gekommen?
„Bestia. Quà qualcuno cerca di fotterci“, sagte Santini, der Vorarbeiter. „Irgendwer scheißt uns hier an.“
Weiter draußen im Tunnel hatte es vor Monaten Schwierigkeiten gegeben, weil ihnen bei den Bohrarbeiten ein ganzer Bach entgegengekommen war. Dafür fehlte der PflererSonnseiten dann plötzlich das Wasser. Was deswegen besonders schlimm war, weil man nun gezwungen war, Schattseitwasser zu trinken. Und das, da waren sich die Leute auf der Sonnseiten einig, schmeckte nach gar nichts.
Aber das hier war etwas anderes. An der Stelle, wo sie heute gesprengt hatten, war der Fels so massiv gewesen, wie man es sich als Tunnelbohrer nur wünschen konnte.
Es war eine etwas eigenartige Situation. Da standen an die fünfzehn Männer in einem halbfertigen Tunnel. So weit im Berg drin, wie sie sich wie die Maulwürfe in den letzten Monaten hineingearbeitet hatten. Und ich, ein verhinderter Aushilfs-LKW-Fahrer, stand dabei. Vor uns der eben abgesprengte Steinhaufen. Und mittendrin eine Leiche.
Die Tunnelbauer hatten bei ihrer Arbeit schon Tote gesehen. Ich auch. Dieser hier fiel etwas aus der Reihe.
So Scheißunfälle wie der am 1. Mai, vor genau einer Woche, saßen ihnen allen noch lange in den Knochen. Es hatte einigen Ärger gegeben, damals. In den Wohnbaracken der Tunnelarbeiter war viel geredet worden, heftig und laut. Natürlich wollten sie sich ein Haus bauen mit dem Scheißgeld, das hier zu verdienen war. Aber ein Toter braucht kein Haus.
Und dann waren plötzlich alle aus ihren Löchern gekommen und über sie hergefallen, genau einen Tag lang: Polizei, Carabinieri, das Arbeitsinspektorat und ein Arbeiterpriester. Ein paar Stunden lang war sogar die Gewerkschaft laut geworden und hatte eine blasse Schmalbrust geschickt, die in einem früheren Leben einmal einen zweifingerdicken Schrieb über Arbeitssicherheit verfaßt haben mußte. Ohne sich dabei auch nur den Zeigefinger zu verstauchen.
Die Firma hatte sich auf das Schicksal hinausgeredet, als ob es Teil des Arbeitsvertrages wäre. Und ansonsten nicht die geringste Schuld an sich entdecken können. Wie auch. Scheiß Schreibtischhocker. Mehr hatte man hier für die nicht übrig.
Die Arbeiter wußten, daß die Höhe ihres Gehaltes auch etwas damit zu tun hatte, daß das hier immer wieder zu einem Höllenjob werden konnte. Aber verheizen ließ man sich ungern. Und daß einer von ihnen ausgerechnet an einem 1. Mai jämmerlich von einem Felsbrocken erschlagen worden war, war dann doch zuviel. Außerdem hatte der Unfall einen unangenehmen Beigeschmack von Unausweichlichkeit gehabt. Etwas von einem Gottesurteil. Von einem Menschenopfer. Mitten in der Arbeit hatte sich von der Tunneldecke eine metergroße Felsplatte gelöst. Und war zentimetergenau auf den Arbeiter geknallt.
Man hatte den Zeitdruck ganz einfach auf sie abgewälzt. Und der hatte einen von ihnen unter sich begraben.
Jahrelang waren die Tunnelbauarbeiten wegen politischer Kungeleien verschleppt worden. Die Politiker hatten sich aufgeführt, als hätten sie es mit einem Jahrhundertwerk zu tun. Dabei ging es eigentlich nur darum, einen neuen Eisenbahntunnel zu bauen. Der alte war an die hundert Jahre alt. Die k. u. k. Ingenieure hatten damalseine unterirdische Schleifedurch das Pflerer Tal gezogen, um den hustenden Dampflokomotiven die Arbeit auf dem Anstieg zum Brenner zu erleichtern. Mit einer Steigung von 23 Promille und Kurvenradien von bis zu 229 Metern.
Für das moderne Europa war das zuviel und zuwenig. Der neue Tunnel sollte einen größeren Radius bekommen, um höhere Geschwindigkeiten und den huckepack genommenenLKWsüberhaupt erst ein Durchkommen zu erlauben. So einfach war das. Eigentlich. Und unter normalen Umständen. Gekommen war es ganz anders.
Was Tunnels anbelangte, war man etwas heikel hier in der Gegend. Geplant war seit gut dreißig Jahren eigentlich einer, der tief unten im Berg den Brennerpaß unterlaufen sollte. Das Problem dabei war vor allem,daß der Brennerpaß zugleich auch Grenzübergang war. Und nicht nur irgendeiner. Sondern ein tirolischer, und ein italischer, und wer weiß was noch. Und einen solchen Grenzübergang einfach so zu untertunneln, war anscheinend nicht möglich. Jahrelang hatten sie sich gerauft und hinten und vorn intrigiert. Und dafür und dagegen. Und wenn es schon einmal gegen die Tunnel ging, dann lieber gleich gegen alle. Auch gegen den Pflerer. 1988 sollte er eigentlich schon fertiggestellt sein und die Kleinigkeit von 90Milliarden Liregekostet haben. Jetzt schrieben wir das Jahr 1991, und wann der Tunnel fertig werden würde,stand in den Sternen.
Im letzten Jahr hatten sie es dann plötzlich eilig gekriegt mit dem Tunnel. Höchstwahrscheinlich aus denselben Gründen, aus denen man vorher dagegen gewesen war.
Nach dem Unfall hatten ein paar von ihnen einen Streik versucht. Umsonst. Die Gewerkschaft war verschwunden. Ich hatte der FirmaM-Bau, zu gleichen Teilen aus Protest wie Unlaune, zwei Fuhren abgesagt. Daraufhin hatte mich dieM-Bau-Chefin einen sturen Hund genannt. Kann sein, daß sie recht hatte. Ich weiß es nicht.
Ich wußte auch jetzt nicht unbedingt, was ich tat. Es hatte mich niemand hierher geschickt. Ich hätte draußen an meinemLKWwarten können. Bis sich die Aufregung gelegt hatte. Statt dessen stand ich in einem Tunnel. Und vor mir lag eine Leiche.
Vielleicht war mir die Fahrerei zu langweilig geworden. Vielleicht war mir in dieser Alpenrosengegend auch einfach zuwenig los. Oder zuviel. Und ich hatte die Kontrolle verloren, über mich. Aber wann hat man die schon.
Sie arbeiteten sich behutsam vor. Als ob der hier noch am Leben wäre. Während die Arbeiter wieder einen Felsbrocken zur Seite räumten, kam der Aktenkoffer langsam zum Vorschein. Wir hatten hier also nicht nur eine Leiche im schwarzen Anzug gefunden, die nicht älter als ein paar Tage sein konnte. Sondern in deren Hand auch noch einen Aktenkoffer. Aus Leder.
Hier, wo ringsherum bis vor kurzem noch massiver Fels gewesen war, und sonst nichts. Und über unseren Köpfen ein Berg, der auf gut 2000 Meter Höhe kam. Oben lag noch jede Menge Schnee. Schließlich hatten wir grad Anfang Mai.
Ich hatte das deutliche Gefühl, daß hier etwas nicht stimmte. Ich wußte nur noch nicht, was.
Die Tunnelarbeiter hatten den Koffer bisher nicht gesehen, weil sie zu sehr damit beschäftigt waren, die Leiche freizuräumen. Oder er interessierte sie einfach nicht. Vielleicht aber wußten sie auch nur zu genau, was sie taten. Keiner sagte etwas, als ich der Leiche den Aktenkoffer aus der Hand nahm. Zwei Finger waren noch einigermaßen fest um den Handgriff geschlungen. Ich zog mit einem Ruck am Koffer; es ging.
Die Arbeiter machten sich daran, die Stelle gegen einen Einsturz abzusichern.
„Meglio che tu te ne vai“, sagte Santini, der Vorarbeiter, zu mir. „Du gehst besser.“
Er war plötzlich wieder in meinem Rücken aufgetaucht. Und blendete mich jetzt mit seiner Stirnlampe. Nur gut, daß ich ihn vom Kartenspielen her genau kannte. Er war immer so. Kurz angebunden, manchmal undurchschaubar. Santini drehte die Lampe nach oben und sah mich an. Den staubigen Aktenkoffer in meiner Hand konnte er nicht übersehen haben.
„Non vorrei, che ti trovassero qua. Geh. Ich möchte nicht, daß man dich hier findet. Vai.“
„Già“, sagte ich. „Giusto quello che volevo fare. Bin schon weg.“
Und ging. Dem Tunnelausgang zu.
Es mußte wirklich nicht sein, daß mich irgendeiner dieser Ordnungshüter hier antraf. Ich hatte schon genug Ärger gehabt mit denen. In früheren Zeiten. Das sollte reichen. Und eigentlich wollte ich die nächsten Wochen und Monate so ruhig wie möglich verbringen. In meinem Alter war das auch zu verstehen. Gut achtunddreißig Jahre waren Grund genug, sich einen warmen Platz hinterm Ofen zu suchen. Nur hatte ich immer Pech dabei. Meistens saß da schon einer. Und tat unschuldig.
2
Langsam kam mir etwas frische Luft entgegen. Ich war froh, wieder aus dem Loch herauszukommen. Licht, Luft, und das bißchen Sonne, das zur Zeit schien. Sonst sind mir solche Dinge ziemlich egal. Aber die letzte halbe Stunde in dem warmfeuchten Tunnel hatte mir gereicht. Luft also gut, aber Sicht schlecht. Meine Augen mußten sich erst an die Helligkeit gewöhnen.
„Tschenett, dich wollte ich hier eigentlich überhaupt nicht sehen.“
Das war im Umkreis von mindestens fünfundzwanzig Kilometern der fähigste Carabiniere. Sagte er. Prackwieser, ein Gesicht wie der Name, den er trug. Und eine ziemlich gesprenkelte Laufbahn. Aber was dieses Thema betraf, durfte ich selbst auch nicht allzuviel lästern.
„Gleich werden Sie überhaupt keinen mehr sehen wollen, Chefinspektor.“
Chefinspektor mochte er gar nicht.
Er war mir nie sehr sympathisch gewesen. Ohne besonderen Grund. Einfach so. Höchstwahrscheinlich hatte er nicht einmal Schuld daran, auch wenn er mich ein paarmal recht unsanft behandelt hatte. Aber dazu war er ja einKarpf. Auch so Heinis, die nur Geld kosten. Und Ärger machen. Völlig überflüssig. Vielleicht sollte ich’s ihm einfach verraten. Daß ich vor ihm dagewesen war.
„Falls Sie’s noch nicht erfahren haben: Da drinnen liegt eine Leiche und wartet auf Sie.“
„Das ist gar nicht nett, Tschenett.“ Wenn er bös wurde, fing er an zu reimen. Und hielt das dann für Humor. „Vorsicht“, sagte er.
„Beeilen Sie sich lieber“, sagte ich und wollte gehen, „sonst haut Ihnen die Leiche noch ab.“
In dem Bereich, das wußte ich zu genau, war er etwas empfindlich. Vor zwei Jahren war ihm einmal ein Mißgeschick passiert.
„Einen Augenblick noch, Tschenett“, sagte Prackwieser und setzte eines seiner übleren Gesichter auf. „Was suchst du denn eigentlich hier?“
„Arbeit“, sagte ich und ging.
Einen trinken gehen ist schließlich auch Arbeit.
Auf der Baustelle stand erst einmal alles still. Soviel war sicher. Bis die mir denLKWmit ihren Bohrkronen und Gestängen vollgeladen hatten, konnte noch ein Tag vergehen. Überhaupt bei dem uniformierten Durcheinander, das jetzt unweigerlich auftauchen würde, um die Ordnung zu hüten. Es war kaum anzunehmen, daß ich mich heute noch nach Steyr auf den Weg machen konnte. Um Steyr war’s nicht schade. Außer Nutten gab es da nichts Anständiges.
Ganz verloren stand er da, der Carabinieribrigadier Prackwieser. Ein halbes Stück Mensch, zwischen Aushub und Baumaschinen. Und war er beleidigt. Vielleicht war ich doch zu grob gewesen zu ihm. Schließlich war er der kleinste Fisch unter seinesgleichen. Obwohl seit fünfzehn Jahren Carabiniere, hatte er in seinem Verein rein gar nichts zu sagen. Erstens war er nicht verschlagen genug, zweitens kein Italiener. Dafür einer, der bei jedem Viehhandel über den Tisch gezogen wird. Und ich hatte ihn Chefinspektor genannt. Fast tat er mir schon wieder leid. Höchstwahrscheinlich dachte er darüber nach, was zu tun sei. Und denken ließ es sich am besten, solang er an sein blaues Dienstauto gelehnt dastand. Mehr als einenFIATPanda hatte es nicht getragen, für ihn. Traurig sah er aus.
Prackwieser allerdings war nur die Voraustruppe. Das wußte ich. Bedeutende Fälle hatten sie ihm schon seit langem keine mehr gelassen. Und sobald hochnotpeinliche Persönlichkeiten in irgendeine Sauerei verwickelt waren, mußte er froh sein, wenn er wenigstens die Autotüren aufhalten durfte. Und hier, das sagte mir irgendein Gefühl, würde sich bald herausstellen, daß man es mit einem komplizierten Fall zu tun hatte. So oder so. Und auch dafür war Prackwieser nicht der Richtige. Außer man brauchte einen Dummen.
Die vier Leute, die in der Bürobaracke saßen, werkelten mit ihren Papieren, als wüßten sie gar nicht, was sonst in der Welt alles vorgefallen war.
„Ich fahr in die Bar hinaus. Ruft halt an, falls es heut noch klappt mit der Ladung“, sagte ich und grinste sie bös an.
„Mach uns nicht schlechter, als wir sind“, sagte einer der grauen Schreibtischmäuse. „Uns ist gesagt worden, du und deinLKW, ihr kommt erst morgen.“
„Gesagt worden. Blöd reden den ganzen Tag und dann sich wundern, wenn nichts Gescheites rauskommt.“
„Das waren die indeinemBüro, wennschon, die den Fehler gemacht haben, ja?“
Jetzt wurde mir’s langsam zuviel.
„Ich“, sagte ich und haute ihm so ordentlich auf seinen Schreibtisch, daß ein paar Zettel durcheinanderflogen, „ich hab kein Büro. Oder schau ich so aus?“
„Tschenett“, sagte der Fette, der sich Bürovorsteher nennen ließ und, seit er es in einem alten Schinken gesehen hatte, Ärmelschoner trug, „Tschenett, mach uns hier nicht schon wieder einenPuff. Verstanden? Diesmal hol ich die Polizei. Ich sag’s dir.“
Als Zeichen meines guten Willens fing ich an, den von mir arg verunstalteten Schreibtisch zu ordnen. Und ließ mir Zeit damit. Die Schreibtischmaus sah mich gequält an. Er würde Stunden brauchen, um sich in seinem Zettelwerk wieder zurechtzufinden. Hatte er wenigstens eine Lebensaufgabe, und seinen Enkelkindern was zu erzählen.
„Die Polizei, Herr Bürovorsteher“, sagte ich, „die Polizei ist schon da.“
Es war sinnlos, sich auf eine Diskussion einzulassen. Ich kuppelte den Hänger ab und fuhr mit der Zugmaschine langsam die Kurven talauswärts.
Die ganze Geschichte kostete mich nur Geld. Ich hätte längst schon auf Fahrt sein können.
Wenn so einer wie ich eine Fuhre übernimmt, rechnet sich Zeit in Geld um. Aushilfsfahrer werden überhapsbezahlt. Egal was passiert. Auch wenn nichts passiert, wie jetzt, weil sie die Bohrgestänge, die ich mitnehmen sollte, noch gar nicht abmontiert hatten. Man mußte nicht hinterm Geld her sein, um zwischendurch auf die Uhr zu schauen. Wenn einer seinen Hintern schon aufhebt, um zu arbeiten, dann soll es wenigstens bald vorbei sein. Bis jetzt sah’s mau aus damit.
Das einzige, was ich mir heute in knapp vier Stunden erarbeitet hatte, war ein brauner Lederkoffer mit unbekanntem Inhalt. Und sogar der war sozusagen gestohlen. Einer Leiche. Und lag jetzt hinter dem Sitz meiner Zugmaschine.
In der ersten Kurve kam mir eine der Fahrerinnen derM-Baumit ihremLKWentgegen. Mehr auf meiner Seite als auf ihrer. Zwei Frauen hatte dieM-Bauinzwischen auf dem Bock sitzen. Eine Blonde und eine Schwarze. Fuhren wie die Teufel, und sahen noch besser aus.
Gottseidank war ich nur mit der Zugmaschine unterwegs. Es wurde auch so knapp genug. Die Straße war verdammt eng hier. Bis jetzt war’s immer gutgegangen. Zweimal hatte einLKWeinenPKWvon der Straße geschoben. Zivilisten. Mehr war nicht passiert. Mit meinem Hänger dran wär’s knapp geworden. Für beide höchstwahrscheinlich. Genauer weiß man es vorher nie. Sie hatte die Hand gehoben, ich hatte mit den Fingern gewinkt. Die festangestellten Fahrer derM-Bauverzichteten meist darauf, wenn wir uns auf der Strecke trafen. Für sie gehörte ich nicht dazu. Mir sollte es recht sein. Solang man mich in Ruhe ließ.
Zwei Kurven weiter kamen mir die Ordnungshüter entgegen. Drei blitzblaue Carabinieri-Wagen. Sirene, Blaulicht. Ich konnte mir die Lichthupe nicht verkneifen. Sollten sie denken, was sie wollten. Sie wußten noch gar nichts. Nicht, was sie im Tunnel erwartete. Und nicht, daß sie dort nur mehr die Hälfte finden würden. Die uninteressantere.
Vielleicht war ja auch gar nichts in dem Koffer. Nichts, was die Sache erklären würde. Den Toten. Und die mißliche Lage, in der er sich immer noch befand, mitten im Berg. Mir war das gleichgültig. Ich wollte nichts. Nicht unbedingt. Schließlich war ichLKW-Fahrer. Aushilfsweise. Und sonst gar nichts. Ich hatte es gar nicht eilig, das schwarze Ding zu öffnen. Hauptsache, ich hatte es. Irgend etwas würde dann schon passieren.
3
Bei Berta war, wie immer, kein Parkplatz mehr frei. Es gab nur einen.
Ich stellte meine Zugmaschine einfach an den Straßenrand. Sehr unvorschriftsmäßig. Einen Vorteil haben diese Geräte auf jeden Fall: sie werden selten abgeschleppt.
„Einen Roten“, sagte ich.
Bertas Bar ist bereits bei fünf Gästen hoffnungslos überfüllt. Meistens waren es ein, zwei mehr. Dabei konnte man hier nicht einmal einen Espresso trinken. Berta hatte früher einmal eine Maschine gehabt. Geschenkt bekommen von einem Sterzinger Gastwirt, weil sie so alt war, daß ihm die Piefkes immer erschrocken davongelaufen waren, alldieweil der alte Schrotthaufen einen höllischen Krach machte, wenn er eingeschaltet wurde. Bei Berta hatte die Espressomaschine dann nach ein paar Wochen den Geist aufgegeben. „Weil sie das Pflerer Wasser nicht vertragt“, hatte Berta gesagt.
Eine Bar ohne ordentlichen Kaffee war für einenLKW-Fahrer eigentlich unmöglich. Trotzdem waren dieLKWler Bertas treueste Gäste. Und ein paar alte Bauern, die hier nicht vorbeifahren konnten, ohne anzuhalten. Auf den betreffenden Höfen und beim Gossensasser Pfarrer war Bertas Bar gar nicht beliebt.
Als ich das dritte Glas Roten bestellte, sagte Berta: „Ich denke, du fährst.“
Stützte sich am Pudelauf, und schaute mich an. Wenn Berta schaute, taten sich ganze Löcher im Erdboden auf.
„Woll“, sagte ich.
„Wenn schon einmal eine Fuhre kriegst“, sagte Berta und hatte gar nicht vor, nachzugeben, „wenn schon einmal eine Fuhre kriegst, dann fahr sie auch.“
Man konnte ihr nicht bös sein. Da stand sie, ruhig und rund, hinter ihrem Pudel, und zog einem gestandenen Mannsbild die Ohren lang.
„Berta“, sagte ich, „es ist alles ganz anders.“
„Nicht schon wieder“, sagte Berta und schenkte mir Wein nach.
Bertas Bruder hatte das Haus gebaut, vor zwanzig Jahren mindestens. In dieses dunkle Loch direkt an der Straße. An der schmalsten Stelle im ganzen Pflerer Tal. Hinterm Haus hatte sich der Wald in die Felsen gekrallt. In der Hoffnung, nicht abzustürzen. Bertas Hennenstall hätte mindestens dran glauben müssen. Neben der Straße war grad noch Platz für den Pflerer Bach. Wenn er überging, was er regelmäßig tat, da konnte die Wildbachverbauung tun, was sie wollte, stand die Straße unter Wasser, und in Bertas Keller schwammen die Marmeladegläser. Den Rest der Zeit war’s hier nur feucht und hinterschattig. Im Winter gab es Tage, wo die Sonne gar nicht zukam.
Aber dafür hatten sie, jahrein, jahraus, den Tribulaun vor sich. Eine Felsenpyramide, die sich steil in den Himmel reckt. Einmal war sie hinaufgeklettert, hatte mir Berta erzählt. Mit ihrem Verlobten, der ein ganz ein wilder Kraxler gewesen war. Das hatte ziemlich einen Aufstand gegeben im Tal, weil damals höchstens die jungen, feinen Damen, die in den Gossensasser Kurhotels abgestiegen waren, auf den Berg gingen. Und dann gleich der Tribulaun, vor dem sogar die Einheimischen einigen Respekt hatten. Der Verlobte war ein paar Jahre später, wie er mit einem Herrischen in der Tribulaun-Wand eine neue Route aufmachen sollte, abgestürzt. „Weil sich der Herrische blöd angstellt hat“, hatte Berta gesagt. Und war sich ganz sicher gewesen dabei. Und hatte trotzdem ihrem Verlobten die Schuld gegeben. „Herrische stellen sich immer blöd an. Das muß einer wissen, wenn er mit ihnen unterwegs ist. Wenn’s nicht fürs Geld wär, wär sowieso gscheiter, man läßt die Herrischen allein hinaufsteigen und allein herunterfallen. Was hat unsereiner schon da ganz oben auf dem Tribulaun verloren. So weit gehn nicht einmal die Geiß. Dann muß der Mensch auch nicht so weit.“
Einen Zorn hatte sie immer noch auf ihren am Berg gebliebenen Verlobten, die Berta. Und hatte nachher sich auf keinen mehr eingelassen. „So oder anders hauen sie immer ab“, hatte sie gesagt, „meiner ist halt aus der Wand gefallen.“
Bertas Bruder war, kaum hatte er das Haus an diese unmögliche, aber grad eben noch bezahlbare Stelle gebaut gehabt, ledig wie er war, beim Sesselliftbau gestorben. Einen ziemlich gemeinen Tod. Keiner der Touristen, die sich sommers wie winters hier den Berg hinaufkarren ließen, ahnte auch nur im geringsten, daß Bertas Bruder in einem der Pfeilerfundamente des Sesselliftes ruhte. Und wenn sie es gewußt hätten, wär ihnen die Geschichte nur ein etwas makabrer Teil des Lokalkolorits gewesen. Und dafür zahlten sie ja schließlich.
Die schon als Verlobte verwitwete Berta hatte sich umtun müssen. Sie hatte aus dem kleinen ebenerdigen Raum ihre Bar gemacht. Ohne Lizenz oder Genehmigung. Sie schenkte einfach aus. Bis jetzt hatte ihr noch niemand einen Strick daraus gedreht. Was bei der Geiermentalität, die manche Leute umtreibt, beinahe schon an ein Wunder grenzte. Aber die Berta kam mit den Leuten zu gut aus, und außerdem war sie mit ihren paar Litern Rotwein, die sie am Tag ausschenkte, offensichtlich doch niemandem eine unliebsame Konkurrenz.
Berta kannte ihre zwei Handvoll Kunden alle ziemlich genau. Die Bar gab es seit gut zehn Jahren. Berta war jetzt fünfundsechzig.
Ich kannte sie seit fünf Jahren. Seit ich wieder ins Land zurückgekommen war. Ob ich mit dieser Rückkehr nicht einen Fehler gemacht hatte, darüber war ich mir immer weniger im klaren.
Dafür hatte ich bei Berta keine Zweifel. Sie war Gold wert. Beziehungsweise das Geld, das ich im Lauf der Jahre bei ihr gelassen hatte. Dafür hatte Berta ihrerseits immer ein wachsames Auge auf mich gehabt. Sie konnte gar nicht anders. Und obwohl sie zeit ihres Lebens nicht aus dem Tal hinausgekommen war, verstanden wir uns bestens. Sie erzählte mir das Neueste von ihren Hennen, und ich ihr Geschichten aus der Zeit, als ich unter Grönland auf Nordmeerfischereifuhr. Was lange her war.
„Der Tschenett. Da schaust di an. Stiehlst dem Herrgott wieder die Zeit, du unheiliger Nichtsnutz?“
Neben mir stand Christus. Arbeitete manchmal beim Sessellift. Wenn er nicht am Predigen und Trinken war.
„Tschenett“, sagte Christus und schaute trotz eines leichten Wacklers, der ihm durch die Knie ging, recht salbungsvoll drein, „Tschenett, geh beichten.“
Das hätte ich mir sonst von keinem sagen lassen. Christus konnte ich’s nicht übelnehmen.
Zwei Tage nach dem Arbeitsunfall im Tunnel hatte er sich in aller Herrgottsfrüh auf einen Felsbrocken fünfzig Meter über dem Tunneleingang gestellt und den Vormittag lang gepredigt. Lauthals. Deutsch, italienisch und in seinem Privatlatein. Mittags war ihm die Stimme weggeblieben. Und höchstwahrscheinlich der Wein ausgegangen.
„Das Loch, das ihr in den Berg wühlt, führt euch direkt in die Hölle“, hatte er auf die Arbeiter heruntergeschrien.
Die hatten ihn nicht verstanden. Sie kamen aus der Poebene oder dem Bergamaskischen.
„Teufelszeug ist das. Und wenn’s zehn Pfarrer einsegnen. Je schneller ihr durch die Welt fahrt, umso früher seid ihr beim Teufel.“
„Va al diavolo“, hatte ein Arbeiter zu ihm hinaufgerufen.
Ich hatte lachen müssen.
„Ich bin dem Teufel so nah wie Gott“, hatte Christus zurückgeschrien. Wie er dastand auf dem Felsen, mit fuchtelnden, spaghettidünnen Armen, konnte man ihm nicht bös sein.
Jetzt auch nicht. Wo er recht hatte, hatte er recht. Ich hatte etwas zu beichten. Aber woher sollte Christus das wissen.
„Einen Roten für Christus, Berta, und einen für einen Ungläubigen“, sagte ich.
Christus versuchte sich an einem höfischen Knicks. Ich mußte ihn vor dem Umfallen retten.
„Eine Gottesgabe“, sagte Christus, als ich ihm das Glas in die Hand drückte. „Erleuchtung und Ewiges Leben.“
Nach dem Ewigen Leben sah er eigentlich nicht aus, der Christus. Eher schon nach einem frühen Tod.
Christus war ein lediges Kind. Und hatte es, wie alle ledigen Kinder, nicht leicht gehabt. In der Gegend hier schon gar nicht. Irgend jemand muß ja schließlich zahlen für eine Ausschweifung, die eh nur zwei Minuten gedauert hatte. Christus war auf drei verschiedenen Höfen groß geworden. Hin und her geschoben. Wenn er davon erzählte, und dazu brauchte es einiges, und ein paar Liter und Vollmond, wenn er erzählte, erzählte er von Arbeit. Und so, als ob es schon Jahrhunderte her wäre.
Dabei konnte er höchstens vierzig sein. Man wußte das nicht so genau. Er selbst behauptete seit Jahren, er sei dreiunddreißig Jahre alt. „So alt wie unser Herr, als er gestorben ist“, sagte er. Und deswegen wurde er nicht älter. Vielleicht hatte er ja auch noch eine Mission in dieser Welt. Manchmal war es, als ob er selbst daran glauben würde.
Ich mußte langsam aufpassen. Mit dem Trinken ging’s immer schneller vorwärts. Da gab’s dann nur mehr zwei Möglichkeiten: Sich halten, oder die Geiß gehen lassen.
Man tat Berta kein Unrecht, wenn man ihren Wein für die Kopfschmerzen vom Tag danach verantwortlich machte. Sie wußte das. Aber ihre Kunden wollten gar keinen anderen Wein. Ich auch nicht. Deswegen war’s in Ordnung so.
„Du wirst mich noch brauchen“, sagte Christus und hielt das Weinglas wie einen erzkatholischen Kelch hoch. „Einer wie du nimmt kein gutes End. Es ist schad drum.“
Und dann drehte er sich von mir weg in die Ecke. Als ob ich nie dagewesen wäre. Als ob er mich nicht kennen würde. Christus redete mit sich und der Wand. Die zwei waren sich wenigstens einig.
Ich stand vor meinem Glas und schaute Berta zu, wie sie die Gläser spülte und trocknete. Eins nach dem anderen. Dann hielt sie sie einzeln gegen das Licht. Hauchte hinein und wischte mit dem Schürzenzipfel nach. Sie ließ sich Zeit damit. Als ob sie in ihrer Küche stehen würde. Eigentlich war es ja auch so. Nur daß sie halt ein großes Herz hatte und andere auch hineinließ.
Einer von Bertas Gästen ging. Ich kannte ihn nur flüchtig. Wenn er bei Berta zukehrte, saß er vor seinem Glas, sagte kaum ein Wort und kratzte sich andauernd in den roten Haaren. Irgendwie brachte ich ihn mit Unimog und Wildbachverbauung in Zusammenhang.
Als er an mir vorbeikam, blieb er stehen, kratzte sich und grinste dabei. Ich wollte ihn gerade zum Teufel schicken, als er mich, heiser und leise, fragte, ob ich mein Auto noch habe. Und schon wieder grinste. Schweinisch.
„Ja“, sagte ich und grinste zurück. Aber so schweinisch wie ihm wollte mir’s beim besten Willen nicht gelingen.
Vielleicht hätte ich mir von Berta ein Belegtes machen lassen sollen. Die halfen. Jetzt war’s zu spät. Falls die am Tunnel meinen Hänger heute wirklich noch vollgeladen sollten, mußte ich mir eine Dusche verpassen. Unten im Bach. Scheiß Weinbauern; wußten genau, wo der Verschnitt am billigsten herzukriegen war. Und wir fuhren ihn auch noch durch die Gegend.
„Dann paß auf, daß es noch länger hast, dein Auto. Nicht daß es plötzlich weg ist, und du liegst im Krankenhaus mit einem dicken Schädel.“
Hatte er gesagt, und war schon verschwunden. Nur am Wein konnte es nicht liegen, daß mir irgend etwas spanisch vorkam.
„Berta, machst mir ein Belegtes?“
Ich konnte es ja trotzdem versuchen.
Berta schaute mich an. Ich wußte, was kommen würde. In ihren Augen war etwas aufgeblitzt.
„Das wird jetzt auch nichts mehr helfen.“
Hatte ich’s doch gewußt. Wir kannten uns schon zu lange, Berta und ich, als daß wir uns etwas vormachen konnten. Ich ihr schon gar nicht.
Wenn mich nicht alles täuschte, hatte mir der Fuchsete etwas mitteilen wollen. Es war so: Ich hatte ein paar Fuhren gemacht für eine Pusterer Firma. Und die hatte nicht gezahlt. So was gibt es. In solchen Fällen muß man sich dann selbst zu helfen wissen. Ich hatte also bei der Firma, als ob nichts wäre, wieder eine Fuhre übernommen, nach Hamburg, den Hänger aber nach ein paar Kilometern hinten im hintersten Ridnauntal abgestellt. So, daß man sich schon ziemlich anstrengen mußte, ihn zu finden.
Und seither war die Pusterer Zugmaschine sozusagen mein persönlicher Personenkraftwagen. Auch nicht schlechter als etwas anderes. Aber eben hatten mir die Pusterer durch den flammhaarigen Boten mitteilen lassen, daß es damit aus und vorbei sei. Wozu braucht man schon eine Zugmaschine, wenn man im Krankenhaus liegt.
„Hab ich gar nicht gewußt, daß den Simml kennst“, sagte Berta.
„Kenn ich auch nicht“.
Berta schnitt Speck auf. Von Hand. So dünn, wie es sich gehörte. Sie konnte Leben retten damit. Vielleicht half es ja sogar in meinem Fall.
„Hat ins Pustertal geheiratet. Ist eigentlich ein Karneiderund bei der Wildbachverbauung.“
Hatte ich also recht gehabt. Aber wenn ich die Dinge richtig sah, nützte mir mein Rechthaben auch nichts. Die wollten ihre Zugmaschine. Konnte ich verstehen. Und ich wollte mein Geld. Das würden die Pusterer Erdäpflköpf nie verstehen. Und deswegen hatten sie mir einfach angedroht, mich zu verdreschen.
Ein schöner Tag. In der Früh aufstehen müssen wegen Arbeit, dann nicht arbeiten dürfen, dann eine Leiche, ein Karpf, und jetzt diese Pustrer Drohung. Mit einem Todesboten, der Simml hieß, heiser flüsterte und sich dauernd im roten Haar kratzte.
Gottseidank waren da Berta und Christus. Wobei Christus immer noch mit der Wand redete. Und Berta mit mir.
„Hast etwas mit dem?“
Sie machte sich Sorgen. Berta eben.
„Nein, Berta“, sagte ich. „Ich hab nur mit dir etwas.“
Berta lachte. Wenn Berta lachte, konnte man kaum mehr stehen in ihrer kleinen Bar. Dazu blies der Wind zu sehr. Sie schenkte sich und mir einen ein.
Ich hatte nicht einmal gelogen. Seit ich wieder ins Land zurückgekommen war, war Berta die einzige, die mich regelmäßig zu Gesicht bekam. Weil sie sonst nichts zu tun haben, hatten sie sogar angefangen, in Andeutungen darüber zu reden. Berta und ich. Dabei hatte ich mich mit meinen achtunddreißig Jahren längst auf die Sechzehnjährigen verlegt. Falls es klappte. Und Berta war fünfundsechzig. Und meine einzige Freundin.
Der Simml schoß mir wieder durch den Kopf. Rotschopfeter Freund, dich hol ich mir. Und dann schob der Wein die Geschichte einfach weg. Zu gegebener Zeit würde mir schon irgend etwas einfallen. Mit sehr viel Glück vielleicht sogar das Richtige. Es gibt Schlimmeres als schweinisch grinsende Pusterer.
Ich war gerade mitten in Bertas Speckbrot, als ein neuer Gast hereinkam. So wie er aussah, mußte es draußen regnen.
„I bin a Bauer. A Großbauer. I bin a Bauer.“
Bertas neuer Gast hing neben mir am Pudel. Er war knapp davor, in die Knie zu gehen.
4
Der kleine alte Mann versuchte verzweifelt, sich am Pudel festzuhalten, um nicht zu Boden zu gehen. Ich konnte ihm deutlich ansehen, daß er damit nicht mehr lange erfolgreich sein konnte. Meinen Roten hatte ich schon in Sicherheit bringen müssen.
Ich griff dem alten Mann unter die Achseln, hob ihn hoch und versuchte, soviel wie möglich von seinem Oberkörper auf den Pudel zu legen. Aber ich hatte nicht viel Glück damit. Die Beine hingen in der Luft. Er war einfach zu klein. Deswegen rutschte er wieder langsam vom Pudel, obwohl er verzweifelt versuchte, sich an der Kante festzuhalten. Das hätte funktionieren können, wenn sein Kopf gewußt hätte, was seine Arme tun. Aber davon konnte keine Rede sein.
„I bin a Bauer. A Großbauer.“
Er wiederholte immer wieder dasselbe. Und wenn er den Satz die nächsten zehn Jahre herunterbetete: Wie ein Großbauer sah er nie im Leben aus. Und zehn Jahre würde er in diesem Zustand auf keinen Fall durchhalten. Höchstwahrscheinlich noch nicht einmal, wenn er fürderhin ein heiligmäßiges Leben führen würde.
„Setz ihn an den Tisch“, sagte Berta. „Sei so nett. Dem kann man das Stehen heut eh nicht mehr beibringen.“
So einfach war das gar nicht. In Bertas Bar gab es nur einen einzigen Tisch. Mit vier Stühlen. Weil mehr in dem kleinen Raum gar nicht Platz gehabt hätte. Und der Tisch war schon besetzt. Stammkunden. Kartenspieler.
„I bin a Bauer.“
Er konnte es nicht lassen. Es klang verdächtig nach Ish bin ein Bearleener. Es glaubte ihm keiner. Deswegen war der Valt mit der Berta auch gar nicht zufrieden.
„Valt“, hatte Berta zum Tisch hinüber kommandiert, „laß uns den da niedersetzen. Sonst tut er sich noch was.“
Valt war ein Aster Bauer, was sozusagen die allernächste Nachbarschaft war und nicht recht viel mehr als drei Höfe und der Schuttabladeplatz der Eisenbahn, seit man sie vor einem knappem Jahrhundert in den Berg gehauen hat. Außerdem war der Valt Stammkunde bei Berta, solange sie die Bar hatte. Und er war gerade mit einem anderen aus Bertas Inventar am Karten. Und dabei hat ihn noch keiner vertrieben. Berta schon gar nicht. Die wußte, daß sie ihre Leute entsprechend zu behandeln hatte. Vor allem, wenn sie die Bußpredigten von Pfarrer und Bäuerin so tapfer schluckten und der Berta die Treue hielten.
Valt und sein Kollege, der Ferdl, verstanden nichts mehr. Wieso wollte ihnen die Berta mitten ins Kartenspiel hinein so ein Stück Elend auf den dritten Stuhl setzen? Wie sollte da einer noch in Ruhe sich den Stich holen können, mit einem am Tisch, der sich so aufführte. Und dann standen sie beide wie auf Kommando auf, Valt sagte etwas vonein andermal zahlenund ließ das halbvolle Glas stehen. Für die eineinhalb Meter durch Bertas Bar brauchten die beiden eine Ewigkeit. Länger als der Fronleichnamsumzug ums Dorf.
In der Tür blieb der Valt noch einmal stehen und sagte, laut: „Sell woll. Großbauer. Aha. So schaut er aus. Großbauer, woll.“
Und lachte. Lachte im Weggehen, mit seiner tiefen Stimme, bis man ihn nicht mehr hören konnte.
„Da gibt’s das nächste Mal etwas zu reden“, sagte Berta.
„Wenn sie überhaupt noch einmal bei dir hereinschauen.“
„Und ob“, sagte Berta. „In dem Alter gwöhnt sich ein Ochs nicht mehr um.“
Ich setzte den Alten an den Tisch. Er sank zusammen, der Kopf lag auf der Tischplatte. Zwischendurch schüttelte es ihn an Beinen und Füßen, als ob einer an einem Faden ziehen würde.
„A Großbauer. A Bauer.“
Stur war er. Das mußte man ihm lassen. Und auf und auf naß. Berta zuckte mit den Achseln.
„Wenn er uns stirbt, wissen wir nicht einmal, wie er geheißen hat.“
Ich konnte sehen, wie es in Berta arbeitete. Mit ihren fünfundsechzig und in den zehn Jahren, wo sie die Bar hier hatte, war ihr einiges unter die Augen gekommen. Aber der Mensch, der da auf dem kleinen Bartisch mehr lag als sonst etwas, dieser kleine alte Mann, durch und durch pudelnaß, und so besoffen, wie man’s nur sein konnte, dieses Stück Elend, das, seit es Berta in die Bar gefallen war, immer nur das eine, das aber mit Ausdauer wiederholte: „I bin a Bauer. A Großbauer“; der gab ihr zu denken.
Wenn es Berta ungemütlich wurde, dann steckte sie beide Hände in die tiefen Taschen ihrer Schürze und ballte sie zu Fäusten. Sie sah dann aus wie eine kugelrunde Katze, die einen Buckel macht.
„Ich kenn den, irgendwoher kenn ich den“, sagte sie.
Den alten Mann schüttelte es wieder am ganzen Körper. Ich hatte den Eindruck, als hätte er sich in den Sonntagsanzug geschmissen. Dabei war erst Mittwoch. Das war heute schon der zweite. Der Tote im Fels hatte sich auch im Wochentag vertan. Wurde langsam auffällig.
Ich kannte ihn nicht. Aber das hatte wenig zu bedeuten. Ich war kein Wipptaler. Nicht einmal ein richtiger Einheimischer. Sagten die Einheimischen. Dazu war ich zu lange weg gewesen, auf und davon. Und obwohl ich jetzt seit ein paar Jahren immer wieder im Land war, traute man dem Frieden nicht: Der ist eh plötzlich wieder weg, von einem auf den anderen Tag. Ich war ihnen nicht böse. Sie hatten nicht unrecht.
Vom Dialekt her konnte der Alte gut auch aus der Sterzinger Gegend kommen. Dem Anzug sah man an, daß er jahrealt war. Die Hosenbeine waren von den Knien abwärts mit nasser Erde verdreckt, an den Bergschuhen klebten ganze Klumpen. Er sah aus, als sei er eben aus seinem eigenen Grab gestiegen.
Und so wie’s aussah, war er Kunde bei der Raiffeisenkasse. Da war ich mir ziemlich sicher.
„Wenn jetzt einer kommt und uns zuschaut, sind wir fein heraußen.“
Berta hatte sich, in der Hand eine Tasse mit etwas Heißem drin, plötzlich neben mir aufgestellt. Ich hatte sie nicht bemerkt.
„Die Berta füllt die Leute an, und der komische Tschenett sackelt sie dann aus. Ganz deutlich, werden s’ sagen, ganz deutlich war’s zu sehen, er hat die Brieftasch in der Hand gehabt, der tunichtse Tschenett.“
„I bin a Großbauer“, stammelte der Alte.
„Deinem Ruf kann das eh nicht mehr schaden, Berta“, sagte ich.
Ich konnte mir die Stänkerei nicht verkneifen. Gleichzeitig versuchte ich, in der Brieftasche irgendein Ausweispapier zu finden.
„An meinem guten Ruf sind nur meine Kunden schuld“, sagte Berta. „Und du auch. Und jetzt tu ihm seine Brieftasch wieder zurück.“
Weil eh nichts zu finden war, was uns sagen konnte, wie er hieß, tat ich Berta den Gefallen. Sie war tatsächlich nervös geworden. Das Kuvert mit dem Raiffeisenkassen-Aufdruck steckte ich auch zurück.
Daß das ein dummer Fehler war, war mir in diesem Augenblick nicht klar.
„Trinken S’ das.“
Berta redete auf den Alten ein. Aber der hatte im Augenblick keinen Kontakt zur Außenwelt. Der Kopf auf der Tischplatte bewegte sich nur, wenn er wieder einmal behauptete, was ihm eh keiner glaubte. Und manchmal schüttelte es ihn. Wie wenn er von einem Weinkrampf gebeutelt würde. Aber da konnte ich mich auch täuschen.
Berta hatte es geschafft, dem Alten die Hälfte der dampfenden Flüssigkeit einzutrichtern. Aber auch nur, weil sie ziemlich robust gebaut war.
„Was für ein Gift gibst ihm da zu trinken?“, sagte ich.
Berta ließ sich nicht abhalten.
„Bei Gift hilft nur Gift.“
Wenn das stimmte, mußte es dem Großbauer bald besser gehen. Berta hatte ihm gerade den Rest des Gesöffs in einem Mal eingeschüttet. Den kleinen Körper des alten Mannes schüttelte es, als ob man ihn ans Stromnetz angeschlossen hätte. Er hustete ein paarmal. Berta zog den Alten hoch, setzte ihn so aufrecht als möglich in den Stuhl. Da saß er jetzt, still, der Kopf war auf die Brust gesackt.
„Irgendwo hab ich den schon gesehen“, sagte Berta.
„Und wo?“
Sie zuckte mit den Achseln. „Ich krieg’s noch heraus. Da siehst, wie’s ausgeht. Aber das kriegt ihr Laggl ja nie mit. Ihr erinnert euch nachher nicht einmal mehr daran. Höchstens, daß ihr einen Haufen weggeputzt habt. Daß ihr euch dann in die Hosen macht wie kleine Kinder, euchvollpoftund winselt, das kriegen nur die Weiber mit. Und wehe, die erinnern euch daran.“
„Die Weiber, die höllischen Weiber.“
Das war Christus. Er sprach immer noch mit der Wand. Diesmal eben so laut, daß wir es auch hören konnten.
„Sei so gut, Christus“, sagte ich, „und laß die Weiber in Ruh.“
„Frommen sollen sie dem frommen Manne“, sagte Christus und hatte sich extra dazu von der Wand weggedreht.
„Eben“, sagte ich, „dem frommen. Von mir aus. Fromm bin ich nicht. Also laß mich in Ruh.“
Christus tat einen Schritt auf mich zu.
Ich stellte mich an den Pudel und ging hinter meinem Weinglas in Deckung. Vielleicht konnte mich das vor Christus retten.
Aber der war mitten im Schritt eingefroren und hörte schon längst nichts mehr. Er war wieder sein eigener Prophet.
„Nachfüllen, Berta, wenn dich drüberaussiehst.“
Für den Alten konnte man im Augenblick nichts tun. Wenn er Glück hatte, wirkte Bertas Zeug. Wenn er Pech hatte, blieb er in der kindlichen Unschuld hängen, in die er versackt war. Vielleicht hielt er das ja für Glück.