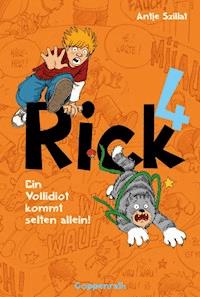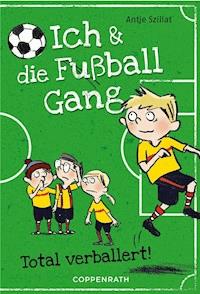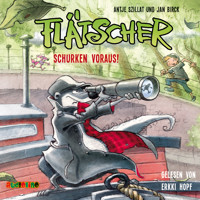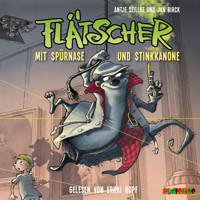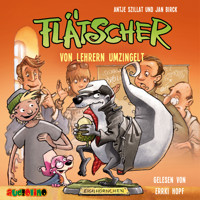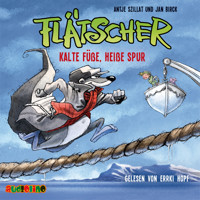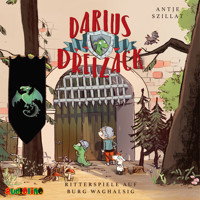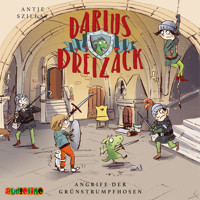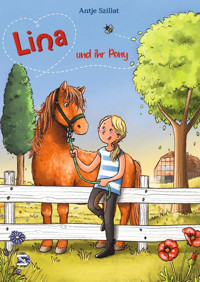Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Charmanter Cosy Crime voller skurriler Charaktere. Als der neue Tierarzt Constantin von Platen auf dem Hof eines Großbauern in Marne ankommt, steckt dieser tot in einer Tonne voller Äpfel. Da es keine weiteren Zeugen gibt, wird Constantin zum Hauptverdächtigen. Widerwillig tut er sich mit der arroganten Oberkommissarin Finja Fährmann und seiner krimibegeisterten Großtante Amalia zusammen, um den wahren Täter zu finden. Doch die eigensinnigen Marschbewohner und ein Netz aus bizarren Intrigen bringen das unfreiwillige Team fast an seine Grenzen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Antje Szillat ist eine erfolgreiche Bestsellerautorin mit einem beeindruckenden Werk von rund hundertdreißig Büchern, die sie teilweise unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlicht hat. Ihre Geschichten haben Leser in mehr als zwanzig Sprachen begeistert und wurden mehrfach ausgezeichnet. Die vielseitige Autorin lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Hannover auf einem kleinen Hof, umgeben von Pferden, Hunden und Hühnern – und einer schier endlosen Sammlung an Büchern. Antje Szillat schöpft Inspiration aus ihrem ländlichen Leben und der Liebe zu Tieren, was sich in ihren fesselnden Erzählungen widerspiegelt.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2025 Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-243-7
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
In de ländliche Idylle, so friedlich un schöön, versteckt sik dat Verbreken, kaum to versteh’n. Tüschen Wiesen un Feldern, in’n Schutz vun Nacht, liegt ’nee düüstere Siet, de keener dacht.
Augustin Wibbelt (1862–
Prolog
Ein abscheuliches Verbrechen hatte sich zugetragen! Die Kriminalhauptkommissarin Finja Fährmann musste zugeben, es überraschte sie selbst, wie erschüttert sie war. Noch vor wenigen Stunden hätte sie jedem gegenüber behauptet, dass Karl-Holger Wollebock – genannt Rotlicht-Kalle – ein ganz und gar scheußlicher Mann ohne Skrupel und Gewissen sei. Aus tiefstem Herzen hoffte sie, dass er bald die verdiente Strafe für seine dreckigen Gräueltaten erhalten würde. Doch in einem derart elenden Zustand vor die Himmelspforte des lieben Herrgottes zu treten, wünschte sie selbst ihren schlimmsten Feinden nicht – nicht einmal Rotlicht-Kalle.
Der Mann war auf grausame Weise skalpiert worden.
Sein einst pechschwarzes Haar, das er stets mit Unmengen schmieriger Pomade zurückgekämmt getragen hatte, war restlos verschwunden. Stattdessen schmückte nun ein rosafarbenes Kopftuch seinen kahlen Schädel, auf dem fröhlich verstreute, unterschiedlich große rote Herzchen prangten.
Als wäre das nicht schon makaber genug, steckte ein Pfeil mitten in seinem Herzen. Bei einem so unmenschlichen Verbrecher wie Rotlicht-Kalle war es jedoch fraglich, ob er überhaupt ein Herz besaß.
Als erfahrene Kriminalhauptkommissarin bei der Düsseldorfer Mordkommission hatte Finja schon viele entsetzliche Anblicke ertragen müssen, und normalerweise vermochte sie nichts mehr davon wirklich zu erschüttern. Selbst die bittersten Momente ihres Berufs ließ sie gewöhnlich am Arbeitsplatz zurück, statt sie mit nach Hause in ihr wunderschönes Penthouse im Herzen von Düsseldorf zu nehmen. Dies war ihr Rückzugsort, ihre Oase der Ruhe, wo sie die belastenden Bilder des Tages hinter sich lassen und einfach abschütteln konnte.
Finja hoffte inständig, dass es auch im Fall Rotlicht-Kalle so sein würde. Die Gewissheit, dass sie in dieser Angelegenheit auf ganzer Linie versagt hatte, lastete schwer auf ihr und ließ sich keinesfalls zu ihrem Vorteil auslegen. Sie ahnte bereits, dass ihr Fehlverhalten noch zu einem richtigen Problem für sie werden konnte – im schlimmsten Fall sogar zu einer internen Ermittlung führte.
Verdammt! Und das alles nur wegen –
»Alles okay bei dir?«, hörte sie eine Männerstimme schräg hinter sich fragen. Im nächsten Moment spürte sie eine warme Hand auf ihrer Schulter und fuhr reflexartig herum.
Finja hätte den Angreifer aus dem Hinterhalt mit einem gezielten Handkantenschlag auf den Solarplexus für einige Minuten kampfunfähig gemacht, wenn der nicht ebenso schnell reagiert und ihren Schlag abgewehrt hätte.
»Ho, ho, ho, Finja, Mädchen, beruhige dich, ich bin’s doch nur, Hendrik.«
Finja starrte ihn an – ihren langjährigen beruflichen Partner und den Mann, mit dem sie bis vor Kurzem jene Penthouse-Oase geteilt hatte: Hendrik Lauenstein. Zu ihrem Entsetzen spürte sie, wie sich ihre hellblauen Augen mit Tränen füllten. Verzweifelt versuchte sie, dagegen anzukämpfen. Doch es war zu spät. In kleinen Rinnsalen liefen ihr die Tränen über die Wangen bis zum Kinn und tropften auf ihren beigefarbenen Burberry-Trenchcoat in Kensington-Passform.
»Ich … ich ertrage das nicht, Hendrik. Die Wohnung, unsere Wohnung, ist ohne dich so leer …«, schluchzte Finja. Und als wäre das nicht schon erniedrigend genug, warf sie sich mit einer theatralischen Geste in die Arme ihres Ex.
»Finja, was soll denn das Theater? Ich dachte, du hättest dich inzwischen mit unserer Trennung abgefunden!«
Die Kollegen von der Spurensicherung beobachteten die Situation mit einem Mix aus Amüsiertheit und Mitleid, während Jürgen Peters, der Leiter der Düsseldorfer Sitte, verächtlich grinste. Finja und er, nun ja, sie konnte den Kerl nicht leiden, und er fand, dass sie eine arrogante Zicke sei; sie nun so schwach und verzweifelt zu erleben, schien ihm natürlich großes Vergnügen zu bereiten.
Mit sanfter Gewalt schob Hendrik sie von sich und räusperte sich verlegen, bevor er sie anknurrte: »Wenn du Privates von Beruflichem nicht trennen kannst, dann haben wir hier ein echtes Problem, Finja. Ich dachte, du wärest alt und reif genug und in der Lage, adäquat mit der Situation umzugehen.«
Seine Worte, aber vor allem die Art und Weise, wie er sie dabei ansah, so kalt und abweisend, trafen Finja wie ein brutaler Schlag mitten in die Magengrube. Doch es sorgte dafür, dass ihr, wenn auch auf schmerzlichste Art und Weise, bewusst wurde, dass Hendrik recht hatte. Sie benahm sich einfach nur noch lächerlich, kindisch und absolut unprofessionell. Rotlicht-Kalle war das beste Beispiel dafür. Das einzig Richtige, das sie jetzt noch tun konnte, war zu verschwinden – zunächst vom Tatort, dann aus ihrer Traumwohnung, in der jeder Raum von Erinnerungen an Hendrik erfüllt war, und am allerbesten auch komplett aus Düsseldorf. Selbst die Dienststelle war kein sicherer Ort mehr – sie musste ihr komplettes gewohntes Umfeld und Leben in Düsseldorf hinter sich lassen.
»Ich lasse mich versetzen«, murmelte sie leise, mehr für sich selbst als für Hendrik.
Mit gesenktem Blick wandte sie sich von ihm ab. Ihre Knie fühlten sich weich an, aber sie versuchte, ihre gewohnte Haltung zurückzugewinnen und aufrecht zu gehen. Schritt für Schritt, die elegante wie selbstsichere Finja Fährmann, die sie früher einmal gewesen war. Dabei wirbelten in ihrem Kopf die Gedanken wild durcheinander. Ein Neuanfang an einem fremden Ort? Das jagte ihr Angst ein und bereitete ihr jede Menge Sorgen, aber es war der einzige Ausweg aus diesem Dilemma.
1
Jedes Jahr, wenn die Aprilstürme vorüber waren und die ersten warmen Maitage anbrachen, erfüllte beinahe über Nacht der schwere Duft von Obstbäumen die Luft. Weiße Blüten schwebten sanft von den Bäumen herab, während die Wiesen mit gelben Butterblumen übersät waren. Die Sonne strahlte golden auf die grünen Felder und tauchte die Landschaft in ein warmes Licht. In der Ferne konnte man das leise Rauschen des nahen Meeres hören.
Die typische Marschlandschaft Dithmarschens zeigte sich in ihrer ganzen Pracht: Weite Felder, eingefasst von Deichen und Gräben, erstreckten sich bis zum Horizont. Die roten Backsteinhäuser mit ihren teilweise reetgedeckten Dächern fügten sich harmonisch in die Umgebung ein. Das Klappern der alten Windmühlenflügel war zu hören, während Möwen kreischend über die Salzwiesen flogen.
Auf den großen Höfen herrschte nun geschäftiges Treiben, denn die Dithmarscher mussten sich allmählich auf den bevorstehenden Ansturm erholungssuchender Städter vorbereiten, die nach etwas Idylle strebten.
Für die Bewohner der prächtigen Anwesen bedeutete das, vom Dachboden bis zum Gewölbekeller zu putzen und zu schrubben. Auch die Fensterscheiben samt Rahmen, Haus- und Nebentüren durften dabei nicht vernachlässigt werden – alles wurde poliert und geputzt, bis es glänzte.
Sobald im Haus Ordnung war, widmete man sich mit großer Begeisterung den Beeten und Vorgärten. Es wurde akribisch geharkt, geschnitten, gezupft und gesammelt, bis auch der letzte vertrocknete Laubhaufen im grünen Sack verschwunden war. Mit geschickten Händen wurden bunte Begonien in Kübel und Töpfe gepflanzt, um den Garten mit lebendigen Farben zu schmücken.
Doch trotz des idyllischen Anblicks lag eine gewisse Anspannung in der Luft, als ob etwas Neues, womöglich sogar Gefahrvolles drohte.
Amalia von Platen konnte dem ganzen aufgeregten Frühjahrsputz so oder so wenig abgewinnen. Nicht etwa, weil die Sechsundsiebzigjährige ihr denkmalgeschütztes imposantes Fachwerkhaus mit seiner einzigartigen Handwerkskunst und der prächtigen Eingangspforte, die den Weg auf das herrschaftlich anmutende Grundstück wies, verkommen lassen würde. Oh nein, das käme für Amalia niemals in Frage! Sie war einfach äußerst gut organisiert, sodass es erst gar nicht zu auffälligem Staub, unschönen Fensterschlieren oder welken Blumen in den Beeten und Kübeln kommen konnte. Immer auf Zack und alles im Griff behalten, ohne dabei den Blick für das Wesentliche zu verlieren – das war Amalias Anspruch an sich selbst.
Trotzdem spürte auch sie eine gewisse innere Unruhe, während sie ans Fenster trat. Die schweren Vorhänge aus burgunderrotem Samt schwangen leicht im Wind, der durch das offene Fenster hereinwehte und den Raum mit einem Hauch von Frische erfüllte. Vor ihr erstreckte sich eine perfekt gepflegte Gartenanlage mit majestätisch anmutenden alten Bäumen, die ihr dann und wann Geschichten aus längst vergangenen Zeiten zuflüsterten. Die Blumen in den Beeten, die wunderschönen Stauden blühten bereits in den herrlichsten Farben, üppiger Efeu rankte an der nach links den Garten begrenzenden Scheunenwand.
Amalia liebte es, in ihrem frisch erwachten blühenden Paradies zu verweilen, die harmonische Atmosphäre ihres Anwesens spiegelte ihre eigene innere Ausgeglichenheit wider.
Normalerweise!
Doch nun brachen neue Zeiten an. Eine Veränderung stand bevor in Amalias sonst so geordnetem Leben. Eine Veränderung, auf die sie sich dennoch von Herzen freute. Endlich kehrte wieder etwas Schwung in ihr eher zurückgezogenes Dasein ein, das sie seit dem Tod ihres Mannes vor fünf Jahren führte: Conzi, der Sohn ihres Neffen Julius seitens ihres verstorbenen Ehemanns und zugleich ihr absoluter Lieblingsgroßneffe, war auf dem Weg nach Marne, um sich hier als neuer Tierarzt niederzulassen – bei ihr, auf Amalias Anwesen, unter ihrem Dach und mit ihrer vollen Unterstützung.
Amalia war so aufgeregt, dass sie immer wieder ihr feines Spitzentaschentuch unter dem Saum ihres hellblauen Blusenärmels hervorholte, um sich damit die Nase zu trocknen. Seit ihrer Kindheit litt Amalia bei großer Anspannung an einer lästigen Tropfnase, gegen die sie schon mit allen erdenklichen Methoden angegangen war – ohne Erfolg. Das Einzige, was half, war ständiges Tupfen. Ansonsten bewahrte Amalia von Platen stets Ruhe und verlor nicht einmal einen Wimpernschlag lang die Fassung. Es kam nur äußerst selten vor, dass sie ihre erstklassigen Manieren vergaß – es sei denn, es ging um inkompetente Kriminalisten.
Neben ihrer Leidenschaft für das britische Königshaus, insbesondere die bezaubernde und gebildete Kate, widmete Amalia sich den dunkelsten Abgründen der Menschheit, dem banalen Verbrechen – und das mit großer Begeisterung. Sie liebte Kriminalromane, auch wenn die Ermittler darin häufig nicht ihren hohen Ansprüchen genügten. Oft handelte es sich um offensichtliche Trottel, bei denen Amalia bereits nach wenigen Seiten wusste, wie der Fall gelöst werden konnte. Hirnlose Aktionen, direkt am Kern des Übels vorbeiermittelt. Himmel und Hölle, über derartiges Fehlverhalten konnte sie sogar richtig in Rage geraten.
Doch nun würde sie nicht mehr viel Zeit haben dafür. Constantin benötigte nicht nur ihre räumliche Unterstützung, sondern auch ihre organisatorische Hilfe bei der Einrichtung seiner Praxis.
Böse Zungen behaupteten, ihr feiner Herr Großneffe aus Hannover würde sich bei ihr ins gemachte Nest setzen. Immerhin hatte sie bereits die Räumlichkeiten bestens eingerichtet – nur vom Feinsten, denn sie konnte es sich schließlich leisten.
Doch Amalia hatte dem Gerede der Leute noch nie groß Beachtung geschenkt, sie gab nichts darauf, wenn die Landfrauen sie misstrauisch beäugten und anschließend beim gemeinsamen Häkelnachmittag sie das einzige und ausschließliche Gesprächsthema war.
»Wer viel redet, tut nichts. Die Gefährlichen schweigen und agieren aus dem Hinterhalt«, pflegte sie stets zu sagen.
Amalia drehte sich vom Fenster weg und ließ ihre Hand im Vorbeigehen über die Lehne des cognacfarbenen Ohrensessels aus feinem Nappaleder gleiten, der einst der Lieblingssessel ihres verstorbenen Gatten gewesen war. Leise murmelte sie vor sich hin: »Wo bleibt er nur?« – und bezog sich dabei natürlich auf ihren Großneffen.
Hm, diese Ungeduld war auch neu, tatsächlich durchlebte sie gerade in Bezug auf Constantin und seine Zukunftspläne betreffend eine Veränderung. Sie erkannte sich selbst kaum wieder, fand seit Tagen nur schwer in den Schlaf und träumte wirr.
Ein besonders verrückter Traum war ihr noch gut im Gedächtnis geblieben, den sie gleich nach dem Aufwachen in ihr kleines Büchlein auf dem Nachtschränkchen niedergeschrieben hatte: Die wunderbare Kate war zu Besuch gekommen. Wie beste Freundinnen hatten sie in Amalias Bibliothek gesessen und delikate Orangenplätzchen zu aromatischem Earl Grey genossen – zumindest behauptete Kate, dass die Plätzchen delikat und der Tee besonders aromatisch seien. Solch bizarre Träume hatte Amalia noch nie gehabt, und sie war überzeugt, dass die anstehende Veränderung in ihrem Leben dafür verantwortlich war. Sie hoffte, dass derartige Phantasien verschwinden würden, sobald Constantin in Marne angekommen war und alles seinen zwar ungewohnten, aber dennoch geregelten Gang nahm.
Seufzend warf Amalia einen Blick auf ihre elegante goldene Armbanduhr, ein Geschenk ihres Anton – Gott hab ihn selig. Es war zehn vor zwölf. Wo blieb ihr Großneffe nur? Sie hatte ihn um elf Uhr erwartet, und das war bereits großzügig bemessen gewesen. Unpünktlichkeit war etwas, das Amalia durch und durch missbilligte, und Constantin wusste das nur zu gut. Daher musste es einen triftigen Grund für seine inzwischen fast einstündige Verspätung geben.
Hoffentlich war ihm nichts zugestoßen. Vielleicht war er in einen Autounfall verwickelt worden? Constantin hatte den neuen Transporter erst vor wenigen Tagen vom Autohändler abgeholt. Vielleicht hatte er in einer brenzligen Situation die Kontrolle über den Wagen verloren, weil er noch nicht geübt darin war, ein so großes Fahrzeug zu fahren?
Die Sorge um ihren Großneffen ließ Amalias Herz schneller schlagen und sie schließlich entschlossen zum Telefonhörer greifen, um Constantins Handynummer zu wählen.
In diesem Moment klingelte es an der Haustür.
»Herr im Himmel!«, rief Amalia erschrocken aus, während sie sich die Hand auf die Brust presste und einmal tief durchatmete. »Nein, meine Liebe, so geht das nicht weiter«, sprach sie kopfschüttelnd zu sich selbst. »Diese übertriebene Sorge tut dir nicht gut.«
Nach einem weiteren tiefen Atemzug verließ sie schließlich die Bibliothek – neben dem wunderbaren Garten war dies Amalias bevorzugter Aufenthaltsort in dem großen Haus, weil sie es liebte, von Büchern umgeben zu sein. Mit eiligen Schritten durchquerte sie die Halle mit der prächtigen Standuhr, deren sanftes Ticken mit dem Klacken ihrer Absätze auf dem weißen Marmorfußboden die Stille durchbrach. Hoch unter der mit Stuck verzierten Decke hing der schöne Kronleuchter, den Anton und sie auf einer ihrer geliebten England-Reisen in einem kleinen Antiquitätenladen in Yorkshire entdeckt und sich sofort darin verliebt hatten. Das warme Licht der Kristallgläser brach sich funkelnd an den Wänden und tauchte die sonst eher kühl wirkende Halle in ein magisches Leuchten. Licht und Schatten im gemeinsamen Tanz. Wie sie das liebte.
Als Amalia wenige Momente später die Tür öffnete, war sie sicher, Constantin vor sich zu haben. Ihre Augen füllten sich bereits mit Freude und Erleichterung – doch sie machte einen überraschten Schritt zurück; vor ihr stand eine fremde Frau mit gelblich blondem, lockigem Haar, die sie mit einem kühlen Blick aus blassblauen Augen ansah. Hinter ihr wurde ein hochgewachsener Mann sichtbar, zwischen dreißig und vierzig Jahren alt, hager und braun gebrannt, mit dunklem Haar, das an den Schläfen bereits leicht ergraut war.
»Entschuldigen Sie bitte, wir sind nicht angemeldet, möchten aber dennoch den Hausherren sprechen«, sagte die Frau mit einer übertriebenen Betonung bestimmter Silben, als wollte sie besonders vornehm und gebildet wirken. Amalia durchschaute diese Maske sofort; das Gewöhnliche hinter der Fassade war unübersehbar. Der Hausherr weilte nicht mehr unter ihnen – das wusste hier jeder. Zudem war es kaum vorstellbar, dass ihr verstorbener Ehemann zu Lebzeiten mit solchen Personen in Kontakt gestanden hatte. Amalia war sich sicher, dass hier ein Missverständnis vorlag.
»Das wird kaum möglich sein«, sagte sie und musterte das fremde Pärchen mit skeptisch hochgezogenen Augenbrauen.
Das selbstsichere Auftreten der Frau, die Amalia gut um einen Kopf überragte, wankte kurz, doch dann richtete sie ihre Schultern auf, verzog die viel zu rot geschminkten Lippen zu einem falschen Lächeln und erklärte: »Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Ist Herr Klünder gerade nicht zu Hause?«
»Klünder?«
»Ja, Fiete Klünder, wir möchten ihm, wie bereits erwähnt, einen kurzen Besuch abstatten.«
Amalia schüttelte den Kopf. »Dagegen habe ich nichts einzuwenden, aber Fiete Klünder wohnt hier nicht.«
Die Fremde hob verwirrt die Hände. »Was soll das heißen, ›Fiete Klünder wohnt hier nicht‹? Das ist doch aber seine Adresse.«
Erneut schüttelte Amalia den Kopf. »Gewiss nicht! Dieses Anwesen befindet sich in vierter Generation im Besitz der Familie von Platen. Fiete Klünders Hofstelle liegt viel weiter außerhalb, in Richtung Friedrichskoog. Und jetzt müssen Sie mich bitte entschuldigen, ich habe zu tun!«, erklärte Amalia und schloss die Tür.
Gewöhnlich war sie nicht so kurz angebunden, doch die Situation hatte sich befremdlich angefühlt.
Das fast schon unfreundlich anmutende Auftreten der übertrieben geschminkten Frau und der beinahe schüchterne Mann im Hintergrund hatten unpassend gewirkt und das gewöhnliche Wesen des Pärchens nur umso deutlicher hervortreten lassen. Amalia konnte sich nicht vorstellen, was dieses seltsame Duo mit Fiete Klünder zu tun haben könnte. Nein, sie konnte wirklich keinen Sinn daraus ableiten.
Der Landwirt Fiete Klünder lebte sehr zurückgezogen auf seinem großen Hof und wollte allgemein mit niemandem außer seinen Kühen etwas zu tun haben. Er war vermögend, sehr vermögend, doch sein Geiz beinah schon legendär. Böse Zungen behaupteten, dass er den Cent nicht nur ein Mal, sondern fünf Mal umdrehte, bevor er ihn ausgab. Eine Frau hatte es nie auf seinem Hof gegeben, was Amalia nicht wunderte. Die rüde Art, wie er mit seinen Mitmenschen umging, ließ kaum Platz für menschliche Beziehungen. Doch hinter seiner harten Schale verbarg sich vielleicht auch eine einsame Seele, hatte Amalia schon manches Mal gedacht, ein verletzlicher und zutiefst einsamer Mann – nun ja, aber wer dermaßen unfreundlich mit einem jeden umging, durfte sich am Ende über Einsamkeit nicht beschweren.
»Wahrscheinlich arbeiten diese Herrschaften in der Versicherungsbranche«, murmelte Amalia, während sie ihren Plan in die Tat umsetzte und ihren Großneffen auf dem Handy anrief – etwas, das sie sich bislang strikt verboten hatte. Sie wollte nicht, dass Constantin dachte, sie würde ihn künftig mit ihrer Fürsorge einengen. Und sie selbst wollte vermeiden, sich nur noch mit seinem Wohlergehen zu beschäftigen.
Nach mehreren Freizeichen sprang Constantins Mobilbox an. Seufzend tippte Amalia auf den roten Hörer, als es plötzlich erneut an der Haustür klingelte. Noch mit dem Telefon in der Hand öffnete sie energisch die Tür und begann zu sprechen: »Ich habe Ihnen doch gerade erklärt, dass Sie sich in der Adresse geirrt …«
Doch dann stockte sie, ihre Augen weiteten sich vor Überraschung. Ein strahlendes Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus, und sie rief: »Constantin! Du bist es. Na endlich!« Constantin trat schmunzelnd näher. »Natürlich bin ich es. Wen hast du denn sonst erwartet?«
Nun lachte Amalia herzhaft. »Dich, mein Junge. Dich!«
»Und warum dann dieser überraschte Blick?«
Amalia winkte ab. »Gerade eben hat ein fremdes Paar hier bei mir geklingelt, und … nun ja, die beiden waren mir nicht ganz geheuer. Im ersten Moment dachte ich, sie wären zurückgekommen.«
»Du liest eindeutig zu viele Kriminalromane, liebe Tante Amalia«, scherzte Constantin mit einem Augenzwinkern. Dann umfasste er sanft ihre Schultern, beugte sich etwas vor und gab ihr einen Begrüßungskuss auf die Wange. »Aber jetzt bin ich ja hier. Da wirst du kaum noch Zeit für dein aufregendes Hobby haben.«
2
»Herzlich willkommen in Marne, Frau Fährmann!«, rief Polizeihauptmeister Hasso Lüders mit einem breiten Grinsen, als Finja die Polizeistation betrat. Doch das freundliche Willkommen konnte nicht über die trostlose Umgebung hinwegtäuschen. Der Raum war schlicht und erinnerte sie sofort an ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Die heruntergelassenen gräulich-weißen Außenjalousetten ließen kaum Licht herein und verstärkten den abweisenden Charakter des Gebäudes. Die Wände in einem fahlen Beige gestrichen, das seine besten Tage längst hinter sich hatte, und der Bodenbelag aus abgenutztem Linoleum knarrte bei jedem Schritt unter ihren Füßen.
In einer Ecke summte ein alter Ventilator monoton vor sich hin, ein vergilbtes Poster mit Verkehrssicherheitsregeln hing schief an der Wand. Die Möbel wirkten allesamt ein wenig wie zusammengewürfelt, ergaben alles andere als ein harmonisches Gesamtbild.
»Danke«, antwortete Finja knapp, während ihr Blick an dem Schreibtisch hängen blieb, der anscheinend für sie vorbereitet worden war. Neben einem länglichen »Willkommen Frau Kriminalhauptkommissarin Fährmann!«-Schild aus buntem Tonkarton befand sich ein grell pinker Notizblock, übersät mit glitzernden Strasssteinen. Daneben lag ein Kugelschreiber mit einem Plüschende in Form eines überdimensionalen Regenbogen-Einhorns.
»Ich dachte, das würde Ihnen gefallen«, sagte Lüders und klopfte sich auf seinen prallen Bauch, den er stolz vor sich hertrug, während er sonderbar glucksend lachte. »Ein bisschen Farbe kann nie schaden.«
Finja zwang sich zu einem Lächeln. »Sehr … kreativ«, grummelte sie und setzte sich auf den Schreibtischstuhl dahinter, woraufhin auch dieser ein gequältes Knarren von sich gab, als würde er in den letzten Zügen liegen.
Bente Fendrich, die junge Polizistin, leuchtende dunkle Knopfaugen, praktische Kurzhaarfrisur, die ihr etwas Burschikoses verlieh, trat auf sie zu. »Ich habe einen Apfelkuchen gebacken«, verkündete sie stolz und stellte eine Schale mit selbst gemachter Holunder-Vanillesoße daneben. »Ich hoffe, er schmeckt Ihnen, Frau Fährmann.«
»Das ist sehr nett«, erwiderte Finja höflich, wenn auch irritiert.
Joachim Clasen kam ebenfalls herbei und bot ihr Kaffee, Kakao und Tee an. »Wir wussten ja nicht, was Sie bevorzugen«, erklärte der Polizist entschuldigend.
»Kaffee ist perfekt«, murmelte Finja und fühlte sich vollkommen erschlagen; von dem altmodisch-trist eingerichteten Revier und ihren überfreundlichen und eifrigen Kollegen, die sie erwartungsvoll ansahen, strahlten und sich anscheinend wirklich freuten, sie hier bei sich zu haben.
Doch Finja konnte sich nicht überwinden zurückzulächeln. Das alles hier – es kam ihr vollkommen surreal vor, konnte doch unmöglich ihr neues Leben sein.
In der Pension, in der sie von Düsseldorf aus ein Zimmer gebucht und die im Internet eigentlich recht ansprechend gewirkt hatte, fühlte sie sich ebenso fehl am Platz wie auf dem Revier. Ein schmaler, düsterer Flur im Gästehaus führte zu ihrem karg eingerichteten Zimmer, das von einem großen Kreuz über dem schlichten Holzbett dominiert wurde. An der gegenüberliegenden Wand hingen zwei grellbunte Stickbilder: ein Fasanenpaar und ein üppiger Blumenstrauß in einer braunen Vase. Wohl der vergebliche Versuch, dem Raum eine heimelige Note zu verleihen.
Der besagte Flur schien ständig unter der wachsamen Aufsicht der neugierigen Pensionsbesitzerin Helga Fritsch zu stehen, die nur darauf brannte, ein Gespräch mit Finja zu beginnen. Der Hauch von Klatschlust umgab sie wie ein unsichtbarer Schleier. Ihr lüstern gaffender Ehemann und der kleine Kläffer namens Honey trugen ebenso wenig zur Verbesserung der Situation bei wie die laut schnatternden Gänse im Garten.
Sie musste sich unbedingt eine andere Unterkunft suchen, das war ihr schon bewusst gewesen, als sie vorgestern Abend die Pension »Zur Sonne« betreten hatte. Doch dazu fehlte ihr bisher die Energie; zumal sie auf ein nur kurzes Gastspiel hier in Marne hoffte. Als talentierte Kommissarin müsste doch jede modern arbeitende Mordkommission sie mit offenen Armen willkommen heißen … oder zumindest schnellstmöglich wieder zurück nach Düsseldorf holen!
Auch die weitere Umgebung trug wenig dazu bei, ihre Stimmung zu heben: Die Deiche erstreckten sich, so weit das Auge reichte. Gemütlich grasten die Schafe vor sich hin; frische Luft und kräftiger Wind sorgten für eine Atmosphäre der vollkommenen Entschleunigung. Anstelle des Großstadtlärms erwartete sie hier meditative Ruhe.
Die majestätischen Wälle wirkten wie sanfte Riesen; beschützten die Landschaft und strahlten zugleich Melancholie aus. Es war, als ob die Uhren hier langsamer tickten. Man konnte sich dem Zauber der Nordseeküste hingeben – alles schien perfekt zu sein –, wenn Finja Fährmann sich ihre neue Wirkungsstätte nicht vollkommen anders vorgestellt hätte!
Gedanklich hatte sie sich in einer aufregenden Metropole gesehen: Berlin oder Frankfurt, vielleicht sogar Hamburg. München wäre auch okay gewesen. Doch stattdessen war sie in Marne gelandet – was definitiv nicht Teil ihres Lebensplans gewesen war!
Man hatte ihr fatale Fehlentscheidungen vorgeworfen; Entscheidungen bei den Ermittlungen im Fall Rotlicht-Kalle, die letztendlich zu seiner brutalen Ermordung geführt hatten – was Finja nach wie vor nicht wirklich bedauerte. Doch dadurch war den Kollegen vom Drogendezernat die Arbeit der letzten zwei Jahre zunichtegemacht worden. Ihr Kronzeuge war ihnen nämlich flöten gegangen.
Finjas Vorgesetzter, Frank Dresdner, hatte ihr angeboten, sie vorübergehend aus der Schusslinie zu nehmen. Die Kollegen von der Internen Ermittlung standen angeblich bereits in den Startlöchern, und wenn sie einmal auf deren Radar geraten war, wäre es endgültig vorbei mit ihrer bisher makellosen und erfolgreichen Karriere. Allerdings war dieses Angebot an die Bedingung geknüpft, dass sie die Dienststelle wechselte – entweder in eine andere Stadt oder sogar in ein anderes Bundesland, möglicherweise vorübergehend nur als Urlaubsvertretung. Für Finja hatte das zunächst ganz akzeptabel geklungen; schließlich wollte sie ohnehin so viele Kilometer wie möglich zwischen sich und ihren Ex in Düsseldorf bringen.
Und nun saß sie in Marne fest – trostloses Kaff und ebenso trostlose Aussichten. Es hätte kaum schlimmer für sie kommen können.
Die ersten Tage fühlten sich für Finja dann auch wie ein zäher, endloser Strom aus grauem Einerlei an, genau wie sie es befürchtet hatte. Die Zeit schien sich quälend langsam zu bewegen, während sie in der öden Polizeistation saß und auf etwas wartete, das nie kam. Es gab kaum etwas zu tun – abgesehen von einem belanglosen Verkehrsunfall mit geringem Blechschaden, einem Ladendiebstahl bei Rewe durch einen fünfjährigen Übeltäter und zwei entlaufenen Gänsen. Mit jeder Stunde wuchs das Gefühl der Monotonie und der Leere in ihr, als ob die Welt um sie herum in einem tristen Grauton erstarrt wäre.
***
»Frau Fährmann, kommen Sie am Samstag auch zum Hoffest bei den Holsteins?«, fragte Bente Fendrich, als sie sich ins Wochenende verabschiedete.
Finja schüttelte den Kopf. »Ich habe leider schon etwas vor.« Das war natürlich eine glatte Lüge, aber auf dieses Hoffest verspürte sie noch weniger Lust als auf ihre Pensionswirtin.
»Ach, wie schade«, bedauerte Bente mit ihrer kindlich hellen Stimme. »Die Holsteins geben sich immer wahnsinnig viel Mühe. Es gibt was Leckeres vom Grill, Kaffee und Kuchen und sogar eine Live-Band. Letztes Jahr waren die so genial, dass bis spätabends getanzt wurde.«
Noch ein Grund mehr für Finja, auf gar keinen Fall dort zu erscheinen.
»Das klingt toll, aber wie bereits gesagt, leider bin ich schon verplant«, log Finja weiter, ohne eine Spur von Röte im Gesicht zu zeigen.
»Hach ja, aufs Hoffest hätte ich wohl auch Lust«, seufzte Hasso Lüders. »Ob es wohl wieder diese leckeren Schinken-Käse-Griller gibt?« Er schleckte sich mit der Zunge über die Lippen, während er seinen Kugelbauch, der bedenklich unter dem Hemd spannte, rieb.
»Wissen Sie was, Lüders«, beschloss Finja spontan, »ich übernehme den Wochenenddienst für Sie.« Lieber hier im Polizeirevier herumhocken, als in der Pension von dieser unerträglichen Fritsch belauert zu werden. Außerdem hatte sie hier wenigstens freien Zugang zum Polizeicomputer und konnte ein wenig nach vakanten Stellen recherchieren.
»Wirklich?« Lüders starrte sie ungläubig an. »Aber … aber Chefin, Sie haben doch die ganze Woche durchgearbeitet, und außerdem wollen Sie doch bestimmt die Zeit nutzen, um sich hier noch besser einzuleben und –«
»Lüders, ich übernehme für Sie!«, unterbrach Finja bestimmt, während ihr Kollege sie immer noch mit großen Augen ansah.
Unschlüssig wandte er sich an Bente, die strahlend mit den Schultern zuckte.
»Das ist wirklich supernett von Ihnen, Frau Fährmann«, sagte Bente. Und dann an Lüders gewandt: »Freu dich doch, Hasso.«
Polizeihauptmeister Hasso Lüders schien immer noch etwas verwirrt zu sein, aber schließlich brach ein dankbares Lächeln auf seinem Gesicht durch. »Ja, Chefin, da hat die Bente vollkommen recht, das ist wirklich unheimlich nett von Ihnen«, brabbelte er. Sein Glück war förmlich greifbar, was Finja mit einem leichten Stirnrunzeln beobachtete. Es war ihr einfach unbegreiflich, wie ein simples Hoffest und die Aussicht auf fettige Schinken-Käse-Griller die trostlose Bevölkerung hier in Marne in wahre Verzückung versetzen konnten. Doch irgendwie war es fast schon verständlich, bedachte man die gähnende Langeweile und die absolute Stille, die sonst in dieser verschlafenen Gegend herrschten.
»Dann trage ich mich aber direkt fürs nächste Wochenende ein, abgemacht, Chefin?«, erklärte Lüders übereifrig.
Doch bevor er zur Tat schreiten konnte, wurde er von seiner Kollegin Bente daran erinnert: »Du, Hasso, da finden doch aber die Besprechung und ersten Vorbereitungen für die Kohltage statt.« Klatschend schlug Lüders sich die Hand vor die hohe Stirn. »Beiß mich der Ameisenbär, das habe ich ja völlig vergessen.« Mit einem Kleinkindverlegenheitsblick wandte er sich an Finja. »Das Kohlfest findet im September statt und ist etwas ganz Besonderes und wird hier mehrere Tage lang gefeiert. Meine Frau, die Jutta, und ich, wir sind im Festkomitee, und ich kann da –«
Finja fiel ihm ins Wort. »Schon gut, Lüders, ich übernehme auch das nächste Wochenende. Und nun ab mit Ihnen beiden in den Feierabend.«
»Nicht Ihr Ernst, Chefin«, staunte Lüders ungläubig.
»Und ob!«, erwiderte Finja mit einem falschen Lächeln und einer wedelnden Handbewegung, um ihre Kollegen aus der öden Polizeidienststelle zu scheuchen.
Die Tür war fast schon hinter ihnen zugefallen, als Bente noch rief: »Hintergrunddienst hat ja der Jo ein letztes Mal, bevor er uns dann verlässt, um zurück in seine Dienststelle zu gehen. Aber das wissen Sie ja, Frau Fährmann.«
Ja, das war ihr bewusst – und sie beneidete ihren Kollegen dafür, dass sein kurzes Aushilfsgastspiel nun zu Ende ging.
Mit einem hörbaren Klack ließ sie sich auf ihren durchgesessenen Chefschreibtischstuhl sinken. Ihr Vorgänger schien tatsächlich viel Zeit im Sitzen verbracht zu haben, was angesichts des mangelnden Verbrechensaufkommens in diesem verschlafenen Kaff nicht überraschte. Das schlimmste Verbrechen schien hier zu sein, dass gelegentlich eine Horde Jugendlicher Spaß daran hatte, die Schafe auf dem Deich umzukippen.
Ihre durch und durch trostlosen Gedanken drifteten nach Düsseldorf ab. Sie stellte sich vor, wie sie sich mit Hendrik über die skurrilen Leute hier amüsieren würde, während sie an ihrem schicken Esstisch saßen, indisches Essen genossen und dazu exzellenten Rotwein tranken. Die Vorstellung war so absurd, dass sie tatsächlich fast lachen musste – oder dann doch eher weinen, wie die heiße Träne verriet, die ihr plötzlich über die Wange lief.
»Na toll, Finja«, schimpfte sie mit sich selbst. »Statt hier im Elend zu versinken, solltest du lieber im Polizeicomputer nach einer freien Stelle suchen und schnellstmöglich von hier verschwinden.« Das Lösen des mysteriösen Falls von Schafumkippen durfte sicherlich nicht das glamouröseste Highlight in ihrer Karriere als Kriminalhauptkommissarin sein.
Mit einer energischen Geste klatschte sie in die Hände und erhob sich elegant von ihrem Stuhl. Sie strich bedacht die Falten aus der edlen dunkelblauen Burberry-Hose, die sie geschmackvoll mit einer weißen Seidenbluse und eleganten schwarzen Pumps desselben renommierten Labels kombiniert hatte. Ihr langes, seidig glänzendes dunkelbraunes Haar fiel in sanften Wellen über ihre Schultern und betonte ihre markanten blauen Augen. In diesen schlichten Räumlichkeiten wirkte sie wie ein exotischer Vogel, der zwischen Tauben gelandet war. Sowohl durch ihre innere Einstellung als auch durch ihr äußeres Erscheinungsbild hob sie sich deutlich von allem hier ab – und genau deshalb würde sie auch alles daransetzen, zu beweisen, dass die bescheidene Polizeistation in Marne nur eine ganz, ganz kurze Episode in ihrer bisher so erfolgreich verlaufenen Karriere bedeutete.
Ganz bestimmt war das so!
3
»Was meinen Sie, Doktor, auf welchem Bein lahmt de Janulf?«
Constantin von Platen rieb sich mit dem Zeigefinger über den Nasenrücken. Das tat er häufig, wenn er nachdachte.
»Eben beim Traben ist er aufs Linke gefallen«, sagte er schließlich.
Die buschigen Brauen des Friesen-Züchters Onno Friedrichs wanderten erstaunt nach oben. »Links? Nöäh, da täuschen Sie sich, Doktor. De is nich auf dem linken Fuß lahm.«
»Das habe ich auch nicht gesagt«, stellte Constantin von Platen richtig. »Er fällt aufs linke Bein, weil er rechts entlastet. Also lahmt er rechts.«
Mürrisch schob der ältere Mann die wulstige Unterlippe vor. »Ja, und warum sagen Sie dat nich gleich und drücken sich so verkruxt aus? Muss wohl so sein, wenn einer direkt von de Hochschule kommt.«
Constantin verzichtete darauf, den Züchter darauf hinzuweisen, dass er bereits vor sechs Jahren sein Studium beendet und seitdem als fertiger Tierarzt an der TIHO in Hannover gearbeitet hatte. Brachte eh nichts. Onno Friedrichs hörte wohl nur, was er hören wollte. Und hielt das für die Wahrheit, was ihm am besten in den Kram passte.
Constantin befühlte das Fesselgelenk des rechten Vorderbeins des stämmigen Friesen. Dann tastete er sich weiter nach oben bis zum Knie, obwohl er längst ahnte, wo das Problem – oder anders ausgedrückt: der Schmerz – bei dem Pferd saß. Auch das war etwas, das er sehr schnell begriffen hatte: ordentlich untersuchen, bevor man mit der Diagnose herausrückte. Sonst waren die Leute der Meinung, man wäre sein Geld nicht wert.
Schließlich legte er die Hand auf den Huf des Hengstes und fühlte, was er genau so erwartet hatte: Der Huf war warm.
»Und?«
»Ich tippe auf ein Hufgeschwür.«
»Ach herrje, so was hat de noch nie gehabt.« Onno Friedrichs kratzte sich umständlich am Hinterkopf. »Aber gut, wie Sie wollen. De Janulf hat also ein Hufgeschwür. Dann tun Sie doch was, ja?«
Constantin hatte inzwischen die lange Zange aus seinem Transporter geholt, um durch gezieltes Abdrücken festzustellen, wo genau das Geschwür im Huf saß. Mit etwas Glück konnte er es direkt aufschneiden und dem Pferd somit schnelle Erleichterung verschaffen. So ein Hufgeschwür war nämlich verdammt schmerzhaft.
Beim ersten Ansetzen zuckte der Friese schon derart zurück, dass sich jede weitere Untersuchung erübrigte.
»Reeespekt«, sagte Onno Friedrichs, lachte glucksend, bevor er dem Doktor anerkennend auf die Schulter klopfte. Allerdings mit etwas sehr viel Elan, sodass es Constantin fast von den Sohlen riss.
»Hopsala, Herr Doktor«, amüsierte Onno Friedrichs sich. »Dat war doch nix für ’nen gestandenen Kerl.«
Constantin bedankte sich mit einem unverbindlichen Lächeln, bevor er den rechten Fuß des Friesen hochnahm und ihn sich zwischen die Knie klemmte.
»Wollen Sie de Janulf denn nich sedieren?«, wunderte Onno Friedrichs sich. »Wenn dem was wehtut, kann de ganz schön grantig werden.«
»Bis der grantig wird, Herr Friedrichs, fließt der Eiter schon in Strömen.«
»Bäh!« Angeekelt verzog Onno Friedrichs das Gesicht. Tja, von wegen gestandener Kerl, schoss es Constantin nicht ohne Genugtuung durch den Kopf.
Konzentriert begann er zu schneiden. Constantin ging der dunklen Stelle nach, wo die Infektion in den Huf eingedrungen war, und sah schließlich, wie unter der Messerklinge ein dünner Eiterstrahl hervorschoss, der zu einem konstanten Rinnsal wurde.
Züchter Onno Friedrichs fummelte ein kleinkariertes Stofftaschentuch aus seiner grauen Cordhosentasche hervor und presste es sich auf Nase und Mund.
»Bah, dat stinkt ja widerlich«, hörte Constantin ihn darunter nuscheln. »Dat Sie dat riechen können, Doktor.«
»Es gibt tatsächlich weitaus Schlimmeres«, gab Constantin zurück.
Anschließend legte er dem Friesen einen dicken Watteverband an, den er mit breitem Klebeband verstärkte. Er erklärte Onno Friedrichs, wie er zweimal täglich den Huf anzugießen hatte, und räumte danach seine Utensilien zurück in den Transporter.
»Hol mich de Teufel, dat war gute Arbeit, Doktor, dat muss ich schon sagen«, brummte Onno Friedrichs, während er Constantin die kräftige Hand hinhielt.
Constantin ergriff sie und gab mit einem Lächeln zurück: »Die wird sich dann in meiner Rechnung widerspiegeln.«
Prompt verdunkelten sich Onno Friedrichs’ Züge.
»Na, na, so dolle kann’s doch wohl nich werden! Sie haben doch ratzfatz gefunden, was de Janulf geplagt hat.«
Constantin wollte erklären, dass er sich lediglich ein kleines Späßchen erlaubt hatte, als das Handy in seiner Hosentasche zu summen anfing. »Entschuldigung, mein Telefon, da muss ich rangehen«, sagte er und nahm den Anruf entgegen.
»Sind Sie der neue Tierarzt?«, fragte eine Männerstimme. »Dieser Verwandte von der von Platen?«
»Ja, der bin ich. Was kann ich für Sie tun?«
»Ich weiß nicht, ob Sie etwas für mich tun können.« Die Stimme klang jetzt arrogant. »Ich bin Fiete Klünder. Ich habe hier eine Kuh, die kalbt. Bis eben ist auch alles wie geschmiert gelaufen, aber nun geht’s nicht weiter. Ich schätze, das Kalb hat sich gedreht und steckt jetzt im Geburtskanal fest. Verstehen Sie was von Geburten?«
Diese Frage ging Constantin gehörig gegen den Strich, ebenso der herrische Tonfall dieses Klünder. Dennoch blieb er freundlich, als er erwiderte: »Ich bin Tierarzt. Also werde ich wohl etwas davon verstehen.«
Es folgte eine kurze Pause, dann ein sonderbares Knurren, gefolgt von einem knappen: »Wann sind Sie hier?«
»Ich bin gerade bei einem anderen Patienten fertig geworden und könnte direkt losfahren. Dafür bräuchte ich natürlich erst einmal Ihre Adresse.«
»Dann aber zügig!«, verlangte Fiete Klünder, nannte ihm die Adresse, schob unfreundlich wie gehabt hinterher: »Aber lassen Sie mich bloß nicht lange warten!«, und beendete das Gespräch.
Kopfschüttelnd verstaute Constantin das Handy wieder in der Hosentasche, verabschiedete sich von Onno Friedrichs und setzte sich hinters Steuer seines Transporters.
Als er den Motor startete, trat Onno Friedrichs an die Fahrertür des Wagens und gab Constantin zu verstehen, dass er das Fenster herunterlassen sollte.
»Hab ich dat gerade richtig mitgekriegt, Doktor, de Kuh vom Klünder macht Probleme beim Kalben?«
Constantin nickte. »Scheint so.«
Unheilvoll verzog Onno Friedrichs das Gesicht. »Dann beeilen Sie sich mal, dat Sie zum Klünderhof hinkommen. Dat kann nur de Berta sein. Wegen ’ner anderen würde de keinen Tierarzt kommen lassen. De is nämlich dem Fiete sin Lieblingskuh. Wenn de was passiert, dann können Sie als Tierarzt hier direkt wieder einpacken. De ist zwar ein oller Sturkopf und geizig wie kein Zweiter, aber de hat was zu sagen. Wenn’s nichts Gutes ist, wird’s eng für Sie.«
Eigentlich wollte Constantin auflachen. Wer auch immer dieser Klünder war, sicherlich ließ er sich von ihm nicht einschüchtern. Aber wie Onno Friedrichs ihn nun ansah, wirklich besorgt – nun ja, hier tickten die Uhren tatsächlich anders, das hatte Constantin schon nach knapp zwei Wochen begriffen. Besser war es also, sich zu beeilen.
Das tat er dann auch, doch nützte es ihm nichts. Schuld war die doofe Navitante, fand er. Die hatte ihn nun mehrfach auf eine falsche Route geschickt. Eine davon führte ihn schnurstracks in den Graben. Auf der jetzigen war er nun am Deich gelandet, weit und breit kein Hof zu sehen.
Schließlich wusste Constantin sich keinen anderen Rat mehr, als Amalia anzurufen, um sich von ihr den Weg beschreiben zu lassen.
»Ich suche nun schon bestimmt seit einer Dreiviertelstunde und lande immer wieder am Deich, wo es dann nicht weitergeht.«
»Ach so, ja, ich denke, du befindest dich auf der anderen Seite, da kommt man tatsächlich nicht weiter. Der richtige Weg führt dich von Helse nach Friedrichskoog. Auf der linken Seite befindet sich ein großer Obst- und Gemüse-Händler, den kannst du überhaupt nicht übersehen, und direkt dahinter führt eine schmale Straße Richtung Meer. Die nimmst du, biegst dann aber gleich nach rechts ab, die Straße dort ist sehr schmal und auch ganz schön holprig, eher ein ausgebauter Feldweg, also nicht wundern. Dann hast du aber auch schon bald die Kuhweiden links und rechts von dir und fährst direkt auf den Klünderhof zu. Übrigens, Conzi, Fiete Klünder ist ein ausgesprochen unangenehmer Mann. Lass dich bloß nicht von dem ärgern, sondern biete ihm gleich Paroli. Sonst behandelt der dich wie seinen Lakaien.«
»So wie der am Telefon klang, habe ich das bereits befürchtet«, brummte Constantin und bedankte sich bei Amalia.
Wenig später hatte er tatsächlich die Hofeinfahrt vor sich und konnte sich nur über sich selbst wundern, weil er mehrfach eben an genau diesem Obst- und Gemüse-Händler vorbeigefahren war, aber die Straße direkt dahinter nicht wahrgenommen hatte. Während Constantin seinen Transporter auf einen makellos sauberen und top gepflegten Drei-Seiten-Hof steuerte, dessen auffallender Mittelpunkt das imposante Wohnhaus im traditionellen Fachwerkstil bildete, rumorte der Ärger noch immer in ihm. Der Weg hierher war so simpel, dass er dem sicherlich inzwischen noch grantigeren Landwirt kaum glaubhaft machen konnte, sich mehrfach verfahren zu haben. Es sei denn, er wollte riskieren, dass es sich wie ein Lauffeuer verbreitete, wie trottelig der neue Tierarzt war. Zu blöd zum Autofahren.
Manche Leute hier waren womöglich schnell mit ihren Urteilen und taten sich andersherum ausgesprochen schwer damit, ein einmal gefälltes wieder zu revidieren, hatte Amalia ihm gesagt.
Beim Aussteigen versuchte Constantin, das nagende Gefühl abzuschütteln, dass seine Karriere als neuer Landtierarzt bereits ruiniert sei, noch bevor sie richtig begonnen hatte – was natürlich eine deutliche Übertreibung war. So viel Einfluss konnte dieser Klünder schließlich nicht haben, zumal dringend ein neuer Tierarzt gebraucht wurde, nachdem der vorherige in den Ruhestand gegangen war.
Energisch schob er die Seitentür des Transporters auf, um seine Tasche herauszunehmen. Da kam ein bulliger Rottweiler aus seiner Hütte neben dem Haupthaus gesprungen und begann, wie blöd zu kläffen. Glücklicherweise hielt das Zwingergitter den nicht besonders freundlich aussehenden Kraftprotz davon ab, hautnahe Bekanntschaft mit dem neuen Tierarzt zu machen.
»Hallo, Herr Klünder!«, versuchte Constantin das Bellen des Hofhundes zu übertönen und sah sich dabei suchend auf dem Hof um. »Constantin von Platen … Der Tierarzt ist da!« Bis darauf, dass sich der Rottweiler noch wütender gegen das Zwingergatter warf, passierte nichts. Weder Scheunen- oder Stalltür noch die doppelflügelige strahlend weiße Haustür öffnete sich.
Okay, dann musste er eben allein den Weg zu Berta finden. Was bestimmt nicht unmöglich war, bei dem Flachdachgebäude zur rechten Seite konnte es sich nur um den Viehstall handeln, während das gegenüberliegende, weitaus höhere unter Garantie die Scheune war, in der sich Heu, Stroh und alle möglichen Gerätschaften befanden.
Von allergefährlichstem Kläffen und Knurren des Hofhundes begleitet, marschierte Constantin zu dem Stallgebäude hinüber. Ammoniakbeladene Stallluft schlug ihm entgegen, als er die graue Stahltür links neben dem breiten Haupttor aufdrückte. Mehrere Kühe befanden sich auf beiden Seiten in Laufställen und beäugten ihn erwartungsvoll, hier und da muhte auch eines der Tiere, als hoffte es auf Futter. Tatsächlich erkannte Constantin, dass die Hoffnung der Tiere nicht unbegründet war. Die Heusilage lag bereits servierbereit auf dem Mittelgang. Es brauchte nur noch jemanden, der die Silage in die Fressrillen schob.
»Hallo, Herr Klünder?«, rief Constantin.
Die Kühe muhten nun noch fordernder. Ansonsten war nichts zu hören, sodass das ungute Gefühl in ihm eine leise Stimme bekam, die hämisch rief: Zu spät! Du kommst so was von zu spät!
Mist!
Am Ende des Stalles entdeckte Constantin auf der rechten Seite eine weitere graue Stahltür. Er nahm an, dass sich dahinter der Geräteraum befand, und wollte sie zunächst gar nicht öffnen, legte dann aber doch die Hand auf die Klinke und – o Wunder, schon stand er in einem weiteren Stall. Hier gab es allerdings keine Laufställe, sondern zu beiden Seiten großzügige Boxen. Gleich in der ersten entdeckte er eine Kuh samt ihrem frisch geschlüpften Kalb, das noch ganz blutig war. Die Geburt des Jungtieres konnte nur wenige Augenblicke zurückliegen.
»Berta?«, fragte Constantin voller Hoffnung.
Ein erleichtertes Lächeln mischte sich unter seine bis eben noch so verzagten Züge, als er erkannte, dass ansonsten der Stall leer war. Demnach konnte es sich bei der jungen Mutter nur um besagte Berta handeln. Sie hatte es also geschafft, oder vielmehr ihr kleiner … ähm, Constantin musste erst einmal genau hinschauen, aha, ihrer kleinen Tochter war der Weg ans Licht doch noch aus eigener Kraft gelungen. Eine andere Möglichkeit war natürlich, dass Bauer Fiete Klünder in seiner Not beherzt zugepackt hatte, weil der Tierarzt verdammt noch mal nicht aufgetaucht war. Hm, und wo konnte man den frischgebackenen Geburtshelfer finden, um ihm zu gratulieren und sich für die Verspätung zu entschuldigen?
Wahrscheinlich im Haus, um sich zu waschen, kombinierte Constantin. Vollkommen logisch – wenn Klünder mit dem halben Oberkörper im Geburtskanal seiner Berta gesteckt hatte, sehnte er sich anschließend garantiert nach einer Dusche und sauberer Kleidung. Constantin tat, was er noch tun konnte: Er untersuchte Muttertier und Kalb, entsorgte die Nachgeburt und rieb dem Kalb anschließend noch mit etwas Stroh das restliche Blut, das Berta nicht abgeschleckt hatte, aus dem feuchten Fell. Weil Bauer Fiete Klünder noch immer nicht zurück bei Mutter und Kind war, beschloss er, rüber zum Haus zu gehen und dort zu klingeln. Eine Rechnung würde er hier sicherlich nicht mehr schreiben, aber wenigstens wollte er sich dem Landwirt vorstellen. Mit etwas Glück war Fiete Klünder so erleichtert, dass die Berta samt Tochter es doch geschafft hatte, dass er ihm die unentschuldbare Verspätung nicht allzu krummnahm.
Doch auch nach dreimaligem Läuten wurde Constantin nicht geöffnet. Entweder stand Fiete Klünder noch immer unter der Dusche und hörte das Klingeln nicht, oder er war tatsächlich nicht zu Hause.
Nun gut, dann gab es hier also nichts mehr für ihn zu tun, außer den Rückzug anzutreten und den Klünderhof wieder zu verlassen.
Er war bereits wieder bei seinem Transporter – der Rottweiler kläffte sich die Seele aus dem Leib –, als ihm einfiel, dass er Fiete Klünder doch einfach anrufen konnte. Die Nummer des Landwirtes befand sich immerhin in seiner Anrufliste.
Meine Güte, warum war er eigentlich nicht längst auf die Idee gekommen?
Constantin nahm sein Handy aus der Hosentasche, tippte auf die in der Anrufliste angezeigte Nummer des Landwirtes und wartete. Die Verbindung wurde aufgebaut … Das Freizeichen erklang, und schon dudelte »Thunderstruck« von AC/DC als Klingelton getarnt los, woraufhin der Rottweiler abrupt verstummte.
Der AC/DC-Sänger brüllte sich die Seele aus dem Leib: »Thunderstruck, thunderstruck – Yeah, yeah, yeah, thunderstruck, thunderstruck – Yeah, yeah, yeah!«
Constantin setzte sich in Bewegung. Er folgte dem Klingelton ums Haus herum und stand schließlich im Garten. Auch hier war alles top in Schuss. Perfekt gestutzter Rasen. In den Rabatten blühten die saisonalen Blumen und Stauden farblich und größenmäßig aufeinander abgestimmt. Gartenmöbel von bester Marke und Qualität befanden sich auf der mit hellen Natursteinplatten gepflasterten Terrasse. Darüber eine cremefarbene Markise.
Einzig das große Fass, das im unteren Bereich der weitläufigen Rasenfläche stand, störte das harmonische Bild, das sich Constantin von Platen bot. Es war nicht nur die Ansammlung von kleinen grünen Äpfeln, die noch weit entfernt von der Erntezeit waren und träge im Behälter lagen; es war vor allem die Gestalt, die kopfüber darin steckte. Constantin konnte nur vermuten, dass es sich um einen Mann handelte, denn die Beine und Stiefel, die aus dem Fass ragten, waren eindeutig männlich. Die groteske Haltung ließ ihn frösteln – es war unmissverständlich klar, dass der Mann, wer auch immer er gewesen sein mochte, nicht mehr lebte.
4
Amalia von Platen hatte es sich mit einem Buch in ihrem Lieblingssessel gemütlich gemacht. Bevor sie es aufschlug und zu lesen begann, schweiften ihre Gedanken jedoch zu Constantin ab, und sie fragte sich, ob es ihm wohl gelungen war, den Weg zum Klünderhof zu finden. Den Gedanken versuchte sie jedoch prompt wieder auszublenden. Wenn das nicht der Fall wäre, hätte er sich noch mal bei ihr gemeldet. Außerdem wollte sie sich doch nicht ständig den Kopf darüber zerbrechen, ob Conzi mit den zuweilen recht schwierigen Leuten hier zurechtkam.
Entschlossen schlug Amalia den Roman auf. Der Buchumschlag und der Klappentext waren ziemlich vielversprechend gewesen, darum hatte sie ihn in ihrer Stammbuchhandlung gekauft.
Natürlich hatte ihr Buchhändler Tore Clausen ihr wie immer davon abgeraten. »Schon wieder Usedom. Schon wieder attraktiver Hauptkommissar und Kollegin, die sich erst nicht ausstehen können, dann aber zum Liebespaar werden. Ich sag es Ihnen, werte Frau von Platen, Sie werden sich schrecklich langweilen, weil alles so vorhersehbar ist. Kein vernünftiger Spannungsbogen, wirklich nicht«, hatte er ihr prophezeit.
Trotz Tore Clausens anhaltender Kritik hatte Amalia den Roman gekauft. Ein Großteil ihres Entschlusses war aus Trotz gegenüber ihm entstanden, der ihr das Genre schon seit einer gefühlten Ewigkeit madig machen wollte.
»Lesen Sie doch mal etwas Anspruchsvolleres, werte Frau von Platen, statt immer nur diese platten Kriminalromane«, hatte er ihr mehrfach geraten.
Amalia hatte bisher noch nie online eingekauft, da sie strikt dagegen war – ihrer Meinung nach musste der örtliche Handel gestärkt und am Leben gehalten werden. Sollte sie jedoch wider Erwarten ihre Meinung ändern, dann würde es zugunsten von Online-Buchhandlungen sein, um den missbilligenden Blicken und den ewigen unaufgeforderten Ratschlägen ihres Buchhändlers zu entgehen.
Amalia begann zu lesen. Leider konnte sie bereits nach wenigen Seiten zu keinem anderen Urteil gelangen, als ihrem brummigen Buchhändler recht zu geben. Der Schreibstil war offensichtlich bewusst schlicht gehalten, aber leider nicht gekonnt schlicht. Die Handlung von Anfang an vorhersehbar und die beiden Hauptprotagonisten so klischeehaft, dass Amalia enttäuscht schnaufte, während sie sich eine Haarsträhne ihres gepflegten schlohweißen Haares hinters Ohr klemmte, die sich aus dem Zopf gelöst hatte. Es war klar, dass der Kauf ein weiterer literarischer Fehlgriff gewesen war – leider genau wie Tore Clausen ihr prophezeit hatte.
Entschieden klappte sie das Buch zu und legte es auf den Beistelltisch neben sich. Amalia ließ ihren Blick in der schönen Bibliothek umherschweifen. Eine ganze Weile lang. Sie dachte an die vielen Bücher, die sie bisher gelesen hatte, und daran, dass der größte Teil davon schon recht gut gewesen war. In letzter Zeit jedoch, hm … Leider hatte sie sich einige Male vom äußeren Erscheinungsbild und von großen Kampagnen täuschen lassen, aber vor allem von der sogenannten Bestsellerliste. Schon lange, sehr lange vertraute sie dieser nicht mehr, weil sich ihr einfach bei einer Vielzahl der Titel nicht erschloss, warum sie es auf diese Liste geschafft hatten. Früher, als ihr Mann Anton noch gelebt hatte, hatten sie oft hier zusammengesessen und sich über ihre aktuellen Bücher ausgetauscht, über die Literatur im Allgemeinen und ganz Speziellen. Sie hatten analysiert, kritisiert, gelobt und manchmal herzhaft gelacht. Was er wohl über das aufkommende Genre der Dark Romance denken würde? Diese Geschichten, durchzogen von grenzwertigen Themen und düsteren Helden, entführten die Leser in eine Welt, in der prickelnde Erotik auf alltägliche Gewalt traf und Moral oft ein Fremdwort blieb.
Tore Clausen hatte ihr erzählt, dass vor allem emanzipierte junge Frauen zu diesen Werken griffen – Frauen, die ihre Rechte kannten und selbstbewusst im Beruf sowie im Leben standen. Doch paradoxerweise fühlten sie sich von Erzählungen angezogen, in denen sexuelle Gewalt von einem unwiderstehlich attraktiven Täter ausging.
Nein, Anton würde dies nicht nachvollziehen können, zumal er Gewalt stets als Ausdruck von Schwäche betrachtet hatte – ein Verhalten, das von jenen ausging, die unfähig waren, mit überzeugenden Argumenten zu agieren.
Während Amalia in alten Erinnerungen schwelgte, wurden ihre Augenlider immer schwerer, und das Hier und Jetzt löste sich allmählich auf. Die Grenze zwischen Realität und Phantasie begann zu verschwimmen, bis Amalia sanft in einen Traum glitt: Sie war eine erfolgreiche Kommissarin, ihr Assistent Tore Clausen. Der Buchhändler, der plötzlich in gestärkter Uniform auftauchte, benahm sich äußerst besserwisserisch. Er behauptete immer wieder, dass die übertrieben geschminkte Frau, die unerwartet ebenfalls in Amalias Traum erschien, diejenige sei, die das Opfer zuerst ausgeraubt und dann auf grausame Weise entsorgt hatte. Amalia wies ihn energisch zurecht, doch Clausen schien unbeirrbar …
Ärgerlich runzelte Amalia die Stirn, als ein störendes Geräusch an ihr Ohr drang, das es ihr unmöglich machte, sich weiterhin auf den Mordfall zu konzentrieren, den sie gerade zu lösen versuchte. Ein schriller Laut – unerträglich und nervend. Was war das?