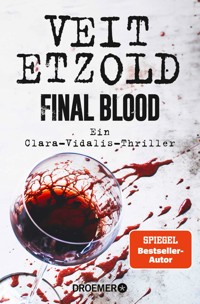Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Clara Vidalis Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein Leichenfund gibt der Berliner Polizei Rätsel auf. Dem Mordopfer wurden mysteriöse Zeichen in die Haut geritzt, die Clara Vidalis bekannt vorkommen. Handelt es sich um kultische Symbole? Als die Obduktion der Leiche weitere grausame Details ans Licht bringt, wird klar, dass es einen ähnlichen Modus Operandi schon einmal gab: Vor zehn Jahren versetzte ein Serienkiller den Westen der USA in Angst und Schrecken. Einen Sommer lang trieb er dort sein Unwesen, bevor er sich mit der blutigen Botschaft verabschiedete: "It's not over, till it's over". Ist der Totenzeichner zurückgekehrt?
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:6 Std. 59 min
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Prolog
Erstes Buch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Zweites Buch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Drittes Buch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Epilog
Dank
Veit Etzold
DERTOTEN-ZEICHNER
Thriller
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Ein Projekt der AVA international GmbH
Autoren- und Verlagsagentur
www.ava-international.de
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Wolfgang Neuhaus
Titelillustration: © shutterstock/Eky Studio; © shutterstock/Gordan
Umschlaggestaltung: Massimo Peter
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-0673-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Von allem Geschriebenen liebe ich nur das, was einer mit seinem Blute schreibt.
Prolog
Los Angeles
Es war Sommer in der Stadt der Engel. Die Männer vom Los Angeles Police Department, kurz LAPD, nannten diesen Sommer des Jahres 2004 den »Blutsommer«. Die Presse war als Erste auf diesen Namen gekommen, und die Einsatzkräfte hatten ihn weiter verwendet, denn er passte sehr gut.
Blutsommer 2004.
Ein brutaler Killer hatte diesem Sommer seinen blutigen Stempel aufgeprägt. Die Ermittler hatten diesen Psychopathen noch immer nicht geschnappt. Und wie es aussah, hatte er soeben wieder zugeschlagen.
Los Angeles, dachte Detective Brooks. Stadt der Engel.
Brooks verzog das Gesicht. Er wusste beim besten Willen nicht, was dieser verkommene, oberflächliche, kranke, abartige Haufen Schmutz von einer Stadt mit Engeln zu tun haben könnte, dazu fehlte Brooks seit Jahren die Fantasie. Himmlische Zustände herrschten hier nicht, ganz im Gegenteil.
Brooks war seit zwanzig Jahren beim LAPD und hatte in seiner Karriere schon einiges gesehen. Schlimme Dinge. Albtraumhafte Bilder. Hunderte von Opfern, von denen die meisten erschossen worden waren. Eine Kugel ins Herz. Oder in den Kopf. Oder beides.
Los Angeles, dachte er wieder einmal. Stadt der Engel. Dass ich nicht lache.
Brooks fragte sich oft, warum er überhaupt noch hier war. Warum er nicht endlich verschwand. L. A. war ein von der Sonne beschienenes Grab, ein Ort, wo man verwesen konnte, ohne dass jemand es bemerkte. Manche merkten es nicht einmal selbst. Sie verwesten bei lebendigem Leibe und wussten nichts davon.
Fast achtzehn Millionen Einwohner lebten im Großraum Los Angeles, dem riesigen Moloch, der sich Jahr für Jahr einen Kilometer weiter in die Wüste fraß, bis er irgendwann Las Vegas erreichen würde und zwei verfluchte Städte endlich verschmolzen wären. Dann hatte ein rachsüchtiger Gott es einen fernen Tages einfacher, sie vom Antlitz der Erde zu tilgen.
Bei Sodom und Gomorrha, dachte Brooks, musste Gott zweimal zuschlagen. Bei L. A. und Las Vegas reicht es womöglich, wenn er einmal hinlangt. Hoffen wir’s.
Los Angeles lag auf der berühmt-berüchtigten San-Andreas-Spalte, einer geologisch instabilen Verwerfungszone. Seit 1800 war die Stadt von neun großen Erdbeben heimgesucht worden, aber totzukriegen war sie nicht. Hier gab es die meisten Verbrechen, die meisten Geistesgestörten, den meisten Smog und die schießwütigsten Cops, wobei Letzteres nur eine Reaktion auf die Umstände war. Das beste Wetter gab es hier auch, könnte man hinzufügen, die Sonne Kaliforniens. Über nasskalte Tage konnte man sich in L. A. selten beklagen, eher über zu viel Hitze, die besonders dann unappetitlich wurde, wenn eine verwesende Leiche in einem Zimmer lag und die Klimaanlage ausgefallen war.
So wie der Tote, den sie an diesem Tag fanden.
Brooks hatte vor einer Viertelstunde den Anruf erhalten, und gemeinsam mit fünf Officers des LAPD hatte er die Tür des großen Hauses aufgebrochen.
»Warum ist es hier so dunkel?«, fragte Brooks nun.
Die Strahlen starker Taschenlampen zuckten durch den Eingangsflur, tasteten sich durch die Dunkelheit, während die Männer jede Sekunde darauf gefasst waren, auf etwas Furchtbares, Abscheuliches zu stoßen.
»Jemand hat die Sicherung rausgerissen. Deshalb geht auch die Klimaanlage nicht.« Einer der Officers zuckte die Schultern. »Vorher hat er noch die Jalousien runtergelassen.«
Es war eine bizarre Situation. Draußen schien die kalifornische Sonne von einem azurblauen Himmel, hier drin herrschte tintenschwarze Nacht. Außerdem war es brütend heiß, die Luft dumpf und schwül und drückend, weil die Klimaanlage keinen Strom mehr bekam. Mit anderen Worten: Alles war so, wie Kalifornien und diese Stadt immer schon waren. Die düsteren Seiten Hollywoods, die Hippies, die Satanisten, die Serienkiller. Glänzende Oberfläche, pechschwarze Seele.
Brooks und die Officers bewegten sich langsam weiter ins Haus. Fliegenschwärme stoben auf und surrten in sämtliche Richtungen davon, als die Männer mit ihren Taschenlampen näherkamen.
Fliegen. Sie waren immer da, wo es Tote gab. Sie legten ihre Eier auf die Leichen, aus denen Fliegenmaden schlüpften, die das tote Fleisch fraßen und wuchsen, bis sie sich verpuppten. Aus diesen Puppen kamen neue Fliegen, und die legten ihre Eier auf dieselbe Leiche. Oder auf neue Leichen. Denn in L. A. gab es daran bestimmt keinen Mangel.
»Hier!«, rief plötzlich einer der Officers. Und dann: »Oh Gott.«
Der Tote lag auf dem Boden, Arme und Beine ausgestreckt. Im Brustkorb ein gähnendes schwarzes Loch, dunkler noch als die Finsternis dieser Wohnung.
»Er hat ihm das Herz rausgerissen«, stellte der Rechtsmediziner mit professioneller Sachlichkeit fest und leuchtete auf den Oberkörper des jungen Mannes. Durchgeschnittene Rippen ragten spitz aus der klaffenden, klebrig-roten Öffnung.
Der Rechtsmediziner stakste in seinem Papieranzug und den Papierüberschuhen vorsichtig über den blutroten Fußboden, wobei er hin und wieder ein Foto schoss. Die Rechtsmedizin von L. A., das Los Angeles County Coroner’s Office, war weltberühmt – nicht erst, seitdem der damalige Chef, Thomas Noguchi, sein Schweigen gebrochen und zwei Bücher über seine berühmtesten Fälle veröffentlicht hatte, zu denen Marilyn Monroe, James Belushi, Robert Kennedy und Sharon Tate gehörten, die 1969 von der berüchtigten Manson Family massakriert worden war.
»Das ist doch … verdammt«, fluchte der Rechtsmediziner.
»Was denn?«, fragte Brooks.
»Hier, schauen Sie sich das an. Ist das ein Hund?«
Es war ein Hund. Das, was davon übrig war.
Der Hund lag neben der Männerleiche. Vielleicht war das Tier abgerichtet gewesen. Ein Kampfhund. Doch wie es aussah, nicht kampferprobt genug. Der offenbar perverse Killer hatte den Hund nicht nur getötet, er hatte ihm Kopf sowie Vorder- und Hinterläufe abgeschnitten und sie neben die Gliedmaßen des Mannes auf den Boden gelegt. Eine Vorderpfote neben den Arm, eine Hinterpfote neben das Bein. Den Kopf des Hundes hatte er auf den Kopf der Leiche platziert, sodass die Ermittler das Blut des Tieres vom Kopf des Menschen wischen mussten, um eine erste Identifizierung vornehmen zu können.
»Du lieber Himmel, er ist es«, stieß der Rechtsmediziner hervor.
»Wer?«, fragte Brooks. Obwohl einer der Coroners das Gesicht des Toten saubergewischt hatte, fehlte ihm das Vorstellungsvermögen, um inmitten dieser stickigen, stinkenden Dunkelheit in diesem von Menschen- und Hundeblut verschmierten Gesicht einen Mann zu erkennen, den er kannte. Oder kennen sollte.
Der Rechtsmediziner schien Brooks’ Gedanken erraten zu haben und leuchtete mit der Taschenlampe auf das Gesicht des Toten. »Vincent Calitri«, sagte er.
»Heilige Hölle«, flüsterte Brooks. »Vincent Calitri?« Den sollte er nicht nur kennen, den kannte er.
»Sieht so aus.«
Vincent Calitri war nicht irgendwer. Er war der Sohn von David Calitri, und der wiederum war Brooks’ Boss. Der Ober-Ober-Boss. Der Chief of Police des LAPD.
Das hier war sein Haus.
Und der Tote war sein Sohn.
Und dieser Sohn war regelrecht geschlachtet worden.
»Er hat ihn im Haus seines Vaters umgebracht?«, fragte Brooks. »Oder wohnte der Junge noch hier?«
»Nein«, sagte einer der Officers, »er wohnte mit seiner Freundin ein paar Blocks weiter.« Er trat an die Leiche heran. »Entweder hat der Killer ihn hier vor Ort umgebracht, oder er hat ihn irgendwo anders getötet und die Leiche dann hierher gebracht.«
»Und der Hund?«
»Den Hund offenbar auch.«
»Ja, das sehe ich«, sagte Brooks. »Findet so schnell wie möglich raus, ob der Junge und sein Kläffer hier getötet wurden oder woanders – falls man es herausfinden kann. Und schickt sofort ein Team zur Wohnung von Calitri. Und sucht seine Freundin!«
»Sind schon dabei.«
»Was ist das?« Brooks’ Taschenlampe bewegte sich in langsamen Kreisen über den Oberkörper des Mannes und die Oberarme. Überall Wunden. Schnittwunden mit eigenartigen Mustern. Brooks wandte sich an den Rechtsmediziner. »Hat der Killer ihm diese Symbole ins Fleisch geschnitten?«
Der Mediziner zuckte die Schultern. »Wer sollte es sonst gewesen sein? Vielleicht hat er ihn gefoltert und dann umgebracht.«
»Aber wieso?«, fragte Brooks. »Das hier ist Downtown L. A. Ein besseres Viertel, nicht das beschissene Compton.«
Compton war ein Vorort von Los Angeles, in den USA auch »Hauptstadt der Morde« genannt. Gerade erst war Compton die zweifelhafte Ehre zuteil geworden, die bisherige Mord-Hauptstadt New Orleans überholt zu haben. Neben Smog stieg in Compton eine Menge Pulverdampf in die Luft.
Es könnte überall passieren, aber es passiert in Compton, sagte man beim LAPD.
»War es vielleicht eine von den Gangs?«, fragte der Rechtsmediziner. »Bloods, Sharks und wie die alle heißen? Wenn denen die Munition ausgeht, und es ist noch ein Gegner übrig, wird er mit dem Gewehrkolben erschlagen. War es hier auch so?«
Möglich war es. Nur war hier nicht Compton, sondern Downtown L. A., wo dreimal so viele Polizisten auf der Straße waren und so etwas trotzdem geschah. Und dann auch noch im Haus des Polizeichefs. Brooks mochte gar nicht daran denken.
»Meinen Sie, das war eine Racheaktion?«, fragte einer der Officers.
Brooks zuckte die Schultern. »Kann ich noch nicht sagen. Die Beweislage ist noch viel zu dürftig.« Er tastete mit dem Lichtstrahl der Taschenlampe über die Wände. »Jesus Christus!«, stieß er so unvermittelt hervor, dass die anderen zusammenzuckten.
»Was ist das?«, flüsterte der Officer.
Mit einem Mal sehnte Brooks sich nach einer Zigarette und einem Bier oder etwas Stärkerem. Am Türrahmen waren Zeichen zu sehen. Mit Blut gemalt, wie es schien. Das Blut war frisch, nur ein paar Stunden alt. Es konnte keine Farbe sein, denn Brooks sah die Fliegen wimmeln, als der Strahl der Taschenlampe sie traf.
»Das ist eine Spur«, sagte Brooks und öffnete vorsichtig die Tür. »Eine Spur aus Blut.« Er hatte vorher schon Ähnliches gesehen. An den anderen Tatorten. Bei den anderen Opfern in diesem Blutsommer.
Langsam bewegte Brooks sich voran, leuchtete weiter die Wände ab. Sie waren voller Blutspritzer – eine grausige Spur, die Brooks und die Ermittler dorthin führte, wo jemand sie haben wollte. Wie Zeichen bei einer Schnitzeljagd – sofern dieses blutige Arrangement für die Ermittler bestimmt war und nicht für jemand anderen.
Weitere Blutflecke, wie mit dem Finger gemalt, an der weißen Wand. An einer Tür. Einem Türrahmen. Brooks und die Officers durchquerten die dunkle Wohnung, folgten der Spur des Blutes.
»Gottverdammt«, murmelte Brooks, als er mit zwei Officers die Küche betrat. Die Jalousien waren hier nur halb geschlossen. Tageslicht fiel herein. Brooks knipste die Taschenlampe aus. Langsam gewöhnten seine Augen sich an das neue Umfeld. Er sah die große Küche. Die Anrichte in der Mitte. Den Herd. Und dann, wie ein Monolith im Mittelpunkt des Ganzen, sah er den großen Kühlschrank. Weiß. Riesig. Die Wand daneben war mit Blut bemalt. Auch auf dem Kühlschrank ein paar Spritzer. Aber der Killer hatte offenbar schnell gemerkt, dass die Farbe an der beschichteten Oberfläche nicht hielt.
Brooks kniff die Augen zusammen und las:
It’s not over ‘til it’s over.
Was sollte das heißen? Es ist nicht vorbei, bevor es vorbei ist. Sollte das ein Abschied sein? Oder eine Drohung?
Brooks kam nicht mehr dazu, seine Gedanken fortzuführen, denn schon fiel sein Blick auf etwas, das er bereits aus den Augenwinkeln wahrgenommen hatte. Eine Tellerhaube. Aus Silber. Mit einer weißen Tischdecke darunter. Angerichtet. Schön. Doch Brooks ahnte schon jetzt, dass es keine freudige Überraschung war, die der Cateringservice für sie vorbereitet hatte, sondern ein Tritt in den Magen für jeden, der es sah.
Brooks trat näher heran, während die Officers, die Pistolen gezogen, sich argwöhnisch umschauten und die Kamera der Spurensuche grelle Blitze schleuderte, die bunte Schatten vor Brooks’ Augen tanzen ließen.
Die weiße Tischdecke. Mit Blut beschrieben. Brooks konnte sich denken, was der Killer getan hatte. Wie er das viele Blut an die Wände geschmiert hatte. Er hatte seinem Opfer das Herz herausgerissen und war damit losgezogen. Hatte einen Rundgang durch die Wohnung gemacht, einen fröhlichen kleinen Spaziergang, und mit dem blutigen Herzen die Tische, Türen und Wände bemalt wie ein Kind mit einem morbiden Malkasten.
Brooks streckte die Hand aus, ergriff den Deckel der Tellerhaube, hob ihn hoch.
Dann sah er, was unter der Haube war. Er hatte schon vorher gewusst, was er dort finden würde, deshalb erschrak er nicht allzu sehr, blickte nur mit versteinerter Miene auf das, was sich ihm darbot.
Es war das Herz des jungen Mannes. Mit Kräutern und Pfeffer bestreut. Blutig. Roh. Und scheußlich deplatziert auf dem Porzellanteller, auf dem es lag.
Im gleichen Augenblick entzifferte Brooks die Buchstaben auf der Serviette, die mit Blut gekritzelt waren. Eine fürchterliche Aufforderung, in einem doppeldeutigen Sinne, wie sie nur einem Psychopathen einfallen konnte. Eine Botschaft für den Vater des Ermordeten, die zeigte, dass sein Sohn unwiederbringlich tot war und sein Herz, die Quelle des Lebens, als Abendessen in der Küche wartete. Eine Botschaft, die Polizeichef David Calitri wahrscheinlich umbringen würde, wenn er sie zu Gesicht bekäme, vielleicht durch einen Herzinfarkt der Stufe 10 auf der Richterskala. Denn es gab Dinge, die machten jeden fertig, ob Chef des LAPD oder nicht.
Dem Mörder würde es ein One-Way-Ticket geradewegs in die Gaskammer bescheren, falls sie ihn erwischten. Oder ein Rendezvous mit der Giftspritze.
Wie ein Blitzlicht bei einem Schnappschuss in der Nacht erschien zuerst das Herz vor Brooks’ Augen. Dann sah er die Schrift, die sich Buchstabe für Buchstabe in sein Hirn brannte, wobei er immer wieder das Herz sah, das rot glänzend auf dem Teller lag, während noch Blut heraussickerte – der Rest des Blutes, den der wahnsinnige Killer nicht an Wänden und Türen verschmiert hatte.
Auf der Serviette stand:
Enjoy it d(e)ad.
Zwei Sätze in einem:
Enjoy it dead. Enjoy it dad.
Eine Nachricht vom Killer an den Vater des Ermordeten, die wie eine Nachricht vom Sohn an den Vater aussah: Genieß es tot. Genieß es, Vater.
Und dann der andere Satz. Eine Nachricht vom Killer an die Ermittler?
It’s not over, ‘til it’s over.
Brooks merkte, wie ihm schwindelig wurde.
Ja, wahrscheinlich war es besser, dass er sich einen neuen Job suchte und aus L. A. verschwand. Aber vorher war es an der Zeit, dieses Monstrum von Stadt umzubenennen.
Von Los Angeles in Los Cadáveres.
Von Stadt der Engel in Stadt der Leichen.
Erstes Buch
Nothing can divide,Terror is thy name.Last legion alive,Set the world aflame.
Enemy of God,Masters you have none.Sweet the victory,When thy kingdom come.
– Kreator, Enemy of God
Berlin, Spätsommer 2014
1.
Stephan Schiller, Boss des Deathguard Chapters Berlin, stieg aus seinem Mercedes, öffnete Grinder, seinem Pitbullterrier, die Hintertür und zog die Schlüsselkarte durch den Hauseingang. Stephan brauchte keinen Bodyguard. Er hatte Grinder, der mehrere Tonnen Beißkraft mitbrachte und schon einige Angreifer zerfleischt hatte.
Der Türöffner piepte, und die Tür zum Außenaufzug öffnete sich. Grinder flitzte bellend in die Kabine. Sein Herrchen schob seine massige Gestalt hinterher. Stephan Schiller wohnte ganz oben, im achten und neunten Stock, wie ein König, hoch über der Stadt, die er beherrschte wie wenige andere. Gerade hatte er seine Tour gemacht, hatte Schutzgelder kassiert, mit den Zuhältern gesprochen und sich über die Geschäfte in seinen Nachtclubs informiert. Auch ein paar neue Pferdchen mussten eingeritten werden. Es waren wieder ein paar Zicken darunter gewesen, bei denen Stephan selbst Hand anlegen musste. Aber dafür war er schließlich der Boss.
Die Deathguards wurden in den Medien stets als »Rockerclub« bezeichnet. Stephan war das nur recht. Denn in Wirklichkeit waren sie viel mehr; sie hatten ihre Hände unter anderem im Drogenhandel, der besonders in den Clubs florierte.
Letztendlich aber waren die Bullen froh, dass Stephans Deathguards für Ordnung sorgten und nicht zahllose kleine Banden. Außerdem hatten sie mit Stephan nur einen einzigen Ansprechpartner.
Der deutsche Rechtsstaat war ohnehin dabei, sich selbst abzuschaffen, und der Staat warf sein Gewaltmonopol über Bord wie eine Ladung fauler Kartoffeln. Steuerhinterziehung und Falschparken waren so ziemlich das Einzige, was in Deutschland noch illegal war. Stephan konnte das nur recht sein. Am Ende übernahmen die Deathguards die Aufgaben, für die eigentlich die Bullen zuständig wären, nur dass diese Weicheier sich nicht mehr heranwagten, weil ihnen von Regierung und Justiz untersagt wurde, ihren Job vernünftig zu machen. Wer hatte die Russenmafia denn aus dem Viertel vertrieben? Die Deathguards, nicht die Bullen. Wer hatte in einer groß angelegten Aktion mehr als zwanzig albanische Zuhälter umgelegt? Die Deathguards.
Sie hatten mit der Polizei ein Abkommen: Wir kümmern uns darum, dass Ruhe und Ordnung herrscht, dafür lasst ihr uns freie Hand. Was anderes bleibt euch sowieso nicht übrig. Und die Polizei hatte zugestimmt. Weil ihnen tatsächlich nichts anderes übrig blieb.
Der Fahrstuhl surrte nach oben. Grinder beäugte sein Herrchen erwartungsvoll.
»Ist ja gut, kriegst gleich was.« Stephan blickte auf sein Handy, während er nach oben fuhr. Der Rest des Abends war frei. Er würde vielleicht noch ein Bier trinken, und dann ab ins Bett. Schließlich war es drei Uhr morgens. Aber so waren die Arbeitszeiten nun mal, wenn man mit Geschäften zu tun hatte, die in der Nacht am besten florierten.
Die Fahrstuhltür öffnete sich. Stephan betrat sein Reich. Zweihundert Quadratmeter auf zwei Etagen mit Dachterrasse. Er warf die Schlüsselkarte auf die Ablage vor der Tür und wollte gerade seine Lederjacke an die Garderobe hängen, als er das Knurren hörte.
»Grinder?«, fragte er. »Was ist los?«
In diesem Moment sah er es.
Eine Gestalt stand am Ende des Flurs. Groß, breit, dunkel. Reglos wie eine Statue. Doch es war keine Statue, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut, denn er bewegte sich.
Grinder hatte den Fremden augenblicklich gewittert. Der Pitbull zog die Lefzen nach oben und fletschte die Zähne, als das Licht des Mondes den Schatten des Unbekannten auf den Teppich warf.
»Okay, Arschloch«, sagte Stephan. »Entweder du kommst mit erhobenen Händen nach vorn, oder du wirst zu Hackfleisch verarbeitet.«
Er konnte Grinder kaum noch halten. Der Hund stieß ein tiefes Grollen aus und zitterte vor Erregung wie ein ausgehungertes Raubtier, das Blut wittert. Würde Stephan ihn jetzt von der Kette lassen, wäre der Fremde binnen weniger Augenblicke zerfleischt.
Der hünenhafte Mann bewegte sich nicht. Er schien keine Waffen zu haben. Schlecht für ihn, gut für Stephan. Dennoch machte er einen letzten Versuch.
»Wer bist du, und was willst du? Mach endlich das Maul auf, Sackgesicht, sonst macht mein Hund Hundefutter aus dir.«
Ein paar Sekunden lang hörte Stephan nur das Knurren seines Hundes. Dann erklang die Stimme des Hünen: »Ich bin der Tod.«
Stephan lachte auf. »Du bist ein echter Komiker. Du bist nicht der Tod, du bist tot.«
Er ließ die Kette los.
»Grinder! Fass!«
Der Hund stürzte nach vorne wie ein Geschoss. Doch der Schatten rührte sich nicht. Erst im letzten Moment riss er wie beiläufig einen Teppich vom Fußboden und wickelte ihn sich blitzschnell um den Arm. Grinder sprang, das Maul weit aufgerissen. Der hünenhafte Mann warf den Arm nach vorne, und der Kampfhund verbiss sich in dem dicken Teppich.
Es waren die Sekundenbruchteile, die der Mann brauchte. Seine freie Hand schoss vor, riss einen Kugelschreiber vom Beistelltisch und rammte ihn dem Pitbull durchs Auge ins Gehirn. Ein Zucken durchlief den Körper des Hundes. Er stieß ein schrilles, beinahe menschliches Kreischen aus, als er sich mit grotesk geöffneten Kiefern vom Teppich löste und wie eine Puppe zu Boden fiel. Dort blieb er zappelnd liegen, bis der Tod ihn erlöste.
»Drecksköter«, spie der Hüne verächtlich hervor und schleuderte den Teppich zur Seite. In seiner Stimme lag etwas Fremdartiges.
Er beugte sich vor, zog den Kugelschreiber aus dem Kopf des toten Tieres. Blut, Hirnmasse und Teile des Auges hingen an dem silbernen Stift. Er hob ihn in die Höhe. »Hast du gesehen? Ich hab dein Mistvieh nur mit einem Kugelschreiber abgeschlachtet.«
Der Fremde warf den Stift zu Boden und ging langsam auf Stephan zu. Einen Schritt. Noch einen. Und noch einen.
Stephan zwang sich, nicht zurückzuweichen.
»Und jetzt«, sagte der Fremde, »werde ich dich schlachten.«
Langsam erkannte Stephan die Umrisse und das Gesicht des Mannes, als dieser näherkam.
Es geschah selten, dass der Boss der Deathguards Berlin Angst hatte.
Jetzt hatte er Angst. Furchtbare Angst.
2.
Es war der letzte Urlaubsabend. Ein Sonntagabend. Der Sonntag war ohnehin ein Tag, der nicht fair spielte. Einerseits war er ein Feiertag, für viele der schönste Tag der Woche, andererseits war er so nahe am grauen Montag und der Arbeitswoche, dass er beinahe schon ein Arbeitstag war. Anders ausgedrückt: Der Sonntag war ein Tag, der es dem Montag nur zu gern erlaubte, seinen ungewaschenen Hals unheilvoll ins Wochenende zu strecken. Insgesamt also ein Tag, den man nur als Riesenverarsche bezeichnen konnte.
War nun der Sonntag allein schon depressiv genug, war es noch viel schlimmer, wenn ein dreiwöchiger Urlaub vorbei war und der letzte Tag dieses Urlaubs auch noch auf einen Sonntag fiel. Was bedeutete, dass man erst einmal fünf volle Tage arbeiten musste, damit wieder Wochenende war.
Kaum zu glauben, es gab genug Blödmänner und Blödfrauen, die ihren Urlaub genau so legten, dass der letzte Tag ein Sonntag war.
Zu den Blödfrauen gehöre auch ich, dachte Clara Vidalis, die in der lauen Abendluft dieses Spätsommertages auf ihrem Balkon in der Schönhauser Allee saß, gemütlich ein Glas Whisky trank und eine Zigarette rauchte. Nur kurz sah sie die Rauchschwaden, die in den Abendhimmel stiegen, dann waren sie im Dämmerlicht verschwunden.
Augenblick, verweile doch. Das stand, soweit Clara wusste, in Goethes Faust. Man sagte es, wenn man sich wünschte, dass etwas Schönes nicht vorüberging. Ein Abend auf dem Balkon, zum Beispiel, und der Geschmack von Whisky auf der Zunge.
Im Grunde war Clara glücklich in ihrem Job. Eigentlich liebte sie ihn, lebte für ihn. Sie konnte nicht ohne ihn, wie man so schön sagte. Doch wenn sie ein paar Wochen Abstand hatte, erkannte sie, wie viele andere Dinge es noch gab. Wie viele ungelöste Fragen und Rätsel – mystisch, erbaulich, interessant. Fragen jenseits der Fragen, welcher Verrückte mal wieder einen anderen Verrückten umgebracht hatte, welcher Abschaum sein Baby in die Mikrowelle gelegt hatte oder welche Perversen wehrlosen Frauen aus Langeweile Chinaböller in die Vagina gesteckt hatten.
Clara verscheuchte diese Gedanken. Es war Nacht, da war es nicht gut, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, vor allem nicht, wenn man alleine war. Ein neuer Tag würde kommen. Beim LKA Berlin, wo Clara als Hauptkommissarin Dienst tat. Ab morgen wieder. In ein paar Stunden.
Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, überlegte Clara. Schließlich bist du ein aufgeklärter Mensch, anders als unsere Ahnen.
Dass der Sonnenwagen am nächsten Morgen wieder übers Firmament fuhr, war jedes Mal eine Überraschung für die Alten gewesen. Eine freudige Überraschung noch dazu, bestand für sie doch stets die Gefahr, dass der Fenriswolf die Sonne verschluckte und damit das Ende der Welt herbeiführte.
Clara hatte keine Angst vor dem Weltuntergang. Denn der würde auch den Abschaum, den sie tagein, tagaus jagte, vom Antlitz der Erde fegen. Der Wolf, der den Sonnenwagen verschluckte, kam jeden Tag aufs Neue, genauso, wie der Weltuntergang jeden Tag kam. Tausendfach. Denn wer einen Menschen tötet, der tötet eine Welt.
Sicher, der Tod kam für jeden. Aber wie er kam, entzog sich der Kontrolle. Das Einzige, was hierzulande in Sachen Tod der bürokratischen Ordnung gehorchte, war der tote Körper selbst. Der Tod hatte in Deutschland ein exaktes Maß: 213 Zentimeter lang, 83 Zentimeter breit und 170 Zentimeter tief musste die Grube sein, in die eine Leiche hinuntergelassen wurde. Und selbst dieser Ort war nicht für die Ewigkeit; er würde irgendwann von einer anderen Leiche übernommen werden, weshalb die Behörden von einer »Grabstätte mit abgelaufenem Nutzungsrecht« sprachen. Clara schmunzelte. Ein genauso poetischer Begriff wie »sozialverträgliches Frühableben«.
Das Reich der Toten, dachte Clara. Alte Tote wichen neuen Toten. Eine Leiche wirft die andere aus dem Grab. Von wegen letzte Ruhe. Nicht einmal die währte ewig. Blieb nur die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Ein anderes, besseres Dasein. Aber daran glaubte Clara immer weniger.
Na ja, sagte sie sich. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Zum Glück hatte sie sich im Urlaub nicht mit solchen Fragen herumgeschlagen. Sie war mit Freunden in Italien gewesen, zuerst am Meer, dann in mehreren Städten. Mit dem Auto von Florenz durch die Toskana: Montepulciano, San Gimignano, Siena. Sie hatten viel gesehen, hatten sich gut erholt, gut gegessen, gut getrunken. Clara war am Ende des Urlaubs absichtlich nicht auf die Waage gestiegen, doch ihre Hosen verrieten ihr bereits, dass sie zugenommen hatte. Aber der Urlaub hatte sie abgelenkt, und das sollte er auch.
Doch die Frage, die Clara eigentlich hatte klären wollen, war nach wie vor unbeantwortet: Was war zwischen ihr und MacDeath bei ihrem letzten Fall gewesen? War es eine Affäre? Nur ein One-Night-Stand? Oder konnte mehr daraus werden?
MacDeaths richtiger Name lautete Dr. Martin Friedrich. Er war Chef der Abteilung für Operative Fallanalyse bei der Mordkommission des Berliner LKA. Den Spitznamen »MacDeath« hatte er sich wegen seiner Liebe zu Shakespeares Werken und aufgrund der Besonderheit seiner Profession eingehandelt, bei der es oft um Mord, Tod und Sterben ging. Bevor er das Jobangebot vom LKA bekam, hatte MacDeath in Harvard und an der University von Virginia Medizin und Psychiatrie studiert und mehrere Jahre in der Behavioural Science Unit des FBI gearbeitet – der berühmten Abteilung für Verhaltensforschung, die als Erste die operative Fallanalyse eingeführt hatte, bei der es darum geht, die Psyche eines Serienmörders zu durchleuchten. Robert Ressler, der die Abteilung mit aufgebaut hatte – er hatte auch Thomas Harris beim Schreiben von Das Schweigen der Lämmer beraten –, war MacDeaths Lehrmeister gewesen, ebenso John Douglas, der Gründer der BSU.
Clara arbeitete sehr eng und sehr gut mit MacDeath zusammen. War es deshalb eine ganz normale Entwicklung oder gar ein notwendiger Schritt, dass man auch privat zusammenkam? Oder war es gerade das, was niemals geschehen sollte, da Emotionen in diesem Job tödlich sein konnten?
Während ihres Urlaubs hatte Clara weder mit MacDeath gesprochen, noch hatten sie telefoniert, obwohl Clara bereits seit knapp einer Woche wieder in Berlin war. Hätte sie ihn anrufen sollen? Vielleicht. Allerdings hätte MacDeath sie auch anrufen können. Andererseits – er war nicht in Urlaub gewesen, sondern hatte gearbeitet.
Trotzdem, sollte nicht der Mann zuerst anrufen? Wirkte es nicht unpassend, wenn eine Frau sich als Erste meldet? So jedenfalls hatte Clara es bisher immer gehalten in ihrem Singledasein, das nur unterbrochen war von ein paar Affären mit Männern, die nicht zu ihr gepasst hatten. Sie und MacDeath. Manchmal war es schwer, über solche Dinge nachzudenken. Love is the devil, hatte mal jemand gesagt. Die Liebe ist der Teufel. Was war da zwischen ihr und MacDeath gewesen? Clara wusste es nicht. Sie wusste nicht einmal, ob sie überhaupt einen festen Partner wollte. Ob es gut für sie wäre. Und für ihn. Sollte sie nicht lieber allein bleiben? Damit sie unbelastet von persönlichen Bindungen und Gefühlen die Bestien jagen konnte, die sie von Berufs wegen jagen musste? Mörder. Kinderschänder. Der Abschaum der Menschheit.
Augenblick, verweile doch, rief Clara sich wieder das Zitat in Erinnerung, diesmal jedoch voller Bitterkeit. Denn die Augenblicke, die verweilten, waren vor allem Augenblicke des Schreckens und der Wut, der Angst und des Mitleids.
Sie ging in die Wohnung und schenkte sich noch einen Schluck Whisky ein. Das Glas in der Hand schlenderte sie am Bücherregal im Wohnzimmer entlang, nahm einen der Bände heraus und ging wieder hinaus auf den Balkon.
Es war im Grunde ein Selbstbetrug. Die Nacht wurde nicht erholsamer, wenn sie lange aufblieb. Sie würde auch nicht besser schlafen, wenn sie noch einen Whisky trank und noch eine Zigarette rauchte, das wusste Clara. Dennoch blieb sie auf dem Balkon, in der Stille dieser lauen Sommernacht, genoss den Geschmack des Whiskys, blickte dem Zigarettenrauch nach und las die Zeilen in Goethes Faust, die ihre Situation so gut umschrieben, dass sie im Licht der Kerze weiterlas, obwohl sie längst im Bett sein sollte.
Werd ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch, du bist so schön.
Dann magst du mich in Fesseln schlagen. Dann will ich gern zugrunde gehn.
Der Morgen war ewig weit weg. Noch war Sonntag. Noch war sie im Urlaub. Noch würde sie hier sein, im Hier und Jetzt. Und darin verweilen. In diesem Augenblick.
3.
Stephan bebte vor Wut. »Du verdammtes Arschloch!«, rief er. »Du hast meinen Hund getötet!«
Stephan Schiller war ein Mann, der keinem Zweikampf aus dem Weg ging. Wenn der Gegner keine Schusswaffe hatte, benutzte er auch keine. Bei diesem Typen würde er erst recht keine Ausnahme machen, denn er wollte dem Penner zeigen, wo der Hammer hängt, auch wenn der Kerl ein Riese war.
Stephan zog das Jagdmesser aus der Scheide an seinem Stiefel und machte sich bereit. Nahkämpfe gab es ohnehin viel zu selten. Und wozu trainierte er so viel? Boxen, Kickboxen, Karate. Er würde diesem Abschaum sämtliche Knochen brechen.
»Denk noch mal schnell an was Schönes«, sagte er und hob das Messer. »Jetzt bist du dran, du mieses Stück Scheiße!«
Stephan schnellte mit einer Geschwindigkeit auf den Fremden zu, die man einem massigen Mann wie ihm niemals zugetraut hätte. Er wollte den Gegner durch einen schnellen Hieb ans Kinn bewusstlos schlagen und ihm gleichzeitig von oben das Messer in die Halsschlagader rammen. Rein mit der Klinge und stecken lassen. Auf diese Weise blutete die Arterie ins Körperinnere aus. Und er, Stephan, hatte keine Schweinereien auf dem Fußboden.
Anschließend würde er seine Jungs anrufen. Die kamen dann mit einem großen Plastiksack. Und morgen früh, wenn der Bauunternehmer sein Schmiergeld kassiert hatte, war die Leiche von dem Typen bereits in einen Brückenpfeiler auf der Stadtautobahn Avus eingemauert. Für immer verschwunden. Keine Leiche. Keine Spuren. Keine Fragen.
Stephans Hand zuckte nach vorne. Sein Handballen berührte das Kinn des Mannes. Doch es blieb bei der flüchtigen Berührung, denn im letzten Sekundenbruchteil war der Fremde schnell wie ein Schatten zurückgewichen. Einen Lidschlag später packte er Stephans Hand, die das Messer hielt, das wie ein Fallbeil auf seinen Hals niedersauste. Im gleichen Moment spürte Stephan die freie Hand des Gegners an der Schläfe. Es war ein Klammergriff, aus dem es kein Entrinnen gab. Mit der Rechten hielt der Hüne Stephans Hand mit dem Messer von sich weg, mit der Linken drückte er den Kopf des Gegners nach unten.
Stephan keuchte, als er sich mit aller Kraft zu befreien versuchte. Fieberhaft überlegte er, wie er aus der Falle herauskam. In diesem Augenblick riss der Fremde das Knie hoch und traf Stephan mit voller Wucht am Kopf. Er hörte ein nasses Knacken, als würde eine Melone zerplatzen. Greller Schmerz schoss durch seinen Schädel. Er schrie und schrie.
Dann wurde ihm schwarz vor Augen.
***
Als Stephan erwachte, sah er alles doppelt. Sein Schädel fühlte sich schwer wie Blei und seltsam feucht an, als würde ihm jemand einen riesigen nassen Schwamm auf den Kopf drücken. Als er sich zu bewegen versuchte, stellte er zu seinem Entsetzen fest, dass er sich nicht rühren konnte.
Dann erst sah er den riesenhaften Fremden, der auf ihn hinunterblickte, ein Messer in der Hand – das Messer, das er Stephan abgenommen hatte.
»So ein Pech aber auch«, sagte der Mann. »Du hast dir den Schädel gebrochen. Das kann passieren, wenn man sich mit dem Falschen anlegt. Aber keine Bange, allzu lange lebst du sowieso nicht mehr.«
Stephan schaute an sich hinunter. Der Kerl hatte ihm das T-Shirt ausgezogen und ihn gefesselt.
»Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, dass ich hier war«, sagte der Fremde. Mit diesen Worten setzte er das Messer an Stephans muskelbepacktem Oberarm an. Anfangs schmerzte es nur leicht, als die Haut und die oberen Fettschichten durchtrennt wurden. Doch als die Klinge tiefer drang, schien sie sich wie Säure durch Stephans Fleisch zu fressen.
Er schrie vor Qual. Seine Schreie verstummten erst, als der Fremde ihm mit seiner riesigen Pranke den Mund zuhielt, während er mit der anderen Hand weiterschnitt. Stephan stöhnte dumpf und versuchte, sich zu wehren, doch es war sinnlos. Sein Körper gehorchte ihm nicht mehr. Er war dem Fremden ausgeliefert. Und der schnitt gnadenlos weiter.
Oh Gott, dachte Stephan, was ist das für ein Tier?
Der Hüne hatte ihn, den gefürchteten Boss der Deathguards, beinahe im Vorbeigehen fertiggemacht. Und seinen Kampfhund dazu. Ohne Waffe.
Stephan spürte, wie der Mann seinen anderen Arm packte. Dann fuhr die Klinge auch schon wie eine glühende Flamme durchs Fleisch. Wieder spürte Stephan, wie sein Blut warm und träge über die Haut floss.
Irgendwann nahm der Fremde die Hand vom Mund des gequälten Mannes. Gierig holte Stephan Luft, blickte schmerzerfüllt zu seinem Peiniger auf, die Augen weit aufgerissen.
»Nur nicht ungeduldig werden«, sagte der Hüne. »Es wird noch ein bisschen dauern.«
»Wer bist du?«, fragte Stephan mit bebender Stimme. »Hör mal, ich … Ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du mich laufen lässt …«
»Nein«, sagte der Fremde. »Ich lasse dich nicht laufen. Ich werde dich töten.«
Stephan wollte etwas erwidern, wollte den Mann anflehen, ihn am Leben zu lassen, doch vor Entsetzen brachte er kein Wort mehr hervor.
Der Fremde trat einen Schritt zurück, betrachtete den geschundenen Körper des Deathguard-Anführers, der sich in eine blutige Trophäe verwandelt hatte, die vor ihm auf dem Tisch lag, hilflos und zitternd vor Schmerz und Todesangst.
Schließlich legte der Fremde das Klebeband über den Mund seines Opfers, behutsam, beinahe fürsorglich. Stephan beobachtete den Riesen, starr vor Schreck. Vor dem, was jetzt kam, fürchtete er sich so sehr, wie er sich nie zuvor vor irgendetwas gefürchtet hatte.
Mein Gott, was ist das für ein Monstrum?
Dann hörte er wieder die Stimme. »Denk an was Schönes. Es wird sich ein Weilchen hinziehen, bis wir fertig sind.«
Dann sah Stephan wieder das Messer.
Spürte den ersten Schnitt an der Brust.
Doch diesmal war es anders.
Die Schnitte waren noch tiefer.
Noch schmerzhafter.
Noch schlimmer.
4.
Am nächsten Morgen auf dem Revier sagte Clara sich das, was man sich immer sagte, wenn man am Abend zuvor ohne triftigen Grund zu lange aufgeblieben war und auch noch unbedingt ein weiteres Glas Whisky trinken musste: Nächstes Mal gehst du früher ins Bett. Nächstes Mal reicht es, wenn du nur ein Glas trinkst. Nächstes Mal wird es anders.
Clara hatte ihre E-Mails gelesen und war die Post durchgegangen. Nun stand sie an der röchelnden Kaffeemaschine im dritten Stock des LKA-Gebäudes am Tempelhofer Damm und schenkte sich einen Kaffee ein, als sie vertraute schwere Schritte auf dem Flur hörte. Sie wusste, wer das war. Denn irgendwie schaffte es diese Person, immer dann an der Kaffeeküche vorbeizukommen, wenn Clara gerade hier war. Dass diese Person ihr unmittelbarer Vorgesetzter war und obendrein Chef der Mordkommission LKA 113 – jener Abteilung, die für besonders schwere Fälle zuständig war –, hatte ihr früher ein bisschen Angst gemacht. Denn was sollte der Mann denken, wenn er sie immer wieder in der Kaffeeküche antraf und nicht in ihrem Büro oder an einem Tatort?
Doch Claras Chef liebte es bisweilen, das Fenster nahe der Kaffeeküche zu öffnen und »nach draußen zu rauchen«, wie er es nannte. Und wenn Clara ihm dabei Gesellschaft leistete, umso besser.
»Buenas dias, Señora«, sagte Kriminaldirektor Winterfeld, als er in die Kaffeeküche kam, eine Klarsichthülle mit Papieren auf die Ablage legte und sich ebenfalls einen Kaffee einschenkte. Da ein Teil von Claras Familie aus Spanien stammte, machte Winterfeld sich des Öfteren einen Spaß daraus, sie auf Spanisch zu begrüßen. Mehr als Hola, que tal oder tenemos a buscar los asasinos brachte er aber nicht hervor. »Wie war Ihr Urlaub?«
»Sehr erholsam«, sagte Clara und blies in die Kaffeetasse. »Nur letzte Nacht habe ich schlecht geschlafen. Es war so schrecklich warm. Ich kann bei Hitze nicht gut schlafen.«
»Ich auch nicht«, sagte Winterfeld. »Als ich noch nicht geschieden war, hab ich meine Frau zu überreden versucht, eine Klimaanlage in unserem Schlafzimmer installieren zu lassen. Sie hielt es für überflüssig. Ich hab’s dann aus eigener Tasche bezahlt. Damit war Ende der Diskussion. Aber eigentlich sollten wir froh sein, dass es noch so warm ist. Es sind die letzten schönen Tage in diesem Jahr, bevor der verdammte Winter uns auf den Pelz rückt. Sechs Monate Kälte, Nässe und nicht gestreute Straßen.« Er hielt inne, blickte Clara an. »Wir sollten noch mal mit MacDeath in dieses Whiskylokal in der Gneisenaustraße gehen, okay? Wie hieß es gleich?«
»Sie meinen die Legende?«
»Genau, die Legende. Wie wär’s am Donnerstag, wenn Sie sich wieder eingewöhnt haben?«
Clara lächelte. »Warum nicht?«, antwortete sie, obwohl sie erst einmal keinen Whisky mehr sehen konnte. »Was war hier denn so alles los?«
»Die Kollegen hatten letzte Woche eine Razzia bei Bestattungsinstituten.« Winterfeld atmete geräuschvoll aus. »Islamischen Bestattungsinstituten. Die machen das ja ein bisschen anders mit den Beisetzungen. Jedenfalls, diese Institute, die alle einem einzigen Besitzer gehörten, haben den Angehörigen ein Rundum-sorglos-Paket angeboten. Nach dem Motto: Wir erledigen für euch die Behördengänge, die für den Toten anfallen, auch die Abgabe der Reisepässe und so weiter.«
»Ich kann mir schon denken, was dann passiert ist.«
»Ja? Die haben die Reisepässe für zwei- bis fünftausend Euro an syrische Flüchtlinge verscherbelt, die nach Deutschland einreisen wollten. Die konnten sich sogar aus verschiedenen Reisepässen den mit dem Foto aussuchen, das ihnen am ähnlichsten war.«
»Das ist ja mal ein schräges Geschäftsmodell. Man sollte doch eigentlich denken, dass Bestattungen auch so genug abwerfen, ohne das Reisepass-Zusatzgeschäft.«
Winterfeld nickte. »Denke ich auch. Gestorben wird immer. Ist absolut krisensicher. Wenn es der Wirtschaft richtig dreckig geht, kommen durch Privatinsolvenzen und dergleichen verursachte Selbstmorde noch hinzu, was das Geschäft zusätzlich ankurbelt. Den Job will nur keiner machen, obwohl er gut bezahlt wird. In der Branche sucht man händeringend Fachkräfte.« Winterfeld trank von seinem Kaffee. »Aber Tote herrichten ist halt nicht so hip, wie wenn man sich in Berlin-Mitte gegenseitig fotografiert und den Käse dann auf Facebook postet.«
»Aber ›Fotos schießen und mit Hartz IV aufstocken‹ klingt auch nicht so cool. Deshalb nennt man das dann ›virale Marketingagentur‹.« Clara lachte. »Was ist denn jetzt mit diesem Besitzer des Beerdigungsunternehmens?«
»Lizenzentzug und U-Haft. Abgeschoben wird er wohl nicht, obwohl er keinen deutschen Pass hat. Wäre aber nicht weiter schlimm für ihn. Er hat sicher noch genug Reisepässe zurückgelegt, falls er doch ausgewiesen wird und wieder zurück will. Aber das ist nur die offizielle Begründung.«
»Und was ist die inoffizielle?«
»Dass der BND und das BKA schon an dem Fall dran sind. Man vermutet nämlich, dass dieser Bestatter von den IS-Terroristen gesteuert wird, die auf diese Weise versuchen, Islamisten für Anschläge nach Deutschland zu schleusen, indem sie Terrorkämpfern aus Syrien für die Einreise deutsche Pässe zukommen lassen.«
»Du meine Güte.«
»Ja, du meine Güte«, sagte Winterfeld und musterte Clara einen Moment. »Was liegt bei Ihnen denn heute so an?«
Clara schaute auf die Uhr. »Ich habe gleich einen Gerichtstermin. Einer von denen, wo ich dem Richter mal wieder alles erklären muss, weil er zu faul war, die Akten zu lesen.«
Winterfeld zuckte die Schultern. »Dann liest er die Akten halt nicht. Ist doch er, der am Ende blöd dasteht, nicht Sie.«
»Nicht ganz«, sagte Clara. »Es geht um den Inkubus. Erinnern Sie sich?«
Winterfeld nickte. »Dieser Verrückte, der die Tampons gesammelt hat.«
»Ja. Und daraus hat er sich Tee gekocht. Weil er glaubte, dass die Frauen ihm dann zu Willen wären.« Clara trank von ihrem Kaffee und versuchte dabei, nicht an den Tee des Inkubus zu denken. »Als das – wenig überraschend – nicht funktionierte, hat er die Frauen wieder ganz normal vergewaltigt.«
»Ganz normal, aha«, sagte Winterfeld. »Und? Ich dachte, der Kerl ist für acht Jahre in den Bau gegangen.«
»Ja, aber sein Anwalt plädiert jetzt auf Unzurechnungsfähigkeit, um ihm den Knast oder die Sicherungsverwahrung zu ersparen. Er will nach Paragraf zwanzig Strafgesetzbuch auf aufgehobene Schuldfähigkeit wegen krankhafter seelischer Störung, Bewusstseinsstörung oder Schwachsinn plädieren.«
»Der gute alte Zwanziger«, murmelte Winterfeld.
»Genau. Wir müssen verhindern, dass dieser Rechtsverdreher damit durchkommt. Warum haben wir den Kerl monatelang gejagt, wenn er morgen wieder frei ist und weitermacht?«
»Stimmt«, sagte Winterfeld und nestelte nervös an seiner Krawatte. »Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Glück.«
»Rauchen Sie gar nicht mehr?«, fragte Clara. Schließlich war es eines von Winterfelds Ritualen, das Fenster an der Kaffeeküche zu öffnen und nach draußen zu rauchen.
»Nicht nötig. Ich habe gleich ein Treffen mit Erich Weber vom BKA. Im Einstein, Kurfürstenstraße. Da kann man schön draußen sitzen und rauchen.«
»Sieh mal einer an«, spöttelte Clara. »Arbeitsgespräche auf der Terrasse des Einstein.«
»Sehen Sie zu, dass Sie schnellstens Kriminaldirektor werden«, sagte Winterfeld und ging mit seiner Kaffeetasse zurück in sein Büro. »Dann dürfen Sie das auch!«
Clara schaute ihm einen Moment hinterher und wollte sich auf den Weg zu ihrem Büro machen, als ihr Handy sich meldete. Es war die Mobilnummer von Hermann, einem ihrer Kollegen.
»Was gibt’s, Hermann?«
»Wie war dein Urlaub?«
»Jetzt ist er vorbei.«
»Das glaubst du«, sagte Hermann. »Er ist erst richtig vorbei, wenn du siehst, was ich sehe.«
»Und was siehst du?«
»Ein Schlachtfeld.«
»Wo?«
»Prenzlauer Berg, Schwedter Straße. Wo diese Lofts stehen.«
»Soll ich vorbeikommen?«
»Wäre gut«, sagte Hermann. »Ist ein bisschen schwierig, den ganzen Krempel aufs Revier zu kriegen. Deshalb wäre es besser, du kommst her.«
»Sehr witzig.« Clara dachte kurz an den Gerichtstermin, sagte sich dann aber, dass sie in zwei Stunden zurück sein müsste.
Sie packte ihre Sachen, stieg ins Auto und fuhr los.
5.
Die Wohnung war dunkel wie ein Grab. Die Jalousien waren heruntergelassen.
Hermann erwartete Clara an der Tür. Auch er war Ermittler beim LKA und für IT-Fragen und Internetkriminalität zuständig. Da er sich aber nicht nur im virtuellen Raum auskannte, sondern auch physisch eine Macht sein konnte – was mit eins neunzig Körpergröße, kahlrasiertem Schädel und bulligem Körperbau nicht schwerfiel –, wurde Hermann oft bei anderen Fällen eingesetzt. Clara arbeitete seit Jahren mit ihm zusammen und schätzte ihn sehr. Ganz abgesehen davon, dass sie seine zwei Gesichter mochte, das des grimmigen Grizzlybären und das des flauschigen Teddys, der sich wie ein kleiner Junge freuen oder staunen konnte.
»Warum ist es hier so dunkel?«, fragte sie nun, während Hermann sie in die Wohnung führte, wobei er mit einer Taschenlampe den Weg leuchtete.
»Der Mistkerl hat ganze Arbeit geleistet. Er hat die Sicherungen rausgerissen.«
»Und wer hat die Leiche entdeckt?«
»Montagvormittag kommt hier immer die Putzfrau. So gegen elf Uhr. Auch heute. Sie hat den Toten gefunden.«
»Wer ist der Mann?«, fragte Clara. »Wissen wir überhaupt, wer hier wohnt?«
»Offiziell wohnt hier ein gewisser Stephan Schiller, einer der Bosse in der Berliner Rockerszene. Was aber nicht heißen muss, dass die Leiche dieser Schiller ist. Ein Kollege von der Abteilung Organisierte Kriminalität ruft mich gleich zurück. Identifizierung läuft dann ja eh über die Rechtsmedizin.«
»Ist von denen schon einer hier?«, fragte Clara und zuckte zusammen, denn wie als Reaktion auf ihre Frage klappte ein Mann im weißen Papieranzug, den sie vorher nicht bemerkt hatte, an einem Tisch sein Laptop auf, das schwaches giftgrünes Licht ins Zimmer warf.
»Wir müssen hier erst mal für ein bisschen Helligkeit sorgen«, sagte Hermann. »Übrigens, von Weinstein lässt schön grüßen. Er ist bei Gericht und schaut sich die Leiche nachher in Moabit an.«
»Wie ist der Mörder eigentlich hier reingekommen?«
»Keine Ahnung. Sieht fast so aus, als hätte er eine Schlüsselkarte gehabt, von wem auch immer.«
»Und das Licht?« Clara setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen.
»Unsere Leute sind unten schon an den Verteilerkästen. Die Jalousien hat der Typ auch runtergelassen und dann die Kabel für die Schaltungen rausgerissen.«
»Also kriegen wir die Jalousien so schnell nicht wieder hoch«, meinte Clara. »Na ja, ist ganz gut so. Die Nachbarn müssen ja nicht alles sehen.« Sie trat ein paar Schritte nach vorne. »Die Leiche?«
»Hier ist sie.« Hermann stellte sich neben sie. Auch der Mann von der Rechtsmedizin kam zu ihr. Clara konnte in der Dunkelheit nicht erkennen, um welchen Kollegen es sich handelte, aber das war ohnehin erst einmal zweitrangig.
»Wir haben ihn auf dem Esszimmertisch vorgefunden«, fuhr Hermann fort. »Der Mörder hat eine Blumenvase und ein paar andere Gegenstände auf den Boden geworfen und das Opfer dann auf den Tisch gefesselt.«
Der Lichtstrahl traf zuerst die Vase, die zerbrochen auf dem Boden lag. Daneben Blumen, Scherben, Wasser. Dann traf der Strahl die Leiche, die mit offenem Mund und aufgerissenen Augen zur Decke starrte. Augen, die den Mörder gesehen hatten, die aber jetzt nur noch starre, murmelartige Eiweißbällchen waren. Der Oberkörper des Mannes war entblößt. Tätowierungen, die Schlangen, Totenschädel und Waffen zeigten, zogen sich über Arme und Brustmuskeln, die von tiefen Schnittwunden verunziert wurden. Doch was am meisten auffiel, war das Loch in der Brusthöhle. Ein ziemlich großes Loch. Die Haut war aufgeschnitten, die Rippen durchtrennt. Dahinter war nichts als Schwärze. Blutspritzer an den Wänden zeugten davon, dass das Opfer bei diesen grausamen Verletzungen und Verstümmelungen noch gelebt hatte.
»Mein Gott«, flüsterte Clara. »Hat er ihm …?«
»Ja«, sagte der Mann von der Rechtsmedizin. »Er hat ihm das Herz herausgeschnitten.«
»Und mitgenommen?«, fragte Clara. »Oder ist es hier irgendwo?«
»Nein.« Hermann schüttelte den Kopf.
»Frau Vidalis?« Eine der Einsatzkräfte kam in die Wohnung. »Da ist ein Doktor Friedrich vom LKA.«
»Ach?«, sagte Clara und stellte fest, dass der Name mehr in ihr auslöste als nur den Gedanken, dass jetzt der Kollege kam, der die Abteilung für Operative Fallanalyse leitete. »Ich dachte, der wäre noch in England. Okay, danke, ich hole ihn ab.«
MacDeath stand mit einer Aktentasche vor der Tür. Er sah ein wenig müde aus.
»Da bist du ja.« Clara und MacDeath hatten beschlossen, einander zu duzen, wenn sie unter sich waren, sich ansonsten vor Kollegen aber nach wie vor zu siezen, damit niemand auf ihre gemeinsame Nacht schließen konnte. Ein bisschen verkrampft das Ganze, das wussten beide. Zumal es eine Nacht gewesen war, von der Clara nicht wusste, ob sie etwas Einmaliges bleiben würde oder ob das, was zwischen ihnen passiert war, eine Zukunft hatte. »Ich hätte gar nicht erwartet, dass du so schnell kommst.«
»Da kannst du mal sehen, wie eilig ich es habe, wenn der Tod ruft.«
»Wie war’s beim Scotland Yard?«, fragte Clara.
MacDeath war die ganze letzte Woche in London gewesen. Erst vor einer Stunde war seine Maschine in Tegel gelandet. Als er den Anruf von Hermann bekommen hatte, war er vom Flughafen sofort zum Tatort gefahren. Seinen Reisekoffer hatte er in einem der Einsatzfahrzeuge zwischengelagert.
»Sehr interessant. Es waren auch Leute vom Obscene Publications Squad gekommen, die Porno-Polizei von Scotland Yard. Wie du weißt, müssen die sich durch alle möglichen Pornos und angebliche Snuff-Movies quälen, um auf diese Weise Verbrechenskartellen auf die Spur zu kommen. Was offenbar erstaunlich gut funktioniert. Man glaubt nicht, was man in einem Film alles über die Macher dieses Filmes erfährt.«
MacDeath hatte die Frühmaschine aus London genommen; hinzu kam eine Stunde weniger Schlafzeit wegen der Zeitverschiebung. Entsprechend müde schien er zu sein. Ansonsten sah er mit seinem grau melierten Haar, der Krawatte und dem Pullunder wieder aus, als hätte er soeben eine Geschichtsvorlesung in Harvard gehalten. »Schöne Grüße von John Douglas. Er war ebenfalls dabei. Also, wie sieht’s hier aus?«
»Der Schrecken geht weiter«, erwiderte Clara. »Komm bitte mit.«
Sie führte ihn zur Leiche. MacDeath blinzelte im Halbdunkel, bis seine Augen sich einigermaßen daran gewöhnt hatten. Dann nickte er grüßend Hermann zu, der neben dem Toten stand, und schaute auf den Oberkörper des Ermordeten. »Ach du Schande. Die Haut aufgeschnitten, die Rippen durchtrennt und dann das Herz entfernt.« MacDeath beugte sich über die Wunde. »Alle anderen Organe scheinen noch da zu sein … Was ist ist das?«
Der Strahl von Hermanns Taschenlampe zuckte nach unten.
Auf dem Boden, in einer Blutlache, lag das Brustbein mit den Rippenansätzen, die offenbar sauber durchtrennt waren. Neben dem Brustbein begann eine Spur aus Blut. Sie führte ungefähr fünf Meter weit von der Leiche weg, um dann im Nichts zu verschwinden.
»Als hätte er das Herz bis hier in der Hand gehalten und dann irgendwo verstaut«, meinte Clara und suchte den Fußboden ab, konnte aber keine weiteren Spuren entdecken.
»Hier ist was«, rief einer der Polizisten. »Das ist … ach du Schande …«
Sie eilten in die Zimmerecke gegenüber der Wohnungstür.
»Ist das ein Hund?«, fragte Hermann.
»Ja. Ein Pitbull, wie es aussieht.« Der Mann von der Rechtsmedizin drehte den Kopf des Tieres zur Seite. Eine Augenhöhle war nur noch ein klebriges, blutiges Loch, ähnlich dem Loch in der Brust des Mannes, nur sehr viel kleiner.
»Hier«, fuhr der Rechtsmediziner fort und hielt einen Kugelschreiber in die Höhe. »Den hat der Mörder dem Hund ins Auge gebohrt. Durch das Auge ins Gehirn.« Er ließ den Kuli in einem Asservatenbehälter verschwinden.
Hermann schüttelte den Kopf. »Was muss das für ein Kerl sein. Mal eben so einen Kampfhund umzubringen …«
»Und einen muskulösen Mann wie den hier.« Clara zeigte auf die Leiche, die auf dem Tisch lag. »Der Mörder muss ein wahres Ungetüm sein.«
Hermanns Handy klingelte. »Ja?«, meldete er sich. »Deathguards? Interessant. Wer könnte uns darüber … Der zweite Mann? Ja, der ist kein Unbekannter. Gut, wir kümmern uns darum.«
Er beendete die Verbindung und schaute Clara und MacDeath an. »Der Mann, der hier wohnt, ist tatsächlich Stephan Schiller, Boss des Deathguard-Chapters hier in Berlin. Jetzt brauchen wir nur noch die Infos von der Rechtsmedizin, dann ist die Identifizierung hundert Prozent komplett.«
»Deathguards? Ist das nicht so ein Rockerclub?« Clara hatte den Namen schon öfter gehört.
»Ja, ähnlich wie die Hells Angels oder die Bandidos. Aber um einiges jünger.«
»Dann sollten wir so schnell wie möglich mit dem stellvertretenden Boss des Chapters sprechen. Du hast doch eben am Telefon von einem zweiten Mann gesprochen, Hermann. Ist er das?«
»Ja. Er heißt Akin Kara, die Nummer zwei der Deathguards Berlin. Die Kollegen hatten vor ein paar Jahren mit ihm zu tun, als dieser Puff am Ostkreuz wegen Geldwäscheverdacht dichtgemacht wurde.«
»Akin Kara? Klingt nach Nahem Osten.«
Hermann grinste. »Skandinavisch klingt es jedenfalls nicht. Er ist Türke, soviel ich weiß. Die müssen ja nicht alle Abdul oder Ahmet heißen.«
»Ich dachte, die Rockerbanden nehmen keine Türken oder Leute aus Nahost bei sich auf.«
»Offenbar hat die Globalisierung auch bei denen zugeschlagen.«
MacDeath stand noch immer vor der Leiche und betrachtete sie nachdenklich.
»Was ist los?«, fragte Clara. Sie konnte sich kaum vorstellen, dass MacDeath erschüttert war, weil er einen Toten sah. Und großes Mitleid hatte er mit einem Bandenboss sicher auch nicht.
MacDeaths Blick war auf den Oberkörper der Leiche gerichtet, besonders auf die Arme und das seltsame Zeichen, das dem Opfer ins Fleisch geschnitten worden war.
»Dieses Zeichen«, sagte MacDeath. »Ich habe es irgendwo schon mal gesehen.«
6.
Clara ging mit MacDeath über den Flur im dritten Stock des LKA-Gebäudes. Ihr Ziel war das Büro von Winterfeld. Sie hatten kurz über den Prozess gegen den Inkubus gesprochen; Clara hatte es gerade noch geschafft, eine Stunde lang vor Gericht auszusagen. Ob der Verrückte jetzt in die Sicherungsverwahrung kam, stand allerdings noch in den Sternen.
Anschließend kamen sie noch einmal auf MacDeaths Aufenthalt in London zurück.
»Von John Douglas hast du mir ja schon Grüße ausgerichtet«, sagte Clara. »Was ist mit Robert Ressler? War der auch in London?«
»Nein.« MacDeath schüttelte den Kopf. »Bob Ressler ist leider im letzten Jahr gestorben. Mai 2013.«
»Davon hast du gar nichts erzählt«, sagte Clara.
»Wir hatten auch nicht mehr so viel Kontakt«, sagte MacDeath. »Aber was ich in London gesehen habe, hatte auch mit Toten zu tun.« Er machte eine Pause. »Hast du schon mal von Cyronics gehört?«
»Nein. Was ist das?«
»Das Einfrieren von Leichen. Eine Firma aus den USA, die auf diesem Gebiet tätig ist, hat ebenfalls am Kongress teilgenommen.«
»Einfrieren können wir Leichen auch. In Moabit, im Kühlraum«, sagte Clara.
»Mit dem Unterschied, dass diese Firma sie angeblich wieder aufwecken kann.«
»Auftauen, meinst du wohl«, erwiderte Clara. »Also, ich kenne ein paar Zeitgenossen, bei denen würde ich höchstpersönlich den Stecker vom Kühlaggregat rausziehen, sobald sie erst eingefroren sind.«
MacDeath lachte auf. »Ich auch. Jedenfalls, diese Firma sitzt in Scottsdale, Arizona, und nennt sich Alcor Life Extension Foundation. Da kann man sich für viel Geld in Tiefkühlkost verwandeln lassen, in der Hoffnung, dass die Medizin irgendwann mal so weit sein wird, dass sie einen aufwecken kann. Falls so etwas überhaupt jemals möglich sein sollte. Man kommt ins Jenseits und sofort wieder zurück. In der Buchhaltung würde man das LIFO nennen.«
»LIFO?«
»Last In First Out. Als Letzter rein, als Erster wieder raus.«
»Und was kostet der Spaß?«
»Um die hundertfünfzigtausend Dollar.«
»Ganz schön teuer. Zumal bei diesem ungewissen Ausgang.«
»Man kann auch nur den Kopf nehmen. Das kostet dann achtzigtausend.«
»Achtzig Riesen? In der Zeitung sehe ich jeden Tag Köpfe, die keinen Cent wert sind. Vielleicht sollte man in diesem Fall das Herz nehmen.« Clara lächelte gequält, als sie Winterfelds Büro erreichten. »So, ich muss kurz hier rein. Wir sehen uns nachher.«
***
»Scheint ja eine üble Sache zu sein«, sagte Winterfeld, als er und Clara Platz genommen hatten. »Ich habe die Akte schon mal überflogen. Zu neunzig Prozent handelt es sich bei dem Toten tatsächlich um Stephan Schiller, Boss der Deathguards in Berlin. Genau wissen wir es allerdings erst, wenn die Jungs mit den Gummihandschuhen durch sind.« Winterfeld zupfte an seiner Krawatte. »Wissen Sie, wie sein Spitzname in der Szene war?«
»Nein.«
»Schiller der Killer.« Winterfeld lächelte in sich hinein. »Dass ausgerechnet er das Opfer eines anderen Killers wird, war bestimmt nicht vorgesehen.«
»Wer mit dem Schwert lebt, wird durch das Schwert sterben«, sagte Clara.
»Klingt jedenfalls nach Bandenkrieg.«
»Das denke ich auch.« Clara nickte. »Ein Krieg allerdings, der auf extrem brutale Art und Weise geführt wird.«
»Zimperlich sind diese Banden ja nie.« Winterfeld zeigte auf die Tatortfotos. »Seltsam ist nur, dass reichlich Fingerabdrücke und DNA am Tatort gefunden wurden. Leider ist die DNA in keiner Datenbank gespeichert, ebenso wenig die Fingerabdrücke.«
»Ob die einen Killer von außerhalb eingeflogen haben?«, warf Clara ein. »Einen Auftragskiller oder Hitman aus dem Dark Web?«
»Wer weiß.« Winterfeld sortierte die Unterlagen vor sich auf der Schreibtischplatte. »Wir haben allerdings noch nicht alle Datenbanken durch.«
Clara zeigte auf ein weiteres Foto des Toten, das vor Winterfeld lag. Auf diesem Bild waren die Schnittwunden und Zeichen deutlich zu erkennen. »MacDeath sagt, er habe diese Zeichen schon mal irgendwo gesehen.«
»Vielleicht gab’s hier mal einen ähnlichen Fall.«
»Möglich. Aber MacDeath meint, er habe sie nicht hier gesehen, sondern irgendwo anders.«
Winterfeld schaute sie verwundert an. »Jetzt macht es nicht komplizierter, als es ist. Okay, wir werden sehen.« Er zog eine andere Akte hervor. »Nächstes Thema. Das ist der Kerl, mit dem wir sprechen müssen.«
»Akin Kara? Die Nummer zwei der Deathguards?«
»Genau der.«
»Und wo finde ich den?«
Winterfeld lehnte sich zurück und lächelte. »Im Knast.«
»Der sitzt?«
»Und das wohl noch eine ganze Weile.« Winterfeld nahm eine Zigarilloschachtel aus einer Schreibtischschublade und öffnete sie schon mal, wahrscheinlich für später. »Er könnte auch eher raus. Allerdings nur, wenn er den Mund aufmacht. Aber diese Rocker – die Deathguards, Hells Angels, Bandidos und was weiß ich – leben nach der Devise ACAB.«
»ACAB.« Clara verzog das Gesicht. »All Cops are Bastards.«
Winterfeld grinste. »Die machen ihre Sachen unter sich aus. Uns Bullen einzuschalten gilt bei denen als Geheimnisverrat. Die haben sogar einen Sonderfonds, der Anwälte bezahlt und die Familien der Inhaftierten gut versorgt. Damit wollen sie verhindern, dass doch noch jemand singt. Und es singt auch fast keiner. Wobei dieser Akin wohl ein bisschen weniger Zeit absitzen muss als die anderen.«
»Warum?«
Winterfeld blätterte durch die Akte. »Er hat mal zwei Männer in der U-Bahn vor fünf Schlägern beschützt.« Winterfeld schien die Story zu gefallen. »Er ging auf die Typen zu und machte kurz seinen Ledermantel auf. Und darunter war …«
»Ein Messer?«
»Nein, eine AK-47.«
»Ein Sturmgewehr?« Clara riss die Augen auf. »Wollte er damit in der U-Bahn um sich schießen?«
»Das haben die Schläger ihn auch gefragt. Und wissen Sie, was er gesagt hat?«
Clara schüttelte den Kopf.
»Er sagte sinngemäß: Wenn ich in den Knast komme, weil ich mit einer AK-47 in der U-Bahn Scheißkerle wie euch abknalle, ist das nur noch mein Problem, nicht eures, weil ihr dann tot seid wie frittierte Hühnerärsche. Oder ich baller euch die Knie weg oder gleich in die Wirbelsäule. Dann seid ihr für den Rest eures kläglichen Lebens Krüppel, die in irgendwelchen Pflegeheimen verfaulen.«
»Scheint ja ein krasser Typ zu sein.« Clara nahm die Akte entgegen, die Winterfeld ihr über den Tisch hinweg reichte. »Bin gespannt, was das für ein Gespräch wird.« Sie schaute noch einmal auf die Akte. »Und er ist Türke?«
»Türke oder Kurde.«
»Der Unterschied wäre schon wichtig.«