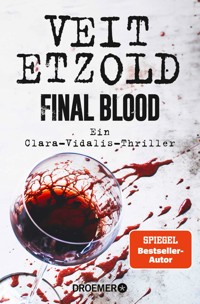9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Christian den Link zu dem Video anklickt, ist er entsetzt über das, was er sieht: einen bis zur Unkenntlichkeit entstellten menschlichen Körper, der regungslos auf dem Wasser eines Swimmingpools treibt. Das ist nur der Höhepunkt einer ganzen Reihe von seltsamen Ereignissen, die sich in Christians sonst so geregeltem Leben plötzlich häufen. Doch als er sich der Polizei anvertraut, reagiert diese anders als erwartet. Christian hat das Gefühl, dass man ihm nicht glaubt. Als er weitere dieser grauenhaften Videos erhält, steht die Polizei plötzlich vor seiner Tür: Man hat herausgefunden, dass die E-Mails von seinem Account verschickt wurden. Und: Die Toten sind keine Fremden - Christian kannte sie alle ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
ERSTES BUCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
ZWEITES BUCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
DRITTES BUCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Epilog
Dank
Veit Etzold
SKIN
Thriller
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Ein Projekt der AVA international GmbHAutoren- und Verlagsagenturwww.ava-international.de
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Wolfgang Neuhaus, OberhausenTitelillustration: © www.buerosued.de (2)Umschlaggestaltung: Bürosüd, München
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-2310-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Saskia
Prolog
Im Flur war es dunkel.
Es roch muffig.
Ein großer Freund der Hygiene war er ja nie gewesen, aber hier war es offenbar noch schlimmer geworden. In der Ferne, so sagte man, kommen die wahren Eigenschaften eines Menschen zum Vorschein, die guten und die schlechten.
Hier offenbar nur die schlechten.
Die Rollos waren heruntergezogen. Die Sonne blinzelte durch die Spalten und brach sich in der abgestandenen Luft, die so ranzig war, dass man sie mit den Händen hätte greifen können. Im trüben Licht summten Fliegenschwärme.
Schöner wohnen würde hier keinen Preis vergeben.
Blick in die Küche.
Die Spüle randvoll mit Geschirr. Auf dem Küchentisch Konserven, Gabeln, schmutzige Servietten. Take-away-Gerichte vom Chinesen. Eines davon noch halb voll. Zwei Essstäbchen ragten aus einem ekelhaften Mischmasch aus blau angelaufenen Nudeln und pelzigem Schimmel. Obendrauf ein wimmelnder Fliegenschwarm.
Verdammt, wo kommen all die Viecher her?
Lieber gleich weiter.
Wo ist er denn nur? Lebt er wirklich in diesem Saustall?
Der Gestank wurde noch schlimmer.
Zeitungen und Magazine lagen auf dem Flur verstreut. So, als sollte hier tapeziert werden. Doch Tapezieren wäre sicher das Letzte, was dem Bewohner dieser Wohnung eingefallen wäre. Auch wenn es bitter nötig war, denn die von Schimmel zerfressenen Tapeten hingen schwarzgrau von der Wand.
Vorne das Wohnzimmer.
Die Jalousien halb geöffnet.
Auf dem Tisch eine Ansammlung von Coladosen, Bier- und Whiskyflaschen. Alle Bierflaschen leer, zwei Whiskyflaschen ebenfalls, in der dritten noch ein Fingerbreit Alkohol. Auf dem Tisch ein paar bunte Pillen und weißes Pulver.
Oh Gott er hat doch nicht etwa angefangen, Drogen zu nehmen? Getrunken hat er in letzter Zeit eh zu viel, geraucht sowieso, aber von Drogen hat er bisher die Finger gelassen.
Eines dieser komischen Geräte zum Zigarettendrehen auf dem Tisch, daneben Blättchen, bröseliger Tabak, zwei kleine Tütchen, wahrscheinlich Marihuana oder Cannabis. Zigarettenasche im überquellenden Aschenbecher. Kippen auf Sofa und Fußboden. Einige so festgetreten, dass sie wie ein Teil des fleckigen Teppichs aussahen.
In der Tischmitte ein Handy. Nur noch zu zehn Prozent geladen. Voll mit Anrufen in Abwesenheit.
Auch hier Fliegen. Auf dem Boden, an der Decke. Eigentlich überall.
Klar, in so einer Messie-Wohnung wimmelt es von Fliegen. Aber so viele?
Links das Bad.
Dieser Gestank!
Das war aber doch nicht der Gestank von Müll oder Schimmel? Oder der einer Wohnung, die zu selten gelüftet wurde?
Nein. Das war der Gestank von etwas anderem. Etwas, das uralte Instinkte alarmierte. Das einem sagte: Hier ist etwas geschehen, was nicht geschehen durfte.
Ein Griff an die Badezimmertür.
Kurzes Innehalten.
Durchatmen. Luft anhalten. Tür öffnen.
Grelles Licht im Bad.
Mit einem Mal war alles klar.
Wenn man in einem derart zugemüllten Saustall von Klarheit sprechen konnte.
Aber jetzt war klar, was mit ihm war.
Er war nicht verreist.
Er war nicht verschollen.
Er war hier.
Er lag in der Wanne.
Tot.
Leben konnte so jemand, so etwas, nicht mehr.
Auch hier Fliegen. Überall.
Das Fenster stand auf Kippe, und die nach außen dringende Luft hatte sie angelockt. Diese Mischung aus Schimmel, vergammelten Essensresten, ranziger Luft und Fäulnis.
Ist das sein Gesicht?
Es war kaum mehr zu erkennen … aber, bei Gott, ja, es war sein Gesicht.
Die Wahrheit war schlimmer als der Tod.
Der aufgetriebene Körper befand sich teils über Wasser, teils unter Wasser. Der Oberkörper war mit Löchern übersät, durch die man die oberen Rippen sehen konnte. Die unteren schimmerten weiß durch das trübe Wasser.
Das Gesicht grau. Die Augen blind. Die Zähne zu einem Grinsen gebleckt.
Man sagte, Wasserleichen seien die schlimmsten Leichen.
Stimmt.
Die Hand lag halb auf dem Rand der Wanne, halb war sie unter Wasser. »Waschhautbildung« nannte man das, verhornte Haut, die aufquoll und Wellen schlug.
Bilder erschienen vor dem inneren Auge.
Sie beide, gemeinsam auf der Brücke. Gemeinsam in der Bahn. An der See. Auf dem Balkon.
Hand in Hand.
Noch einmal kamen die Bilder.
Die Hand in meiner Hand. Ich muss die Hand ergreifen! Es geht nicht anders! So wie früher. So wie immer.
Ein Griff nach der Hand, wie zu Lebzeiten. Als letzte Geste. Auch wenn er verschwunden war, ein Teil von ihm war noch hier. So wie seine Hand.
Dieses Gefühl …!
Die tote Hand in der lebenden. Die Berührung. Als wäre dadurch alles wie früher.
Dann das Geräusch, als die Haut sich löste.
Die Haut der Hand in meiner Hand.
Erst dann wurde klar, was wirklich passiert war.
Der Schrei gellte durch die Hölle des Bades und die Vorhölle des Flures.
Für einen Moment stoben die Fliegenschwärme auf. Ihr helles Summen erfüllte die warme, feuchte, beinahe ölige Luft, die sich als dünner Film auf Haut und Kleidung legte. Die Wasseroberfläche zitterte.
Dann ließen die Fliegen sich wieder nieder.
Alles war wie vorher.
Nur die abgelöste Haut der Hand lag auf dem Badezimmerboden.
ERSTES BUCH
1.
»Du hast in Witten studiert?«
Christian hörte die Frage gar nicht, als er mit Fabian, seinem Projektleiter, über den nicht enden wollenden Gang im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens ging. Ihnen folgte Katharina, die ziemlich laut mit einem offenbar begriffsstutzigen Kunden telefonierte. In fünfzehn Minuten begann das Boarding für ihren Flug nach Zürich. Wenn es jemals eine Zeit gegeben hatte, in der Christian Flughäfen mit Urlaub in Verbindung brachte – diese Zeit war jetzt endgültig vorbei.
Er schaute auf sein Smartphone, stolz auf die Gravur in der Metallhülle. Christian König, stand da. East Coast Consulting.
East Coast Consulting. ECC. So hieß die Firma, für die er jetzt arbeitete. Die führende Strategieberatung der Welt, hatte man ihm und den anderen eingehämmert. Erst in den Karriere-Magazinen, dann in den Recruiting-Workshops und schließlich bei ECC selbst.
Jetzt war Christian Teil dieser Firma. Was für jeden Hochschulabsolventen, der Karriere machen wollte, einem Ritterschlag gleichkam. Erst recht für jemanden, der Christians Fach studiert hatte.
»Schläfst du noch?«
Christian wurde aus seinen Gedanken gerissen. »Bitte?«
»Ob du in Witten studiert hast, habe ich dich gefragt«, sagte Fabian.
»Ja«, antwortete Christian knapp. »Witten Herdecke. Philosophie. Und dann noch ein bisschen Volkswirtschaft.«
»Okay.« Fabian schien nicht allzu begeistert zu sein. »Aber die BWL-Sachen sitzen auch, oder? Ihr wart doch alle auf dem Exotentraining?«
»Ja, klar«, beeilte sich Christian zu sagen, während er seine Tasche schulterte und einer dicken alten Dame auswich, die ohne Vorwarnung stehen geblieben war. Noch drei Schritte, und sie standen auf einem dieser horizontalen Förderbänder, auf denen man sich immer so vorkam wie die grauen Herren in Michael Endes Momo, wenn man schnell lief: Ein kleiner Schritt nach vorne, und die Außenwelt rauschte viel schneller an einem vorbei.
Katharina war noch immer ein paar Meter hinter ihnen, da ständig neue Kunden anriefen und sie des Öfteren gegen den Lärm im Terminal anschreien musste. Christian mochte Katharinas norddeutsche, pragmatische Art und ihren klassischschlichten Stil. Besonders ihre eleganten Schuhe waren ihm aufgefallen, zumal sie keine hohen Absätze hatten. Das kannst du vergessen, hatte Katharina ihm gesagt, mit hohen Absätzen kilometerweit zum Gate laufen. Fabian hatte Katharinas Schuhe scherzhaft »Carla-Bruni-Treter« genannt, da das italienische Model/Sängerin/Expräsidentengattin ebenfalls keine hochhackigen Schuhe mehr trug. Allerdings nur deshalb, damit sie ihren kleineren Ehemann Sarkozy nicht überragte.
Hoffentlich sitzen die BWL-Sachen wirklich, dachte Christian. Alles, was er beim Exotentraining gelernt hatte. Ein seltsamer Begriff, aber so nannte man das hier. Exotentraining. Alle, die keine BWLer waren, galten als Exoten: Philosophen, Literaturwissenschaftler, Physiker, Mediziner. Sie alle kamen irgendwann nach der Uni zu ECC, denn das Unternehmen zahlte sehr gut. Und ECC brauchte immer Nachwuchs. Wenn man dann rigoros herausfilterte, wer gut genug war, um ein Jobangebot zu bekommen, musste man halt ein umso größeres Netz auswerfen. Je kleiner der Filter, desto größer musste das Netz sein, wenn etwas hängen bleiben sollte. Und um all die Nicht-BWLer für die harte Business-Welt fit zu machen, gab es das Exotentraining.
Oh ja, Christian hatte daran teilgenommen. Zwei Wochen Druckbetankung im Münchner Büro der ECC. Kostenrechnung, Investitionsrechnung, Bilanzen, Buchhaltung, Barwert, Unternehmensbewertung, Operational Finance, Corporate Finance, International Finance – das volle Programm. Alles das, was normale Leute in einem ganzen BWL-Studium lernen, wurde den Nicht-BWLern, die intelligent – oder auch ahnungslos – genug waren, um von ECC ein Angebot zu bekommen, innerhalb von zwei Wochen in gnadenloser Schlagzahl eingehämmert.
Christian war jetzt genau vier Wochen bei ECC. Zwei Wochen Exotentraining, zwei Wochen European Business Training. Mit anderen Beratern aus England, Spanien und Frankreich. Tagsüber Fallstudien lösen, um sie dann den Geschäftsführern oder Partnern von ECC vorzulegen, die extra mit einem Fahrservice von irgendeinem internationalen Flughafen aus in dieses bayerische Nest gekommen waren, wo die Trainings stattfanden und die hoffnungsvollen Talente in Klausur gingen. Dann gab es Feedback. Und am Abend hoch die Tassen.
Am letzten Abend schließlich wurde die große Überraschung präsentiert, wie bei einer Weihnachtsbescherung. Oder wie bei den Marines auf Paris Island, wenn sie erfuhren, in welches Krisengebiet man sie schickte. Passend dazu nannte man die letzte Woche des European Business Trainings »Bootcamp«.
Am jenem letzten Abend wurde mitgeteilt, wer auf welchem Fall arbeiten würde. Diesen Job übernahmen die Mitarbeiter der Personalbeschaffung, die dafür zuständig waren, die richtigen Leute zu den richtigen Projekten zu bringen. Wenn ein Partner bei ECC einem Unternehmen ein Beratungsprojekt verkaufte, brauchte er dafür Berater, die die eigentliche Arbeit machten, den Job on the ground, wie es bei ECC hieß. Die Partner selbst schwebten oft nur zu den Lenkungsausschüssen ein, den sogenannten Steering Committees, und ließen sich vorher von den rangniedrigeren Chargen über den Projektfortschritt unterrichten, damit sie im Meeting nicht allzu ahnungslos wirkten. Was sie nicht davon abhielt, dem Kunden dennoch achttausend Euro in Rechnung zu stellen. Pro Tag, wohlgemerkt.
Christian hatte bereits davon gehört, was die Partner verdienten, was sie den Kunden kosteten und wer ein »Rainmaker« war, ein Regenmacher. Das waren diejenigen, die die größten Aufträge an Land zogen.
Das alles wurde hinter vorgehaltener Hand bei den beiden Trainingsveranstaltungen diskutiert. Denn es war so, wie es oft war: Einige der »Newies«, der Neueinsteiger, wussten mehr über die Firma als andere. Vielleicht, weil sie dort jemanden kannten, vielleicht, weil sie die richtigen Insiderseiten im Internet gelesen hatten, vielleicht auch nur deshalb, weil sie behaupteten, etwas zu wissen, in Wahrheit aber keine Ahnung hatten. Eine Fähigkeit, die in der Unternehmensberatung nicht ganz unwichtig war. SABVAkürzte man firmenintern die Begabung ab, auch bei einem Problem, von dem man nie zuvor gehört hatte, so zu erscheinen, als habe man die Lösung schon vor dem Gespräch in der Schublade. SABVA – Sicheres Auftreten bei vollständiger Ahnungslosigkeit.
Was beispielsweise zur Folge hatte, dass Berater an Versicherungsprojekten arbeiteten, obwohl sie von Versicherungen erst einmal keine Ahnung hatten. Das wiederum führte unter anderem dazu, dass auch Philosophen wie Christian von ECC eingestellt wurden, auch wenn sie sich die betriebswirtschaftlichen Details mühevoll innerhalb von zwei Wochen – und später an den Projekten – in den Kopf hämmern mussten und sich dann gänzlich unphilosophisch fragten, warum sie nicht gleich etwas Vernünftiges studiert hatten.
Genauso blöd kamen sich allerdings auch die studierten BWLer vor, wurde ihnen doch vor Augen geführt, dass man in schlappen zwei Wochen nachholen konnte, wofür sie sich fünf Jahre lang krumm gemacht hatten.
We don’t hire skills, we hire attitudes, hatte mal ein ECC-Partner an der Uni Witten Herdecke gesagt, als ECC dort ein so genanntes Recruiting durchgeführt hatte, um neue Mitarbeiter zu gewinnen, Häppchen und Sektempfang inklusive. »Wir schauen nicht auf die Fähigkeiten, sondern auf die Einstellung. Wer die richtige Einstellung hat und smart und schnell ist, kann alles lernen.«
Christian war mehr als zufrieden gewesen, als man ihn an jenem letzten Abend der BWG zugeteilt hatte, als die neuen Projekte für die Newies verkündet worden waren. BWG, die Bank für Wirtschaft und Gesellschaft. Er, Christian König, würde an einem Bankenprojekt arbeiten! Obendrein für eine große und bedeutende Bank, denn von der BWG hatte er zuvor schon gehört, sogar als Philosoph. Das machte ihn stolz, zeigte es doch, dass man ihm viel zutraute. Er hatte auch schon von Geisteswissenschaftlern gehört, die erst einmal bei einem so genannten Pro-Bono-Projekt landeten, wo ein Museum oder eine Uni gegen geringe oder gar keine Gebühr beraten wurde. Schön und gut, aber nicht besonders förderlich für die Karriere bei ECC. Denn wer nur »Schönwetterberatung« gewöhnt war, war für die »harten« Beratungsprojekte nicht geeignet – und mit denen verdiente ECC nun mal das große Geld.
Doch Christians anfängliche Hochstimmung verflog, als er feststellen musste, dass die Banking-Praxisgruppe der ECC so riesig und unersättlich war, dass sie immer wieder Nachschub brauchte und sich nicht groß darum kümmerte, ob die Newies etwas anderes machen wollten als Banking. Schließlich hatten die Banken nach wie vor eine Menge Geld und eine Menge ungelöste Probleme, bei denen sie Beratung brauchten. Bei den Newies war daher schon vom obligatorischen »Bankenjahr« die Rede, das jeder Neuling erst einmal hinter sich bringen musste.
»Ich glaube, Lars war vor Kurzem auf einem Recruiting Workshop in Witten«, sagte Fabian, als sie auf dem Laufband standen. »Kann das sein?«
Christian nickte. Lars war der ECC-Partner, der an der Uni Witten von »Skills und Attitudes« geredet hatte. Ihn würde er auch noch kennenlernen, denn Lars war der Partner bei dem Projekt, an dem Christian mit Fabian und Katharina arbeitete.
Kurz darauf stiegen sie vom Förderband, und die Welt bewegte sich wieder langsamer.
»Also, pass mal auf«, tastete Fabian sich an eine Sache heran, die ihm offenbar wichtig war. »Wir haben da ein Excel Sheet mit den Zahlungsströmen der Bank. Bilanz, Profit and Loss, alles Mögliche. Eine Riesentabelle.« Er schaute Christian an. »Da musst du wahrscheinlich ran.«
»Wer sitzt denn zurzeit dran?«
»Ein Kollege namens Jonathan.« Fabian zog ein düsteres Gesicht. »Allerdings ist Lars unzufrieden mit ihm, und ich bin’s auch. Da sind tausend Bugs in dem Sheet, irgendwelche verdammten Programmfehler, und wenn Lars und ich beim Kunden sind, stehen wir wie die Doofen da, weil die Zahlen nicht zusammenpassen. Jonathan performt nicht richtig.«
Er performt nicht richtig, dachte Christian.
Was sich anhörte wie das Auswahlverfahren bei deutschen Castingshows, hatte einen viel ernsteren Hintergrund. Christian hatte in den Trainings davon gehört, dass Teammitglieder, die »nicht richtig performten«, aussortiert und später womöglich gefeuert werden.
»Excel kannst du doch?«, fragte Fabian. »Das hattet ihr doch im Exotentraining, oder?«
»Mehr oder weniger.«
»He«, rief Katharina und wies mit ausgestrecktem Arm auf die Anzeigetafel. »Frohe Botschaft!«
»Scheiße«, fluchte Fabian. »Der Abflug verzögert sich um eine Viertelstunde.« Demonstrativ ließ er seine Laptoptasche fallen. »Okay, wir nutzen die Zeit und geben dir ein paar Tipps, von denen du bei den Trainings bestimmt nichts gehört hast. Also pass auf, es ist wichtig.«
2.
Freitagabend.
Hauptkommissar Frank Deckhard nahm einen vorsichtigen Schluck Bier und ließ den Blick durch die Bar schweifen. »Das Eisen« war so etwas wie seine Stammkneipe, gelegen zwischen Keithstraße, wo sich das Abschnittsrevier des LKA befand, und dem Kudamm. Eine Mischung aus rebellischer Aufsässigkeit und Westberliner Mief. Ein bisschen Motörhead, ein bisschen Europa-Center, ein bisschen Café Kranzler. Und so richtig zusammen passte gar nichts. Aber das Bier war eiskalt, und das war das Wichtigste.
Deckhard kam gerade vom Karatetraining, wie jeden Freitagabend. Wado-Ryu-Karate. Bei diesem Kampfstil gab es nicht nur Schläge und Tritte, auch Hebel, Würger und Würfe. Heute hatten sie im Training Bruchtests gemacht und Bretter durchschlagen. Deckhards Exfreundin hatte sich immer beschwert, wenn er nach solchen Übungen mit dicken Knöcheln nach Hause kam, und ihm Eis auf die geschwollenen Stellen gelegt. Oder tiefgefrorene Himbeeren aus dem Gefrierfach. Nun war die Freundin weg, die tiefgefrorenen Himbeeren ebenfalls. Dafür war das Bier kalt, und Deckhard presste die Knöchel an das vor Kälte beschlagene Glas.
Immerhin hatten sie heute einen Fall zu Ende gebracht. Vor zwei Tagen hatten sie Uwe P. auf der Autobahn gefunden. Als er noch gelebt hatte, war er Zuhälter gewesen. Was er jetzt noch war, ließ sich schwer definieren. Denn sie hatten ihn in einem Zustand gefunden, als wäre er von einem Riesen auf einem gigantischen Hobel abgeschliffen und gleichzeitig angezündet worden. Den Ermittlern war schnell klar geworden, dass der Mann nur kurze Zeit auf der Autobahn gelegen hatte, ehe er von einem Wagen erfasst und vermutlich mehrere Kilometer weit mitgeschleift worden war.
Doch erst die Rechtsmedizin fand heraus, was vorher niemand erkannt hatte: Uwe P. war etwa fünf Kilometer von der Stelle entfernt, wo die Ermittler ihn gefunden hatten, totgeschlagen worden. Dort hatten der oder die Täter den armen Uwe nachts auf die Autobahn gelegt. Und gehofft, die dämlichen Bullen würden glauben, er sei totgefahren worden.
Tja, da habt ihr Pech gehabt, dachte Deckhard und trank in kleinen Schlucken von seinem Bier. Die Rechtsmediziner hatten herausgefunden, dass der Mann bereits tot gewesen war, als das Auto ihn erfasst hatte, denn es hatte keine Vitalitätszeichen mehr gegeben. Die Schläge auf den Kopf aber hatten zu Blutungen geführt, bevor das Opfer mitgeschleift worden war. Also war es an diesen Schlägen gestorben.
Eigentlich gut so, dachte Deckhard. Denn lebend von einem Auto mitgeschleift zu werden würde er nicht einmal seinen schlimmsten Feinden gönnen. Die Bilder vom Tatort und aus dem Obduktionssaal blitzten noch immer vor seinem inneren Auge auf wie kurze Einblendungen aus einem Horrorstreifen. Die Füße nur noch blutige Klumpen. Die ganze rechte Seite eine einzige klaffende Wunde. Das Gesicht enthäutet und von der Hitze angesengt wie ein verbrannter Lampion.
Deckhards Handy piepte. Er schaute aufs Display. Eine SMS. Ich denke noch immer an den Pazifik, stand da.
Er wollte gerade antworten, als sich die Tür zum »Eisen« öffnete und eine attraktive, zierliche Frau Ende dreißig die Bar betrat. Deckhard erkannte seine Kollegin Sophie sofort. Die von der Kälte roten Bäckchen, die Sporttasche, die wachen Augen. Sie arbeiteten viel zusammen. Sophie war Fachärztin für Rechtsmedizin und obendrein auch noch für forensische Psychiatrie, was ihr half, nicht nur die Seele von Verbrechern und deren Opfern zu verstehen, sondern auch deren meist leblose Körper.
An diesem Abend hatte man Sophie noch zu einem anderen Tatort gerufen, nachdem Deckhard bereits gegangen war. Mehrere Alkoholiker waren im Suff übereinander hergefallen. Einen von ihnen hatte es besonders schlimm erwischt; er schwebte in Lebensgefahr. Sophie hatte die Notärzte zum Tatort begleitet, deshalb kam sie nun später ins »Eisen« als verabredet. Sie und Deckhard machten freitags Sport – Deckhard Karate, Sophie Zumba-Fitness.
Nicht zum ersten Mal fragte sich Deckhard, weshalb er und Sophie nicht zusammen trainierten.
Eigentlich, überlegte er, könnten wir sogar zusammen leben. Ein schöner Gedanke! Aber es würde wahrscheinlich ziemlich schnell kompliziert mit uns beiden. Schwierig. Auf längere Sicht unerfreulich. So wie mit meiner Ex. Da verzichte ich lieber auf die Himbeeren aus dem Eisfach und ertrage meine Prellungen und Stauchungen wie ein Mann. Er verzog das Gesicht. Aber das Single-Dasein ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Wie man’s macht, ist es verkehrt …
»Na, Kollegin.« Er umarmte Sophie und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »K oder K? Krankenhaus oder Kühlraum?«
»Kühlraum«, sagte Sophie. »Der Typ hat’s hinter sich.«
»Apropos Kühlraum … Willst du auch ein Bier?«
»Lieber einen Weißwein.«
»Typisch Frau.«
»Immerhin kein grüner Tee.«
»Stimmt. So wie meine Ex.«
»Die war nett. Aber manchmal ein wenig seltsam.«
»Dein Verflossener auch. Dieses gepiercte Klappergestell.«
»Im Nachhinein finde ich das auch. Vielleicht dachte ich damals, dass gepiercte Männer die idealen Ehemänner sind.«
»Wieso?«
»Sie haben Sinn für Schmuck und sind Schmerzen gewohnt.«
»Sonst nehm Se mich, junge Dame!« Das war Wolle, der Barmann, der Sophie den Weißwein über den Tresen reichte.
Sie lächelte. »Ich denk drüber nach!«
Sie stießen an.
»Der Typ ist also tot?«, fragte Deckhard.
»Toter geht’s nicht!« Sophie nickte.
»War es schade um den Kerl?«
»Einen Hund hatte er nicht«, sagte Sophie, »und ich wüsste nicht, wer sonst um ihn trauern sollte. Der Tod ist für die Hinterbliebenen ja meist schwerer als für die, die ins Gras beißen.«
»Ja, stimmt. Meistens merkt man’s ja nicht, dass man tot ist. Es ist nur schwierig für die anderen, damit klarzukommen.«
»Genauso, wie wenn man dumm ist«, sagte Sophie. »Auch das merkt man meistens nicht. Es ist nur schwierig …«
Deckhard ergänzte lachend: »… für die anderen, damit klarzukommen.«
Eine Zeit lang ließen sie schweigend die Blicke schweifen. Über den Billardtisch, das Dartspiel, die verkrachten Existenzen, die dumpf in ihre Bier- und Schnapsgläser starrten und auf irgendetwas zu warten schienen, was niemals kommen würde. Es hätte gepasst, wäre jetzt Musik von Bruce Springsteen erklungen, die war wie gemacht für Leute, die einsam an der Bar saßen und auf etwas warteten, was niemals kam. Doch es lief nicht Bruce Springsteen, sondern irgendein Waschmittelsong von Helene Fischer.
»Wie war es sonst so? Die Woche?«, fragte Sophie.
Deckhard verzog das Gesicht. »Manchmal weiß ich echt nicht, was der ganze Mist soll.«
»Verbrecher jagen, vor Gericht bringen und zuschauen, wie der Richter sie wieder laufen lässt?« Sophie blickte kurz auf ihr Smartphone und ließ es dann in der Handtasche verschwinden.
»Ja, zum Beispiel. Oder im Auto sitzen und auf einen Penner warten, der nicht kommt. Oder Leute zu vernehmen, von denen man sowieso weiß, dass sie lügen. Typen in den Knast zu bringen, die nach drei Tagen eh wieder draußen sind. Oder betroffen zu tun, wenn man’s nicht ist, weil einen die Sache einen Dreck interessiert. Oder halb totgeprügelte Kinder aus einer Familie rauszuholen, damit das Jugendamt sie sofort wieder in dieselbe Familie zurückschicken kann, um diese Kinder dann irgendwann als tote Kinder aus besagter Familie zu holen.« Er atmete tief aus und trank von seinem Bier. »Und nicht nur das. Erinnerst du dich an Glöckner? Das ist fast auf den Tag ein Jahr her.«
Sophie nickte. Glöckner war ein Kollege, der sich vor einem Jahr erschossen hatte. Keiner wusste genau, warum. Wahrscheinlich war ihm alles zu viel geworden.
»Weißt du noch, was er damals gesagt hat, kurz bevor er an seiner Sig Sauer genuckelt hat?« Glöckner hatte sich mit seiner Dienstwaffe in den Mund geschossen. »Warum die längste Gefängnisstrafe lebenslang heißt?«
»Weil man fast ein Leben lang im Knast ist.«
»Nein. Weil das Leben selbst eine Strafe ist. Ein Leben lang leben zu müssen, ist lebenslang.«
»Das Leben ist aber nicht nur schlecht.«
»Das habe ich ihm auch gesagt.«
»Und? Was hat er geantwortet?«
»Wir leben, leiden und sterben. Wir pflanzen uns fort, führen Kriege, reiben uns auf, sterben und werden für immer vergessen. Und warum das alles? Wir wissen es nicht.«
»Aber es ist ja nicht allen Leuten egal, was wir tun. Wenn wir Menschen helfen …«
»Wenn es keine Menschen gäbe, müssten wir auch keinem helfen.«
»Aber es gibt nun mal Menschen. Und darum kann das, was wir tun, nicht sinnlos sein.«
»Doch! Und da muss ich Glöckner recht geben, auch wenn ich mir niemals mit meiner Dienstwaffe den Kopf wegschießen würde. Was ist ein einziger Mensch im Vergleich zu sieben Milliarden? Was ist die Erde im Vergleich zur Milchstraße? Was ist die Milchstraße im Vergleich zum Universum? Winzig klein und völlig sinnlos.« Deckhard trank von seinem Bier. »Das ist Charles Darwin damals auch klar geworden. Als er erkannte, dass die Evolution nur Zufall sein konnte und nicht Gottes Wille, ist er schwer depressiv geworden.«
»Wenn ich manche Typen sehe, die wir festnehmen, ist bei der Evolution des Menschen irgendwas mächtig schiefgelaufen.«
»Hey, ich meine es ernst. Gott hat bei der Evolution keinen Plan gehabt.«
»Oder es gibt keinen Gott.«
»Würde ich nicht sagen.«
»Ja oder nein?«
»Vielleicht gibt es einen Gott.« Deckhard blickte nach draußen und blinzelte, als würde die Sonne scheinen. »Ich habe in letzter Zeit öfters darüber nachgedacht.«
»Und?«
»Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es ihn gibt. Die Welt ist derart auffällig von einer perversen Intelligenz konstruiert, dass ihre Erschaffung kein Zufall sein kann. Gott hat sich gelangweilt. Er wollte Gesellschaft. Action. Er erschuf die Schöpfung. Und seitdem schaut er sich die Realität an, das Leiden der Menschen. So, wie sich irgendwelche Teenager einen Horrorfilm angucken.«
»Oder manche Wähler die Politik ihrer Regierungen.«
»Kann sein.« Er trank wieder von seinem Bier. »Die ganze Welt ist für Gott ein riesiger Gewaltfilm. Ein überdimensionaler Snuff-Movie.«
»Sag mal, hast du einen VHS-Kurs in Theologie gemacht? Gut, dass du nicht Priester geworden bist.«
»Hatte ich mal vor. Bis die Sünde ihr hässliches Haupt erhob.«
»Die Sünde?«
»Ja. In Gestalt des Weibes.«
»Verstehe. Und dann?«
»Hatte ich auf einmal keine Lust mehr, Priester zu werden, sondern Lust auf ganz andere, eher fleischliche Dinge.«
»Auf was genau?«
Er grinste. »Hast du ein paar Stunden Zeit?«
Sie grinste zurück. »Oh, bitte, nicht schon wieder die ganze Nacht fernsehen.«
Deckhard seufzte. »Touché.« Er gab dem Barmann ein Zeichen. »Noch so eins.«
Er schaute Sophie wieder an. »Jedenfalls, mit den Frauen hat es bei mir nicht so richtig geklappt, wie du weißt. Deshalb bin ich einsam und allein. Tja, die Welt ist schlecht …« Er trank sein Glas leer und stellte es auf den Tresen.
»Und was lernen wir aus deiner Predigt?« Sophie lächelte ihn an. »Die Welt ist schlecht. Deshalb …?«
»Deshalb bin ich Bulle geworden. Jeder versucht mit seinem Job, das Defizit wettzumachen, das er um sich herum wahrnimmt. Sogar an sich selbst.«
»Zum Beispiel das Fehlen des Gehirns als Voraussetzung für eine politische Karriere.«
Deckhard lachte. »Ja. Die sollten keine Reden halten, sondern die Klappe.«
»Wow«, sagte Sophie, »jetzt auch noch coole Aphorismen.«
»Ja, verarsch mich nur.« Deckhard nahm das frische Bier entgegen. »Die Welt ist schlecht. Und genau diese Einsicht hat den armen Glöckner aus dieser kalten, polizistenfeindlichen Welt geradewegs ins Grab befördert. Es gab ja keinen, der ihm die Arbeit abgenommen hat. Sogar diesen letzten Dienst musste er sich selbst erweisen.« Er wies nach draußen. »Da hatte es der Kerl, der jetzt im Kühlraum schlummert, viel besser. Bei dem haben seine Freunde den Job erledigt.«
»Na, auf diesen Freundschaftsdienst kann ich verzichten.« Sophie verzog das Gesicht. »Ich glaube nicht, dass ich mit dem tauschen will.«
»Wie auch immer. Das Leben hat keinen Sinn, aber darüber nachzudenken, noch viel weniger.«
»Wenn die Telefonseelsorge mal neue Mitarbeiter sucht«, sagte Sophie, »würde ich dich glatt empfehlen.«
Deckhard nahm seine Schachtel Lucky Strikes ohne Filter und zündete sich eine Zigarette an. Hier durfte man rauchen, obwohl es offiziell verboten war. Aber das war wahrscheinlich das West-Berliner Flair, das hier im »Eisen« nicht fehlen durfte.
Er zog an der Zigarette, bevor er weitersprach. »Hängen sich die meisten Rechtsmediziner nicht auf, wenn sie am Leben verzweifeln, oder wie war das? Müsstest du doch wissen. Du bist ja eine von denen.«
»Ja«, sagte Sophie. »Wir wissen eben, wie es geht. Die Halsschlagadern abschnüren. Das Gehirn bekommt keinen Sauerstoff mehr. Trotzdem verfällt man nicht in Panik, weil noch Kohlendioxid abgeatmet werden kann. Du kannst aber auch Beruhigungsmittel nehmen. Und dann eine Tüte über den Kopf. Der Sauerstoff, den man einatmet, enthält immer mehr Kohlendioxid, und schließlich schläft man ein. Und dann – tschüssi.«
»Was du so alles weißt. Was ist mit Ertrinken?« Deckhard blies Rauch aus und rieb seine Knöchel an dem kalten Bierglas. »Das machen doch immer die Künstlertypen.«
»Künstlertypen?«, sagte Sophie. »Weiß ich nicht. Aber wer diese Methode wählt, hat keine Ahnung, wie man richtig lebt, und noch weniger, wie man richtig stirbt. Ertränken sollte man sich nicht. Viel zu schmerzhaft. Zu viel Panik. Erschießen ist übrigens auch nicht zu empfehlen. Wenn man sich nicht richtig in den Kopf schießt, wacht man als querschnittsgelähmter Sabberlappen auf.« Kaum hatte sie ausgesprochen, blickte sie Deckhard betroffen an. »Oh, tut mir leid. Das hätte ich nicht sagen dürfen.«
»Schon gut, hast ja leider recht.«
»Jedenfalls wacht man dann querschnittsgelähmt auf und ist noch unglücklicher als zuvor. Obendrein kann man sich dann nicht mehr umbringen. Nein, das ist kein Exit. Das ist dann wirklich lebenslang.« Sie trank von ihrem Weißwein. »Aber über was für Dinge reden wir hier eigentlich? Es ist Wochenende.«
Wieder piepte Deckhards Handy. Es hatte die Eigenart moderner Smartphones, zweimal zu piepen, sobald eine SMS kam und der Besitzer sie nicht schnell genug geöffnet hatte.
»Ich darf mal eben?«, fragte Deckhard. Er wusste, wer die SMS geschickt hatte.
Du wachst als querschnittsgelähmter Sabberlappen auf …
»Ja, klar«, sagte Sophie.
Deckhard drückte die Zigarette aus. Klickte auf die SMS. Zeigte sie Sophie.
»Ich denke noch immer an den Pazifik«, las Sophie den Text laut.
»Tja, irgendwann werde ich mit ihm dorthin fahren müssen.« Deckhard tippte eine kurze Antwort und steckte das Handy ein. »Du weißt ja, was er mit dem Pazifik meint.«
»Ja.«
»Die Frage ist«, Deckhard kippte sein Bierglas hin und her, »ob er es jemals schafft.«
Du wachst als querschnittsgelähmter Sabberlappen auf … Oder du bist schon einer. Und wenn kein Sabberlappen, dann doch querschnittsgelähmt.
»Siehst du ihn bald wieder?«
»Ja. Ich fahre morgen Abend mal wieder hin. Dann ist wenig Verkehr. Nach Hannover sind es ja nur gut zwei Stunden.«
»Und bis dahin?«, fragte Sophie. »Trinken wir noch einen?«
»Aber klar doch.« Deckhard winkte Wolle. »Freitagabend ist im Grunde die einzige Zeit, wo richtig Wochenende ist. Der Samstag ist eigentlich fast schon wieder Sonntag, und der Sonntag fast schon wieder Montag. Und deshalb die totale Verarsche.«
3.
»Also dann«, sagte Fabian und blickte sich um, als könnte jemand ihn belauschen. »Nutzen wir die Viertelstunde für ein paar Tipps im neuen Job. Hast du schon eine Miles & More Karte?«
Christian schüttelte den Kopf.
»Besorg sie dir so schnell wie möglich. Was ist mit den Flügen zum Bootcamp, zum Exotentraining und so weiter? Durftet ihr da Business-Class fliegen?«
»Nein, Economy. Hatten die Trainingsleute für uns gebucht.«
»Dachte ich mir. Wie auch immer. Die Flüge lässt du dir nachträglich auf deine Miles & More Karte schreiben, dann hast du schon mal ein paar Statusmeilen. Hol dir die Goldkarte. Die kostet zwar achtzig Mäuse, aber dann verfallen die Prämienmeilen nicht mehr.«
»Wie viele Meilen brauche ich eigentlich, um Senator zu werden?«, fragte Christian.
Katharina, die irgendwelche Nachrichten in ihren Blackberry hackte, schaute belustigt auf.
»Also, erst mal zur Unterscheidung«, antwortete Fabian lachend. »Um Frequent Traveller, Senator und so weiter zu werden, brauchst du Statusmeilen. Wenn du kostenlos fliegen willst, brauchst du Prämienmeilen.«
»Und die Statusmeilen?«
»Sind meist ein Jahr gültig. Dann heißt es, von vorn anfangen.«
»Und wann bin ich Senator?«
»Erst mal bist du Frequent Traveller. Das sind 35000 Meilen. Das ist schon ganz gut. Du kannst in die Lounge, das ist das Wichtigste. Mit 100000 Meilen im Jahr wirst du Senator. Dann kannst du kurzfristig buchen, hast auch in der Economy-Klasse den Sitz neben dir frei, wenn die Maschine nicht ausgebucht ist, kannst am First-Class-Schalter einchecken und so weiter.«
»Früher brauchte man hierzulande sogar 120000 Meilen«, ergänzte Katharina. »Da ist die Lufthansa jetzt wieder ein bisschen freundlicher geworden.«
»Ja, stimmt«, sagte Fabian. »In Österreich waren es nur 100000 Meilen, sodass sich alle Berater von ECC, die kurz vor der 100000er-Schwelle standen, auf der Lufthansa-Website als Berater im Wiener ECC-Büro angemeldet haben. Schwupps, waren sie Senator. Die Kollegen in Österreich waren ganz schön angepisst, weil sie sämtliche Senator-Karten in die deutschen Büros weiterleiten mussten.«
Verrückte Welt, dachte Christian. Auf dem Papier das Büro wechseln, um schneller Senator zu werden. Manche Leute haben Probleme.
»Und ganz oben ist der HON?«, fragte er.
»Ja, ganz oben stehen die HON Traveller«, erklärte Fabian. »Dafür brauchst du 600000 Meilen in zwei Jahren. Und du musst diese Meilen ausschließlich in der Business oder First Class erfliegen. Dann wirst du aber auch mit der Limousine zur Maschine gefahren, hast vierundzwanzig Stunden vor Abflug Buchungsgarantie und kannst die First-Class-Lounges benutzen.«
»Taugen die denn was?« Katharina blickte von ihrem Blackberry auf.
Fabian nickte. »Ich war mit Lars mal hier in Frankfurt in der First-Class-Lounge. Das macht schon was her. Mit Zigarrenlounge, Gourmetrestaurant, riesiger Whiskysammlung und Badewannen. Manche buchen sich einen Flug in der First Class, gehen in die Lounge und stornieren den Flug dann wieder. Das geht kostenfrei. Manche machen das nur, damit sie mal die Lounge sehen. Sie übt auf diese Leute offenbar eine große Faszination aus. Und die Quietscheentchen in den Badewannen dort sind ein beliebtes Souvenir.«
»Warst du mit Lars auch in der Badewanne?« Katharina lachte auf.
»Nee, ein Quietscheentchen hat mir gereicht.«
Christian fragte: »Dann ist Lars HON Traveller?«
»Ja.« Fabian wusste offenbar nicht recht, ob er Lars dafür beneiden oder bemitleiden sollte. »Dafür lebt der aber auch im Flieger. Der kennt seine Flugbegleiter besser als seine Frau.«
»Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Ehe am Ende ist«, meinte Katharina.
»Yep.« Fabian nickte. »Wenn sie das nicht schon längst ist.« Er blickte Christian an. »Also, verstanden, Grünschnabel? Miles & More Karte beantragen. Am besten auch AirBerlin topbonus, American Airlines Advantage und British Airways. Kann nicht schaden, überall Punkte zu sammeln. Du solltest dich aber auf eine Marke fokussieren, und das ist bei uns die Lufthansa. Und leg dich auch gleich auf eine Hotelmarke fest. Da kannst du nämlich auch Punkte sammeln.«
»Was sammelt ihr denn?«
»Starwood«, sagte Fabian. »Es gibt bessere Programme, aber Starwood hat global die größte Abdeckung. Wenn wir hier in Frankfurt sind, übernachten wir meist im Airport Sheraton gleich um die Ecke. Oder an der Konstablerwache. Du kannst die Punkte übrigens auch für den Urlaub einsetzen. Die Meilen ebenfalls. Da ist ECC wirklich großzügig. Bei anderen Beraterfirmen musst du die Meilen, die du für die Firma erflogen hast, in irgendeinen Pott werfen. Der reinste Sozialismus.«
Katharina lachte auf. »Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht.«
Der Flug nach Zürich wurde aufgerufen.
»Auf geht’s«, sagte Fabian. »Kommt schnell, ich will meinen Koffer noch irgendwo reinquetschen.«
Kurz darauf schoben sie sich in der Schlange nach vorne und legten ihre Smartphones mit den Online-Tickets auf den Scanner, der piepsend ihre Ankunft quittierte und die Schranke öffnete. Nur Christian hatte ein altmodisches Pappticket dabei, mit dem er sich vorkam wie ein Zeitreisender aus dem 19. Jahrhundert.
»Wieso checkt ihr die Koffer nicht ein, anstatt sie immer mit euch herumzurollen?«, fragte er mit Blick auf Fabians Trolley.
»Ja, ich hab vorhin schon gesehen, dass du dein Gepäck eingecheckt hast«, sagte Fabian. »Aber Vorsicht.«
Christian musterte ihn verwirrt. »Wieso Vorsicht?«
»Es gibt eine goldene Regel des Reisens als Berater. Niemals etwas einchecken. Was du eincheckst, kannst du so gut wie abhaken. Wenn man mit viel Gepäck unterwegs ist, das man nicht so einfach in die Kabine bekommt, lässt man es sich per UPS, FedEX oder wem auch immer ins Hotel schicken. Das ist zuverlässiger und billiger. Die Airlines wollen mehr Geld, um dann als Gegenleistung deine Sachen zu verschludern.«
»Willst du damit sagen, mein Koffer ist weg?«
»Wir werden sehen.«
Bevor sie in die Maschine stiegen, nahm Christian sich am Zeitungsstand vor dem Eingang die Neue Zürcher Zeitung und die FAZ mit.
Sie ließen sich auf die Sitze in der Business-Class fallen, die durch einen Vorhang vom Rest des Passagierraums abgetrennt war. Ansonsten war es hier genau wie in der Economy, nur dass der Platz in der Mitte immer frei war.
Fabians Handy klingelte. »Hallo, Lars … Was denn, schon wieder? Okay, ich sag’s Christian … Ja, der ist hier neben mir. Machen wir.«
Christian spürte einen Kloß im Hals, als sein Name fiel. Da drehte Fabian sich auch schon zu ihm herum. »Du musst leider schon ein bisschen eher ran. Jonathan hat wieder Mist gebaut. Die Zahlen stimmen wieder nicht.« Er klappte seinen Rechner auf. »Ich schicke dir den letzten Stand des Excels.«
»Okay.« Christian faltete seine Zeitung auseinander.
Fabian blickte ihn verwirrt an. »Was heißt hier okay? Falte die Zeitung zusammen und klapp deinen Rechner auf, Junge. Ich meinte damit, dass du dir das Excel jetzt schon anschaust, während des Fluges, damit du in Zürich gleich loslegen kannst.«
»Haben wir da nicht ein Kundenmeeting bis abends?«
»Ja. Deshalb ist es ja so eilig. So, Mail ist raus. Ich schlage vor, du gehst langsam online. Wenn du dir das Excel während des Fluges anschauen willst, solltest du es schnellstens runterladen. Wenn wir in der Luft sind, gibt es nämlich kein Internet mehr für uns. Und Lars erwartet, dass du zu dem Thema im Kundenmeeting schon sattelfest bist.«
Sattelfest? Christian erstarrte. Bei nur vierzig Minuten Flugzeit?
Er seufzte laut, klappte sein Laptop auf, ging online und rief seine E-Mails ab, auch die kommentarlos abgeschickte Mail von Fabian mit dem Excel Sheet.
Er seufzte noch tiefer, als sich das Excel-Dokument aufbaute und bald den gesamten Bildschirm ausfüllte. Wehmütig blickte er auf die FAZ und die NZZ, die neben ihm auf dem Sitz lagen und die er während des Fluges lesen wollte – mit der Betonung auf wollte.
4.
Sie saßen im Taxi vom Flughafen ins Zürcher Büro, als schon wieder Fabians Handy klingelte. Fabian fand seinen Bluetooth-Ohrhörer nicht, deshalb stellte er das Handy auf laut, um gleichzeitig mit beiden Händen in den Computer tippen zu können, den er auf dem Rücksitz des Taxis auf den Knien balancierte. Christian saß neben ihm, Katharina vorne.
»Na, alles im Lot?«, fragte eine tiefe Stimme am anderen Ende. »Ich schaffe es doch noch bis zum Meeting, also sehen wir uns nachher. Siebzehn Uhr, richtig?«
»Ja, richtig«, sagte Fabian. Seiner Miene war nicht zu entnehmen, ob er sich darüber freute oder sich davor fürchtete.
»Carl Hagen« stand im Display. Genauer gesagt, Dr. Carl Hagen, Seniorpartner von ECC und früherer Leiter der Praxisgruppe Financial Services, der die BWG Bank vor fünfzehn Jahren übernommen und die Beratung immer weiter ausgebaut hatte, bis ECC sozusagen der »Hausberater« der Bank geworden war, an dem die Konkurrenz nicht mehr vorbeikam. Mittlerweile war die BWG von einem »Kunden unter ferner liefen« zu einem »Tripple A Plus Client« geworden, wie man intern bei ECC sagte. Einem Kunden also, den es unbedingt zu halten galt. Carl Hagen war stets das Bindeglied zu diesem Kunden gewesen. Auch deshalb, weil er neben seinem Fachwissen über die Finanzbranche ein gutes Gespür für Marktentwicklungen hatte. Doch das alte Vorstandsmitglied, dem Hagen seine Projekte verdankte und dem er in den guten alten Zeiten das eine oder andere Projekt auf dem Golfplatz verkauft hatte, war heute nur noch Vorsitzender des Aufsichtsrats und hatte nicht mehr viel zu melden. Und der neue Vorstandschef der BWG in Deutschland, Klaus Röpke, machte immer wieder deutlich, dass seine Bank »nicht mit ECC verheiratet« sei, stattdessen müsse ECC sich jeden Auftrag hart verdienen. Dem globalen Chef der Bank, Jack Andrews in London, war es ohnehin egal, wer beriet. Hauptsache, es wurde geliefert.
»Ich habe Lars gerade nicht erreicht«, sagte Hagen. »Wahrscheinlich sitzt er ebenfalls im Flieger. Aber ich muss natürlich zusehen, dass mein Baby weiterhin in guten Händen ist.« Es sollte lässig klingen, aber für Christian hörte es sich nicht so an. »Schickt ihr mir noch die Präsentation?«
»Der letzte Stand ist vorhin an deine Assistentin rausgegangen, die druckt es dir aus«, sagte Fabian, als sie sich bereits der Stadt näherten und die Alpengipfel in der Ferne im Wintersonnenlicht funkelten.
»Okay. Danke.« Hagen beendete das Gespräch.
»Mist, verdammt«, fluchte Fabian. »Hagen kommt auch zum Meeting.«
Katharina verzog das Gesicht. Sie wusste nur zu gut, was das bedeutete: Hagen musste vorher noch »auf Flughöhe« gebracht werden, damit er wusste, was er im Kundenmeeting sagen sollte. Denn in den Niederungen der Projektarbeit steckte so ein Mann natürlich nicht.
»Hoffe, ihr habt ein bisschen vorgeschlafen die letzten Nächte.« Fabian klappte seinen Laptop zu und bezahlte den Fahrer, nachdem das Taxi vor dem ECC-Büro Zürich gehalten hatte. »Könnte eine lange, ungemütliche Nacht werden.«
5.
Samstag.
Frank Deckhard war gerade in Hannover angekommen. Sein Vater hatte ihn begrüßt. Später würden sie gemeinsam zu Abend essen, zuerst aber wollte Frank seinen jüngeren Bruder Lukas sehen.
In Lukas’ Zimmer beugte er sich zu ihm hinunter und umarmte ihn. »Na, Bruderherz. Was hast du so alles Rebellisches gemacht in der Zwischenzeit?«
Lukas schaute mürrisch an seinem Rollstuhl hinunter. »Was soll ich schon Rebellisches gemacht haben? Vielleicht einen Coffee to go im Sitzen trinken? Hahaha. Und einen guten Grund, die Bude zu verlassen, sehe ich heute auch nicht.«
Deckhard nickte bloß und schaute aus dem Fenster auf das milchig gelbe Licht der Straßenlaternen in Laatzen bei Hannover. Einer dieser Orte, wo immer Sonntagnachmittag 16 Uhr ist. Die Dunkelheit hatte sich an diesem diesigen, trüben, deprimierenden Wintertag schon früh herabgesenkt.
Diesig, dachte Deckhard. Trüb. Deprimierend. Wenn diese Worte für einen Ort der Welt erfunden worden sind, dann für diesen Vorort von Hannover.
Bräsige Langeweile, die tristen Gebäude nichts als Stein gewordene Eintönigkeit, die grauen Straßen so trostlos und verlassen, dass es Deckhard nicht gewundert hätte, wäre der Verkauf von Rasierklingen und Schlaftabletten hier illegal gewesen, damit sich nicht zu viele Leute wegen der allgegenwärtigen Tristesse selbst aus dem Leben katapultierten. Er konnte sich denken, was die Einheimischen hinter den grauen Gardinen und den trüben Fenstern dachten: Warum vegetiere ich eigentlich hier in diesem grauen Filz vor mich hin und werde mit jedem Tag schwermütiger?
Aber vielleicht war Deckhard auch der Einzige, der die Welt so schwarz sah. Vor allem sein Bruder Lukas, der viel mehr Grund zum Klagen hätte, kam offenbar ganz gut mit dieser Welt zurecht. Besser jedenfalls als er. Zumindest kam es ihm so vor.
Lukas. Früher fanden alle den Namen seines Bruders uncool. Doch spätestens seit Star Wars war er der Held. Denn die Jungs in der Schule, die ein bisschen helle waren – und das waren sogar in Laatzen mehr, als der junge Frank Deckhard anfangs gedacht hatte –, diese Jungs wussten, dass Luke Skywalker genau genommen Lukas hieß. Und dann noch der Regisseur: George Lucas! Eine wahre Lukas-Invasion. Man könnte sagen, durch Star Wars hatte Lukas ein Image-Upgrade erlebt.
Ungefähr zwei Jahre lang.
Bis zu dem Tag, als Lukas Deckhard den verhängnisvollen Kopfsprung machte.
»Was war denn bei dir so los?«, fragte Lukas nun.
»Ach, der übliche Mist. Wobei es diese Woche schon extrem heftig war.«
»Was denn?«
»Willst du wirklich, dass ich es dir erzähle?«
»Kannst ja mal anfangen«, sagte Lukas. »Wenn es zu schlimm wird, melde ich mich. Aber ein bisschen was kann ich ab.«
Er zeigte auf die Regale mit den DVDs an den Wänden. An einer etwas versteckten Ecke befanden sich die harten Fälle des Horrorgenres: Texas Chainsaw Massacre, alte und neue Version, SAW, sämtliche Teile, Hostel eins, zwei und drei.
»Ich hab die alle gesehen«, fuhr Lukas fort, »aber mir geht dieser Splatterkram immer mehr auf den Geist. Ich glaube, ich bin einer, der die Klassiker liebt, so was wie Spiel mir das Lied vom Tod. Die Sache mit dem Pazifik, weißt du?«
»Na klar«, sagte Deckhard. »Willst du dir die Szene noch mal angucken? Mit dem Eisenbahnbaron, der das Meer sehen will?« So wie du, fügte er in Gedanken hinzu.
»Nein, verdammt.« Lukas stemmte sich in seinem Rollstuhl hoch. »Ich will lieber wissen, was bei dir so heftig war diese Woche.«
Deckhard erzählte ihm die Geschichte von dem Zuhälter, den seine Mörder tot auf die Straße gelegt hatten und der dann ein paar Kilometer von einem Auto mitgeschleift worden war.
Lukas verzog das Gesicht. »Oh Mann«, sagte er. »Wie sah der denn aus?«
»Als käme er geradewegs aus der Hölle.« Deckhard erschauderte, als er daran dachte. »An Teilen des Körpers, im Gesicht, an Knien und Fußspitzen fehlte die Haut, sodass die blanken Knochen zu sehen waren. Was von Lederjacke und Jeans noch übrig war, hing in Fetzen.«
»Wusstet ihr denn sofort, was los war?«
»Nein.« Deckhard schüttelte den Kopf. »Ich habe selten einen Toten gesehen, der so viele, so schwere und so unterschiedliche Verletzungen auf einmal aufwies. Der arme Kerl. Dass es ein Mann war, haben wir an den Kleidungsresten und den noch vorhandenen Genitalien erkannt. Sophie, meine Kollegin, hat das ganz richtig zusammengefasst. Auf den ersten Blick, sagte sie, hätte man meinen können, jemand hätte den Typen mit einer Trennscheibe, einer Kreissäge und einem Hobel bearbeitet und ihn gleichzeitig in Brand gesetzt.« Deckhard machte eine kurze Pause.
»Und weiter?«, fragte sein Bruder.
»Besonders schlimm sahen Gesicht und Hals aus. Wo Kehlkopf und Wangen gewesen sind, waren nur noch zwei schwarze Löcher. Rachen, Speiseröhre, Luftröhre, alles offen. Unterkiefer war fast wegradiert. Sogar die Zähne waren an einigen Stellen bis auf die Zahnwurzeln abgeschliffen.« Deckhard schluckte. »Ein grauenhaftes Gemisch aus Fleisch, Knochen und Asphalt.«
Lukas verzog das Gesicht. »Ich glaube, ich habe genug gehört. Aber wieso war der Mann verbrannt?«
»Reibung erzeugt Wärme. Erst recht bei mehr als hundert Sachen auf der Autobahn.«
»Weshalb hat der Fahrer nichts gemerkt? Das fällt doch auf, wenn man einen Toten kilometerweit mitschleift.«
»Diesem Fahrer offenbar nicht.«
»Vielleicht war er betrunken oder zugedröhnt.«
»Vielleicht.«
»Habt ihr ihn erwischt?«
»Nein. Ich fürchte, der ist weg. Es sei denn, irgendeine Werkstatt oder Waschanlage meldet uns einen auffällig schmutzigen und blutigen Wagen, denn einiges wird schon haften geblieben sein.« Er schauderte, als er über die tiefere Bedeutung des Wortpaares »haften geblieben« nachdachte.
Lukas starrte eine Zeit lang vor sich hin. Man hätte beinahe »andächtig« sagen können.
»Und ihr wusstet gleich, dass der Typ vorher schon tot war?«, fragte er dann.
»Hätte ein Auto die Schädelverletzungen verursacht, wäre Blut von der Fraktur eine Etage tiefer in den Nasen-Rachenraum gelaufen. Wenn das Opfer noch atmet, geht das von selbst in die Luftröhre. Wir hätten dann Blut in den Lungen finden müssen. Haben wir aber nicht. Aber das kann Sophie dir viel besser erklären.«
»Die ist ja nie hier.«
»Stimmt auch wieder.«
»Läuft da eigentlich was zwischen euch?«, fragte Lukas.
»Nee.«
»Ist doch komisch.«
»Wieso?«
Lukas ruckte ein wenig verlegen in seinem Rollstuhl hin und her. »Na ja, ich finde, sie ist die einzige Frau, die zu dir passen würde.«
»Danke. Ich nehme an, das war kein Kompliment.«
»War eher nett gemeint, du kennst mich doch.« Lukas lächelte.
»Jedenfalls«, sagte Deckhard und lehnte sich zurück, »haben wir kein eingeatmetes Blut gefunden. Der Mann war bereits tot, als das Auto ihn überfahren hat.«
»Wie ist er gestorben?«
»Wurde mit einem Totschläger erschlagen.«
»Besser als der Tod durch Mitschleifen.«
Deckhard nickte. »Da hast du recht.«
»Ist dann ja eigentlich ganz gut gelaufen für den Typen«, stellte Lukas lapidar fest. »Stell dir vor, der hätte noch gelebt, als das Auto kam.«
»Stimmt. So hab ich das noch gar nicht gesehen. Wir sollten den Kerlen, die ihn erschlagen haben, einen Orden verleihen. Vielleicht gibt’s für so was sogar den Bambi.«
6.
Das Kundenmeeting hatte bis 18 Uhr gedauert, das Abendessen, bei dem Carl Hagen natürlich auch dabei war, bis 23 Uhr. Hagen hatte dem Kunden ein paar Geschichten über ECC erzählt, die auch Christian noch nicht gehört hatte. Dass ECC von William Sommerset 1960 in New York gegründet worden war, wusste jeder. Und dass ECC, anders als die meisten Beratungen, nicht den Namen des Gründers trug, weil Sommerset wollte, dass die Partner vorne stehen und nicht der Gründer, war ebenfalls bekannt. Doch dass der Co-Gründer von ECC, Thomas McMullan, fünf Jahre später MRT gründete, McMullan, Reynold & Thomson, der schließlich zum schärfsten Konkurrenten von ECC aufstieg, war selbst in der Wirtschaftswelt nicht allen geläufig.
Um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, gab es bei ECC einen Seniorpartner, der ebenfalls Thomas McMullan hieß, kurz Tom, ein Mann, der sich für die Firma sehr verdient gemacht hatte. Vor einigen Jahrzehnten hatte er die asiatischen ECC-Büros in Peking, Shanghai, Seoul, Tokyo und Singapur eröffnet. Um die beiden McMullans zu unterscheiden, sprach man im inneren Führungskreis der ECC immer vom »guten Tom« und vom »bösen Tom« – good Tom and evil Tom.
Nach dem Abendessen saß Christian zu nächtlicher Stunde im ECC-Büro in Zürich vor seinem Rechner und versuchte, sich trotz seiner Müdigkeit in das Excel Sheet einzuarbeiten. Er hatte mit Jonathan telefoniert, der ihm vom Frankfurter Büro aus ein paar Tipps gegeben hatte. Aber viel schlauer schien er mit dem Excel auch nicht zu sein. Was daran liegen konnte, dass Jonathan es ebenfalls von einem Vorgänger übernommen hatte. Offenbar wurde die Excel-Tabelle wie eine heiße Kartoffel von Berater zu Berater weitergereicht.
Vor der Tür des Büros standen Carl Hagen und Fabian und unterhielten sich. Christian hörte mit einem Ohr zu.
»Ich versteh nicht, wo das Problem liegt«, sagte Hagen. »Ihr müsst doch nur mit dem Kunden sprechen und ihm zeigen, was wir anders machen.«
»Ist nicht mehr so einfach«, sagte Fabian. »Die Zeiten haben sich geändert. Du weißt doch, der Einkauf hat mittlerweile überall den Daumen drauf. Selbst ein Premiumprodukt wie Beratung wird mittlerweile von den gleichen Leuten eingekauft, die sonst die Bleistifte, das Klopapier und die Kekse für die Konferenzräume bestellen. Einfach mit dem Kunden Golfen gehen wie früher geht nicht mehr. Frag Lars.«
»Weiß ich, weiß ich. Aber trotzdem. Der Bank geht es schlecht. Die müssen handeln!«
»Ja«, sagte Fabian. »Kann aber sein, dass die sich arm rechnen. Das machen die Kunden ja sowieso gern. Umso mehr, wenn es ihnen wirtschaftlich mies geht. Früher wurde man als große Strategieberatung mit echtem Interesse vom Vorstand empfangen, heute ist das Ganze eher wie ein Casting, bei dem die Berater als Bittsteller auftreten, als würden sie an der Tür Knöpfe verkaufen.«
»Stimmt schon. Was bei uns früher die Abschlusspräsentationen waren, sind heute die Proposals, die man braucht, um überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen.« Hagen zog den aktuellen Spiegel aus der Tasche seines Sakkos. »Haste gesehen, was hier über die BWG steht? Hier in der Schweiz hat das offenbar noch nicht jeder gelesen, und ich wollte es dem Kunden vorhin nicht unter die Nase reiben, aber …«
Hagen und Fabian verschwanden von der Tür, sodass Christian die Gesprächsfetzen nicht mehr hören konnte. Er klickte sofort auf Spiegel Online. Dort fand sich ein kurzer Artikel über die BWG, der auf den längeren Artikel im Spiegel verwies. Der Bank schien es in der Tat nicht so gut zu gehen. Vor ein paar Jahren noch vor Kraft strotzend, war die BWG offenbar in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Die Finanzkrise hatte das Kreditportfolio mit Milliardenabschreibungen belastet, ein Teil des US-Geschäfts musste 2010 viel zu günstig verkauft werden, und der Versicherungsarm der Bank hatte sich mit griechischen Staatsanleihen verspekuliert und wurde seitdem von der Aufsicht kritisch beäugt. Und das Filialgeschäft, einst die Visitenkarte der Bank in Deutschland, verödete. »Denen laufen die Kunden weg, das Wasser steht ihnen bis zum Hals«, zitierte der Autor Frankfurter Bankenkreise.
Der neue Strategieschwenk, den der Vorstand auf der nächsten Hauptversammlung verkünden wollte, wurde von Beobachtern als letzte Chance betrachtet, die Bank vor der drohenden Abwicklung zu retten. Und wer war zuständig für den Strategieschwenk? ECC. Und Christian. Manchmal konnte Verantwortung richtig wehtun.
7.
»Lass uns noch mal die Szene von damals anschauen«, sagte Lukas und schaltete den DVD-Player ein.
Es war sein Lieblingsfilm, Sergio Leones Spiel mir das Lied vom Tod. Als Kinder hatten sie den Film heimlich geschaut und die Filmfiguren nachgespielt. Deckhard war Cheyenne, der Gangsterboss, der aber irgendwie auch einer der Guten war. Lukas war »Mundharmonika«, die Rolle, die Charles Bronson berühmt gemacht hatte. Lukas hatte damals sogar eine Mundharmonika gehabt und oft darauf gespielt. Bis der Unfall geschah. Seitdem spielte er nicht mehr.
Er spulte zur Eingangsszene, in der Charles Bronson alias Mundharmonika an einem Bahnhof auf drei Gangster in Staubmänteln trifft und sie erschießt.
»Ich hab schon mal drei von diesen Mänteln gesehen«, sagt Mundharmonika in einer anderen Szene des Films über die Schießerei. »In den Mänteln waren drei Männer, und in den Männern drei Kugeln.«
Lukas lachte in sich hinein. Über diese Sprüche konnte er sich nach Jahren noch amüsieren.
Deckhard war froh, dass es für seinen Bruder überhaupt etwas zu lachen gab.
Die Tür ging auf, und ihr Vater kam ins Zimmer.
»Ich habe euch was zu essen gemacht. Kommt ihr?«
Deckhard stand auf und schob seinen Bruder im Rollstuhl durch die Tür. »Aber klar. Gibt es auch Kaffee?«
Sein Vater schaute ihn verdutzt an. »Ja, sicher, ihr könnt Kaffee haben.«
»Du machst bestimmt ’nen guten Kaffee«, sagte Deckhard.
Lukas kicherte, denn genau diesen Satz sagte auch Claudia Cardinale in Spiel mir das Lied vom Tod, als Cheyenne und seine Bande Kaffee von ihr wollten. »Erst wollt ihr Kaffee, und dann werdet ihr alle über mich herfallen. Aber das wird mir nichts ausmachen. Ich werde danach ein heißes Bad nehmen, und alles wird sein wie immer. Schlechte Erfahrungen können einen im Leben nur weiterbringen.« Worauf Cheyenne erwiderte: »Du machst bestimmt ’nen guten Kaffee.«
Deckhard schob seinen Bruder in die Küche.
Schlechte Erfahrungen können einen im Leben nur weiterbringen.