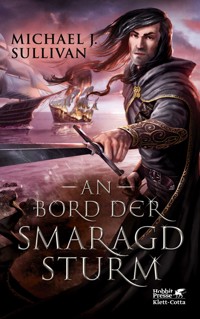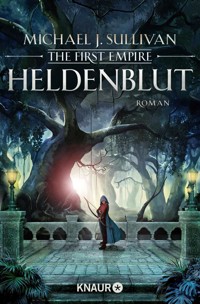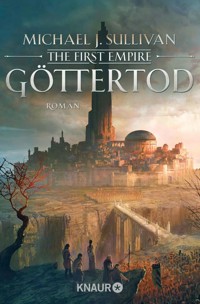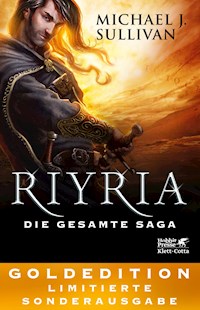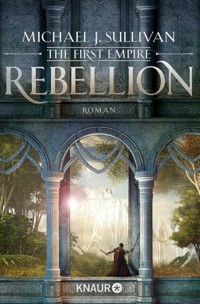8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Riyria
- Sprache: Deutsch
In einem Turm – ein uraltes Geheimnis. Das Problem – ein Ungeheuer. Die Rettung – zwei Diebe. Hadrian und Royce möchten eigentlich nur ein paar Bauern in einer armen Gegend helfen. Und auf einmal sind sie in die undurchsichtigen Pläne des Zauberers Esrahaddon verwickelt. Das mittellose Mädchen Thrace bittet Royce und Hadrian, ihr abgelegenes Dorf vor den nächtlichen Angriffen eines unbekannten Ungeheuers zu schützen. Dabei stoßen die beiden allerdings auf viel größere Schwierigkeiten als gedacht: Die Kreatur scheint unbesiegbar. Einer alten Prophezeiung nach kann nur das Geheimnis im alten Elben-Turm von Avempartha den mit allen Wassern gewaschenen Dieben weiterhelfen. Warum tauchen aber plötzlich Vertreter des Adels und der Kirche von Nyphron in der gottverlassenen Gegend auf? Und welche Ziele verfolgt Esrahaddon der Zauberer?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Michael J. Sullivan
DERTURMVONAVEMPARTHA
RIYRIA 2
Aus dem Englischen vonWolfram Ströle
Impressum
Hobbit Presse Paperback
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Theft of Swords/Avempartha« im Verlag Orbit, Hachette Book Group, New York
© 2011 by Michael J. Sullivan
© Karten by Michael J. Sullivan
Für die deutsche Ausgabe
© 2014, 2019 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: © Birgit Gitschier, Augsburg
Illustration: © Federico Musetti
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96450-9
E-Book: ISBN 978-3-608-10733-3
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
1Colnora
2Thrace
3Die Botschafterin
4Dahlgren
5Die Festung
6Das Turnier
7Von Elben und Menschen
8Sagen und Legenden
9Nächtliche Experimente
10Verlorene Schwerter
11Der Gilarabrywn
12Rauch und Asche
13Magische Vision
14Nacht
15Die Erbin Novrons
Karten der Welt Elan
1
Colnora
Als der Mann aus dem Schatten trat, wusste Wyatt Deminthal, dass dies der schlimmste und womöglich letzte Tag seines Lebens sein würde. In grobe Wolle und derbes Leder gekleidet, kam der Mann ihm auf Anhieb bekannt vor, ein Gesicht, das er vor über zwei Jahren einmal kurz bei Kerzenlicht gesehen hatte. Damals hatte er gehofft, ihm nie wieder zu begegnen. Der Mann trug drei Schwerter, alle gleichermaßen abgenutzt und verschrammt und mit zerschlissenen, vom Schweiß fleckigen Griffen. Er überragte Wyatt um fast einen Zoll und hatte breite Schultern und starke Hände. Auf den Fußballen balancierend blieb er vor Wyatt stehen und starrte ihn unverwandt an, wie eine Katze eine Maus.
»Baron Delano DeWitt von Dagastan?« Es war keine Frage, sondern eine Anklage.
Wyatt schlug das Herz bis zum Hals. Zwar hatte er das Gesicht erkannt, doch hatte der Optimist in ihm, der all die schrecklichen Jahre irgendwie überlebt hatte, weiterhin gehofft, der Mann sei nur hinter seinem Geld her. Die ersten Worte des Mannes machten diese Hoffnung zunichte.
»Tut mir leid, Ihr müsst mich verwechselt haben«, sagte er. Es sollte freundlich klingen, sorglos – unschuldig. Sogar seinen kalischen Akzent unterdrückte er, um seine Rolle noch überzeugender zu spielen.
»Keineswegs«, erwiderte der Mann, trat in die Mitte der Gasse und kam näher. Der Abstand zwischen ihnen schmolz bedrohlich. Der Mann trug die Hände locker vor dem Körper. Es wäre Wyatt lieber gewesen, sie hätten an den Schwertgriffen gelegen. Zwar war er selbst mit einem langen Entermesser bewaffnet, der Mann schien jedoch keine Angst vor ihm zu haben.
»Aber ich heiße nun mal Wyatt Deminthal, deshalb müsst Ihr Euch irren.«
Er hatte den Satz ohne Stottern herausgebracht, Gott sei Dank. Krampfhaft versuchte er sich zu entspannen, ließ die Schultern fallen und verlagerte das Gewicht auf ein Bein. Sogar ein freundliches Lächeln gelang ihm und er sah sich gelangweilt um, als gehe ihn das alles nichts an.
So standen sie einander in der engen, unaufgeräumten Gasse gegenüber, nur wenige Fuß von der Absteige entfernt, in der Wyatt sich eingemietet hatte. Es war Nacht. Unmittelbar hinter Wyatt hing an der Mauer eines Ladens eine Laterne. Ihr flackernder Schein spiegelte sich in den Pfützen, die der Regen auf den Pflastersteinen hinterlassen hatte. Hinter sich hörte er gedämpft und blechern die Musik des Wirtshauses ZUR GRAUEN MAUS. Von weiter weg kamen Stimmen, Gelächter und wütendes Gebrüll. Auf den Schrei einer unsichtbaren Katze folgte das Scheppern eines Topfes, den jemand hatte fallen lassen. Irgendwo ratterten die Räder einer Kutsche über das nasse Pflaster. Es war spät. Auf den Straßen waren nur noch Betrunkene, Huren und dunkle Gestalten unterwegs, allesamt lichtscheues Gesindel.
Der Mann trat noch einen Schritt näher. Der Blick seiner Augen gefiel Wyatt nicht. Aus ihm sprach eine unversöhnliche Entschlossenheit, aber auch, was Wyatt noch viel mehr beunruhigte, ein Anflug von Bedauern.
»Ihr habt mich und meinen Freund beauftragt, ein Schwert aus Schloss Essendon zu stehlen.«
»Tut mir leid, ich habe wirklich keine Ahnung, wovon Ihr sprecht. Ich weiß nicht einmal, wo dieses Essendon-Dingsbums sein soll. Bestimmt verwechselt Ihr mich mit jemandem. Wahrscheinlich liegt es an meinem Hut.« Wyatt nahm seinen breitkrempigen Filzhut ab und hielt ihn dem Mann hin. »Bitte sehr, ein ganz gewöhnlicher Hut, wie man ihn überall bekommt, zugleich aber ungewöhnlich, weil zur Zeit nur wenige ihn tragen. Ihr habt wahrscheinlich jemanden mit einem ähnlichen Hut gesehen und glaubt jetzt, ich sei der Betreffende. Ein verständlicher Irrtum, den ich Euch auch gewiss nicht übelnehme.«
Er setzte den Hut wieder auf und zog ihn so zurecht, dass er nach vorn etwas tiefer und zur Seite ein wenig schräg auf dem Kopf saß. Zu diesem Hut trug er ein kostbares Wams aus schwarz-rotem Brokat und einen kurzen, glitzernden Umhang. Der fehlende Samtbesatz und die abgewetzten Stiefel verrieten freilich, wie es in Wirklichkeit um ihn stand. Noch verräterischer war der goldene Ring in seinem linken Ohr, eine letzte Erinnerung an das Leben, das er hinter sich gelassen hatte.
»Als wir die Kapelle betraten, lag der König auf dem Boden. Tot.«
»Ich verstehe ja, dass so etwas unangenehm ist«, sagte Wyatt und zupfte an den Fingern seiner vornehmen roten Handschuhe, wie er es immer tat, wenn er nervös war.
»Die Wachen warteten bereits auf uns. Wir wurden in den Kerker geworfen und wären fast hingerichtet worden.«
»Tut mir aufrichtig leid, aber wie gesagt, ich bin nicht DeWitt. Ich habe nie von ihm gehört. Sollte ich ihm je begegnen, richte ich ihm selbstverständlich aus, dass Ihr ihn sucht. Wie war noch gleich der Name?«
»Riyria.«
Die Laterne des Ladens hinter Wyatt erlosch und an seinem Ohr flüsterte eine Stimme: »Das ist Elbisch und bedeutet zwei.«
Sein Puls hämmerte, doch bevor er sich umdrehen konnte, spürte er die scharfe Schneide eines Messers an seinem Hals. Er erstarrte und wagte kaum zu atmen.
»Ihr habt uns getäuscht«, fuhr die Stimme hinter ihm fort. »Ihr habt alles eingefädelt und uns in die Kapelle gelockt, damit man uns als Mörder verhaftet. Erlaubt, dass ich mich dafür revanchiere. Wenn Ihr noch letzte Worte sprechen wollt, dann jetzt, aber bitte leise.«
Wyatt war ein guter Kartenspieler und verstand etwas von Bluffen. Der Mann hinter ihm bluffte nicht. Er wollte ihn nicht einschüchtern, erpressen oder zu etwas zwingen. Er benötigte keine Informationen, denn er wusste schon alles, was er wissen wollte. Der Ton seiner Stimme, seine Worte und der Rhythmus seines Atems an Wyatts Ohr machten nur eines klar – er wollte ihn töten.
»Was ist los, Wyatt?«, rief eine kindliche Stimme.
In einiger Entfernung ging eine Tür auf und ein Lichtkegel fiel auf die Gasse. In ihm stand ein Mädchen. Sein Schatten fiel über das Pflaster und wuchs an der gegenüberliegenden Häuserwand hinauf. Das Mädchen war mager, hatte schulterlange Haare und trug ein Nachthemd, das ihm bis zu den Knöcheln reichte. Darunter waren nackte Füße zu sehen.
»Nichts, Allie – geh wieder rein!«, rief Wyatt. Sein Akzent war auf einmal deutlich zu hören.
»Wer sind die Männer, mit denen du sprichst?« Allie kam einen Schritt näher. Sie trat mit dem Fuß in eine Pfütze und das Wasser kräuselte sich. »Sie sehen wütend aus.«
»Ich will keine Zeugen«, zischte die Stimme hinter Wyatt.
»Tut ihr nichts«, flehte Wyatt. »Sie hat nichts damit zu tun, ich schwöre es.«
»Womit zu tun?«, fragte Allie. »Was wollen die von dir?« Sie kam noch einen Schritt näher.
»Bleib, wo du bist, Allie! Komm nicht näher. Tu bitte, was ich sage.« Das Mädchen blieb stehen. »Ich habe einmal etwas Schlimmes getan, Allie. Du musst das bitte verstehen. Ich habe es für uns getan, für dich, Elden und mich. Weißt du noch, wie ich vor ein paar Wintern einen Auftrag übernommen habe? Wie ich für einige Tage nach Norden verreisen musste? Also damals … da habe ich etwas getan, eine schlimme Sache. Ich habe mich für jemanden ausgegeben, der ich nicht bin, und das hätte einige Leute um ein Haar das Leben gekostet. Damit habe ich das Geld für den Winter verdient. Du darfst mich deshalb nicht verurteilen, Allie. Ich liebe dich, Schatz. Und jetzt geh bitte wieder nach drinnen.«
»Nein!«, rief das Mädchen. »Ich sehe das Messer. Die wollen dir wehtun.«
»Wenn du nicht sofort reingehst, töten sie uns beide!«, brüllte Wyatt. Er hatte nicht laut werden wollen, aber irgendwie musste er Allie doch überzeugen.
Allie begann zu weinen. Mit bebenden Schultern stand sie in dem Lichtkegel, der auf die Gasse fiel.
»Geh rein, Schatz«, wiederholte Wyatt mühsam beherrscht. »Alles wird gut. Du darfst nicht weinen. Elden wird für dich sorgen. Erzähl ihm, was passiert ist. Alles wird gut.«
Das Mädchen schluchzte weiter.
»Bitte, Schatz, du musst jetzt reingehen«, bettelte Wyatt. »Mehr kannst du nicht tun. Tu’s für mich, bitte.«
»Ich … liebe … dich, Pa … pa.«
»Das weiß ich doch, Schatz, das weiß ich doch. Ich liebe dich auch und es tut mir schrecklich leid.«
Allie ging langsam ins Haus zurück. Der Spalt, durch den das Licht fiel, schrumpfte, dann fiel die Tür ins Schloss und draußen wurde es wieder dunkel. Nur der schwache bläuliche Schein des wolkenverhangenen Mondes drang in die enge Gasse, in der die drei Männer standen.
»Wie alt ist das Mädchen?«, fragte die Stimme hinter Wyatt.
»Lasst sie aus dem Spiel. Und jetzt macht wenigstens schnell, bitte!« Schicksalsergeben senkte Wyatt den Kopf. Der Anblick des Kindes hatte ihn gebrochen. Er zitterte am ganzen Leib und hatte die behandschuhten Hände zu Fäusten geballt. Seine Kehle war wie zugeschnürt, er konnte kaum schlucken und bekam keine Luft. Er spürte die stählerne Klinge an seiner Kehle und wartete darauf, dass sie sich bewegte und in seinen Hals schnitt.
»Wusstet Ihr, dass es sich um eine Falle handelte, als Ihr den Auftrag angenommen habt?«, fragte der Mann mit den drei Schwertern.
»Was? Nein!«
»Hättet Ihr ihn angenommen, wenn Ihr es gewusst hättet?«
»Keine Ahnung – wahrscheinlich – doch. Wir brauchten das Geld.«
»Ihr seid also kein Baron?«
»Nein.«
»Was dann?«
»Ich war Kapitän.«
»Wart? Warum nicht mehr?«
»Ihr wolltet mich doch töten. Wozu die ganzen Fragen?«
»Solange Ihr Fragen beantwortet, lebt Ihr noch«, sagte die Stimme hinter ihm, die Stimme des Todes, bar jeden Gefühls. In Wyatt krampfte sich alles zusammen, als blickte er über die Kante eines hohen Felsens in den Abgrund. Das Gesicht des anderen nicht zu sehen und zugleich zu wissen, dass er das Messer in der Hand hielt, das ihn töten würde, war schon fast so schlimm wie eine Hinrichtung. Er dachte an Allie. Sie musste sich jetzt ohne ihn durchschlagen. Da fiel ihm ein – sie würde ihn ja sehen. In aller Deutlichkeit trat das Bild ihm plötzlich vor Augen. Wenn alles vorbei war, würde sie nach draußen stürzen und ihn auf der Straße liegen sehen. Sie würde durch sein Blut waten.
»Warum nicht mehr?«, fragte der Henker wieder, und seine Stimme löschte augenblicklich alle anderen Gedanken aus.
»Ich habe mein Schiff verkauft.«
»Warum?«
»Das tut nichts zur Sache.«
»Spielschulden?«
»Nein.«
»Warum dann?«
»Ist das wichtig? Ihr tötet mich doch sowieso. Tut es einfach!«
Wyatt hatte sich gefasst, war bereit. Er biss die Zähne zusammen und schloss die Augen. Doch sein Henker zögerte weiter.
»Es ist wichtig«, flüsterte er Wyatt ins Ohr, »weil Allie nicht Eure Tochter ist.«
Die Klinge drückte auf einmal nicht mehr an Wyatts Hals.
Zögernd drehte Wyatt sich zu dem Mann mit dem Messer um. Er kannte ihn nicht. Der Mann war kleiner als sein Partner und trug einen schwarzen Mantel mit einer Kapuze, die sein Gesicht weitgehend verbarg – nur das spitze Ende einer Nase, ein prominenter Wangenknochen und das Kinn ragten hervor.
»Wie kommt Ihr darauf?«
»Sie hat uns im Dunkeln gesehen. Sie hat mein Messer an Eurer Kehle gesehen, obwohl wir zwanzig Schritte tief im Schatten standen.«
Wyatt schwieg. Er wagte nicht, sich zu bewegen oder zu sprechen, und wusste nicht, was er denken sollte. Etwas hatte sich verändert. Er glaubte nicht mehr, dass er gleich sterben würde, spürte den Schatten des Todes aber noch über sich. Weil er nicht wusste, was hier gespielt wurde, hatte er schreckliche Angst, einen Fehler zu machen.
»Ihr habt Euer Schiff verkauft, um Allie zu kaufen, richtig?«, sagte der Mann mit der Kapuze. »Aber von wem und warum?«
Wyatt starrte das Gesicht unter der Kapuze an – eine feindselige Maske, eine Wüste, in der jedes Mitleid versickert war. Der Tod war nur einen Atemzug entfernt. Zwischen seinem Tod und seiner Rettung lagen nur einige wenige Worte.
Der andere Mann, der mit den drei Schwertern, streckte die Hand aus und legte sie ihm auf die Schulter. »Von Eurer Antwort hängt viel ab. Aber das wisst Ihr natürlich schon. Ihr überlegt gerade, was Ihr sagen sollt und, vor allem, was wir hören wollen. Aber das bringt nichts. Haltet Euch an die Wahrheit. Dann seid Ihr, wenn die Antwort falsch war, wenigstens nicht wegen einer Lüge gestorben.«
Wyatt nickte, schloss erneut die Augen, holte tief Luft und sagte: »Ich habe Allie von einem gewissen Ambrose gekauft.«
»Ambrose Moor?«, fragte der Henker.
»Ja.«
Wyatt wartete, aber nichts geschah. Er öffnete die Augen. Das Messer war verschwunden, und der Mann mit den drei Schwertern lächelte ihn an. »Ich weiß zwar nicht, was das Mädchen gekostet hat, aber besser hättet Ihr Euer Geld nicht anlegen können.«
»Ihr tötet mich also nicht?«
»Nicht heute«, sagte der Mann mit der Kapuze kalt. »Aber Ihr schuldet uns für den Auftrag von damals noch hundert Taler.«
»Die … habe ich nicht.«
»Dann beschafft sie.«
Die Tür zu Wyatts Bleibe flog mit einem dumpfen Schlag auf, wieder fiel Licht in die Gasse, und Elden stürmte heraus. In den Händen schwang er eine gewaltige Doppelaxt. Grimmig entschlossen näherte er sich.
Der andere Mann zog sofort zwei seiner Schwerter.
»Nicht, Elden!«, brüllte Wyatt. »Sie wollen mich nicht mehr töten! Bleib stehen!«
Elden blieb mit erhobener Axt stehen und sah zwischen den drei Männern hin und her.
»Sie lassen mich gehen«, wiederholte Wyatt. Er drehte sich zu den beiden Männern um. »Stimmt doch, oder?«
Der Kapuzenmann nickte. »Aber Ihr bezahlt Eure Schulden.«
Die Männer entfernten sich. Elden trat zu Wyatt, und Allie kam nach draußen gerannt und flog ihm in die Arme. Anschließend kehrten die drei zu ihrem Quartier zurück und gingen hinein. Elden sah sich ein letztes Mal um, dann zog er die Tür hinter sich zu.
* * *
»Hast du den Hünen gesehen?«, fragte Hadrian Royce und warf einen Blick über die Schulter, als fürchtete er, der besagte Hüne könnte ihnen heimlich folgen. »So einem bin ich noch nie begegnet. Der ist bestimmt über sieben Fuß groß. Was für ein Stiernacken, was für Schultern! Und erst die Axt! Es bräuchte zwei meiner Größe, allein um sie zu heben. Vielleicht ist er gar kein Mensch, sondern ein Riese. Oder ein Troll. Einige Leute schwören nämlich, dass es die gibt. Ich kenne sogar welche, die behaupten, dass sie ihnen persönlich begegnet sind.«
Royce warf seinem Freund einen finsteren Blick zu.
»Gut, das sind meist Betrunkene in irgendwelchen Kneipen, aber deshalb ist es ja nicht ausgeschlossen. Frag Myron, der stimmt mir sicher zu.«
Sie marschierten nach Norden, in Richtung Langdon-Brücke. Alles war still. Die Bewohner des achtbaren Hügelviertels von Colnora schliefen nachts lieber, als durch die Kneipen zu ziehen. Hier wohnten die Millionäre, steinreiche Geschäftsleute mit Häusern, die größer waren als so mancher Palast des Hochadels.
Colnora war ursprünglich eine unbedeutende Haltestation an der Kreuzung der Handelsstraßen von Wesberg und Aquesta gewesen. Ein Bauer namens Hollenbeck und seine Frau hatten die Kaufmannszüge hier mit Wasser versorgt und die Kaufleute im Austausch gegen Nachrichten und Waren in ihrer Scheune beherbergt. Hollenbeck hatte ein Auge für Qualität und suchte sich aus jeder Lieferung das Beste heraus.
Sein einfacher Bauernhof verwandelte sich schnell in eine Herberge, an die er einen Laden und ein Lagerhaus für den Verkauf der erworbenen Güter an Reisende anbaute. Die Händler, denen er die besten Stücke abgenommen hatte, kauften die benachbarten Grundstücke und eröffneten darauf eigene Läden, Schenken und Gasthäuser. Aus dem Bauernhof wurde ein Dorf und dann eine Stadt, aber die durchreisenden Kaufleute stiegen weiterhin am liebsten bei Hollenbeck ab. Der Legende nach war der Grund dafür seine Gemahlin, ein Prachtweib, das nicht nur ausnehmend schön war, sondern auch sang und Mandoline spielte. Außerdem hieß es, sie backe die besten Pfirsich-, Heidelbeer- und Apfelpasteten. Noch Jahrhunderte später, als schon niemand mehr die genaue Lage des Hollenbeck’schen Anwesens kannte und überhaupt nur noch wenige wussten, dass es den Bauern überhaupt gegeben hatte, erinnerte man sich an seine Frau – Colnora.
Im Laufe der Jahre blühte der Ort auf und wurde schließlich zum größten städtischen Zentrum Avryns. In Colnora konnte man in Hunderten von Geschäften und auf genauso vielen Märkten Kleider der neuesten Mode, den teuersten Schmuck und die größte Vielfalt an exotischen Gewürzen kaufen. Außerdem beherbergte die Stadt vortreffliche Handwerker und rühmte sich der besten Wirtshäuser und Schenken des ganzen Landes. Auch Gaukler und Schauspieler hatten dort seit jeher ihre Wirkungsstätte, was wiederum Cosmos DeLur, den reichsten Bürger der Stadt und Patron der Künste, zum Bau des DeLur-Theaters veranlasst hatte.
Auf dem Weg durch das Hügelviertel kamen Royce und Hadrian an ebendiesem Theater vorbei. Abrupt blieben sie vor der großen weißen Anschlagtafel stehen. Darauf waren als Schattenriss zwei Männer abgebildet, die außen am Turm eines Schlosses hinaufkletterten. Darunter stand:
Der Thron von Melengar
Wie ein junger Prinz und zwei Diebe ein ganzes
Königreich retten
Vorstellungen: Jeden Abend
Royce zog die Augenbrauen hoch, Hadrian fuhr mit der Zungenspitze an seinen Schneidezähnen entlang. Stumm wechselten sie einen Blick, dann gingen sie weiter.
Sie verließen das Hügelviertel und näherten sich auf der Brückenstraße dem Fluss. Zeilen von Lagerhäusern säumten die Straße – riesige Speicher, auf denen wie königliche Wappen die Embleme der Handelsgesellschaften prangten. Bei einigen, überwiegend neueren Unternehmen ohne eigene Tradition waren das lediglich die Initialen, andere hatten Wappen wie den Eberkopf der Bocant-Gesellschaft, ein Imperium der Schinken und Schweinshaxen, oder den Diamanten der DeLur-Unternehmensgruppe.
»Du weißt bestimmt genauso gut wie ich, dass er nie in der Lage sein wird, uns die hundert Taler zurückzuzahlen«, sagte Hadrian.
»Er sollte nur nicht zu leicht davonkommen.«
»Oder nicht glauben, dass Royce Melborn beim Anblick eines weinenden Mädchens schwach wird.«
»Das war nicht irgendein Mädchen. Außerdem hat er sie vor Ambrose Moor gerettet. Grund genug, ihn am Leben zu lassen.«
»Aber das verstehe ich nicht. Wie kommt es, dass Ambrose noch lebt?«
»Da habe ich mich wohl ablenken lassen«, sagte Royce. Sein Ton verriet, dass er nicht darüber reden wollte, und Hadrian fragte nicht weiter nach.
Von den drei Hauptbrücken der Stadt war die Langdon-Brücke die prächtigste. Sie war vollständig aus Stein erbaut und wurde in kurzen Abständen von hohen, Schwanenhälsen nachempfundenen Laternen gesäumt, die der Brücke einen festlichen Glanz verliehen, wenn sie brannten. Jetzt war freilich alles dunkel und das Pflaster nass und gefährlich schlüpfrig.
»Wenigstens haben wir nicht umsonst einen Monat lang nach DeWitt gesucht«, bemerkte Hadrian ironisch, als sie die Brücke überquerten. »Ich hätte gedacht …«
Royce blieb stehen und hob ruckartig die Hand. Sie sahen sich um, stellten sich wortlos Rücken an Rücken und zogen ihre Waffen. Alles schien ruhig. Nur das Rauschen des Wassers war zu hören, das schäumend unter ihnen dahinströmte.
»Respekt, Brilli«, sagte eine Stimme, und ein Mann trat hinter einem Laternenpfosten hervor. Sein Gesicht war bleich, sein Körper so dünn und knochig, dass er in der Kniehose und dem weiten Hemd zu versinken drohte. Der Mann sah aus wie eine Leiche, die man versehentlich nicht begraben hatte.
Hinter ihm huschten drei weitere Gestalten über die Brücke, alle ähnlich mager und sehnig und dunkel gekleidet. Sie umkreisten die beiden wie Wölfe.
»Woran habt ihr gemerkt, dass wir hier sind?«, fragte der Dünne.
»Wahrscheinlich an eurem Mundgeruch. Könnte aber auch der Schweiß gewesen sein«, sagte Hadrian. Er grinste, ohne die Männer einen einzigen Moment aus den Augen zu lassen.
»Schnauze, du da«, drohte der Größte der vier.
»Welchem Anlass verdanken wir deinen Besuch, Price?«, fragte Royce.
»Komisch, dasselbe wollte ich dich gerade auch fragen«, gab der Dünne zurück. »Schließlich ist das unsere Stadt, nicht deine – nicht mehr.«
»Schwarzer Diamant?«, fragte Hadrian.
Royce nickte.
»Du bist bestimmt Hadrian Blackwater«, sagte Price. »Ich habe mir dich immer größer vorgestellt.«
»Und du bist ein Schwarzer Diamant. Ich dachte immer, es gäbe mehr von euch als nur vier.«
Price lächelte und erwiderte seinen Blick gerade so lange, dass es wie eine Drohung wirkte. Dann wandte er sich wieder an Royce. »Und was hast du hier zu suchen, Brilli?«
»Wir sind nur auf der Durchreise.«
»Ach wirklich? Keine Geschäfte?«
»Keine, die euch interessieren könnten.«
»Da irrst du dich aber sehr.« Price löste sich von dem Laternenpfosten und ging langsam um sie herum, während er weitersprach. Der Wind, der über den Fluss blies, zerrte an seinem losen Hemd wie an einer gehissten Fahne. »Der Schwarze Diamant interessiert sich für alles, was in Colnora geschieht, besonders wenn du die Finger im Spiel hast, Brilli.«
Hadrian beugte sich vor. »Warum nennt er dich andauernd Brilli?«
»Das war mein Zunftname«, antwortete Royce.
»Der hat zu uns gehört?«, fragte der am jüngsten Aussehende der vier. Er hatte vom Wind fleckig rote Pausbacken und einen schmalen, von einem schütteren Bärtchen umrahmten Mund.
»Stimmt, Ätzer, du kennst Brilli gar nicht. Ätzer ist neu in der Zunft, er kam erst vor, na – sechs Monaten zu uns. Tja, Brilli war nicht nur ein Diamant, sondern ein Offizier, ein Dunkelmann und eins der berühmt-berüchtigtsten Mitglieder in der Geschichte der Zunft.«
»Dunkelmann?«, fragte Hadrian.
»Auftragsmörder«, erklärte Royce.
»Eine Legende«, fuhr Price fort und steuerte sorgfältig um eine Pfütze herum. »Ein Wunderkind, das so schnell aufstieg, dass viele Mitglieder beunruhigt waren.«
»Komisch«, sagte Royce, »ich weiß nur von einem.«
»Tja, wenn der Erste Offizier der Zunft beunruhigt ist, dann sind es die anderen auch. Damals führte ein gewisser Hoyte die Geschäfte für Klunker. Für die meisten von uns war er ein Arschloch – ein guter Dieb und Organisator, aber eben doch ein Arschloch. Brilli hatte bei der Basis viele Anhänger und Hoyte fürchtete, er könnte ihn von der Spitze verdrängen. Deshalb schickte er Brilli auf besonders gefährliche Einsätze – Einsätze, die komischerweise immer schiefgingen. Doch Brilli passierte nie etwas und sein Ruf wuchs stetig. Dann kursierten Gerüchte, wir hätten einen Verräter in der Zunft. Statt sich darum zu kümmern, sah Hoyte seine Chance gekommen.«
Price unterbrach seine Wanderung und blieb vor Royce stehen. »Es gab damals nämlich drei Dunkelmänner in der Zunft und sie waren dicke Freunde. Jade, die einzige Frau darunter, war eine Schönheit, die …«
»Worauf willst du eigentlich hinaus, Price?«, fiel Royce ihm unwirsch ins Wort.
»Ich gebe Ätzer nur einige Hintergrundinformationen, Brilli. Ihr habt doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich meine Jungs ein wenig auf den Stand der Dinge bringe?« Price schob lächelnd die Daumen in den losen Bund seiner Hose und setzte sich wieder in Bewegung. »Wo war ich stehengeblieben? Ach ja, Jade. Es ist da drüben passiert.« Er zeigte in die Richtung, aus der sie gekommen waren. »In dem leeren Speicher mit dem Kleeblatt an der Wand. Dorthin hat Hoyte die beiden gelockt und als vermeintliche Verräter gegeneinander kämpfen lassen. Die Dunkelmänner haben damals wie heute Masken getragen, um nicht erkannt zu werden.« Price machte eine Pause und sah Royce mit geheucheltem Mitgefühl an. »Du wusstest nicht, wer dir gegenüberstand, bis alles vorbei war, stimmt’s, Brilli? Oder wusstest du es und hast Jade trotzdem getötet?«
Royce schwieg, doch seine Augen funkelten gefährlich.
»Der dritte Dunkelmann, Schleifer, war natürlich empört, als er erfuhr, dass Brilli Jade umgebracht hatte, zumal er und Jade ja ein Paar waren. Dass ausgerechnet sein Freund Jade getötet hatte, machte die ganze Sache sehr persönlich. Hoyte ließ Schleifer freie Hand, die Rechnung zu begleichen.
Aber Schleifer wollte Brilli nicht töten. Brilli sollte leiden, Schleifer musste sich deshalb eine raffiniertere, schmerzhaftere Strafe überlegen. Der Mann ist ein strategisches Genie – unser bester Mann für die Planung von Raubüberfällen. Er fädelte ein, dass Brilli von der Stadtwache festgenommen wurde. Für einige Gefälligkeiten und etwas Geld kaufte er Richter und Zeugen des Prozesses und Brilli kam in das Manzant-Gefängnis. Ein Loch, aus dem niemand zurückkehrt, denn daraus zu fliehen, gilt als unmöglich – nur dass Brilli es doch irgendwie geschafft hat. Übrigens wissen wir immer noch nicht, wie.« Price machte eine Pause, um Royce die Gelegenheit zu einer Erklärung zu geben.
Doch Royce schwieg weiter.
Price zuckte die Achseln. »Nach seiner Flucht kehrte er nach Colnora zurück. Zuerst wurde der Richter, der den Prozess geleitet hatte, tot in seinem Bett aufgefunden, dann die falschen Zeugen – alle drei in derselben Nacht – und zuletzt der Anwalt. Wenig später verschwanden nacheinander die Mitglieder des Schwarzen Diamanten. Sie tauchten an den seltsamsten Orten wieder auf: im Fluss, auf dem Marktplatz und sogar auf dem Kirchturmdach.
Über ein Dutzend Mitglieder mussten dran glauben, bis Klunker schließlich einlenkte und Hoyte an Brilli auslieferte. Brilli zwang Hoyte zu einer öffentlichen Beichte, anschließend tötete er ihn. Die Leiche drapierte er im Brunnen auf dem Hügelplatz – ein Kunstwerk. Der Krieg war damit beendet, aber die Wunden waren zu tief für eine Versöhnung. Brilli verließ die Zunft. Jahre später tauchte er wieder auf. Er operierte jetzt vom Territorium der Roten Hand im Norden aus. Du bist dort aber kein Mitglied, oder?«
»Ich will mit Zünften nichts mehr zu tun haben«, antwortete Royce kalt.
»Und wer ist das?«, fragte Ätzer und zeigte auf Hadrian. »Brillis Diener? Er trägt genug Waffen für beide.«
Price grinste. »Das ist Hadrian Blackwater, und ich würde nicht auf ihn zeigen – es könnte dich den Arm kosten.«
Ätzer beäugte Hadrian misstrauisch. »Wieso? Weil er so toll mit dem Schwert kämpft?«
Price kicherte. »Schwert, Speer, Pfeil und Bogen, Stein, was gerade zur Hand ist.« Er wandte sich an Hadrian. »Über dich wissen wir weniger, aber es kursieren viele Gerüchte. Nach einem warst du früher Gladiator, nach einem anderen General der kalischen Armee – sogar ein überaus erfolgreicher, wenn man den Berichten glauben darf. Wieder andere behaupten, du hättest im Osten als Sklave am Hof einer exotischen Königin gedient.«
Einige Diamanten, darunter Ätzer, kicherten ebenfalls.
»Dein Ausflug in die Vergangenheit war sehr amüsant, Price, aber gibt es einen Grund, warum ihr uns anhaltet?«
»Du meinst abgesehen davon, dass wir gerne mit euch plaudern? Euch ein wenig ärgern wollen? Daran erinnern, dass diese Stadt das Territorium des Schwarzen Diamanten ist? Und warnen, dass zunftlose Diebe hier nicht praktizieren dürfen und insbesondere du nicht willkommen bist?«
»Richtig.«
»Doch, einen hätte ich noch. Ein Mädchen sucht euch.«
Royce und Hadrian wechselten einen fragenden Blick.
»Sie hat sich in der Stadt nach zwei Dieben namens Hadrian und Royce erkundigt. Es mag ja lustig sein, eure Namen in aller Munde zu hören, aber für den Schwarzen Diamanten ist es peinlich, wenn jemand in Colnora nach Dieben sucht, die nicht zu unserer Zunft gehören. Die Leute könnten einen falschen Eindruck von dieser Stadt bekommen.«
»Wer ist das Mädchen?«, fragte Royce.
»Keine Ahnung.«
»Wo finden wir sie?«
»Sie schläft unter dem Triumphbogen der Kaufmannschaft auf dem Finanz-Boulevard, wir können deshalb wohl ausschließen, dass es sich um eine adlige Debütantin oder reiche Kaufmannstochter handelt. Außerdem reist sie allein, sie will euch also wahrscheinlich auch nicht töten oder verhaften. Wenn ich raten sollte, würde ich sagen, sie will euch engagieren. Allerdings muss ich sagen, wenn sie typisch für die Kundschaft ist, für die ihr arbeitet, würde ich mich nach einer weniger exponierten Arbeit umsehen. Vielleicht könntet ihr auf einem Schweinehof unterkommen – dann wärt ihr wenigstens unter euresgleichen.«
Price wurde wieder ernst. »Sucht sie und verschwindet bis morgen Abend aus unserer Stadt. Ihr solltet euch übrigens beeilen. Frisch gewaschen sähe sie nicht übel aus und könnte jemandem ein hübsches Sümmchen einbringen oder zumindest einige vergnügliche Minuten bereiten. Ich vermute mal, sie ist bisher nur deshalb unbehelligt geblieben, weil sie überall eure Namen erwähnt. Der Name Royce Melborn sorgt hierzulande noch immer für einen gewissen Schauder.«
Price wandte sich zum Gehen, und sein spöttischer Ton kehrte zurück. »Zu schade, dass ihr nicht bleiben könnt. Das Theater zeigt gerade ein Stück über ein Diebespaar, dem man den Mord am König von Melengar in die Schuhe schiebt. Dem wirklichen Mord an Amrath vor einigen Jahren frei nachempfunden.« Price schüttelte den Kopf. »Allerdings sehr unrealistisch. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein erfahrener Dieb sich in ein Schloss locken lässt, um ein Schwert zu klauen und dadurch seinen Auftraggeber vor einem Duell zu retten? Schriftsteller!«
Er ließ Hadrian und Royce stehen, entfernte sich immer noch kopfschüttelnd mit seinen Kumpanen und verschwand im Gewirr der Gassen am anderen Ufer.
»Reizende Begegnung, nicht wahr?«, sagte Hadrian. Sie gingen den Weg zurück, den sie gekommen waren, und stiegen zum Finanz-Boulevard hinauf. »Wirklich nette Jungs. Mich enttäuscht ein wenig, dass sie nur vier geschickt haben.«
»Glaub mir, die waren schon ziemlich gefährlich. Price ist der Erste Offizier der Zunft, die beiden Stillen waren Dunkelmänner. Außerdem lagen sechs weitere im Hinterhalt auf der Lauer, drei auf jeder Seite der Brücke, nur für den Fall. Sie wollten kein Risiko eingehen. Zufrieden?«
»Allerdings, danke.« Hadrian verdrehte die Augen. »Brilli, ja?«
»Nenn mich nicht so«, sagte Royce. Er klang ernst. »Nie mehr.«
»Schon vergessen«, sagte Hadrian unschuldig.
Royce seufzte, dann lächelte er. »Beeil dich. Kundschaft wartet.«
* * *
Sie wachte auf, weil sie eine rauhe Hand auf ihrem Schenkel spürte.
»Was haste denn in der Börse, Kindchen?«
Verwirrt rieb sie sich die Augen. Sie lag unter dem Bogen der Kaufmannschaft im Rinnstein. Ihre Haare waren verfilzt und voller Blätter und Zweige, ihre Kleider schmutzig und zerknittert. Mit den Händen hielt sie eine kleine Börse umklammert, deren Zugband sie sich um den Hals gehängt hatte. Die meisten Passanten hielten sie wahrscheinlich für Müll, den jemand am Straßenrand entsorgt hatte, oder einen Haufen aus Lumpen und Zweigen, den die Straßenkehrer übersehen hatten. Doch sogar dafür gab es offenbar Interessenten.
Als ihre Augen wieder klar sehen konnten, sah sie als Erstes das dunkle, hagere Gesicht und den offenen Mund des Mannes, der sich über sie beugte. Sie schrie und wollte wegkriechen, doch eine Hand packte sie an den Haaren. Starke Arme drückten sie nach unten und hielten ihre Handgelenke fest.
Sie spürte den feuchtwarmen Atem des Mannes im Gesicht. Er stank nach Alkohol und Rauch. Der Mann riss ihr die Börse aus den Fingern und zog ihr die Schnur über den Hals.
»Nein!« Sie bekam eine Hand frei und griff danach. »Die brauche ich.«
»Ich auch.« Der Mann lachte hämisch und schlug ihre Hand weg. Grinsend wog er den Beutel in der Hand, spürte das Gewicht der Münzen und steckte ihn in seine Brusttasche.
»Nein!«, protestierte das Mädchen.
Der Mann setzte sich auf sie, nagelte sie auf den Boden und strich ihr mit den Fingern über Gesicht und Mund. Am Hals hielt er an, schloss die Finger darum und drückte ein wenig zu. Das Mädchen schnappte erschrocken nach Luft. Der Mann presste seine Lippen auf ihren Mund, so fest, dass sie seine Zahnlücke spürte. Seine groben Bartstoppeln zerkratzten ihr Kinn und Wangen.
»Pst!«, flüsterte er. »Wir fangen doch erst an, spar dir deine Kraft für später.« Er richtete sich auf die Knie auf und machte sich an den Knöpfen seiner Hose zu schaffen.
Das Mädchen wehrte sich verzweifelt, trat nach ihm und kratzte ihn. Doch er klemmte ihre Arme unter seinen Knien ein und ließ sie strampeln. Als sie kreischte, schlug er ihr die Hand ins Gesicht. Vor Schreck verstummte sie und starrte blind nach oben, während er wieder an den Knöpfen seiner Hose nestelte. Die Schmerzen setzten erst nach und nach in Wellen ein, und ihre Wange brannte wie Feuer. Durch einen Tränenschleier hindurch sah sie ihn wie von ferne auf sich sitzen. Die Geräusche um sie verschmolzen zu einem dumpfen Brei. Seine aufgesprungenen, schorfigen Lippen und die langen Muskelstränge an seinem Hals bewegten sich, doch sie hörte seine Worte nicht. Sie konnte einen Arm befreien, doch der Mann packte ihn sofort und drückte ihn wieder nach unten.
Hinter dem Mann näherten sich plötzlich zwei Gestalten, und sofort regte sich in ihr wieder die Hoffnung. »Hilfe«, ächzte sie kaum hörbar.
Der vordere der beiden Männer zog ein gewaltiges Schwert, fasste es an der Klinge und schlug mit dem Knauf zu. Ihr Peiniger fiel zur Seite und blieb bewegungslos im Rinnstein liegen.
Der Mann kniete sich neben sie. Er hob sich nur als Schemen vor dem schwarzen Himmel ab, ein nächtliches Trugbild.
»Kann ich behilflich sein, Gnädigste?« Die Stimme klang freundlich. Er ergriff ihre Hände und half ihr auf.
»Wer seid Ihr?«
»Ich bin Hadrian Blackwater.«
Sie starrte ihn an. »Ist das wahr?«, brachte sie schließlich heraus und hielt seine Hände fest. Unversehens begann sie zu weinen.
»Was machst du da?«, fragte der andere Mann und kam näher.
»Äh … keine Ahnung.«
»Lass sie los. Du zerquetschst ihr ja die Hände.«
»Ich halte sie nicht fest. Sie lässt mich nicht los.«
»Oh, Verzeihung.« Die Stimme des Mädchens zitterte. »Ich hatte die Hoffnung, Euch zu finden, schon aufgegeben.«
»Ist ja gut, jetzt hast du uns gefunden.« Hadrian lächelte. »Dieser Herr hier ist übrigens Royce Melborn.«
Sie sah Royce fassungslos an, dann fiel sie ihm um den Hals, drückte ihn fest an sich und schluchzte noch lauter. Royce stand ein wenig steif da, während Hadrian das Mädchen von ihm löste.
»Ich habe den Eindruck, du bist froh, uns zu sehen«, sagte er. »Das freut mich. Aber wer bist du?«
»Ich bin Thrace Wood aus Dahlgren.« Das Mädchen lächelte. Sie konnte nicht anders. »Ich suche Euch schon so lange.«
Sie schwankte.
»Alles in Ordnung?«
»Mir ist ein wenig schwindlig.«
»Wann hast du das letzte Mal gegessen?«
Thrace überlegte. Unruhig wanderte ihr Blick hin und her.
»Egal.« Hadrian wandte sich an Royce. »Du hast hier früher gewohnt. Irgendeine Idee, wo wir mitten in der Nacht Hilfe für diese junge Dame finden?«
»Schade, dass wir nicht in Medford sind. Gwen wäre ideal.«
»Gibt es hier kein Bordell? Wir befinden uns doch im größten Handelszentrum der Welt. Sag jetzt nicht, dass ausgerechnet dieses Gewerbe hier fehlt.«
»Doch, es gibt da ein nettes in der Südstraße.«
»Gut. Thrace? Komm mit, wir wollen doch sehen, ob wir dir eine Waschgelegenheit und eine Mahlzeit beschaffen können.«
»Wartet.« Thrace kniete sich neben den bewusstlosen Mann und zog ihm die Börse aus der Tasche.
»Ist er tot?«, fragte sie.
»Kaum. So stark habe ich nicht zugeschlagen.«
Sie stand auf. Schwindel erfasste sie und ihr wurde schwarz vor Augen. Sie verharrte einen Augenblick unsicher, als sei sie betrunken, dann begann sie zu torkeln und brach zusammen. Sie wachte noch einmal kurz auf und spürte, wie Arme sie behutsam aufhoben. Durch ein tiefes Brummen hindurch hörte sie jemanden kichern.
»Was ist so lustig?«, fragte einer der beiden Männer.
»Es dürfte das erste Mal sein, dass jemand, der ein Bordell besucht, selbst eine Frau mitbringt.«
2
Thrace
»Jetzt glänzt sie wieder wie ein neuer Kupferpenny«, bemerkte Clarisse. Die drei betrachteten Thrace, die im Gesellschaftszimmer wartete, durch die Tür. Clarisse war eine korpulente Dame mit rosigen Wangen und kurzen, fleischigen Fingern, die fortwährend mit den Falten ihres Rocks spielten. Sie und die anderen Damen des Salons Clarisse hatten an Thrace Wunder bewirkt. Thrace trug neue Kleider, die zwar billig und schlicht waren – einen braunen Leinenrock über einem weißen Untergewand und ein gestärktes braunes Leibchen –, aber entschieden ansehnlicher als die Fetzen, die sie davor getragen hatte. Mit dem zerlumpten Wesen, das die beiden Männer in der Nacht zuvor auf der Straße aufgelesen hatten, hatte sie jedenfalls nicht mehr viel gemein. Die Frauen hatten ihr nicht nur ein Bett gemacht, sondern sie auch geschrubbt, gekämmt und verköstigt. Sogar Lippen und Augen hatten sie ihr geschminkt. Das Ergebnis war umwerfend. Vor ihnen saß eine Schönheit mit sensationellen blauen Augen und goldenen Haaren.
»Die Arme war in einem schrecklichen Zustand, als ihr sie gebracht habt«, sagte Clarisse. »Wo habt ihr sie gefunden?«
»Unter dem Bogen der Kaufmannschaft«, antwortete Hadrian.
»Armes Ding.« Traurig schüttelte Clarisse den Kopf. »Wenn sie eine Bleibe braucht, könnte sie bestimmt bei uns einsteigen. Sie hätte ein Bett zum Schlafen und drei Mahlzeiten täglich, und bei ihrem Aussehen könnte sie es zu etwas bringen.«
»Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie keine Prostituierte ist«, sagte Hadrian.
»Das sind wir auch nicht, mein Lieber. Das ist man erst, wenn man unter dem Bogen der Kaufmannschaft schläft. Du hättest sie beim Frühstück sehen sollen. Hinuntergeschlungen hat sie es wie ein verhungerter Hund. Zuerst wollte sie nichts anrühren. Wir mussten ihr versichern, dass das Essen nichts kostet, dass es sich um einen Willkommensgruß der Handelskammer für Besucher der Stadt handelt. Diese Idee hatte übrigens Maggie. Sie ist manchmal furchtbar witzig. Dabei fällt mir ein, die Rechnung für Zimmer, Kleider, Essen und Waschen beträgt fünfundsechzig Silbertaler. Die Schminke ist gratis. Delia wollte nur wissen, wie sie damit aussieht, weil Thrace doch meinte, sie hätte noch nie welche aufgelegt.«
Royce gab ihr einen Goldtaler.
»Ihr solltet wirklich öfter vorbeischauen, das nächste Mal am besten ohne das Mädchen, eh?« Clarisse zwinkerte. »Aber im Ernst, was hat sie nach Colnora verschlagen?«
»Das ist es ja gerade«, sagte Hadrian. »Wir wissen es nicht.«
»Aber wir sollten sie danach fragen«, fügte Royce hinzu.
Der Salon Clarisse konnte sich nicht annähernd mit dem Medforder Haus vergleichen. Seine Ausstattung bestand aus knallroten Vorhängen, wackligen Möbeln, rosafarbenen Lampenschirmen und Dutzenden Kissen. Alles, von den fadenscheinigen Teppichen bis zu den Stoffborten, welche die oberen Ränder der Wände einfassten, war mit Troddeln und Fransen besetzt. Die Einrichtung war alt, verblichen und abgenutzt, aber immerhin sauber.
Das Gesellschaftszimmer war ein kleiner, unmittelbar an die große Eingangshalle grenzender ovaler Raum mit zwei Erkerfenstern, die zur Straße hinausgingen. In ihm standen zwei Zweiersofas und einige Tische mit allerlei Nippes, dazu kam ein kleiner Kamin. Thrace saß wartend auf einem Sofa. Ihr Blick schoss unruhig hin und her wie der eines Kaninchens auf offenem Feld. Als die beiden Männer eintraten, sprang sie auf, kniete hin und verbeugte sich.
»He! Aufgepasst, das Kleid ist neu«, rief Hadrian mit einem Lächeln.
»Oh!« Sie errötete, stand hastig auf, knickste und verbeugte sich erneut.
»Was tut sie da?«, flüsterte Royce.
»Keine Ahnung«, flüsterte Hadrian zurück.
»Ich will Euch nur den gebührenden Respekt erweisen, Eure Durchlauchten«, flüsterte Thrace an beide gewandt und hielt den Kopf weiter gesenkt. »Ich bitte um Verzeihung, wenn ich darin nicht sehr geübt bin.«
Royce verdrehte die Augen, Hadrian schmunzelte.
»Warum sprichst du so leise?«, fragte er.
»Weil Ihr es auch tut.«
Hadrian musste lachen. »Entschuldigung, Thrace – so heißt du doch, nicht wahr?«
»Jawohl, Herr, Thrace Annabell Wood aus Dahlgren.« Sie knickste wieder ungeschickt.
»Also gut … Thrace.« Hadrian bemühte sich krampfhaft um ein ernstes Gesicht. »Wir sind keine vornehmen Herren, man braucht sich also nicht vor uns zu verbeugen und auch nicht zu knicksen.«
Thrace hob den Kopf.
»Ihr habt mir das Leben gerettet«, sagte sie mit einem solchen Ernst, dass Hadrian das Lachen schlagartig verging. »Auch wenn ich mich an nicht mehr viel von letzter Nacht erinnern kann, daran erinnere ich mich. Und dafür gebührt Euch mein Dank.«
»Einige Informationen wären mir lieber«, sagte Royce. Er trat zu den Fenstern und begann die Vorhänge zuzuziehen. »Hör auf, dich zu verbeugen, bei Maribor, bevor ein Straßenkehrer dich sieht und uns für Adlige hält und das überall herumerzählt. Wir bewegen uns hier sowieso schon auf dünnem Eis und dürfen niemanden provozieren.«
Thrace richtete sich auf. Hadrian konnte den Blick nicht von ihr abwenden. Die von Zweigen und Blättern befreiten langen, blonden Haare fielen ihr in schimmernden Wellen über die Schultern, und sie erschien ihm als Inbegriff jugendlicher Schönheit. Er schätzte sie auf höchstens siebzehn.
»Also«, sagte Royce und schloss den letzten Vorhang, »warum suchst du uns?«
»Ich habe eine große Bitte an Euch«, sagte Thrace. »Könnt Ihr meinen Vater retten?« Sie band die Börse von ihrem Hals los und hielt sie mit einem schüchternen Lächeln hoch. »Hier. Fünfundzwanzig Silbertaler. Massives Silber, gestempelt mit der Krone von Dunmore.«
Royce und Hadrian wechselten einen Blick.
»Reicht das nicht?« Ihre Lippen begannen zu zittern.
»Wie lange musstest du dafür sparen?«, fragte Hadrian.
»Mein ganzes Leben. Ich habe jeden Penny gespart, den ich je bekommen oder verdient habe. Das Geld war meine Aussteuer.«
»Deine Aussteuer?«
Thrace senkte den Kopf und blickte auf ihre Füße. »Mein Vater ist ein armer Bauer. Er würde nie … ich habe beschlossen, dass ich selbst sparen muss. Aber es reicht nicht, ja? Das wusste ich nicht. Ich komme aus einem kleinen Dorf und dachte, es sei viel Geld. Alle sagten das, aber …« Sie drehte sich zu dem abgewetzten Sofa und den verblichenen Vorhängen um. »So prächtige Häuser wie dieses gibt es bei uns nicht.«
Royce zeigte wie üblich keinerlei Mitgefühl. »Also wir können nun wirklich nicht …«
»Royce meint«, fiel Hadrian ihm ins Wort, »dass wir das jetzt noch nicht entscheiden können. Es hängt davon ab, was wir für dich tun sollen.«
Thrace blickte hoffnungsvoll auf.
Royce sah Hadrian nur finster an.
»Aber so ist es doch, nicht wahr?« Hadrian zuckte die Achseln. »Du sagst also, dass wir deinen Vater retten sollen, Thrace. Wurde er entführt oder etwas in der Art?«
»Nein, keineswegs. Soviel ich weiß, geht es ihm gut. Obwohl ich schon länger weg bin, weil ich ja Euch suche. Deshalb weiß ich es nicht sicher.«
»Das verstehe ich nicht. Wozu brauchst du uns dann?«
»Um eine Tür zu öffnen.«
»Eine Tür? Was für eine denn?«
»Die Tür zu einem Turm.«
»Wir sollen für dich in einen Turm einbrechen?«
»Nein. Oder … hm, doch, aber es ist nicht … es ist nicht verboten. Der Turm steht leer, schon seit Jahren. Wenigstens glaube ich das.«
»Wir sollen also nur die Tür zu einem leeren Turm öffnen?«
»Ja!« Thrace nickte so heftig, dass ihre Haare auf und ab wippten.
»Klingt nicht besonders schwer.« Hadrian sah Royce an.
»Wo liegt dieser Turm?«, fragte Royce.
»In der Nähe meines Heimatdorfes am westlichen Ufer des Nidwalden. Dahlgren ist sehr klein und existiert noch nicht lange. Es liegt in der neuen Provinz Westmark von Dunmore.«
»Ich habe davon gehört. Es wird offenbar immer wieder von Elben überfallen.«
»Nein, nicht Elben. Die haben uns noch nie Ärger gemacht.«
»Ich wusste es«, sagte Royce zu niemandem im Besonderen.
»Jedenfalls soviel ich weiß«, fuhr Thrace fort. »Wir glauben, dass es sich um ein wildes Tier handelt. Niemand hat es je gesehen. Diakon Tomas meint, es sei ein Dämon, ein Knecht des Uberlin.«
»Und was hat dein Vater damit zu tun?«, fragte Hadrian.
»Er will das Ungeheuer töten, nur …« Sie verstummte und blickte wieder auf ihre Füße.
»Nur du glaubst, dass es umgekehrt ihn töten könnte?«
»Es hat schon fünfzehn Menschen und über achtzig Schafe und Kühe auf dem Gewissen.«
Eine Frau mit sommersprossigem Gesicht und einem wilden Schopf roter Haare kam herein. Sie ging rückwärts und zog lachend einen kleinen, korpulenten Mann hinter sich her, der sich offenbar eigens für diesen Anlass rasiert hatte, denn sein Gesicht war mit Schnitten übersät. Der Mann blieb wie angewurzelt stehen, als er die anderen sah, und ließ die Hände der Frau los, und die Frau setzte sich mit einem Plumps auf den Boden. Entgeistert sah der Mann zwischen der Frau und den anderen hin und her. Die Frau blickte über die Schulter und lachte.
»Hoppla«, sagte sie. »Wusste nicht, dass hier besetzt ist. Hilf mir auf, Rubis.«
Der Mann half ihr auf die Beine. Sie musterte Thrace anerkennend und zwinkerte den Männern zu. »Gute Arbeit, was?«
Dann verschwand sie mit dem Mann wieder nach draußen. »Das war Maggie«, erklärte Thrace.
Hadrian ging zum Sofa und bedeutete ihr, sich zu setzen. Sie setzte sich kerzengerade hin, ohne mit dem Rücken die Lehne zu berühren, und strich ihren Rock sorgfältig glatt.
Royce blieb stehen. »Hat diese Provinz einen Fürsten? Warum unternimmt er nichts?«
»Wir hatten einen tüchtigen Markgrafen«, sagte Thrace. »Einen tapferen Mann mit drei tüchtigen Rittern.«
»Hatten?«
»Er ritt mit seinen Rittern eines Abends aus, um gegen das Ungeheuer zu kämpfen. Später fand man nur noch einzelne Teile der Rüstungen.«
»Warum zieht ihr nicht einfach woanders hin?«, fragte Royce.
Thrace senkte den Kopf und ihre Schultern fielen nach unten. »Zwei Tage bevor ich hierher aufbrach, tötete das Ungeheuer meine ganze Familie außer mir und meinem Vater. Wir waren nicht zu Hause. Mein Vater arbeitete noch spät auf dem Feld und ich war ihn abholen gegangen. Ich … ich ließ versehentlich die Haustür offen. Licht zieht das Ungeheuer an. Es drang in unser Haus ein und tötete meinen Bruder Thad, seine Frau und ihren Sohn. Thad war der ganze Stolz meines Vaters. Seinetwegen sind wir überhaupt erst nach Dahlgren gezogen – er sollte der erste Böttcher des Ortes werden.«
Tränen waren Thrace in die Augen getreten. »Jetzt sind alle tot und mein Vater hat nur noch seinen Kummer und die Bestie, die ihn verursacht hat. Er will sie noch vor Monatsende töten oder aber selbst sterben. Hätte ich damals doch die Tür richtig zugemacht … Hätte ich noch einmal gegen das Schloss gedrückt …«
Sie schlug die Hände vor das Gesicht und ihr schmaler Leib bebte. Royce sah Hadrian streng an, schüttelte kaum merklich den Kopf und formte mit den Lippen ein stummes Nein.
Hadrian erwiderte seinen Blick böse, legte Thrace die Hand auf die Schulter und strich ihr die Haare aus den Augen. »Du ruinierst dein schönes Make-up«, sagte er.
»Verzeihung. Ich will Euch wirklich nicht zur Last fallen. Das hat ja nichts mit Euch zu tun. Nur, mein Vater ist alles, was ich noch habe, und ich kann den Gedanken nicht ertragen, ihn auch noch zu verlieren. Er lässt nicht mit sich reden. Ich wollte ja, dass wir wegziehen, aber er hört nicht auf mich.«
»Ich verstehe dein Problem, aber warum ausgerechnet wir?«, fragte Royce ungerührt. »Und wie kommt es, dass eine Bauerntochter aus der Provinz unsere Namen kennt und weiß, dass sie uns in Colnora findet?«
»Ein Krüppel hat es mir gesagt. Er hat mich hierher geschickt. Er meinte, Ihr könntet den Turm aufschließen.«
»Ein Krüppel?«
»Ja. Er heißt Haddon und meinte, das Ungeheuer könne nicht …«
»Haddon?«, fiel Royce ihr ins Wort.
»Mhm.«
»Dieser Haddon … hat nicht zufällig keine Hände?«
»Doch, stimmt.«
Royce und Hadrian wechselten einen Blick.
»Was genau hat er gesagt?«
»Er sagte, von Menschenhand geschaffene Waffen könnten dem Tier nichts anhaben, aber in Avempartha gebe es ein Schwert, mit dem man es töten könne.«
»Ein Mann ohne Hände hat also gesagt, du solltest uns in Colnora aufsuchen und beauftragen, aus einem Turm namens Avempartha ein Schwert für deinen Vater zu holen?«, fasste Royce zusammen.
Das Mädchen nickte.
Hadrian sah seinen Partner an. »Lass mich raten … der Turm gehört den Zwergen?«
»Falsch«, erwiderte Royce, »den Elben.« Nachdenklich trat er einen Schritt zur Seite.
Hadrian wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Mädchen zu. Verflixt und zugenäht! Dass das Dorf so weit weg war, war schlimm genug, aber jetzt hatten sie es auch noch mit einem Turm der Elben zu tun. Selbst wenn das Mädchen ihnen hundert Goldtaler geboten hätte, konnte er Royce wahrscheinlich nicht dazu überreden, den Auftrag anzunehmen. Dabei war Thrace verzweifelt und brauchte dringend Hilfe. Krampfhaft überlegte er, was er als Nächstes sagen sollte.
»Hm«, begann er zögernd, »zum Nidwalden wären wir mehrere Tage durch unwegsames Gelände unterwegs. Wir bräuchten Proviant für eine, na … sechs- bis siebentägige Reise? Macht hin und zurück zwei Wochen. Und Futter für die Pferde. Dazu käme die Zeit am Turm. Wir könnten in dieser Zeit keine anderen Aufträge übernehmen, verlieren also Geld. Und gefährlich ist das Ganze auch noch. Jedes Risiko erhöht den Preis, und ein Massenmörder in Form eines Dämons oder Tieres, dem man mit Waffen nichts anhaben kann, ist definitiv ein Risiko.«
Er sah Thrace an und schüttelte den Kopf. »So ungern ich es sage und so leid es mir tut, aber wir können nicht …«
Royce drehte sich um. »Fünfundzwanzig Taler«, fiel er Hadrian ins Wort, »sind zu viel. So viel für diesen Auftrag zu verlangen … Im Grunde reichen zehn vollkommen aus.«
Hadrian hob die Augenbrauen und starrte ihn verblüfft an.
»Also zehn für jeden?«, fragte Thrace.
»Äh, nein«, erwiderte Hadrian, ohne den Blick von Royce abzuwenden. »Zehn zusammen. Einverstanden? Fünf für jeden?«
Royce zuckte die Achseln. »Da ich ja das Schloss knacken werde, sollte ich eher wohl sechs bekommen, aber das können wir noch unter uns ausmachen. Darum braucht sie sich keine Gedanken zu machen.«
»Im Ernst?«, fragte Thrace. Sie sah aus, als wollte sie vor Glück gleich platzen.
»Ja«, bestätigte Royce. »Wir sind schließlich keine Diebe.«
* * *
»Willst du mir vielleicht erklären, warum wir den Auftrag jetzt doch übernehmen?«, fragte Hadrian. Sie waren nach draußen gegangen, und er hob schützend die Hand über die Augen. Der Himmel war wolkenlos blau, die Pfützen der vergangenen Nacht verdunsteten bereits in der Morgensonne. Menschen strebten scharenweise in Richtung Markt. Hinter drei mit Heu beladenen Fuhrwerken stauten sich Karren mit Frühlingsgemüse und Fässern, die mit Planen zugedeckt waren. Unmittelbar vor ihnen löste sich ein dicker Mann aus der Menge, der sich zwei flatternde Hühner unter die Arme geklemmt hatte. Hastig trippelte er um Pfützen, Menschen und Karren herum und drängelte mit einer gemurmelten Entschuldigung an ihnen vorbei.
»Sie zahlt uns zehn Silbertaler für einen Auftrag, der uns bereits einen Goldtaler gekostet hat«, fuhr Hadrian fort, nachdem sie dem Mann mit den Hühnern erfolgreich ausgewichen waren. »Und noch weitere Goldtaler kosten wird.«
»Wir tun es nicht fürs Geld«, erklärte Royce und bahnte sich einen Weg durch das Gedränge.
»Richtig, aber warum tun wir es überhaupt? Ich meine, klar, sie sieht wirklich niedlich aus und alles, aber was bringt uns das? Es sei denn, du willst sie verkaufen.«
Royce drehte sich zu ihm um und grinste böse. »Darauf bin ich gar nicht gekommen. Damit könnten wir einen Teil der Kosten reinholen.«
»Vergiss es. Sag mir einfach, warum wir es tun.«
Royce steuerte sie aus dem Gedränge hinaus und zu Ognotons Ramsch-Laden mit einem Schaufenster voller Wasserpfeifen, Porzellantiere und messingbeschlagener Schmuckschatullen. Sie schlüpften in den schmalen Spalt, der den Laden vom Nachbarhaus trennte, einem Zuckerbäcker, bei dem man Gratisbonbons probieren konnte.
»Du hast dich doch bestimmt auch schon gefragt, was Esrahaddon vorhat«, flüsterte Royce. »Er sitzt neunhundert Jahre lang im Gefängnis, dann verschwindet er noch am selben Tag, an dem wir ihm zur Flucht verhelfen, und wir hören bis heute nichts mehr von ihm. Die Kirche muss davon wissen, trotzdem haben die Imperialisten keinerlei Suchaktion gestartet. Ich hätte ein wenig mehr Aufregung erwartet, wenn der gefährlichste Mensch auf Erden frei herumläuft. Zwei Jahre später taucht er dann in einem kleinen Dorf auf und lädt uns zu einem Besuch ein. Als Treffpunkt wählt er ausgerechnet die elbische Grenze und Avempartha. Macht dich das nicht auch neugierig?«
»Was ist dieses Avempartha eigentlich?«
»Ich weiß nur, dass es alt ist, also richtig alt. Eine Art Elbenfestung aus grauer Vorzeit. Würdest du dort nicht auch gern mal reinschauen? Esrahaddon hat bestimmt einen triftigen Grund.«
»Wir suchen also nach einem alten Elbenschatz?«
»Keine Ahnung, aber bestimmt ist dort etwas Wertvolles versteckt. Jetzt müssen wir allerdings noch Proviant kaufen, und wir sollten von hier verschwinden, bevor Price seine Spürhunde auf uns loslässt.«
»Na gut, aber erst musst du mir versprechen, dass du das Mädchen nicht verkaufst.«
»Versprochen – wenn sie sich benimmt.«
* * *
Hadrian spürte, wie Thrace sich wieder zur Seite drehte. Diesmal hatte es ihr ein zweistöckiges Landhaus aus verputztem Stein mit einem gelben Strohdach und einem Schornstein aus orangefarbenem Lehm angetan. Eine hüfthohe, mit Flieder und Efeu überwachsene Mauer umgab das Anwesen.
»Ist das schön«, seufzte sie.
Es war früher Nachmittag, Colnora lag erst wenige Meilen hinter ihnen, und sie ritten auf der nach Alburn führenden Landstraße in Richtung Osten. Die Straße schlängelte sich zwischen den zahlreichen Dörfern der hügeligen Umgebung der Stadt hindurch, kleinen Flecken mit Bauern, die von der Feldarbeit lebten. Zwischen ihren Höfen standen luxuriöse Villen, in denen reiche Städter im Sommer drei Monate Gutsherr spielten. Royce ritt neben ihnen oder trabte voraus, je nachdem, wer ihnen entgegenkam. Seine Kapuze hatte er trotz des warmen Wetters aufgesetzt. Thrace saß im Damensitz hinter Hadrian auf dessen brauner Stute, und ihre Beine baumelten im Rhythmus des Pferdes hin und her.
»Wie anders hier alles ist«, rief sie. »Ein richtiges Paradies. Alle sind reich, jeder ist ein König.«
»Colnora ist zwar nicht arm, aber so weit würde ich nicht gehen.«
»Woher kommen dann all die prächtigen Häuser? Die Räder der Fuhrwerke sind mit Eisen beschlagen. Man kann an jeder Ecke Zwiebeln und Erbsen kaufen. In Dahlgren haben wir nur Fußwege, die sich bei Regen in einen Morast verwandeln. Hier gibt es breite Straßen, die sogar Pfosten mit Namensschildern haben. Und eben erst hat ein Bauer bei der Arbeit Handschuhe getragen. Handschuhe! In Dahlgren besitzt nicht einmal der Diakon Handschuhe, und wenn er welche hätte, würde er sie bestimmt nicht zur Arbeit anziehen. Ihr seid also sehr reich.«
»Einige ja.«
»Wie Ihr und Euer Gefährte.«
Hadrian lachte.
»Ihr habt doch schöne Kleider und Pferde.«
»Mein Pferd ist nun wirklich nichts Besonderes.«
»In Dahlgren hat niemand ein Pferd außer dem Markgrafen und seinen Rittern, und Eures sieht so schön aus. Ich mag besonders die Augen mit den langen Wimpern. Wie heißt es?«
»Ich nenne es Millie nach einer Frau, die ich einmal kannte und die mir auch nie zugehört hat.«
»Millie ist ein schöner Name. Er gefällt mir. Und das Pferd von Royce?«
Hadrian runzelte die Stirn und sah zu Royce hinüber. »Weiß ich gar nicht. Royce, hast du ihm überhaupt einen Namen gegeben?«
»Wozu?«
Hadrian drehte sich zu Thrace um, die seinen Blick entsetzt erwiderte.
»Wie wäre es mit …« Sie verstummte und drehte sich suchend in alle Richtungen. »Rosa? Margerita? Oder halt, nein, Hyazintha?«
»Hyazintha?«, wiederholte Hadrian. So lustig die Vorstellung war, Royce könnte auf einer Hyazintha oder auch Rosa oder Margerita sitzen, musste er doch einwenden, dass Blumennamen nun wirklich nicht zu Royces gedrungener, schmutziggrauer Stute passten. »Wie wäre es mit Moppel oder Schmuddel?«
»Nein!«, rief Thrace entrüstet. »Das wäre doch schrecklich für das arme Tier.«
Hadrian lachte in sich hinein, Royce ignorierte ihr Geplänkel. Er schnalzte mit der Zunge, trat seinem Pferd in die Flanken und trabte nach vorn, um einem entgegenkommenden Wagen auszuweichen. Dort blieb er auch, nachdem die Straße wieder frei war.
»Wie wäre es mit Lady?«, fragte Thrace.
»Klingt das nicht übertrieben? Schließlich ist sie kein rassiges Vollblut.«
»Aber so ein Name baut sie auf, gibt ihr Selbstvertrauen.«
Sie näherten sich einem Fluss. Geißblatt und Himbeeren überzogen den glatten Granit, der die Ufer säumte, mit ihrem frischen Frühlingsgrün. Am Fluss stand eine Getreidemühle, deren großes Rad sich knarrend und tropfend drehte. Zwei kleine, viereckige Fenster, die an schwarze Augen erinnerten, machten aus der steinernen Wand unter dem steilen Holzgiebel ein Gesicht. Ein niedriges Mäuerchen trennte die Mühle von der Straße. Auf ihm saß eine grauweiße Katze. Träge öffnete sie ihre grünen Augen einen Spalt und blickte den Reisenden entgegen. Doch als die immer noch näher kamen, hatte sie offenbar genug und sprang herunter, rannte über die Straße und verschwand im Gebüsch.
Royces Stute bäumte sich wiehernd auf und wich unruhig tänzelnd einige Schritte zurück. Fluchend riss Royce an den Zügeln, zog ihren Kopf nach unten und zwang sie, sich einmal um sich selbst zu drehen.
»Lächerlich!«, schimpfte er, als er sie wieder unter Kontrolle hatte. »Ein fünfhundert Kilo schweres Pferd hat Angst vor einer drei Kilo schweren Katze. Man könnte denken, sie sei eine Maus.«
»Maus!«, rief Thrace so laut, dass Millie die Ohren nach hinten drehte. »Das passt.«
Hadrian nickte. »Gefällt mir auch.«
»Du meine Güte«, brummte Royce kopfschüttelnd und trabte wieder nach vorn.
Sie drangen weiter nach Osten vor, und aus den Landsitzen wurden Bauernhöfe, aus Rosenbüschen Hecken und aus den Zäunen zwischen den Feldern Baumreihen. Doch Thrace machte ihre Begleiter weiter auf Sehenswürdigkeiten aufmerksam wie überdachte Brücken, ein unvorstellbarer Luxus, wie sie fand, oder die prunkvollen Kutschen, die immer noch gelegentlich an ihnen vorbeidonnerten.
Die Straße stieg an, und schon bald öffnete sich um sie herum ein weites, mit Goldruten, Seidenpflanzen und wildem Salifan überwachsenes Brachland. Mücken umschwirrten sie sirrend, Zikaden schrillten. Thrace wurde immer stiller und lehnte den Kopf an Hadrians Rücken. Hadrian fürchtete schon, sie könnte einschlafen und vom Pferd fallen, aber hin und wieder hob sie den Kopf, um sich umzusehen oder nach einer Mücke zu schlagen.
Sie gelangten immer höher hinauf, bis sie schließlich die Amberhöhe erreichten, einen felsigen, grasbewachsenen Bergkamm. Der Kamm gehörte zu einer Bergkette, die sich am Ostrand von Warric entlangzog und die Grenze zwischen dem Königreich Warric und dem Königreich Alburn bildete. Alburn rangierte, was Macht und Reichtum anbetraf, in Avryn an dritter Stelle hinter Warric und Melengar. Es war zum größten Teil dicht bewaldet, und seine Küste war häufigen Überfällen der Ba Ran Ghazel ausgesetzt, die blitzschnell angriffen, die unglücklichen Einwohner entführten und niederbrannten, was sie nicht tragen konnten. Alburns Herrscher, König Armand, hatte erst vor kurzem den Thron bestiegen, nachdem der alte König überraschend gestorben war. König Reinhold war Royalist gewesen, der neue König sympathisierte dagegen Hadrians Eindruck nach eher mit den Imperialisten. Er unterstützte sie zuweilen sogar recht offen, sehr zum Verdruss von Melengar, dessen Verbündete täglich weniger wurden.
Eine Besonderheit der Amberhöhe, sogar für die Bewohner der Gegend, waren die Menhire, mächtige blaugraue Steine, die man zu eigenartig fließenden Formen zugehauen hatte. So natürlich wirkten sie mit ihren Rundungen, dass sie aussahen wie Schlangen, die sich in den Boden bohrten und wieder daraus auftauchten. Hadrian hatte nicht die leiseste Ahnung, welchem Zweck sie ursprünglich gedient haben mochten. Wahrscheinlich wusste es niemand. Darum herum waren die Überreste von Lagerfeuern verstreut. In die Steine hatten frühere Besucher Liebesschwüre und andere Botschaften geritzt, etwa »Maribor ist Gott!«, »Die Nationalisten sind doof«, »Der Erbe ist tot« oder sogar »Wirtshaus zur Grauen Maus – in Richtung Tal gehen und immer geradeaus«. Die Aussicht von der Kuppe war überwältigend: Hinter ihnen lag Colnora ausgebreitet, im Nordosten erstreckten sich die endlosen, undurchdringlichen Wälder der Königreiche Alburn und Dunmore. Sie kamen Hadrian vor wie ein endloses grünes Meer – Meilen über Meilen einer unwegsamen Wildnis, auf deren anderer Seite ein kleines Dorf namens Dahlgren lag.