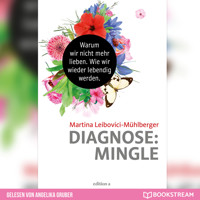Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Was tun mit den Tyrannenkindern? Wie umgehen mit dem Nachwuchs, der uns essgestört, chillbewusst, leistungsverweigernd und verhaltensoriginell in die Resignation treibt? Die Jugendpsychologin Martina Leibovici-Mühlberger glaubt, dass diese Kinder beim Bewältigen zukünftiger Herausforderungen zu den Besten gehören können. Ihre richtige Erziehung setzt allerdings ein neues Menschenbild voraus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MartinaLeibovici-Mühlberger
DERTYRANNENKINDERERZIEHUNGSPLAN
Warum wir für die Erziehung einneues Menschenbild brauchen undwarum die schwierigen Kinder dasgrößte Potenzial haben
edition a
Martina Leibovici-Mühlberger:
Der Tyrannenkinder-Erziehungsplan
Alle Rechte vorbehalten© 2018 edition a, Wienwww.edition-a.at
Cover: JaeHee LeeGestaltung: Lucas Reisigl
ISBN 978-3-99001-271-0
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim
www.brocom.de
INHALT
WARUM WIR EIN NEUES MENSCHENBILD BRAUCHEN UND WESWEGEN ES IN REICHWEITE IST
DER TYRANNENKINDER ERZIEHUNGSPLAN
Eine Mutter mit Sohn ist mir angekündigt. »Es sei wirklich äußerst dringend«, setzt meine für Erstkontakte und Terminplanung zuständige Assistentin hinzu und zieht dabei ihre Augenbrauen zur Unterstreichung hoch. Susanne ist extrem erfahren und wenn sie so tut, ist es immer dringend. Diese Klientin ist bereit, grundsätzlich jeden angebotenen Termin zu akzeptieren, nur bald, möglichst sofort, solle es sein. Und das, obwohl sie und ihr Sohn aus der Gegend zwischen Graz und Klagenfurt anreisen.
Zwei Tage später öffne ich um 20.30 Uhr die Eingangstür meiner Praxis. Eine zierliche Frau knapp über 45 steht mir gegenüber. In ihrem Blick liegt jene dauerhafte Erschöpfung, die nur jahrelange, kontinuierliche Alltagsüberlastung einem Gesicht einzumeißeln vermag.
Hinter ihr ragt ein Menschengebirge auf.
Auf meine einladende Geste hin tritt sie durch den einen vergleichsweise schmalen, geöffneten Flügel der Altwiener Doppeltür herein.
Ihr Sohn muss sich mit Anstrengung hindurch winden, um endlich in meinem Vorzimmer zu landen.
Ich beobachte dieses ungleiche Paar, wie es sich durch mein langes Vorzimmer auf meinen Praxisraum zubewegt: die raschen, wie eine Nähmaschine trippelnden Schritte der zielstrebigen Mutter und den in ihrem Schlepptau weit seitlich ausschwankenden, sich wiegend und rollend dahinschiebenden Sohn, der kaum eine Chance hat, mit ihr Schritt zu halten. An meiner Praxistür wiederholt sich dasselbe Schauspiel wie vorhin an meiner Eingangstür. Die Mutter flitzt durch, während der Sohn mit Seitwärtsdrehung und schraubender Bewegung, deutlicher körperlicher wie logistischer Anstrengung nachfolgt. Er nimmt dann auch gleich den richtigen Platz auf meiner Couch ein. Seiner Mutter überlässt er einen der beiden dunkelgrünen Lederfauteuils, in dem sie zu verschwinden droht. Ich nehme den anderen, der ihrem gegenübersteht. Wie viele, die unter hohem Druck stehen, braucht auch sie als Einladung nicht mehr als einen offenen Blick meinerseits. Daraufhin bricht die Geschichte jahrelangen Leidens hervor, als wäre ihr endlich die Erlaubnis erteilt, alle Kraftanstrengungen eines Niederkämpfens fallen zu lassen. Auf eine kurze Vorstellung oder auch nur Nennung ihres Namens verschwendet sie keine Zeit. Sie liebe ihren Sohn über alles, ist es ihr wichtig eingangs klarzustellen, so als könnte dies in Frage stehen. Markus ist ein absolutes Wunschkind von ihr gewesen. Aber jetzt weiß sie einfach nicht mehr weiter. Sie kann vor Panik kaum noch schlafen. Die letzte Aussage des Internisten, der Markus seit mehreren Jahren wegen seines Bluthochdrucks und seiner prädiabetischen Stoffwechsellage kontinuierlich betreut, hat ihr den Rest zur schon bestehenden Misere mit seiner sozialen Isolation gegeben. Wenn es so weitergehe mit Markus, werde er seinen dreißigsten Geburtstag nicht mehr feiern können, hat der Internist in Aussicht gestellt, nachdem Markus wieder an Gewicht zugelegt hatte. Der Herr Professor ist äußerst ungehalten gewesen. Seine Ablehnung und sein Unverständnis, dass sie es als Familie so weit haben kommen lassen, ist deutlich spürbar gewesen. Sie als Mutter hat sich unter seinem abschätzigen Blick wie eine Versagerin gefühlt. Markus hat vor lauter Scham gleich seinen flammenroten Ausschlag bekommen. In ihr ist dieses Gefühl von Ohnmacht und auch von ungerechter Behandlung aufgestiegen, denn sie haben beide alles Mögliche versucht, soweit es in ihrer Macht stand. Sie hat Markus zu allen Programmen und Therapien überredet und ihn immer ermuntert durchzuhalten.
Innerlich seufze ich. Geht es hier um eine Opfergeschichte? Unsensible Ärzte, die nur Laborwerte in den »grünen Bereich« geschoben haben wollen und diese Mutter samt ihrem Sohn traumatisiert hätten. Ich spüre, wie ich mich versteife. Wäre nicht das erste Mal, dass mich jemand für einen absurden Schadenersatzprozess zu instrumentalisieren trachtet. Heute ist einfach alles möglich und Eigenverantwortung wird zunehmend zu einem Fremdwort. Mein Blick streift Markus. Während seine Mutter die Krankengeschichte ausrollt, nickt er angedeutet. An ihm erscheint sonst alles verhalten, gedämpft und dabei überdimensional. Auf der breiten, ausladenden Couch mit ihrem lila Samtbezug wirkt er wie ein trauriger, gestrandeter Seeelefant. Er nimmt so viel Platz ein, dass neben ihm links und rechts höchstens noch zwei filigrane Dreijährige Platz hätten. Ein beständiges nervöses Wippen durchläuft seinen rechten Oberschenkel, dessen Dimensionen dem Körperumfang seiner Mutter gleichkommen. Und ich denke mir gerade ohne jeden Anflug von unangebrachtem Humor, dass es wohl keine schlechte Idee sein wird, den Hausarbeiter meines Instituts zu bitten, nach diesem schwerwiegenden Besuch die Gelenkverbindungen der Beine der Couch zu überprüfen, um vor zukünftigen unliebsamen Überraschungen gefeit zu sein. Die ganze Veranstaltung hier ist Markus offenbar extrem unangenehm. Dass er überhaupt hier ist, beruht wahrscheinlich auf einem Machtwort seiner Mutter. Gegenwärtig betet er ganz sicher um ein Unsichtbarkeitscape, wie es ein unbekannter Gönner Harry Potter zukommen ließ.
Zwischenzeitlich bauen sich die Verzweiflungskaskaden seiner Mutter zum großen Wasserfall begründeter Angst um ihres Sohnes Existenz auf. Wenn ein Staudamm bricht, kann man sich nicht entgegenstellen. Unter heftigem Weinen beschreibt sie die bereits bestehende Befundlage ihres Sohnes: Plattfüße, degenerative Schäden an der Wirbelsäule, namhafte Anzeichen von Gelenksabnützungen in beiden Sprung- und Kniegelenken, stark erhöhter Blutdruck mit zeitweise beängstigenden Spitzenwerten, eine Herzvergrößerung, immer wieder, besonders in der warmen Jahresperiode aufflammende nässende Entzündungen irgendwo in einer der Falten in der Fettschürze seines Bauchs oder auch im Schrittbereich, ausgedehnte Krampfadern an beiden Beinen, Atemnot bereits bei geringer körperlicher Anstrengung; nicht zu vergessen ist noch, dass eine manifeste Blutzuckererkrankung sprungbereit hinter der nächsten Ecke lauert und dass ihr Sohn einen Gefäßstatus hat, der, wie es der Internist nach der Ultraschalluntersuchung der großen Gefäße genannt hat, bei einem schweren Raucher jenseits der sechzig zu erwarten wäre. Einen Schlaganfall oder Herzinfarkt hat der Herr Professor ihrem Sohn binnen der nächsten zehn Jahre als mehr als wahrscheinlich in Aussicht gestellt, wenn eine drastische Umkehr nicht sofort erfolgt. Stattdessen hat sein Gewicht bei der letzten Untersuchung die Sturmmarke von 170 Kilogramm überschritten. Jetzt muss einfach wirklich Schluss sein! Markus ist seit zwei Wochen für eine Magenbandoperation angemeldet.
Während seine Mutter referiert, bohrt Markus seinen Blick so vollkommen starr ins Muster des knapp vor seinen Füßen endenden Perserteppichs, als müsste er es später aus dem Gedächtnis zeichnen können. Auch sein Oberschenkel wippt nicht mehr. Nur als sie sein Gewicht nennt, geht ein merkliches Zucken durch seine riesige Gestalt, so als würde er damit nicht nur entblößt, sondern gleichzeitig gezwungen, einer vor sich selbst verschleierten Realität ins Auge zu blicken.
Verdammt, der Junge tut mir echt leid! Wie kann ein 19-Jähriger nur in eine solche Situation geraten? Gleichzeitig wird mir immer unklarer, was Markus’ Mutter mit diesem Besuch gemeinsam mit ihrem Sohn eigentlich bezweckt. Was soll hier abgehen? Was will diese verzweifelte Mutter von mir? Ich bin zwar auch Ärztin und vermag das Puzzle seiner verschiedenen Befunde zu einem schlüssigen Bild zusammenzusetzen. Doch bewegt sich alles, was seine Mutter berichtet hat, außerhalb meiner medizinischen Fachgebiete. Meine Ausbildung als praktische Ärztin liegt lange zurück und im fachärztlichen Bereich bin ich in erster Linie Gynäkologin und nicht Internistin. Außerdem ist das hier eine psychotherapeutische Praxis. Warum eröffnet sie gerade mir das alles?
Noch bevor ich zu einer entsprechenden Rückfrage komme, wird sie dahingehend konkreter. »Das mit dem Magenband klingt ja jetzt wie eine Lösung!«, meint sie, doch ihr Tonfall hat etwas kämpferisch Herausforderndes, so als würde sie die zuvor getätigte Ansage nun in Frage stellen wollen. »Ich habe mich genau erkundigt. Es ist kein unbedingt kleiner Eingriff, aber, wie es scheint, trotz der Nebeneffekte unvermeidbar. Und natürlich nehmen dann auch alle, die so etwas bekommen, drastisch ab. Wobei auch Fälle beschrieben sind, bei denen es nur vorübergehend zu einer Gewichtsabnahme kommt.« Ihr Blick sucht jetzt den meinen, um für das, was jetzt kommen wird, Bestätigung zu finden. »Wissen Sie«, setzt sie im Unterschied zu ihrer vorigen sehr emotionalen Beschreibung der Situation ihres Sohnes nun bedeutend gefasster fort, »Markus’ Gewichtsproblem ist in Wirklichkeit nur die Spitze des Eisbergs, die Gestaltwerdung einer schwer beeinträchtigenden Entwicklungsproblematik.« Sie hält inne. Kurz ist es seltsam ruhig im Raum. Ein Moment gespannter Konzentration entsteht ganz unvermittelt, jene situative Einfrierung des Kommunikationsflusses, die wie ein Anhalten des Atems andeutet, dass das Folgende besondere Aufmerksamkeit verdient.
WARUM WIR EIN NEUES MENSCHENBILD BRAUCHEN UND WESWEGEN ES IN REICHWEITE IST
Eindeutig die beste aller Welten und dennoch ist die Kacke am Dampfen. Wir nehmen lieber gleich volle Fahrt auf …
»Sie sind also Kulturpessimistin.« Diesem Satz, zwar mit fragendem Unterton gestellt, aber als Festlegung gemeint, habe ich mich nach Erscheinen meines letzten Buches bei zahlreichen Gelegenheiten und Interviews stellen müssen. Damals habe ich es am Ende sozusagen als Ausblick geschrieben. Jetzt will ich es als Einleitung und damit als Leitidee für alles Folgende nochmals verdeutlichen: Wir leben in der besten aller Welten, die wir bisher schaffen konnten. Und wir dürfen stolz auf den zurückgelegten Weg sein. Also nicht einmal ein Hauch von Kulturpessimismus!
Machen wir einfach einen hemmungslosen Kassasturz unserer praktischen alltäglichen Lebenssituation und der Basiswerte unserer Kulturkonzeption als postmoderne Technologiegesellschaft am Beginn des dritten Jahrtausends. Nehmen wir einen Notizblock, zücken wir einen spitzen Bleistift und ziehen wir nur das Offensichtliche heran, um den vielen Zweiflern mit Überzeugung begegnen zu können. Wie sieht es mit all jenen Bedrohungen aus, die für alle bisherigen Generationen den Stoff für nachtschwarze Albträume und vernichtende Tragödien bereitgehalten haben?
Als Nummer eins betritt da der Hunger als zuverlässiger Begleiter während unserer gesamten Menschwerdung die Bühne. Und wir können feststellen, dass es so richtig bösen Hunger, den, der Eiweißmangelödeme hervorbringt und damit die berühmten Wasserbäuche der Biafra Kinder, die mir von Schwarzweißfotos meiner Kindheit in Erinnerung sind, Gott sei Dank zumindest zurzeit kaum mehr gibt, auch wenn 815 Millionen Menschen in manchen Zonen unseres Globus nach wie vor schwer mangelernährt und die sozial schlecht Gestellten in unseren Breiten vorwiegend fehlernährt sind. Mein Großvater, der als Zwölfjähriger als ältester der damals für bäuerliche Familien üblichen Schar von Kindern zu einem Bäcker in die Lehre gegeben wurde, hat mir noch erzählt, wie seine jüngeren Geschwister auf der Schwelle des Kleinsiedlerhäuschens seiner Eltern mit dem gestampften Lehmboden hungrig und mit großen erwartungsvollen Augen seiner geharrt hatten, da er manchmal die angebrannten Semmeln heimnehmen durfte. Diese wie alle anderen Szenen hohlwangigen Hungers sind im Dorf meines Großvaters mit seinen schmucken, heute trockenen und mit viel Fleiß und Krediten der Landesregierung sanierten Bauernhäusern mit ihren alten Arkadengängen ganz sicher nicht mehr zu finden. Stattdessen fahren alle in den nächsten größeren Ort, um dort je nach ihrer Börse zwar unterschiedliche Qualität, sicher aber ausreichend Kalorien einzukaufen. Es mag zynisch klingen, aber es sterben heute weitaus mehr Menschen an den Folgeerkrankungen von Übergewicht als an Hunger.
Als Nächstes können wir festhalten, dass wir jene große Geißel der Menschheit mit Namen Krankheit den unterschiedlichsten schrecklichen Peinigern der Vergangenheit bereits so erfolgreich aus der Hand genommen haben, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in unseren Breiten aus heutiger Perspektive durchwegs ein geruhsames Altern in der achten Lebensdekade erwarten lässt, ohne dass man damit gleich zur Rarität wird. Vor etwas mehr als 150 Jahren hat unter anderem die Arbeit des genauso großartigen wie bemitleidenswerten Dr. Ignaz Semmelweis für diesen Fortschritt den Grundstein gelegt. Semmelweis hat die Macht des damaligen Medizin-Establishments herausgefordert, das sich nicht die Hände waschen wollte. Er ist zwar an der Ignoranz seiner Kollegenschaft seelisch zerbrochen und wahrscheinlich sogar über den Umweg der Psychiatrie aktiv zu Tode gebracht worden, doch seine Erkenntnisse über Hygiene haben sich durchgesetzt und sind heute nahezu allen Menschen auf diesem Globus in ihrer Bedeutung nachvollziehbar, eine fixe Grundbastion jeder Krankheitsabwendung. Unsere unstillbare Neugier hat Antibiotika und Hochtechnologiemedizin hervorgebracht. Der damit verbundene Forscherelan hat uns in Einsichtsebenen zu den Zusammenhängen von Krankheiten, ihrer Entstehung und Bekämpfung katapultiert, die noch vor wenigen Generationen schlichtweg Science-Fiction gewesen wären. Das, was noch kommen wird, könnte zwar bedingt durch die Bruchlinie ökonomischer Potenz nur Eliten zugänglich werden, ist aber für jeden aus der heute erwachsenen Generation vom Prinzip und den Möglichkeiten her sogar noch weit mehr als Science-Fiction.
Auch wenn Ebola oder Vogelgrippe in uns planetare Endzeitvisionen hervorrufen, die uns kurz erschauern lassen: Die erfolgreiche Bekämpfung von Epidemien haben wir in der Hand, um nicht zu sagen im kleinen Finger. Und das trotz noch nie dagewesenem globalen Massentourismus. Man braucht das zum Beweis nur mit der großen Grippewelle um die Jahrhundertwende zu vergleichen. Diese soll immerhin noch bis zu hundert Millionen Menschen das Leben gekostet haben.
Große Naturkatastrophen, also Erdbeben, Sturmwinde oder Tsunamis, Zeiten, in denen der Globus sich streckt und uns zeigt, wer wirklich Herr im Haus ist, versuchen wir zumindest vorherzusagen. Im Wiederaufräumen und damit der Schadens- und Leidensbegrenzung sind wir unbestritten ebenfalls die beste aller bisherigen Menschheitsgenerationen.
Wenn wir dann etwas tiefer hinein in den weicheren Schichten unseres kollektiven Seelenlebens schürfen und zu Tage fördern, wie wir unser soziales Leben als Gemeinschaft organisieren, so zeigt sich hierbei ebenfalls Erfreuliches. In der Entwicklung des gesetzlichen Regelwerks als Träger der gesellschaftlichen Werte, also im Umgang miteinander, ist uns grundsätzlich zu attestieren, dass wir einen Weg hin zu Milde und Respekt, zumindest dem menschlichen Leben gegenüber, gemacht haben. Nehmen wir nur die Zeit Maria Theresias her. Sie würde heute gerade mal ihren 300. Geburtstag feiern. Die zu ihrer Zeit durchwegs angestrebte »hohe Pein« wurde aufgehoben. Von Maria Theresia wird berichtet, dass sie angeblich mit ihrer Kutsche an einem Richtplatz vorbeigefahren und von dem dort herrschenden Grauen und dem Gestank derart berührt gewesen sein soll, dass sie eine entsprechende Strafreform anregte, die größere Milde vorsah. Das hieß natürlich nicht, dass eine beherzte Neustrukturierung des Rechtssystems beheizte Gefängnisse hervorgebracht hätte oder die Todesstrafe aus dem damals geltenden Recht verschwunden wäre. Aber immerhin wurde in der Folge zumindest nicht mehr im Gesicht oder auf der Stirn gebrandmarkt. Übrigens: Bevor Maria Theresia intervenierte, hat man auch in unserer Gegend noch gerne aufs Rad geflochten. Um dies tun zu können, musste man zuvor systematisch alle großen Knochen brechen. Unglaublich aus heutiger Sicht, aber vor ein paar Generationen waren wir hierzulande nicht wirklich zart besaitet. Das gilt nebenbei gesagt für ganz Europa.
Und wenn wir uns dann aufmachen und noch weiter, ganz tief hinab ins Untergebälk unseres gemeinschaftlichen Selbstverständnisses steigen und mit unserer Fackel jenen letzten Raum ausleuchten, wo unsere intimsten Grundwerte im sicheren Tresorraum des uns steuernden kollektiven Unbewussten gelagert werden, so finden wir zu unserer großen Freude und vor ein paar Generationen noch genauso unvorstellbar ebenda die Grundtrias von Frieden, Freiheit und Selbstverwirklichung für jeden als Ecksteine unserer gemeinsamen heutigen Identitätskonstruktion. Beflügelnderweise ist uns dies nicht nur mit der Feder des erhobenen Zeigefingers ins schöngeistige kollektive Stammbuch geschrieben, um gleichzeitig unerreichbares Ideal zu bleiben. Vielmehr sind wir mit aufgekrempelten Hemdsärmeln und der uns als Spezies eigenen Begeisterungsfähigkeit auch am Umsetzen unserer Grundüberzeugungen dran. Auch da dürfen wir ruhig etwas genauer hinschauen.
Zum Thema Frieden liest sich die Erfolgsstory der postmodernen Technologiegesellschaft, zumindest was unser Territorium betrifft, wirklich beeindruckend. Dass jedem Menschen dieser Gesellschaft Friede heute grundsätzlich als hohes Gut gilt, ist sonnenklar, ja selbstverständlich. Selbst die scharfzüngigsten Ideologen würden grobe Schwierigkeiten haben, uns davon abzubringen. Wir haben den Frieden einfach als Topkriterium im Organigramm unserer Wertepyramide aufgehängt, als einen der drei Engerln auf der Spitze des Christbaums. Den durchschnittlichen Österreicher lassen heute Religionsfragen oder politische Ideologien, wenn deren Durchsetzung den Frieden bedrohen würde, völlig kalt. Und Gott sei Dank auch die meisten anderen Europäer, zumindest die, die das Sagen haben. Sollte die katholische Kirche zum Beispiel den Zölibat abschaffen wollen oder zu einem handfesten Kreuzzug sagen wir mal nach Syrien aufrufen, fast niemand wäre bereit, dafür auch nur ins kalte Wasser zu springen, geschweige denn in den Krieg zu ziehen. Und auch abseits von Religion, in handfesten politischen, nationalen Streitigkeiten sind wir nicht so weit zu erregen, dass Tschechows Annahme »Wenn im ersten Akt ein Gewehr an der Wand hängt, wird es bis zum letzten Akt abgeschossen!« noch gelten würde. Wir setzen heute auf eine andere Methodik: die der Verhandlung. Wer heute versuchen würde, ernsthaft und glaubwürdig zu versichern, dass bereits untrügliche Zeichen an der Wand stünden, dass Italien mobilmachen wolle, um Österreich oder gar Deutschland den Krieg zu erklären, müsste damit rechnen, nicht als politischer Prophet, sondern als eine im Freigang befindliche Person aus einer psychiatrischen Abteilung angesehen zu werden.
So selbstverständlich dies heute klingt, so sehr war Frieden als Zustand der Gesellschaften in Mittel- und Westeuropa vor weniger als hundert Jahren noch mehr als eine Unterbrechung von Kriegen anzusehen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg und dem NS-Regime ist der Frieden hierzulande eine Grunderwartung geworden, auf der man Pläne für die Zukunft zuverlässig gründen kann. Bei den bewaffneten Auseinandersetzungen anderswo sehen diverse Studien in den letzten Jahren eine gleichbleibende Tendenz. Europa sticht als die friedlichste Region weltweit heraus. Der Weg, den wir bis hierher, zu unserer heutigen, allgemein gegebenen Grunderwartung von Frieden, zurückgelegt haben, ist einfach unleugbar großartig. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und verdanken dies großartigen Denkern und Architekten des Friedenskonzepts. Es handelt sich um einen echten Erfolg, einen echten Fortschritt. Unsere Kinder haben nun sogar die Chance, sich zunehmend, durchgehend und grundsätzlich als Europäer und sogar globale Bürger der Weltgemeinschaft mit Weltmitverantwortung zu empfinden. Und hier sind eben nicht nur die Kinder von intellektuellen Eliten in ihren Elfenbeintürmchen gemeint, sondern alle Kinder. Wenn wir es richtig machen! Das soll hier gleich angemerkt werden. Denn genau um dieses Richtigmachen geht es in diesem Buch. Dieses Buch soll das Bewusstsein für den richtigen Weg und das entsprechende Handeln schärfen. Für die gerade heranwachsende Generation wollen wir ein gelungenes Leben in einer Gesellschaft ermöglichen, in der Frieden, Freiheit und Selbstverwirklichung ganz oben stehen und für alle gelten. Das geht jeden an: Eltern und Großeltern, Pädagogen, Politiker und jeden, der sich als aktiver, am Leben teilnehmender Mensch, also als Bürger erlebt.
Doch was sich in meiner Praxis abspielt, bereitet schweres Kopfzerbrechen …
In die gespannte Stille hinein knarzt mein Sofa ganz leise, als würde es stöhnen. Dabei bewegt sich der Riese auf ihm nicht ein bisschen. Er sitzt da, die Hände auf den Knien, wie ein überdimensionierter Buddha und zeigt nicht die geringste Regung.
»Alles hat vollkommen fein begonnen«, beginnt seine Mutter zu erzählen und fügt noch spöttisch hinzu: »Man könnte sogar sagen, es war nahezu ideal, wenn man das gängige, uns aufgeprägte Ideal romantischer Liebe heranzieht.« Die ersten Takte ihrer persönlichen Schicksalssymphonie klingen dann auch tatsächlich nach einer großen klassischen Melodie, die jedem Ohr zu schmeicheln vermag. Durch Fleiß und Intelligenz fällt sie bereits früh auf und schafft den Sprung nach Wien an die Universität aus ihrem kleinen Dorf, das eingemauert zwischen den umgebenden steilen Bergwänden einer beeindruckenden Landschaft liegt, aber sonst für Frauen nur schlecht bezahlte Jobs im saisonalen Gastronomie- und Hotelbetrieb als Übergang bis zur Heirat anzubieten hat. Als Laune des Schicksals könnte man es bezeichnen, dass sie nach Jahren letztendlich wieder in dieses Dorf zurückgekehrt ist. Ausgerüstet mit einem etwas rebellischen Wesen erscheint ihr nach der fünfjährigen Frauenoberschule samt Matura die soziologische Fakultät in Wien mit ihrer bunten Studentenschar und den diskussionsbereiten Professoren als aufklärerischer Tempel gegenüber der engstirnigen Zwangsgesellschaft ihres Heimatorts. Wir bewegen uns am Ende der achtziger Jahre. Das alte politische Gleichgewicht des Schreckens zwischen Ost und West löst sich zu jener Zeit gerade auf, Gender rangiert ganz oben auf der intellektuellen Speisekarte und »grün« wird als Hauptwort großgeschrieben. An der Uni trifft sie Georg, Spättrotzkist, aber bekehrungsbereit, weich, alternativ und allen alten Männlichkeitsentwürfen bereitwillig abschwörend, fast zwei Meter groß, ohne wesentlichen Muskelansatz, dafür mit philosophischem Wallebart und allgemein anerkanntem wortgewaltigen Auftreten. Außerdem gilt er an der Fakultät als Exot. Georg ist gelernter Koch-Kellner und stammt wie Brigitte, Markus’ Mutter, die mir an dieser Stelle erstmals ihren Vornamen verrät, ursprünglich aus einem kleinen Dorf, nur liegt seines in Oberösterreich, nicht in der Steiermark. Die soziale Herkunft verbindet mehr, als man wahrhaben möchte. Im harten zweiten Bildungsweg hat er es bis hierher an die Fakultät geschafft. Damit spannt er einen Bogen zu den sogenannten täglich Werktätigen, der ihn fast in die Nähe jener gerade vom kommunistischen Regime befreiten Werktätigen des ehemaligen Ostblocks rückt. Auf jeden Fall zählt sein Wort in allen Diskussionsforen zur zukünftigen Entwicklung des ehemaligen Ostens besonders und lässt ihn nahezu charismatisch wirken. Auch so kann man historischer Gewinner werden. Als in seiner tabulosen WG ein Zimmer frei wird, zieht sie dort ein, stellt sich den soziologischen Selbstversuchen der Hinterfragung von Verpaarung und erliegt letztendlich Georgs verhaltenem Charme in einer dauerhaften Beziehung. Das senkt zuerst einmal die Kosten und fühlt sich dann auch endlich wieder normal und angekommen an in dieser so neuen, verwirrenden Welt. Die beiden studieren und diskutieren noch viel heftiger, engagieren sich mannigfach politisch im Speziellen und weltanschaulich ganz allgemein. Sie jobben, um sich über Wasser zu halten. Ein Soziologiestudent, der in Mindestzeit studiert, würde sein Fach verraten. Brigittes Eltern werden zunehmend nervös. Sie hätten ihre Tochter sowieso lieber in einem Lehramtsstudium gesehen. Knapp nach ihrem siebenundzwanzigsten Geburtstag hat sie dann endlich einen positiven Diplomabschluss und einen ebensolchen Schwangerschaftstest in der Tasche. Georg reagiert auf die bevorstehenden Vaterfreuden in erster Linie berührt, um nicht zu sagen rührselig und auch Brigitte verbindet mit dem Thema Kinderkriegen zuallererst romantische Vorstellungen. In der aufblühenden, von Wiedervereinigung geprägten gesellschaftlichen Stimmung der neunziger Jahre werden als Leitwerte guter Kindererziehung die Freiheit und Potenzialentwicklung des zukünftigen Erdenbürgers ganz großgeschrieben. Mit dieser neuen Erziehungshaltung als Königspfad sollen sich quasi über die Hintertreppe auch die vorderen Plätze der Lebensbühne, jene der großen Erfolgreichen, sicher betreten lassen. Das leuchtet ein. Denn wer, wenn nicht der, der das tut, was er wirklich will und wirklich gut kann, wäre prädestinierter, ganz vorne mitzuspielen. Das wollen schließlich alle für ihre Kinder in deren zukünftigem Erwachsenenleben. Zumal damals bei aller Freude über die Demontage autokratischer Systeme schon ansatzweise spürbar ist, dass es knapp werden könnte im Rattenrennen um die besten Plätze. Eine von immer rascheren technologischen Fortschritten durchwachsene Zeit mit von allen Seiten pausenlos nachdrängenden vielen Menschen führt zu dieser Zukunftssorge irgendwo in der unbewussten Hochrechnung, die alle Eltern als gefühlte Vorausschau in sich tragen. Die resultierende Zielsetzung der Eltern ist nicht ganz neu. Bei genauerer Betrachtung ist dieses »fit for life« sogar ein ziemlich verschlissener alter, aber bewährter Hut. Neu ist nur die Erziehungsmechanik, die verspricht, angeblich genau dorthin, zu den besten Plätzen, führen zu können. Nicht antiautoritär soll Erziehung jetzt geschehen, also nicht als schnöder Gegenentwurf zum früheren autoritären Erziehungsmodell, das immer noch in einzelnen traditionell strengen pädagogischen Enklaven oder in eigenen biographischen Bruchstücken als schmerzhafte Erinnerung haust. Vielmehr soll sich Erziehung gleichsam von selbst im Vertrauen auf die Selbstentwicklung, mit dem Kind als Taktgeber, ergeben. Das Kind wird als eine Art »emerging theory« begriffen. Eltern übernehmen die Rolle von beobachtenden, aufmunternden und benötigte Mittel zur Verfügung stellenden Begleitfahrzeugen, die Ausrüstung und Nachschub für die Reise liefern. Die Gesellschaft fungiert als eine Art Warner Brothers oder Paramount Pictures Studio für die Inszenierung des Drehbuchs der Selbstentdeckung. Klingt irgendwie sehr gut, sehr frei und sehr schmeichelhaft. Vor allem, dass jeder Mensch ein ganz besonderes, unwiederbringliches, einzigartiges Geschöpf ist, kommt damals ganz groß in Mode. Das gefällt natürlich Eltern, die durchschnittlich nur mehr knapp unter 1,5 Kinder produzieren. Da muss einfach jedes ein Besonderes sein. Brigitte liegt im Trend der Zeit. Und wer, der sich als ernsthafter Mensch im Spiegel wiedererkennen möchte, könnte sich auch so einfach über das gefühlte gesellschaftliche Grundverständnis in dieser Frage von richtiger Erziehung hinwegsetzen, während der eigene Bauch schon Melonenform annimmt. Ein paar Alte vielleicht, wie Brigittes Großmutter, die die Bekanntgabe der Schwangerschaft mit einem trockenen »Zeit war’s und g’heirat g’hört« kommentiert, um sich dann wieder Wichtigerem, eben dem Holzmachen, zuzuwenden. Brigitte will nichts falsch machen. Sie liest jede Menge Schwangerschaftsratgeber und erste Erziehungshandbücher und findet viel heraus. Zum Beispiel über die natürliche Weisheit von Kindern, die sie laut Beobachtungen bei Naturvölkern sogar schon im Krabbelalter davor schützt, in einen Abgrund zu stürzen. Ebenso ermutigend klingt, dass jedes Kind über ein zuverlässiges, inneres Selbstregulationssystem verfügt, das so ziemlich für jede Lebenslage richtigen Rat wüsste. Da ist also ein zuverlässiger Taktgeber, so man ihn nicht zerstört, indem man dem Kind Rhythmus und Zeitabläufe von außen aufdrängt. Das beeindruckt, klingt plausibel und legt gleich auch einen Vergleichsmaßstab für gute Elternschaft fest, den nur mehr Unsensible missachten können. Sorgsame Beobachtung des einem anvertrauten und durch einen selber geschaffenen Wunders liegt als Idealkurs nahe, auch deswegen, um rasch bei der Hand zu sein, um dem Keim eines an die Oberfläche brechenden Talents oder zumindest einer potenziellen Neigung möglichst frühzeitig zum Durchbruch verhelfen zu können. Alles ist bereits im Kind angelegt, muss nur zum Vorschein kommen, sich entpuppen dürfen. Brigitte und Georg ist rasch klar, dass das Ganze vom Start her richtig aufgesetzt werden muss. Natürlich machen sie gemeinsam die Geburtsvorbereitung, lernen richtig atmen und hadern damit, ob sie sich für die sanfte Geburt in einem Geburtshaus oder eine richtige Hausgeburt entscheiden sollen. Es kommt dann alles ganz anders, als Brigitte in der 34. Schwangerschaftswoche plötzlich Fruchtwasser verliert und im Spital aufgenommen werden muss. Ein Nabelschnurvorfall bringt die Seifenblase romantischer Geburtsphantasien zum Platzen. Stephan, Markus’ älterer Bruder, wird per Notkaiserschnitt in einem chromglänzenden, sterilen Operationssaal unter grellem Scheinwerferlicht geboren. Gott sei Dank, wie sich später herausstellt, gesund, wenngleich sehr zart, wird er dem bangenden Georg für kurze Momente in die Arme gelegt, bevor ihn der Neonatologe kassiert und unter seine Fittiche nimmt.
»Wir wollten es einfach wirklich richtig machen mit unserem Kind«, hält Brigitte Rückschau, »besonders nach dem unerwartet dramatischen Start. Stephan ist immer bei uns im Bett gelegen und entweder hatte Georg ihn im Tragetuch oder ich.«
Den unvermeidbaren Umstellungen für die Anforderungen des Lebens mit einem Säugling und den neu hinzukommenden Rollenanforderungen will das junge Elternpaar sehr offen und partnerschaftlich begegnen. Doch der ökonomische Druck belastet schwer und bricht immer wieder in Gestalt von unbezahlten Rechnungen in die familiäre Idylle ein. Letztendlich finden sich Georg und Brigitte, an der soziologischen Fakultät Speerspitzen zum Thema Gender, im pragmatischen Design traditioneller Rollenbilder wieder. Georg hat einen Job in seinem früheren Grundberuf angenommen und Brigitte bezieht Karenzgeld. Mit Sommerbeginn, Stephan ist jetzt gerade sieben Monate, wird dieses Lebenskonzept für beide zu eng. Eine Tour mit ihrem zum Wohnmobil umgebauten, alten VW-Studentenbus wird für beide mehr als nur eine Urlaubsreise. Es wird ein Ausbruch aus dem Würgegriff gesellschaftlicher Verhältnisse. »Wir waren naiv und wollten frei sein«, erläutert Brigitte, »frei für unser Kind. Das war uns vor allem im Hinblick auf Stephan und seine unbehinderte Entwicklung wichtig.« Georg hat von alten Studentenkontakten von einer Kolonie ähnlich denkender Menschen, die in den Pyrenäen in Tipis wie Indianer leben, gehört. Beide fahren mit ihrem Kind und viel Erwartung im Herzen dorthin. Doch als die Sommermonate in diesem wildromantischen Ambiente zu Ende gehen, der erste frühe Frost scharfe Zähne zeigt und Georg und Brigitte erkennen, dass die in dieser Gruppe etablierten tribalistischen Sozialstrukturen recht weit entfernt von den vorgegebenen demokratischen, gemeinschaftlichen Ideen wurzeln, ist für beide klar, dass eine Rückkehr in die beheizte Bürgerlichkeit vorzuziehen ist.
Manchmal kommt das Leben ganz unerwartet daher. Dann trifft einen die Erkenntnis der grundsätzlichen persönlichen Bedeutungslosigkeit im Gesamtkosmos derartig durchgreifend und niederschmetternd, dass ein Festhalten an der zuvor vermeinten Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz nahezu unmöglich erscheint. So muss es Brigitte und Georg gegangen sein, als sie das traf, was keine Mutter oder Vater zu Ende denken wagen: »Es war auf dem Rückweg«, hält sie sich an den Fakten fest. Ihre Stimme hat jenen tonlosen Klang, der andeutet, dass der Sprecher darum ringt, emotionale Distanz zum Erzählten zu halten. »Wir waren bereits in Italien und todmüde. Wir haben uns einen guten Platz zum Stehenbleiben und Übernachten auf einem beleuchteten Parkplatz gesucht. Ich habe Stephan gestillt und er ist an der Brust eingeschlafen. Er ist zwischen uns auf der Matratze gelegen. Am Morgen war er einfach tot.« Stephan ist neuneinhalb Monate, als er am plötzlichen Kindstod verstirbt. Georg und Brigitte bleiben starr und ohnmächtig zurück. Beide müssen durch eine strenge polizeiliche Untersuchung. Die Obduktion von Stephan wird angeordnet. Obwohl nach Wochen endlich die behördliche Bestätigung kommt, dass kein Fremdverschulden vorliegt, sehen sich Georg und Brigitte bei der Beisetzung ihres Kindes nicht nur Anteilnahme gegenüber. Vor allem von Georgs Familie kommen massive Vorwürfe wegen des Aufenthalts in den Pyrenäen. Besonders Brigitte wird wegen einer vermeintlichen Nichterfüllung ihrer Mutterpflichten angegriffen.
Fünf Monate später ist Brigitte wieder schwanger. Georg reagiert diesmal in seiner Freude gedämpft, er hat den Tod des Sohnes bei weitem noch nicht verkraftet. Doch Brigitte ist rasend in ihrem Kinderwunsch. »Obwohl mir klar war, dass ein totes Kind nie und nimmer durch ein neues ersetzt werden kann, war ich manisch von dem Gedanken erfasst, wieder Mutter werden zu müssen. Es war, als würde da ganz tief in mir und trotzdem außerhalb meiner Steuerung, abseits meiner Vernunft, ein Programm ablaufen, das auf nichts anderes ausgerichtet war, als ein Kind zu produzieren. Es war wie eine Fernsteuerung. Jeden Morgen bin ich schon mit diesem Gedanken aufgewacht. An keinem Kinderwagen konnte ich vorbei, ohne zu denken: Das will ich auch wieder. Das muss ich haben«, beschreibt sie ihre damalige Haltung freimütig. Diesmal bleibt nichts dem Zufall überlassen. Die Schwangerschaft unterliegt einer durchgerasterten, lückenlosen Überwachung und Markus wird vorsorglich per Terminkaiserschnitt »geholt«. Auch in den ersten beiden Lebensjahren ist Markus die Praxis seines Kinderarztes wegen zahlreicher rückversichernder Untersuchungstermine wesentlich vertrauter als anderen Kindern, die nur entlang der Leitlinie der vorgesehenen Impf- und Mutter-Kind-Pass-Termine dort aufkreuzen. Brigitte entwickelt sich zu einer Mustermutter, pädagogisch stets auf dem allerletzten Erkenntnisstand und in jedem das Thema Kind auch nur annähernd streifenden Lebensbereich grundsätzlich am Ball.
… und dennoch ist die Kacke am Dampfen
Die Kinder der postmodernen Globalisierungsgesellschaft wachsen so behütet wie noch keine Generation vor ihnen auf. Von der Empfängnis über Schwangerschaft bis zur Geburt bestimmen Planung, Überwachung und Optimierung ihr Werden. Und dann geht es erst richtig los. Wirklich bewusste Eltern haben schon längst und ausgiebig das Internet nach einem originellen Namen für ihr Kind durchforstet. Über dessen identitätsspendende Bedeutung wissen sie Bescheid. Und auch sonst wird viel und früh gefördert. Musisches Talent wird geweckt, wo es vielleicht noch schlummern wollen würde. Kreativkurse werden belegt, sobald das Babyschwimmen erfolgreich absolviert ist. Die neoliberale Gesellschaft spannt individuelle Förderung und maximale Wahlfreiheit als neue Paradigmen auf und bietet damit Schirmherrschaft für die neue Betriebsmechanik gelungener Elternschaft. Die neuen Paradigmen bieten massig Platz für wohlredende Experten und zwielichtige Geschäftemacherei, womit wiederum Eltern unter Druck geraten können. Lang schon lernen Kinder nicht mehr zwischen Wünschen und Bedürfnissen zu unterscheiden. Diese entscheidende Differenzierung den Kindern beizubringen, haben viele Eltern aufgegeben. Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Doch in einer Zeit, in der nichts mehr fix, alles möglich und der Ausgang ungewiss ist, werden Orientierung und Klarheit zur Mangelware. Eltern reagieren stark verunsichert.
Eltern sollten zuallererst Beziehungsexperten für ihr eigenes Kind werden und dabei eigenen Hausverstand, Herz und Hirn zu Rate ziehen. Stattdessen vertrauen sie zunehmend auf äußere Vorgaben und Erfüllungsnormen, die es zu absolvieren gilt. Für diese Vorgaben findet sich stets eine Fülle gefälliger Referenzen, so die entsprechenden Studien gut bezahlt wurden. Unter dem Deckmantel von Freiheit und individueller Förderung wird daraus ein übles Spiel. Eltern und Pädagogen wird der Platz des Steigbügelhalters zugewiesen, der dafür verantwortlich ist, ob dieses Kind einmal sicher im Sattel sitzen wird. Ein hoher Druck lastet auf allen Protagonisten. Jedes Kind muss ein »besonderes« sein, ein Prinz oder eine Prinzessin, ein Einstein oder Bernstein oder sonst eine Größe, die in ihm schlummert. Dass diese Größe vorhanden ist, steht vorderhand außer Zweifel. Alle Beteiligten wirken poliert und enthusiastisch, denn all der Aufwand und die Investitionen müssen aus sich selbst sinnbegründend sein. Platz für Verzweiflung ist erst nach Mitternacht, dann wenn unsere anonyme Online-Beratung seit fast einem Jahrzehnt traditionell die meisten Zuschriften erhält. Das Kind mutiert zum Geschäftsfall, der entsprechend der vorgegebenen Leitlinie korrekt abgehandelt wird und an dem so mancher Industriezweig gut verdient. Damit ist auch die Haftungsfrage wie schon auf TÜV-zertifizierten Spielplätzen, Gott sei gelobt, gleich mitbehandelt. Nur schade, dass diese wohldesignten Anlagen kein richtiges Kind wirklich hinter dem Ofen hervorzulocken vermögen.
Und auch die Institutionen geraten unter Druck. Nicht unbedingt nach entwicklungspsychologischer, aber dafür nach wirtschafts- und damit gesellschaftspolitischer Ansicht sollen Institutionen immer früher ins Leben unserer Kinder treten. Wirklich punkten kann eine frühkindpädagogische Einrichtung heute allerdings nur mehr mit Native Speaker zur frühestmöglichen Sprachförderung und extracurricularem Angebot, auch wenn diese Leistungen im neuen Dienstleistungsverständnis von Kinderentwicklung und Erziehung extra zu bezahlen sind. Das schafft natürlich weiteren Druck und Neid, vor allem bei jenen, die sich das ganze Karussell rund ums Kind nicht leisten können. Soll es auch. Und die öffentlichen Einrichtungen, da in ihrem Dunstkreis natürlich jede Menge Wahlvolk herumlungert, bemühen sich dann, ganz schnell nachzuziehen. So schnell, dass sie ihren eigentlichen Auftrag, jenen der ersten Sozialisation zu einer friedlichen Gemeinschaft, bei all der Portfolioarbeit und individuellen Förderung und Selbstbestimmung des Kindes gar nicht mehr reflektieren können. Dafür wird vorsorglich sensorisch integriert, motopädagogisch vorgestellt und zur Logopädie überwiesen, damit auch alles als bedacht erfasst ist. Die Kindergartenpädagoginnen sollen so lückenlos dokumentieren, dass sie gar keine Zeit mehr finden, all die Übungen und Anforderungen umzusetzen, selbstredend natürlich individuell und auf das einzelne Kind hin zugeschnitten.
Etwas später halten dann schlaue Pädagogen haufenweise Arbeitsblätter bereit und achten auf transparente Notengebung nach ausgefeiltem Punkteschema, um am Elternsprechtag vor den Angriffen von Eltern geschützt zu sein, die sich in Didaktik eingelesen haben. In ihrer kargen Freizeit träumen diese Pädagogen von durchgerasterten, zentralen Übungs- und Prüfungsvorgaben nicht nur zur Zentralmatura. Wer seine Burnout-Prophylaxe ernst nimmt, macht Dienst nach Vorschrift. Denn es könnte gefährlich werden, sich auf Schüler einzulassen, wenn es schiefläuft sogar bis zu parlamentarischen Anfragen führen. Wer will das schon durchstehen müssen. Da müsste man schon eher zum Revolutionär geboren sein und nicht zum Lehrer.
Noch dazu muten die Kinder heute rasch sehr widerspenstig und bereits sehr früh ganz seltsam erwachsen an, auch wenn sie es ganz im Gegenteil oft viel weniger sind als Gleichaltrige früherer Generationen. Manche vermögen sogar ihren Harndrang zu Schuleintritt noch nicht einmal über die unendliche Strecke einer gesamten Schulstunde zu regulieren und bestehen getreu dem Ideal der Selbstbestimmung fünfmal auf der Pipibox. Das Chaos fliegender Blätter und sich auflösender Unterlagen sowie unüberblickbarer Abgabetermine für Hausaufgaben beherrscht für viele den Schulalltag dann auch noch in Zeiten, in denen sie als Jugendliche bereits Ausgehmöglichkeiten verhandeln. Dafür verfällt der Gebrauch eines differenzierten Wortschatzes zunehmend, was allerdings in den wirklich wichtigen Lebensräumen der Social Media nicht auffällt und durch Emojis ausreichend ersetzbar erscheint. Und sinnerfassendes Lesen ist sowieso nur mehr etwas für Streber.
Betrachten wir das ganze Treiben rund ums Kinderkriegen und Kindererziehen unter den gängigen Gesichtspunkten von Nützlichkeit und Zielerreichung. Sieht so das Profil erfolgreicher Zukunftsgestalter aus? Oder betrügen wir unsere Kinder, indem wir das Konsumentenlied einer Spaßgesellschaft bereits an ihrem Kinderbettchen summen, wahnhaft meinen, einen besonderen Genius in ihnen finden zu müssen und das Training antiquierter Sekundärtugenden für verzichtbar erklären? Wenn sie dann schlecht vorbereitet in der harten Realität der hinter der Spaßgesellschaft auf sie wartenden Steigerungsgesellschaft aufschlagen, eröffnet sich in ihrer mangelnden Selbsterhaltungsfähigkeit die ganze Misere ihrer verbrauchten Kindheit. Dann enthüllt sich, dass unsere Gesellschaft wirkliche Achtung und echten Schutz der Lebensphase Kindheit über Bord geworfen hat und diese stattdessen verwaltet und als Industriezweig vielfach ausbeutet.
Übergewichtig und essgestört, von vielerlei Verhaltensauffälligkeiten geplagt, von Schlafstörungen gezeichnet, leistungsverweigernd und dafür chillbewusst, sich von der Gesellschaft abwendend, noch bevor sie ihren eigenen Platz einnehmen konnten und vielfach nicht zu bändigen oder tyrannisch in ihrem Auftreten, so treten uns immer mehr Kinder und Jugendliche entgegen. Das Zustandsbild eines nicht unerheblichen Prozentsatzes unserer Kinder gibt zu denken. Es nützt nichts, dies zu verleugnen. In Kindergartengruppen und Schulklassen ist die Befundlage mehr als eindeutig. Wer es gerne wissenschaftlich verbrämt hat, braucht sich nur die gerade in die Fachöffentlichkeit entlassene, erste österreichweite epidemiologische Studie zur Häufigkeit psychischer Erkrankungen in der Altersgruppe der 10- bis 18-Jährigen ansehen: Knapp 24 Prozent der Kinder und Jugendlichen dieser Altersgruppe leiden aktuell an einer psychischen Erkrankung. 36 Prozent geben sogar an, nach eigener Einschätzung schon einmal eine psychische Störung gehabt zu haben. Prost Mahlzeit! Unsere armen Kinder! Jedes einzelne dieser beeinträchtigten Kinder ist eines zu viel. Die postmoderne Technologiegesellschaft entfernt sich augenscheinlich immer weiter von »artgerechter Haltung und Aufzucht« ihrer Kinder.
Die Tyrannenkinder sind die lautesten, die uns die Misere mit ihrem Verhalten als großen Spiegel ins Gesicht drücken, damit wir als Gesellschaft unsere Fratze der Verantwortungslosigkeit erkennen. Den Kindern stehen Schutz, Geborgenheit und Leitung als Grundrechte zu. Die Tyrannenkinder stoßen uns vor den Kopf, damit wir wahrnehmen, wie wir sie in einem grausamen Disneyland alleine lassen. Sie sind die wahren Dissidenten dieser Gesellschaft, Propheten, die unsere erwachsene Generation zur Handlung aufrufen und dazu, endlich unsere Verantwortung zu übernehmen. Sensitiv, sensibel und wahrnehmungsstark, wie die meisten von ihnen sind, ausgerüstet mit einem starken Grundempfinden für Gerechtigkeit und Werte, jedes von ihnen Veteran einer persönlichen Geschichte des Im-Stich-gelassen-worden-Seins, steckt gerade in diesen Kindern ein Schatz: der starke, unabschüttelbare Aufruf, die Gesellschaft und deren Marschrichtung neu zu überdenken. In diesem ihrem Auftreten, dessen eigentliche Botschaft es zu dechiffrieren gilt, steckt der Code zum notwendigen neuen Menschenbild. Dass sie uns oft an den Rand der Verzweiflung und die Grenze unserer Belastbarkeit zu bringen vermögen, unterstreicht nur die Dringlichkeit. Denn jedes einzelne Kind kann für die Zukunft entscheidend sein.
Die Menschheit ist das extremste Phänomen auf diesem Globus. Unseren Ahnen war einst die Position irgendwo in der Mitte der Futterkette zugedacht. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit und für kein anderes Wesen auf diesem Planeten nachahmbar ist es dem Homo sapiens gelungen, sich in die oberste Spitzenposition zu katapultieren. Vergleichsweise in der Periode eines Wimpernschlags sind seit unseren Anfängen Bevölkerungszahl, Wirkmächtigkeit und Geschwindigkeit des Technologiefortschritts explodiert. In der Verschraubung dieser Wirkfaktoren hat der Mensch diesen Globus nicht nur zu einem einzigen Ökosystem zusammengeschweißt. Durch sein Wirken erscheinen auch alle Pufferkapazitäten der Natur nahezu ausgereizt. Wenn Agent Smith aus Matrix in der berühmten Szene des Verhörs von Morpheus den Menschen mit einem sich raubtierhaft ausbreitenden Virus vergleicht und als Krankheit, als Krebs der Erde und eine Plage beschreibt, scheint es, als hätte er recht. Doch er unterschätzt den Menschen, beschreibt damit nur den bis gerade eben von der Evolution favorisierten, weil bisher überlebenstüchtigen Homo sapiens bestialis. Dieser muss jetzt durch ein neues Menschenbild ersetzt werden, soll unsere Spezies weiter im Rennen bleiben. Denn weder Mauern noch Waffen vermögen das Ungleichgewicht auf unserem Planeten auf Dauer in Schach zu halten, noch eine drohende Erschöpfung der Natur aufzuhalten. Vieles weist darauf hin, dass nur das Mindset des Homo sapiens socialis, des integrierten, sozialen Menschen, dasjenige sein wird, das dem weiteren Bestehen unserer Art auf diesem Globus den Weg zu bereiten vermag. Und alleine die Gesetze der Evolution, die nur den tatsächlich Fittesten, der die wirklichen Anforderungen begreift, bevorzugen, haben das letzte Wort.
Ein Quantensprung, ein immer wieder in unserer Entwicklung als Menschheit aufgetretenes Phänomen, muss her, diesmal einer des Denkens. Auf den Schultern der kommenden Generation wird die gesamte Verantwortung dafür lasten und sie braucht Vorbereitung für ihre Aufgabe. Die Tyrannenkinder spüren den gravierenden Mangel an Vorbereitung, also Erziehung, am stärksten.
Dieser Text möchte ein Plädoyer für die Utopie der Entwicklung des Homo sapiens socialis sein. Dieser neue Mensch ist bei genauem Hinsehen bereits in vielen bewussten Menschen sichtbar: sowohl als Forderung als auch in gelebten Ansätzen eines respektvollen Grundumgangs mit sich selber, mit anderen und mit den Ressourcen der Natur.
Außerdem befasst sich dieser Text mit der praktischen Realität der Vorbereitung unserer Kinder, also mit dem Thema Erziehung im Zeitalter von Globalisierung und Hochtechnologie. Wie können wir mit der nächsten Generation vermehrt reflexive, kollaborativ agierende, kommunikationsgewandte Teamspieler hervorbringen, die ihre Hand stets am Puls von Natur und Gesellschaft haben? Wir werden Menschen benötigen, die es vermögen, ihr eigenes Kompetenzprofil angepasst an die jeweiligen neuen Anforderungen umzugruppieren. Die es verstehen, rangierend, je nach Inhalt, Führung und Position sinnvoll und mutig Aufgaben zu übernehmen und auch wieder an den Nächsten weiterzugeben, statt in konkurrenzorientierten Grabenkriegen ihre Energien zu vergeuden.
Wie müssen wir die Tyrannenkinder ansprechen, um ihnen den richtigen Wirkraum eröffnen zu können, der ihrem eigentlichen Potenzial entspricht? Was müssen wir tun, damit nicht noch mehr Kinder diesen steinigen Weg gehen müssen, statt leichtfüßig in die tatsächliche Kraft einer integrierten Persönlichkeit zu kommen?
Eltern und Familie, Institutionen und Politik, ja jeder, der Weltbürger sein möchte, muss die Verantwortung für unsere Kinder spüren und sie ernst nehmen. Das hoch interdependente, biosoziale Ökosystem Erde wird immer komplexer. In einigen Jahren wird nur mehr der Homo sapiens socialis im Zusammenwirken von Hand, Hirn und Herz in der Lage sein, die zum Wohle von Menschheit und Umwelt richtigen und notwendigen Entscheidungen zu treffen. Das ist meine Überzeugung!
Für alle jene, die davon ebenso überzeugt sind, habe ich diesen Text geschrieben und für alle jene, die bereit sind, darüber ernsthaft zu diskutieren.
Die Familie als potenzielles Schlachtfeld
»Ich möchte Ihnen unsere Geschichte schonungslos offen erzählen«, betont Brigitte. »Und danach sage ich Ihnen, was ich von Ihnen in Bezug auf meinen Sohn möchte.«
Ich habe es für heute endgültig aufgegeben, in dieser Begegnung mit Markus und seiner Mutter noch die Spielregeln einer Therapiesitzung realisieren zu wollen. Ich muss mir sogar meine Aufregung eingestehen, vielleicht anhand der Geschichte, wie sich Markus und seine Familie im Strom ihrer Biographie durch diese Gesellschaft bewegt haben, Einblicke in jenes verschraubte Übergangsfeld zu bekommen, in dem Gesellschaft und Individuum miteinander im Ringen liegen. Also lehne ich mich jetzt einfach zurück und folge dieser Einladung, ihren inneren Seziersaal zu betreten, um der anatomischen Freilegung der Misere beizuwohnen. Möge kommen, was da wolle. Wir haben noch knapp eine halbe Stunde Zeit.
Georg, der als Soziologe nicht wirklich adäquat Fuß fassen konnte, ist über die Rolle des Familienerhalters im Familienleben zunehmend in den Hintergrund getreten. Nicht ganz unfreiwillig, denn irgendwie gelingt es ihm nicht, sich auf das neue Kind so unbeschwert einzulassen wie auf das erste. Eine feine Bruchlinie zeichnet sich in der Beziehung zwischen Georg und Brigitte ab. Als Georg für sieben Monate auf einem Kreuzfahrtschiff anheuert, sieht Brigitte in erster Linie den positiven wirtschaftlichen Aspekt dieses Engagements. Nach Georgs Rückkehr ist aus der Bruchlinie in der Beziehung ein solider Graben geworden. Markus ist inzwischen dreieinhalb Jahre alt, ein aufgewecktes Kleinkind, gewohnt, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und verwöhnt zu werden. Der Kindergartenbesuch steht vor der Tür. Die Eingewöhnung gestaltet sich als äußerst schwierig, weil Markus stark an seiner Mama hängt, der Kindergarten anderseits auf ein rasches Verabschiedungsritual drängt. Gott sei Dank bietet Graz diverse pädagogische Alternativen und nach zwei weiteren Versuchen findet sich nach einem turbulenten Jahr endlich eine feine, wenngleich teure, private Kindergarteninitiative. Markus steht einfach gern im Zentrum der Aufmerksamkeit, kann kaum zurückstehen und ist leicht gekränkt, wenn andere nicht so wollen wie er. Dann fällt es ihm schwer seine Enttäuschung zu kontrollieren. Er spuckt und beißt, was zwar nicht mehr seinem Lebensalter entspricht, aber ganz genau dazu passt, dass es ihm auch an jeglicher Ausdauer für Spiele fehlt; von den Anforderungen, die ein Puzzle an ihn stellt, ganz zu schweigen. Brigitte ist heilfroh und Georg bezahlt es zähneknirschend, dass in der endlich gefundenen Einrichtung alles »spielerisch« und vom Kind selbst reguliert abläuft.