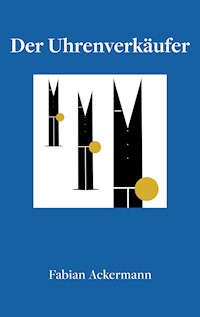
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie kann es gelingen, als Verkäufer erfolgreich zu sein, ohne die eigene Persönlichkeit preiszugeben? Diese Frage geht dem 16-jährigen W., Auszubildender im zweiten Lehrjahr bei einem Züricher Luxusjuwelier, nicht mehr aus dem Kopf. Seine anfängliche Faszination für die exklusive Umgebung, die edlen Produkte und die wohlhabenden Kunden ist einem Gefühl der Ernüchterung gewichen. Es fällt ihm immer schwerer, die von ihm erwartete und präzise einstudierte Rolle als charmante Verkaufsmaschine zu spielen. Nicht gerade die besten Voraussetzungen, um einen herausfordernden Arbeitstag unbeschadet zu überstehen... Und so müssen wir W. in seiner Luxusboutique zurücklassen. Still mit der Frage ringend, ob alle um ihn herum verrückt sind ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Über den Autor
Anfänge
Chinesische Kundschaft
Bahnhofstraßenposer
Das klassische Schweizer Kunden-Ehepaar
Der, dem die Welt etwas schuldet
Die alte Dame und das Mädchen
Die glücklichen Verkäufer
Der Uhrenbegeisterte
Über den Autor
Fabian Ackermann wurde 1992 in Thalwil geboren und blieb trotz vieler Umzüge im Jugendalter dem linken Zürichseeufer treu. Er arbeitet als Verkäufer und unterrichtet nebenbei Englisch in Zürich. Die im Lauf seines Werdegangs im Luxussegment gesammelten Eindrücke sowie die daraus resultierenden Konflikte prägten ihn maßgeblich und veranlassten ihn zur Niederschrift der vorliegenden Erzählung. Als Stellvertretender Geschäftsführer taucht er noch heute tagtäglich in die sonderbare Welt des Luxusuhrenverkaufs ein, was seiner Prosa Authentizität und letztlich, zumindest in Teilen, den Charakter eines kleinen Feldberichts verleiht.
Anfänge
Es fiel W. nicht leicht, mit knapp sechzehn Jahren zu entscheiden, welchen Berufsweg er einschlagen sollte. In einem Alter, wo ein Teil der Kinderspielsachen noch griffbereit rumliegt und die Pubertät sowie die dazugehörende Selbstfindung gerade erst begonnen hat. Manchen seiner Klasse machte das keine Mühe. Sein Freund Konrad, der schon in der dritten Klasse gerne Tabellen und Grafiken zu allem Möglichen angefertigt und im Rechnen alle vorgeführt hatte, entschied sich für eine Lehre zum Bankkaufmann. – Damit schaffte er es in die Liga der kaufmännischen Ausbildungen, des sagenumwobenen »KV«. Konrads Mutter ohne Schulabschluss schüttelte es vor Stolz und der Vater schwoll vor Freude derart an, dass sich seine Hausmeistergoldkettchen in die Handgelenke gruben.
Auch W.s Freund Quentin bereitete die Berufswahl keine großen Schwierigkeiten. Dem Computer- und Videospielenthusiast war klar, dass er Informatiker werden würde. Dank seiner guten Noten war es ihm mühelos möglich, einen der begehrteren Ausbildungsplätze zu ergattern. Quentins Vater versuchte, sich für ihn zu freuen, obwohl er realisierte, dass sein Sohn den kränkelnden Familienbetrieb nicht weiterführen würde.
Nach und nach waren alle in W.s Klasse mit einer Lehrstelle oder zumindest einer Perspektive für nach dem zehnten Schuljahr versorgt. Übrig blieb nur er. Der Zweitkleinste der Klasse. Laut ersten Rückmeldungen der Mädchen trotzdem relativ gut aussehend und deshalb bereits mit einem nicht zu unterschätzenden Maß an Eitelkeit und Gönnerhaftigkeit ausgerüstet. Ein Scheidungskind ziemlich erfolgreicher Eltern und mit einer acht Jahre älteren Schwester gesegnet, die es ebenfalls ins elternhausdurchrüttelnde KV geschafft hatte. Im unteren Notendurchschnitt rumtänzelnd und in seinen Talenten augenscheinlich so mittelmäßig, dass niemand so recht wusste, was er denn beruflich machen könne. Nichts stach heraus. Nichts war erkennbar. Weder für seine Eltern und Lehrer noch für seine – es werden im Lauf der Jahre ein halbes Dutzend gewesen sein – Tagesmütter. Er verbrachte etappenweise mehr Zeit auf dem Flur der Schule als im Klassenzimmer, ohne dass man sich am jeweils folgenden Tag noch hätte erinnern können, wieso man ihn eigentlich rausschicken musste. Es war W.s charmante Verstohlenheit, die ihn bei Bedarf entweder ins beste Licht rückte oder ihn, sofern Ärger drohte, vor nachhaltigen Bestrafungen verschonte. So kam es auch, dass W. mehrmals auf dem Flur vergessen wurde und dort in einer Gemütsruhe ganze Vormittage mit seiner portablen Spielekonsole verbachte, ohne den Unterricht ernsthaft zu vermissen.
W. blieb letzten Endes nichts anderes übrig, als so viele Berufe anzuschauen wie möglich. Dank einer ausgeprägten Videospielesucht, die seine ganze Sekundarzeit andauerte, hatte er, abgesehen davon, wie viele Gegner sein Stufe-siebzig-Blutelf-Hexenmeister im schwarzen Tempel umhauen konnte, keine wirklichen Interessen, die in der realen Welt hätten nützlich sein können. Deswegen fokussierte man sich bei der Wahl einer geeigneten Lehrstelle besonders auf handwerkliche Berufe, wobei man hoffte, sie könnten den chronisch Uninteressierten wenigstens mit der praktischen Tatsache, etwas mit eigenen Händen erschaffen zu haben, begeistern. Und tatsächlich war es dann auch so, dass W. in den meisten Handwerksbetrieben während seiner Probearbeit überzeugen konnte. Dies lag nicht zuletzt an seinem auffallend guten Benehmen, das in den meisten Handwerksbetrieben, wo die Mehrheit der jungen Bewerber noch nicht in der Lage war, einen vollständigen Satz zu bilden, eine absolute Rarität war und sogar teilweise über die eine oder andere Unzulänglichkeit seiner handwerklichen Fähigkeiten hinwegtäuschen konnte. Diese Tatsache bescherte ihm ziemlich früh auf seiner Lehrstellensuche die ersten konkreten Angebote, die er aber allesamt – man hatte ja noch genug Zeit, um etwas Besseres zu finden – ablehnte, was bei seinen Lehrern immer mehr die Vermutung aufkommen ließ, W. nehme seine Berufswahl auf die leichte Schulter. Denn in Wahrheit war es so, dass jenes Eintauchen in die verschiedenen Handwerksberufe für W. eher eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag darstellte und er sich zu keinem Zeitpunkt wirklich darüber Gedanken machte, ob er den Beruf, den er gerade zur Probe ausübte, wirklich erlernen wollte. W.s unausgesprochene Kommentare zu den verschiedenen Arbeitsabläufen waren dabei nicht, wie man es von einem zukünftigen Uhrmacher, Schreiner, Zahntechniker oder Bäcker erwarten würde, »spannend« oder »beeindruckend«, sondern gingen eher in Richtung »witzig« und »überraschend praktisch gedacht«. Seine Gefühle glichen denen einer stolzen Schlossherrin, die sich, indem sie zwischendurch ihren Angestellten in der Küche beim Karottenschälen half, ein wenig zu erden versuchte. Trotz allem hätte er sich beinah in einer berühmten Zürcher Confiserie zum Bäcker und Konditor ausbilden lassen. Er zeigte viel Begeisterung fürs kunstvolle Verzieren von Torten und das Herstellen der verschiedenen Canapés. Dabei legte W. eine Fingerfertigkeit an den Tag, über die er selbst erschrak. Dinge schön aussehen zu lassen, war sein neu entdecktes Talent, das ihm, in Kombination mit seinem tadellosen Verhalten gegenüber den Kollegen und Vorgesetzten, einmal mehr problemlos zu einer Lehrstelle verholfen hätte. Er zog auch ernsthaft in Betracht, diese Lehre anzutreten, jedoch wurde ihm am dritten Tag seines Probearbeitens seine Eitelkeit zum Verhängnis. Er musste seine auf einem Blech drapierten Canapés durch den Gastraum – an allen Tischen vorbei – zur Verkaufstheke bringen. Auf seine Frage, ob er sich dafür zuerst seiner Bäckerklamotten entledigen und die privaten Kleider anziehen dürfe, reagierte sein Chef auf Zeit mit großer Verwunderung und verneinte knapp mit: «Für so was haben wir keine Zeit hier.» W. hatte sich noch nie zuvor so geschämt wie an diesem Tag. In seinem verschwitzten Kittel, der karierten Bäckerhose und mit der durchsichtigen Plastikhaube auf dem Kopf ein Tablett durchs gehobene Zürcher Publikum zu balancieren, war ein wahr gewordener Alptraum. W. war den neugierigen Blicken der gelifteten Ehefrauen und den abschätzigen Seufzern ihrer hübschen Töchter schonungslos ausgeliefert. In diesem Moment vergaß er die komplette handwerkliche Leistung, die für solche schönen Canapés verantwortlich war, und der kleine Funke von heranwachsendem Berufsstolz war in diesem kurzen Augenblick der Exponiertheit wieder erloschen.
Als Mensch war W. noch so unfertig, dass zehn Sekunden vermeintlichen Nichtcoolseins ausreichten, um das Angebot der Lehrstelle überzeugt abzulehnen. Die Entschlüsse und Urteile waren damals schnell gefällt. Mangelnde Erfahrung glich W. mit der Einbildung aus, bereits klare und unerschütterliche Prinzipien zu haben.
Auch weitere Berufseinstiege schlugen fehl. Etwa weil es als Technischer Zeichner nicht schlecht gewesen wäre, einfache Dreisätze im Kopf zu können, oder weil es in der Autogarage seines Patenonkels hieß, dass so ein Fünfundzwanzig-Zoll-Rad schon ziemlich schwer für einen schmächtigen Kerl wie ihn wäre. Auf die Frage, ob sein knapp sechzigjähriger, knorriger Arbeitskollege die Hebebühne für ihn etwas herunterlassen könnte – es wäre ihm nämlich bequemer so –, wurde auch hier wieder mit Verwunderung reagiert. In diesem Fall hatte es zusätzlich die Strafe zur Folge, dass er zwei Stunden unter dem aufgebockten Auto verbringen, mit einem waagerecht ausgestreckten Arm eine komplette Auspuffanlage am Herunterknicken hindern und mit der anderen Hand seinem Kollegen mit der Taschenlampe leuchten musste, der am vorderen rechten Rad hantierte. Als der ihn anwies, ihm einen Kaffee zu holen, fragte W., ob er in der Zwischenzeit den Auspuff festhalten könne. »Das ist nicht nötig«, hieß es, worauf W. loslief, um den Kaffee zu besorgen. Es dämmerte ihm erst Jahre später, dass es das tragende Teil, das er unter schmerzenden Krämpfen in seiner ungelenken Pose zu vertreten glaubte, gar nicht gab. Schon damals war ihm der Gedanke unmöglich, dass es jemand nicht gut mit ihm meinen oder in seinem Tun eigene, niedere Ziele verfolgen könnte.
Alles schien für W. darauf hinauszulaufen, die komplett selbst verschuldete Extrarunde in Form des zehnten Schuljahres anzutreten. Zu seiner Rettung kam ein letztes Arbeiten auf Probe als Detailhandelsfachmann in einem der renommiertesten und berühmtesten Uhren- und Schmuckgeschäfte an der Zürcher Bahnhofstraße. Zur Egomassage der Schüler und Eltern war der Beruf »Verkäufer« damals schon in »Detailhandelsfachmann« unbenannt worden, und den Lehrern der Gewerbeschule wurde es körperlich unwohl, wenn man Formulierungen wie »einfacher Verkäufer«, »Ein zweiwöchiger Einführungskurs hätte es auch getan« oder »Auffangbecken« in den Mund nahm.
W.s Mutter war Kundin in diesem Geschäft und hatte bei ihrer Stammverkäuferin, die gleichzeitig Patientin in ihrer Praxis war, ein gutes Wort eingelegt. W. war schnell überzeugt, diese Gelegenheit wahrzunehmen. Die schwarzen Lederschuhe wurden rasch geputzt, der Konfirmationsanzug bereitgelegt. Dass weiße Socken zum Anzug ein absolutes No-Go waren, war W. nur so halb bekannt, und so stand er wenige Tage später um Punkt 9:30 Uhr vor dem Laden in schwarzem Anzug, rosa Kurzarmhemd, schief gebundener Krawatte und eben dicken, weißen Tennissocken und wartete, bis der Sicherheitsmann den Sicherheitsrolladen hochgezogen hatte. Dieser Ort war alles, was er sich je hätte träumen können. Hier konnte er seine Begeisterung für schönes Handwerk ausleben – nicht als echter Handwerker in verschwitzten Kleidern, sondern als schicker Anzugträger, als Vermittler schönen Handwerks. Die Boutique strahlte eine Atmosphäre eleganter Geschäftigkeit aus. Die Verkäufer und Verkäuferinnen waren allesamt aufs Äußerste herausgeputzt und schwebten über den italienischen Marmor, als trügen sie Rollschuhe. Auf den Bedientableaus balancierten sie keine Canapés oder Schwarzwälder Kirsch-Torten, sondern Uhren und Juwelen erster Güte. Diese wurden der in beigen Ledersesseln sitzenden Kundschaft mit einer wohlwollenden Direktheit angepriesen, ohne auch nur für den Hauch einer Sekunde aus dem Takt zu geraten oder die Zeichen, die sich aus der Körpersprache der potenziellen Käuferschaft ergaben, zu übersehen. Es war dieses Wachsein, dieses Gespür für Konversation, Reaktion und gegebenenfalls Frieden erhaltenden Konter, das W. enorm beeindruckte. Die Detailhandelsfachleute saßen ebenfalls auf edlem Leder, jedoch war es kein bequemer Sessel, sondern ein etwas zu tiefer Schemel. Dies sollte zu einer klaren Hierarchieordnung beitragen und verhindern, dass zum Beispiel ein Kunde bei der Realisierung, dass sein Visavis einen Dreitausend-Franken-Anzug trug, in größere Verlegenheit geriet, sondern selbst als gegebenenfalls hemdsärmeliger Macher immer noch die unsichtbare Oberhand behielt. Sie ließen ihre mit Samthandschuhen umschmeichelten Hände so elegant über die sündhaft teuren Schmuckstücke gleiten, dass es eine Freude war, zuzuschauen. Der in warmes Licht gehüllte Raum wurde von einer schicken, gerade im richtigen Maß wahrnehmbaren Jazzmusik aus unsichtbaren Lautsprechern beschallt. In der Mitte des Geschäfts stand ein massiver Jugendstil-Springbrunnen, der zugegebenermaßen ziemlich kitschig war, aber das Geschäft war seit den Siebzigerjahren nicht mehr von Grund auf renoviert worden, weshalb auch das Geplätscher dieses Brunnens zum Gefühl des alten Glanzes von früher dazugehörte. Untermalt wurde die Geräuschkulisse von gedämpft geführten Unterhaltungen, die nur hie und da vom etwas zu lauten, ja bald derben Herauslachen eines russischen Oligarchen am oberen Ecktisch unterbrochen wurden. Höchst diskret wurde sein Champagnerglas von nun an nur noch zur Hälfte nachgefüllt. Niemand hätte ihn je gebeten, sich zu mäßigen, denn damals gab es die Obergrenze von einhunderttausend Franken für Barzahlungen noch nicht.
Die Boutique war ein von der hektischen Außenwelt abgeschnittener Mikrokosmos von Schmeicheleien, flüchtigen Blicken zum Nachbartisch, funkelnden Diamanten und als gediegene Jovialität verkleideten Machtspielen. Der ganze Raum schien zu atmen und alle Personen wie ein in sich verschlossener Organismus aufeinander zu reagieren. An fünf Tischen wurde die Kundschaft beraten. Das klare Konzept war die sogenannte Vollbedienung. Hierhin kam man als Kunde nicht zum Durchschlendern, zumal eine gewisse Verbindlichkeit still vorausgesetzt war und bei Bedarf diskret vermittelt werden konnte. Die berühmtberüchtigte Schwellenangst der Kundschaft wurde zum Machtinstrument eines schwächelnden Sekundarschülers, zum in Nadelstreifen gehüllten Aufstieg an die Speerspitze der tieferen Einkommensklasse.
Dies war der Ort, an welchem W. die nächsten zehn Jahre verbringen sollte. Der Ort, der ihn von nun an formte. Dass nicht jeder Tag so angenehm verlaufen würde wie sein Probetag, sollte W. bald herausfinden.
Chinesische Kundschaft
Es ist Samstag, 9:55 Uhr. In Kürze öffnet das Geschäft. W., in dunkelblauem Zweireiher, weißem Hemd und gepunkteter Krawatte, steht am Empfang. Das seidene Einstecktuch mit größter Sorgfalt so zurechtgerückt, dass es gerade diese fünf Millimeter weiter aus der Brusttasche herausschaut, als es im »New Knigge«, den er sonst wie seine Bibel behandelte, vorgeschrieben ist. Durch diese Entschärfung seiner sonst so gestriegelten Aufmachung verspricht er sich, seinem Auftritt eine romantische Note zu geben. Leicht lässig, mit dem linken Ellenbogen an den neuen Empfangstresen gelehnt, stellt er den einen Fuß auf die Spitze und damit die hochglanzpolierten Double-Monks zur Schau. Sie sind brandneu, W. hat sie sich trotz des Fiaskos während der letzten Sommerferien – er hatte vergessen, das Datenvolumen seines Mobiltelefons abzustellen: siebenhundert Franken Auslandsgebühren – geleistet. Man gönnt sich ja sonst nichts, und man möchte schließlich mitmachen. Ein kurzer, oberflächlicher Schwatz mit dem Sicherheitsmann, der seine erste Amtshandlung vorbereitet: die Entriegelung der Tür. Smalltalk beherrscht W. bereits. Er ist unterdessen im zweiten Lehrjahr. Sprachgewandt und sich mit Vorliebe als Traumschwiegersohn verkaufend, kokettiert er allzu gern mit der Tatsache, als Schweizer das unbestreitbar berühmteste Schweizer Produkt zu verkaufen. Und dann noch an der teuersten Straße der Welt, wie es heißt. Manchmal auch nur Europas. Mal liegt London vorn. Ganz egal, hier geht was. Während seines ersten Jahres hat er sich eine kleine, aber treue Stammkundschaft erarbeitet, die vor allem aus lokalen Kunden besteht. Vorwiegend sind es männliche Bankiers oder Juristen, die sich über einen jungen Glücksritter, wie W. einer war, amüsieren und bei einem Besuch gut und gern mal ihre vierzigtausend Franken ausgeben. Einen Teil mit Kreditkarte, einen Teil in bar. »Das Geld muss unter die Leute.« Wahrscheinlich erinnert W. sie an ihre eigenen Anfänge. Auf die Idee, dass er weder ab der sechsten Klasse im Elite-Internat gewesen noch nach dem anschließenden Jurastudium in der Anwaltskanzlei von Dads – man sprach ja Englisch zu Hause – Kumpel unter dessen Fittiche genommen worden war, kommen sie gar nicht.
Bemerkenswerterweise ist W. aber ohne jegliche Ressentiments. Ohne Neid. Nein, er bewundert die, die es ins Gymnasium geschafft hatten und eine höhere Karriere anstreben. Den Hass auf die »Bonzen«, die in der Nähe seiner Schule aufs Privatgymnasium gehen, spielt er nur, um vor den Freunden zu bestehen. Selbst als er mit selbigen auf den saftig grünen Fußball- respektive Rugbyplatz der Private English School urinierte – ins Detail soll hier nicht gegangen werden –, stierte er fasziniert von unten in die Klassenzimmer hinauf. Er konnte die perfekt gepflegte Stuckatur erkennen und einen Lehrer mit Hornbrille dabei beobachten, wie er eine Formel auf die Wandtafel schrieb. So etwas hatte und würde er in seinem Unterricht nie zu sehen bekommen. An seiner Schule war man einfach froh, wenn alle eine Lehrstelle ergattert hatten.





























