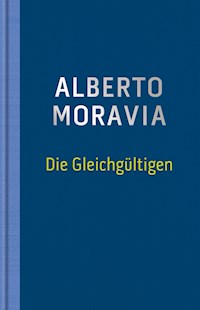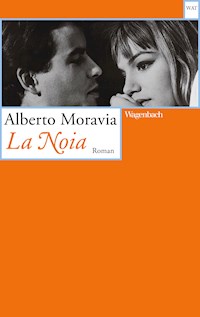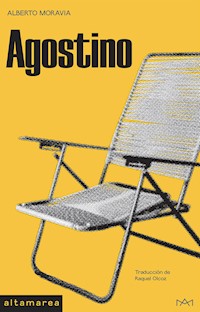Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Luca, 15 Jahre alt, fährt mit den Eltern nach den Sommerferien am Meer zurück nach Rom, die Schule beginnt, aber seine Welt ist alles andere als in Ordnung: Ein seltsamer Widerwille gegen alle Dinge beschleicht ihn, und er begibt sich in eine innerliche Opposition zu allem, was ihn umgibt: die wohlhabenden Eltern, deren Fürsorge er fortan zurückweist, der Unterricht, die Freunde – alles wird ihm langweilig, alle Bindungen sind ihm lästig und zuwider. Seinen Besitz verschenkt er an ihm vollkommen gleichgültige Personen, was ihn mit finsterer Freude erfüllt. Zwei Frauen befreien Luca aus seiner Todessehnsucht: Die eine, das Kindermädchen seiner Cousinen, sorgt für sein erotisches Erwachen, die andere, eine Krankenschwester, die ihn nach langem Fieber gesundpflegt, wird seine erste leidenschaftliche Liebe. Der Ungehorsam ist einer der schönsten Romane Alberto Moravias. Meisterhaft beschreibt er in wenigen Sätzen das gutsituierte römische Milieu und die aufgewühlte innere Welt des jungen Luca. Messerscharf beobachtet und mit untergründigem Witz erzählt – ein Buch zum Wiederlesen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus dem Italienischen von Lida Winiewicz.
Die italienische Originalausgabe erschien erstmals 1955 unter dem Titel La disubbidienza bei Bompiani in Mailand, die deutsche Erstausgabe 1964 im Verlag Kurt Desch in München, Wien und Basel.
Die Übersetzung wurde für diese Ausgabe neu durchgesehen.
E-Book Ausgabe 2019© RCS Libri S.p.A., Milano / Bompiani 1948–2010
© 2010, 2019 für die deutsche Ausgabe: Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin Covergestaltung Julie August unter Verwendung eines Filmstills aus Der Ungehorsam mit freundlicher Genehmigung der Stiftung Deutsche Kinemathek. Autorenphoto © Isolde Ohlbaum. Das Karnickel zeichnete Horst Rudolph. Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 9783803142566
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 2645 0
www.wagenbach.de
Die Ferien waren vorüber. Luca hatte sie am Meer verbracht, in der Sommerwohnung der Eltern, und nun, auf der Heimreise, war ihm, als sei etwas nicht in Ordnung, als stünde ihm eine Krankheit bevor. Der Fünfzehnjährige, in letzter Zeit merklich aufgeschossen, wirkte wie ein Mann mit schmalgebliebenen Schultern, bleichem Gesicht und beherrschenden, brennenden Augen. Sie schienen die fahle Stirn, die eingefallenen Wangen gleichsam verzehren zu wollen.
Luca bat die Eltern nicht, der Schule fernbleiben zu dürfen. Der Gedanke streifte ihn nicht einmal. In einem Alter, da es näherliegt zu empfinden, als das Empfundene zu werten, stellte er zwischen verminderter Widerstandskraft und der Abneigung zu lernen keinen Zusammenhang her. Er war sich seiner Geschwächtheit ebensowenig bewußt wie der Gefahren, die sie für ihn barg. Er ging seit jeher zur Schule. Es schien ihm selbstverständlich, weiter zur Schule zu gehen. Manchmal allerdings war ihm, als sähe er den Lernstoff nicht über das Schuljahr verteilt, nach Schultagen aufgegliedert, sondern vor sich aufgetürmt, ein ragendes Gebirge, dessen glatte Felswände keine Angriffsfläche boten. Es fehlte ihm nicht an Willen. Eher an Spannkraft, an Mut: Der Körper ließ ihn im Stich wie ein erschöpfter Gaul, dessen verzweifelter Reiter vergebens die Sporen gebraucht.
Luca hatte zu jener Zeit Wutanfälle, die, scheinbar grundlos, gewittergleich losbrachen und seine verbliebenen Kräfte in wütendem Rasen aufzehrten. Meist entzündeten sie sich an der stets neuen Erbitterung über den träg-stummen Widerstand lebloser Gegenstände oder, genauer gesagt, dem Zorn über die eigene Unfähigkeit, sich ihrer zu bedienen. Ein schlecht zugeschnürter Schuh, die trotz Verfolgungsjagd verpaßte Straßenbahn, verschüttete Tinte, der Schmerz – jäh und heftig, wenn Luca, ein Buch in der Hand, das er aufgehoben hatte, den Kopf an die Tischkante stieß –, derlei Nichtigkeiten brachten ihn außer sich. Dann fluchte er, knirschte mit den Zähnen, ja vergaß sich manchmal soweit, den Tisch mit Fäusten zu schlagen, die Tintenflasche zu zerschmettern oder in Tränen auszubrechen, in ein verzweifeltes Schluchzen, das, dem Anlaß nicht entsprechend, unverstandener Ausdruck vergessenen Leides zu sein schien. Die Welt war ihm feindlich gesonnen, und er haßte die Welt seinerseits, führte Krieg gegen sie, gegen alles, was ihn umgab. Diese Aufsässigkeit der Dinge sowie sein Unvermögen, ihrer Herr zu werden, trat während der Ferien täglich auf neue Art zutage. Und besonders ein Zwischenfall überzeugte Luca, daß zwischen ihm und dem Leben keine Einigung möglich war.
Luca bastelte gern. Wann immer es Pannen gab, wandte man sich an ihn. Eines Abends verlosch das Licht: Kurzschluß. Die Mutter rief laut nach Luca. Er nahm sein Werkzeug, tappte durch das Dunkel zu ihr und fing an herumzuhantieren. Plötzlich – hatte er es versäumt, die nötigen Vorkehrungen zu treffen, hatte er unbedachterweise den Stromkreis zu früh geschlossen –, wie dem auch gewesen sein mochte, Strom jagte durch seinen Körper. Luca schrie auf, umklammerte jedoch – natürliche Reaktion – die Drähte nur desto fester. Die Mutter, außer sich, stand ratlos dabei; Luca brüllte, der Strom schoß durch seine Finger, mit einer bösartigen Kraft, die nicht dem Draht zu entströmen schien, sondern der ganzen Welt, jener feindlich-geheimnisvollen, die er nicht verstand und die er haßte. Endlich, nach langem Durcheinander, kam jemand auf den Gedanken, den Hauptschalter abzustellen. Luca öffnete mühsam die Hände, warf sich in die Arme der Mutter und weinte. Sie drückte ihn an sich und glättete zärtlich sein Haar, doch ohne rechte Überzeugung: Sie begriff nicht, warum er schluchzte. Luca weinte lange, am ganzen Körper zitternd, nicht zuletzt, weil er erkennen mußte, daß die Zärtlichkeit der Mutter ihn nicht mehr heilte wie einst. Es wurde licht. Luca besah seine Hände. Drei Finger waren versengt. Der Strom hatte sie versehrt, sein Zeichen in die Kuppen gegraben: drei winzige gezackte Blitze.
Der nächste Wutanfall ereilte Luca in der Eisenbahn, auf der Heimreise vom Meer. Er hatte das Frühstück, eine Schale lauwarmen schlechten Kaffees, im Morgengrauen hinuntergestürzt, inmitten von Koffern und Kisten, der Ungastlichkeit des Aufbruchs. »Iß ordentlich«, hatte die Mutter gesagt, über ihre Tasse hinweg, »im Speisewagen wird spät serviert.«
Die Aussicht, im Speisewagen zu essen, hatte Luca erfreut. An diesen Tischchen – er hatte sie oft schon in anderen Zügen bemerkt, bei Bahnhofsaufenthalten – aß man gewiß mit Behagen, mit Freude und Appetit. Brot, Suppe, Fleisch, von Kellnern gereicht, mit Messer und Gabel verzehrt, während der Zug das fliehende Land vor sich herjagte, mußten anders und besser schmecken. Luca litt unter Mißachtung, hielt viel auf äußere Form. Er haßte es aus tiefstem Herzen, im Abteil Reiseproviant zu essen, Pakete auf dem Schoß, aus fettigen Papieren Brötchen hervorzuziehen. Bei solchen Mahlzeiten fehlte es nie an stummen, verachtungsvollen Zeugen, die in der Absicht, den Speisewagen aufzusuchen, die Sandwichfamilie hoheitsvoll musterten. Die vornehme alte Dame zum Beispiel, auf der Fahrt in die Ferien … Wie mißbilligend hatte sie zugesehen. Luca hatte sich doppelt geschämt: daß er so essen mußte und daß er sich dessen schämte. Und vor lauter Demütigung war sein Appetit verflogen.
Nun, diesmal hieß es nicht, dick belegte Brote aus fettigen Papieren zu schälen. Ein angenehmer Gedanke. Luca saß lange Zeit ruhig und blickte zum Fenster hinaus. Der Speisewagenkellner kam, um die Platzkarten auszugeben. Der Vater schwieg. Luca dachte: wahrscheinlich beim zweiten Service – und betrachtete weiter die Landschaft. Da hörte er den Vater sagen: »Eigentlich könnten wir in Orvieto Proviant kaufen. Das ist wesentlich billiger, als in den Speisewagen zu gehen. Außerdem sind die Sachen, die man in den Körbchen bekommt, qualitativ viel besser.«
Der Vater sprach ruhig, leidenschaftslos, und Luca verstand sehr wohl, daß nicht Geiz die Überlegung bestimmte, sondern einfache Vernunft. Die Mutter, Sparmaßnahmen jederzeit zugänglich, sagte gleichmütig: »Wie du meinst. Eigentlich hätte ich lieber im Speisewagen gegessen. Man macht sich sonst die Hände so fettig.«
Zwei Erwachsene besprachen eine Nichtigkeit. Die Unterhaltung, gelassen-freundschaftlich geführt, endete mit dem Sieg des Vaters, einem so läppischen, so leicht errungenen Sieg, daß das Ganze eher an eine Übereinkunft gleichgestimmter Seelen gemahnte. Luca wußte genau, daß sich der Verzicht auf den Plan, im Speisewagen zu essen, nicht gegen ihn richtete. Trotzdem schoß Wut in ihm hoch. Und was ihn am meisten verletzte: Weder Vater noch Mutter fragten nach seiner Meinung, als wäre er ein Gegenstand, ein Ding, und auf Grund seiner Dinghaftigkeit keines Gedankens fähig, keiner Vorliebe, keines Wunsches. Seine Enttäuschung war um so tiefer, als er dem Aufenthalt im Speisewagen mit Freude entgegengesehen hatte. Und zu diesen Widrigkeiten gesellte sich eine weitere, die auf den ersten Blick mit der Speisewagensache nichts zu tun zu haben schien: der sonderbare Zorn, der ihn unweigerlich befiel, wenn Menschen oder Dinge sich seinem Willen widersetzten, der plötzlich, auf einmal, ausbrach wie ein uneindämmbarer Brand, ihn erfaßte und versengte. Luca wurde bleich, biß die Zähne zusammen, sein Körper versteifte sich. Einen Augenblick war er versucht, sich aus dem Zug zu stürzen. Die Anwandlung erschreckte ihn weder, noch schien sie ihm absurd: Das niederdrückende Bewußtsein der eigenen Machtlosigkeit suchte sich Luft zu machen. Er schlug die Augen auf, musterte seine Eltern, als sähe er sie zum erstenmal, als hätte die Wut, ein grelles, schmerzendes Licht, ihre Züge neu gezeichnet.
Da war die Mutter, blond, hager, mit einem kantigen Gesicht, dem die vorspringende Nase, der gerade, schmallippige Mund etwas Kluges, Herrisches verliehen; der Vater, ebenfalls blond, aber rundlich weich, mit sanften, gutmütigen Zügen, die zu verschwimmen schienen. Zum erstenmal war es Luca, als sei ihm das Wesen der Eltern – Härte und Tugend der Mutter, Vernünftigkeit, Wohlwollen des Vaters – nicht nur fremd, sondern geradezu feindlich, als wollte ihm nichts auf der Welt ihre Eigenschaften näherbringen, ja als erreichten sie ihn wie das Licht kalter, ferner Sterne, die sich jeder Annäherung entzogen. Wahrscheinlich wären die Eltern mit ihm in den Speisewagen gegangen – nach kurzem Sträuben der Mutter, die es nicht liebte, Beschlossenes zu widerrufen –, hätte er seinen Wunsch ausgesprochen. Aber er wollte die Eltern um keinen Preis zu Handlungen veranlassen, die sie, unbeeinflußt, nie und nimmer ausgeführt hätten. Die Heftigkeit seines Wunsches, im Speisewagen zu essen, störte und ärgerte ihn wie ein sinnloser Impuls, der keine Beachtung verdiente. Aber es ging längst nicht mehr darum, im Speisewagen zu essen oder nicht, sondern darum, daß jene Feindseligkeit, die ihm überall entgegenschlug, nun auch von den Eltern ausströmte. Das rückte sie von ihm weg, mochten sie ihn noch so sehr lieben, verwies sie in die Reihen der zu bekämpfenden Kräfte.
Lucas Zorn legte sich nicht. Der Zug hielt in Orvieto. Der Vater stieg aus – Luca sah ihm nach, mit äußerstem Widerwillen –, kaufte Proviant und kam atemlos zurück. Sorgfältig schloß er die Tür, hakte das Klapptischchen ein, setzte die drei Schachteln ab und fragte mit jener oberflächlichen, leicht weinerlichen Beflissenheit, die für ihn bezeichnend war: »Chino, bist du hungrig? Sollen wir jetzt essen? Oder möchtest du lieber warten?« Luca sagte, ohne sich umzuwenden: »Ich esse, wenn ihr eßt.« Der Zug setzte sich in Bewegung. Beim Anblick der Landschaft, die langsam, dann schneller vorüberzog, ließ Lucas Wut etwas nach. Aber auf einmal – er wußte nicht, wieso – überfiel sie ihn mit neuer Macht. Er konnte sich nicht mehr beherrschen, sprang auf, verließ das Abteil, ging geradewegs zur Toilette, betrat die Kabine und knallte die Tür zu. In dem Spiegel oberhalb des Waschbeckens sah Luca sein Gesicht, seinen weit aufgerissenen Mund, doch kein Laut kam aus seiner Kehle. Dennoch wußte er, daß er schrie, mit seinem ganzen Körper. Der Zug jagte voran, heftig, unaufhaltsam, durchratterte Weiche um Weiche. Alles klirrte, ächzte, die Achsen, die Scheiben, der Messingfensterrahmen, das Trinkglas in seinem Ständer – Hunderte Eisenteilchen wurden durcheinandergerüttelt. Und in dem Getöse stand Luca, verkrampft, gespannt, offenen Mundes, mit dem unsinnigen Gefühl, den Lärm zu überschreien. Der Zug – so erschien es ihm – war sein Zorn, war gestaltgewordene Wut, würde im nächsten Augenblick aus den Schienen springen, durch die Luft jagen und an den Hügeln zerschellen.
Endlich kehrte er ins Abteil zurück. Die Proviantschachteln waren offen. Der Vater, eine Zeitung über die Knie gelegt, bereitete Brötchen. »Für dich«, sagte er und reichte Luca das erste. Dann fragte er seine Frau: »Möchtest du den Wein jetzt? Aber vielleicht sollten wir zuerst essen? Dann haben wir die Hände frei.« Der Vater sprach zögernd, stockend, als sei er seit jeher gewöhnt, seine schüchternen Anregungen zurückgewiesen zu sehen. Luca, nicht im geringsten hungrig, nahm die zwei Hälften in Empfang – sie wölbten sich über kaltem fettem Fleisch – und biß voll Wut hinein, zwang sich zu essen, ohne die Eltern anzusehen. Er hörte Papier rascheln, die Stimme des Vaters, der, mit vollem Mund, seiner Frau Brote anbot, ihre einsilbigen Antworten. Luca würgte das Sandwich hinunter. Sein Zorn, jetzt zwar nicht mehr übermächtig, war darum nicht minder schmerzhaft in seinem chronischen Gleichmaß, als bliebe der Körper von nun an in alle Ewigkeit steif, der Geist für immer trübe. Luca sah zum Fenster hinaus. Das Reiseziel war nahe, aber er merkte es nicht. Das Brötchen lag in seinem Magen, als hätte er ein Paket verschluckt, einen Packen schlechtgekauten Zeugs, mit dem vergleichbar, was man Katzen zuwarf, die in den Lichthöfen umherstrichen.
»Was hast du?« fragte die Mutter und glättete mit leichter Hand sein windzerzaustes Haar. Die Kühle der Berührung tat Luca wohl. Aufsteigende Übelkeit hatte seinen Mund mit säuerlichem Speichel gefüllt.
Der Zug fuhr ein. Luca blieb sich selbst überlassen. Die Eltern hatten vollauf mit dem Gepäck zu tun. Und als sie endlich im Strom der Reisenden den stehenden Zug entlangschritten, wußte Luca, daß er erbrechen würde, und zwar schon in wenigen Sekunden. Der Drang, den Mund aufzutun, wurde von Schritt zu Schritt stärker, der ungute Geschmack nahm zu.
Noch ein Waggon. Noch einer. Jeder spie Menschen aus. Sie ließen in den leeren Abteilen Schachteln zurück, Papier, Säckchen, Flaschen, Zigarettenstummel. Ein dritter Waggon, schon leer, Fenster und Türen offen. Und jetzt die Lokomotive, riesenhaft, mit zahlreichen Hebeln versehen, gespickt mit Knöpfen und Röhren, der Kessel vor all dieser Schwärze ein rotes, offenes Maul. Der Heizer, ans Fenster gestützt, schaute auf die Menge hinab, mit geschwärztem, schweißglänzendem Gesicht. Er hielt ein Brot in der Hand – es war mit etwas Grüngelbem belegt –, und Luca mutmaßte: Hühnerfleisch und Spinat. Der Heizer biß herzhaft hinein. Bei diesem Anblick verstärkte sich Lucas Übelkeit, als seien zwischen dem Brei, den der Mann so gierig verschlang, und jenem, der in Lucas Magen gärte, Anziehungskräfte am Werk. Luca klammerte sich an einen Signalmast – sie hatten die Puffer erreicht –, beugte sich zu dem Leib der prustenden Lokomotive hin und erbrach.
»Ich wußte ja, daß dir nicht gut ist«, hörte er die Stimme der Mutter. Sie schien ihm erstaunlich ruhig. Dann fühlte er eine kühle Hand, die seine Stirn stützte.
»Es ist gleich vorbei – gleich vorbei –«, sagte die Stimme des Vaters in freundlich-teilnehmendem Ton. Luca begann zu schluchzen. Zu seiner Wut gesellte sich Schmerz, ein Schmerz, den er nicht verstand, nicht zu ermessen vermochte.
Die Eltern führten ihn weg. »Was ist? Warum weinst du denn?« fragte die Mutter verärgert. »Jetzt ist er beinahe erwachsen und weint immer noch –«
Luca schwieg. Ich habe mich übergeben, dachte er, auf die keuchende Lokomotive. War das seine Rache dafür, daß sie ihn zurückgebracht hatte, eisern, unaufhaltsam, in die Stadt, in die Schule, nicht minder zielbewußt als die Eltern, die ihm den Speisewagen hartnäckig vorenthalten hatten?
Luca war wieder daheim. In seinem Zimmer, dem Schauplatz oftmaligen fruchtlosen Aufbegehrens, nahm seine Reizbarkeit ungeahnte Formen an: Sie wurde zu Resignation, plötzlich, ohne Übergang, als wüßte sie um die Sinnlosigkeit jeglicher Gewaltanwendung. Die aufrührerischen Gelüste, belehrt durch zahlreiche Niederlagen, suchten ihr Heil in heimlichem, beharrlichem Verneinen. Klassenkampfschlagworte waren Luca nicht vertraut. Sonst hätte er die neue Form seiner Auflehnung zweifellos als »Streik« erkannt.
Lucas Körper verkrampfte sich nicht mehr in zwecklosen Wutanfällen, sondern gab nach wie ein Seil, das, einmal überdehnt, nicht mehr gespannt werden kann. Während der Nachmittagsstunden geschah es immer häufiger, daß Luca plötzlich einnickte, obwohl er nachts ausreichend schlief. Der Nachmittagsschlaf, leer und traumlos, eher ein Abwesendsein, überkam ihn aus heiterem Himmel, inmitten eines gedruckten Satzes, einer beschriebenen Seite. Luca dachte: Erst lese – oder schreibe – ich das fertig, dann lege ich mich hin – umsonst. Er brachte es kaum noch zuwege, vom Sessel hochzukommen, schleppte sich zum Bett und schlief ein, sobald er sich ausgestreckt hatte. Schwarze, bleischwere Stunden. Wann immer sie wiederkehrten, was häufiger und häufiger der Fall war, erweckten sie in Luca ein gewisses gehässiges Behagen. Er kannte dieses Gefühl. Er hatte es damals empfunden, an jenem Morgen auf dem Bahnhof, als er sich vorgeneigt hatte, um sich auf die Lokomotive zu erbrechen, und er identifizierte es als etwas Zerstörerisches, eine Manifestation des Grolls, den er für die Umwelt hegte. Die Schlafsucht war letztlich nichts anderes als eine Form des Verzichts, das tauglichste unter den vielen Mitteln der Gegenwehr, die er erprobt und für unzulänglich befunden hatte. Normalerweise hätte er den Müdigkeitsanfällen Widerstand entgegengesetzt oder mit den Eltern gesprochen, wie sonst, wenn er sich nicht gesund fühlte. Jetzt aber erahnte er hinter jenem unguten Behagen endlich eine treibende Kraft – früher war da nur Schwäche gewesen –, einen schmerzlich vermißten Willen, dem es beizuspringen galt. Es bereitete Luca Vergnügen, jeden Ehrgeiz von sich abzutun. Ehrgeiz war unnütz, hemmend. Mochte die Zeit noch so schnell über sein Haupt hinwegfließen – er tauchte unter, versank, verschmähte jeglichen Kampf. Aber genügte das? War dieses Sich-gehen-Lassen in Wirklichkeit nicht bloß der Anfang, der allererste Schritt auf einem dunklen Weg, der sich einladend darbot? Noch stand es in seiner Macht, ihm zu folgen oder nicht, noch war es Zeit zur Umkehr. Und plötzlich wußte Luca: Nein, es genügte nicht, die Apathie zu dulden. Man mußte sie fördern, pflegen, wenn auch nur, um sich zu beweisen, daß man nicht ihr Opfer war. Von nun an leistete Luca den Müdigkeitsanfällen nicht nur keinen Widerstand, sah nicht nur davon ab, sich den Eltern mitzuteilen, sondern tat, was er konnte, die Anwandlungen von Schlaffheit mit den verschiedensten Mitteln geradezu hervorzurufen. Entweder er las mit Absicht trockene lange Texte, oder er begann einen Aufsatz, dessen Thema ihn zutiefst langweilte. Der Erfolg blieb nicht aus: Seine Augen wurden schwer, schlafkündende Schauer liefen sein Rückgrat entlang; er stand auf, warf sich aufs Bett, den Kopf nach unten, die Füße hochgelagert, überließ sich dem Schlaf, der ihn bei den Haaren zu fassen und in die Tiefe zu ziehen schien wie klebrigsüße Melasse. Milchige Schwere erfüllte den sinkenden Kopf, die Füße, leer und leicht, schienen höher und höher zu steigen. Luca sagte sich vor: »Ich sollte lernen – lesen –, ich sollte übersetzen« – und erkannte gleichzeitig zu seiner Befriedigung, daß dieses »ich sollte« besagte, er würde weder lesen noch lernen noch übersetzen. Und bald darauf schlief er fest.