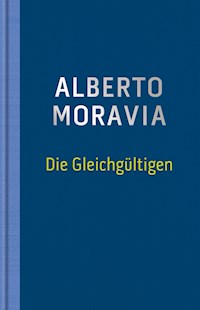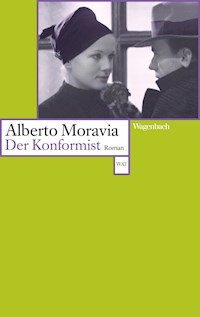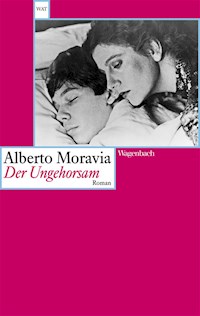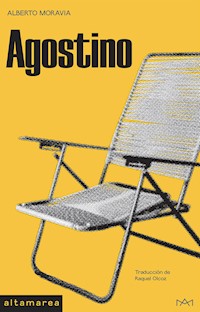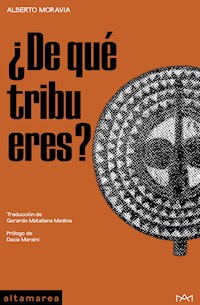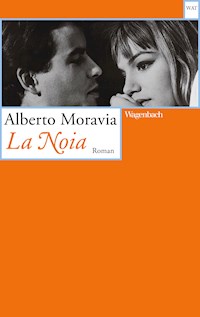
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große Menschenkenner Moravia lässt die Frage im großen und ganzen offen, beantwortet sie aber im erotischen Detail. Der wegen seiner Freizügigkeit umstrittene und vom Klerus heftig bekämpfte Roman wurde mit Horst Buchholz verfilmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die italienische Originalausgabe erschien 1960 unter dem Titel La Noia bei Bompiani in Mailand, die deutsche Erstausgabe 1961 unter dem Titel La Noia im Verlag Kurt Desch, München. Die Übersetzung wurde für diese Ausgabe neu durchgesehen.
E-Book-Ausgabe 2020
© 1960, 2017 Giunti Editore S.p.A./ Bompiani, Firenze-Milano
© 2007, 2020 für die deutschsprachige Ausgabe: Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin
Umschlaggestaltung Julie August unter Verwendung eines Filmstills aus »La Noia«.
Das Karnickel zeichnete Horst Rudolph. Alle Rechte vorbehalten
Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 9783803142818
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 2828 7
www.wagenbach.de
Prolog
Ich erinnere mich genau, wie das war, als ich aufhörte zu malen. Eines Abends, nachdem ich acht Stunden unablässig in meinem Atelier gewesen war, mal fünf oder zehn Minuten arbeitend, mal eine oder zwei Stunden auf dem Diwan ausgestreckt und zur Decke emporstarrend, zerdrückte ich einer plötzlichen Eingebung folgend meine letzte Zigarette in dem bis zum Rand mit Stummeln angefüllten Aschenbecher, sprang wie eine Katze aus dem Lehnstuhl, auf dem ich kauerte, packte ein Radiermesser, das ich bisweilen benutzte, um die Farben abzuschaben, und zerschnitt die Leinwand, an der ich arbeitete, bis nur noch Fetzen davon übrig waren. Dann zog ich aus einem Winkel eine leere Leinwand von derselben Größe hervor und stellte sie statt der zerfetzten auf die Staffelei.
Gleich darauf bemerkte ich freilich, daß all meine gewissermaßen schöpferische Energie sich in diesem wütenden und im Grunde durchaus vernünftigen Zerstörungsakt erschöpft hatte. Ich war während der letzten zwei Monate pausenlos und hartnäckig mit diesem Bild beschäftigt gewesen. Wenn ich es jetzt mit Messerstichen vernichtete, so bedeutete das im Grunde, daß ich es vollendete, vielleicht in negativer Weise, was die äußeren Resultate anging, die mich aber wenig interessierten, doch in positiver, was meine Eingebung betraf. Die Zerstörung dieses Bildes war etwas wie der Abschluß eines Gesprächs, das ich seit langer Zeit mit mir selbst führte. Es hieß soviel, wie endlich den Fuß auf festen Grund setzen. Die leere Leinwand, die jetzt auf der Staffelei stand, war also nicht nur irgendeine noch ungebrauchte Leinwand, sondern eben die eine Leinwand, die ich am Ende einer langen inneren Arbeit dort hingestellt hatte. In dem Bemühen, das Gefühl einer Katastrophe loszuwerden, das mich an der Kehle gepackt hatte, dachte ich, daß mit dieser Leinwand, die so ähnlich allen anderen Stücken Leinwand war und doch für mich eine solche Bedeutung besaß, ein neues, freies Leben für mich beginnen könne, als wären keine zehn Jahre vergangen, als sei ich noch immer fünfundzwanzig, wie zu jener Zeit, da ich das Haus meiner Mutter verlassen hatte und in das Atelier in der Via Margutta gezogen war, um mich nach Belieben der Malerei widmen zu können. Andererseits war es auch möglich und sogar sehr wahrscheinlich, daß diese leere Leinwand, die jetzt auf der Staffelei stand, eine nicht minder intime und notwendige Entwicklung symbolisierte, die aber gänzlich negativ war, jene Entwicklung nämlich, die mich in kaum fühlbaren Übergängen zur künstlerischen Impotenz geführt hatte. Und daß diese zweite Vermutung zutreffender war, schien aus der Tatsache hervorzugehen, daß Langeweile mich bei der Arbeit während der letzten sechs Monate mehr und mehr begleitet und daß ich ihr schließlich mit der Zerstörung des Bildes ein Ende bereitet hatte – etwa so, wie Kalkablagerungen schließlich ein Rohr verstopfen und den Wasserdurchfluß völlig verhindern können.
Ich denke, an diesem Punkte ist es angebracht, ein paar Bemerkungen über die Langeweile zu machen, ein Gefühl, von dem ich auf den folgenden Seiten noch oft sprechen werde. Soweit meine Erinnerung zurückreicht, habe ich immer an Langeweile gelitten. Man muß sich aber über die Bedeutung dieses Wortes einig werden. Für viele Menschen ist Langeweile ganz einfach das Gegenteil von Unterhaltung; ich könnte sogar sagen, daß sie ihr in gewisser Hinsicht ähnelt, da sie Zerstreuung und Vergessen nach sich zieht, wenn auch von einer sehr besonderen Art. Für mich ist Langeweile eine Art Ungenügen oder Unangemessenheit oder Spärlichkeit der Realität. Um einen Vergleich zu gebrauchen: Wenn ich mich langweile, macht mir die Wirklichkeit stets den Eindruck, den eine zu kurze Decke einem Schläfer in einer Winternacht macht. Zieht er sie über die Füße, so friert er auf der Brust, zieht er sie zur Brust empor, friert er an den Füßen. So gelingt es ihm niemals, richtig einzuschlafen. Oder ein anderer Vergleich: Meine Langeweile ähnelt der wiederholten geheimnisvollen Unterbrechung des elektrischen Stromes in einer Wohnung. Einen Moment ist alles klar und augenfällig, die Sessel, die Diwane, die Schränke, die Konsolen, die Bilder, die Vorhänge, die Teppiche, die Fenster, die Türen: einen Augenblick später ist alles nichts als Leere und Finsternis. Oder dritter Vergleich: Meine Langeweile könnte als eine Krankheit der Gegenstände definiert werden. Sie verlieren plötzlich jede Vitalität, so als sähe man in Sekunden eine Blume von der Knospe zum Verblühen und zum Staub übergehen.
Langeweile entsteht in mir aus dem Gefühl der Absurdität einer Wirklichkeit, die, wie gesagt, unzureichend ist, das heißt, die mich nicht von ihrem wirklichen Dasein zu überzeugen vermag. Zum Beispiel kann es mir geschehen, daß ich mit einer gewissen Aufmerksamkeit ein Glas ansehe. Solange ich mir sage, daß dieses Glas ein Behältnis ist, zu dem Zweck, eine Flüssigkeit aufzunehmen und an die Lippen zu führen, scheint es mir, als hätte ich zu ihm eine Beziehung, die ausreicht, an seine Existenz und demzufolge auch an meine eigene zu glauben. Es kann aber auch geschehen, daß das Glas in der zuvor beschriebenen Art seinen Lebenssinn einbüßt und sich mir als etwas Fremdes darbietet, zu dem ich keinerlei Beziehung habe, das mir – mit einem Wort – als völlig absurder Gegenstand erscheint. Dann ergibt sich aus dieser Absurdität Langeweile, die, letzten Endes, nichts anderes ist als mangelnde Fähigkeit zur Kommunikation und die Unmöglichkeit, sich von diesem Zustand zu befreien. Unter der Langeweile an sich würde ich weniger leiden, wenn ich mir nicht sagen würde: Obwohl ich keinerlei Beziehung zu dem Glas habe, könnte es eine solche Beziehung durchaus geben; das heißt, jenes Glas existiert in irgendeinem unbekannten Paradies, in dem die Gegenstände keinen Augenblick aufhören, Gegenstände zu sein. Die Langeweile besteht also sowohl in meiner Unfähigkeit, ihr aus eigener Kraft zu entweichen, als auch in dem theoretischen Wissen, daß ich dank irgendeines Wunders ihr vielleicht doch entweichen könnte.
Ich sagte schon, daß ich mich immer gelangweilt habe; jetzt füge ich noch hinzu, daß es mir erst in letzter Zeit gelungen ist, mit ausreichender Klarheit zu verstehen, was diese Langeweile in Wirklichkeit ist. Als Kind und in meiner Knabenzeit habe ich an Langeweile gelitten, ohne mir sie erklären zu können, wie einer, der dauernd Kopfschmerzen hat, sich aber nicht entschließen kann, zum Arzt zu gehen. Besonders als ich noch ein Kind war, nahm die Langeweile Formen an, die mir und der Umwelt völlig unklar waren, und ich konnte niemandem erklären, wie ich mich eigentlich fühlte. Meine Mutter schrieb mein schlechtes Befinden gesundheitlichen Störungen oder ähnlichen Ursachen zu, so wie das Weinen ganz kleiner Kinder auf das Durchbrechen der Zähne zurückgeführt wird. Es widerfuhr mir in jenen Jahren, daß ich plötzlich zu spielen aufhörte und ganze Stunden regungslos und wie blöde vor mich hin starrte, überwältigt von diesem Unbehagen, das ausgelöst wurde durch das, was ich mit dem Verwelken der Dinge bezeichnet habe, also durch das vage Wissen, daß zwischen mir und der Umwelt keinerlei Beziehung bestand. Wenn in solchen Augenblicken meine Mutter das Zimmer betrat und mich dasitzen sah, stumm, bleich vor Leiden und regungslos, und wenn sie mich fragte, was ich hätte, antwortete ich regelmäßig: »Ich langweile mich.« So suchte ich mit einem klaren und enggefaßten Ausdruck einen weiten und dunklen Gemütszustand zu erklären. Meine Mutter nahm dann meine Erklärung ernst, beugte sich zu mir herab, küßte mich und versprach mir, mich noch am selben Nachmittag ins Kino zu führen. Das heißt, sie stellte mir Zerstreuung in Aussicht, die, wie ich nun schon gut wußte, keineswegs das Gegenteil der Langeweile und auch kein Mittel gegen sie war. Ich tat, als erfüllte mich der Vorschlag mit Freude, empfand aber dieselbe Langeweile, die meine Mutter zu verscheuchen suchte, wenn ihre Lippen sich auf meine Stirn drückten, ihr Arm sich um meine Schultern legte und sie mir das Kino als wunderbares Rettungsmittel pries. Ich hatte in diesem Augenblick keinerlei Beziehung, weder zu diesen Lippen und diesen Armen noch zum Kino. Wie aber hätte ich meiner Mutter erklären sollen, daß es kein Mittel gegen Langeweile gab, an der ich litt? Ich habe schon bemerkt, daß diese Art der Langeweile vor allem in einer mangelnden Fähigkeit zur Kommunikation besteht. Da ich dann auch mit meiner Mutter keine Verbindung hatte und mich von ihr ebenso getrennt fühlte wie von allem übrigen, war ich genötigt, auf das Mißverständnis einzugehen und sie zu belügen.
Ich übergehe die Katastrophen, die mir meine Langeweile während der Knabenzeit verursachte. Mein miserables Abschneiden in der Schule wurde auf sogenannte ›Konzentrationsschwäche‹ zurückgeführt, das heißt auf eine angeborene Unfähigkeit, diese oder jene Materie aufzunehmen, und ich selbst akzeptierte diese Erklärung in Ermangelung einer besseren. Jetzt aber weiß ich mit Sicherheit, daß die schlechten Noten, die ich am Ende jedes Schuljahres einheimste, ein einziges Motiv hatten: Langeweile. Ich spürte deutlich und mit dem gewohnten tiefen Unbehagen, daß ich keinerlei Beziehung besaß zu dem riesigen Durcheinander von athenischen Staatsmännern und römischen Kaisern, von südamerikanischen Flüssen und asiatischen Gebirgen, von den Elf-Silbern Dantes und den Hexametern Vergils, von algebraischen Operationen und chemischen Formeln. Diese ungeheure Menge von Wissensstoff ging mich nichts oder nur soweit etwas an, als ich ihre fundamentale Unsinnigkeit feststellte. Aber, wie gesagt, ich bekannte mich weder vor mir selbst noch vor anderen zu diesem rein negativen Gefühl; ich sagte mir vielmehr, ich dürfe es nicht haben, und litt darunter. Ich erinnere mich, daß mir schon damals dieses Leiden den Wunsch eingab, es zu definieren und zu erklären. Aber ich war ein Junge mit der ganzen Pedanterie und dem Ehrgeiz eines Jungen. Das Ergebnis war daher das Projekt einer Weltgeschichte unter dem Gesichtspunkt der Langeweile, von der ich aber nur die ersten Seiten wirklich schrieb. Diese Weltgeschichte unter dem Aspekt der Langeweile beruhte auf einer sehr einfachen Idee: Nicht der Fortschritt, die biologische Evolution, ökonomische Faktoren, noch irgend andere Motive, die von den Historikern der verschiedenen Schulen für gewöhnlich angeführt werden, waren die Triebfedern der Geschichte, sondern die Langeweile. Von dieser großartigen Entdeckung hochbegeistert, ergriff ich die Dinge bei der Wurzel: Im Anfang war also die Langeweile, gemeinhin Chaos genannt. Gott, der Langeweile überdrüssig, schuf Erde und Himmel, Wasser, Tiere und Pflanzen, Adam und Eva. Die aber langweilten sich ihrerseits im Paradies und aßen von der verbotenen Frucht. Gott wurde ihrer überdrüssig und vertrieb sie aus dem Paradies. Kain, von Abel gelangweilt, erschlug ihn. Noah, der sich langweilte, erfand den Wein. Wiederum waren die Menschen dem lieben Gott langweilig geworden, und er zerstörte die Welt durch die Sintflut. Auch die aber wurde ihm bald dermaßen langweilig, daß er es wieder schönes Wetter werden ließ. Und so weiter. Die großen Reiche der Ägypter, Babylonier, Perser, Griechen und Römer erwuchsen aus der Langeweile und brachen unter der Langeweile wieder zusammen. Die Langeweile des Heidentums rief das Christentum hervor, die Langeweile des Katholizismus den Protestantismus. Europa war so langweilig geworden, daß die Menschen auszogen, Amerika zu entdecken. Die Langeweile des Feudalismus führte zur Französischen Revolution, die des Kapitalismus zur Russischen. Alle diese hübschen Ideen wurden auf einer Art Generalplan verzeichnet, und dann begann ich mit großem Eifer, die Geschichte so zu schreiben. Genau erinnere ich mich nicht mehr, aber ich glaube, ich kam nicht über die sehr eingehende Schilderung der Langeweile Adams und Evas im Paradies und des hierdurch verursachten Sündenfalles hinaus. Dann wurde mir meinerseits das ganze Projekt zu langweilig, und ich ließ es liegen.
Ich litt an der Langeweile von meinem zehnten bis zu meinem zwanzigsten Jahr wohl noch mehr als in jedem anderen Lebensalter. Ich bin im Jahre 1920 geboren, so daß meine Jugend unter der schwarzen Flagge des Faschismus verlief. Dieser aber war ein politisches Regime, das die Unmöglichkeit einer Kommunikation zum System erhoben hatte, sowohl zwischen dem Diktator und den Massen als auch zwischen den Bürgern untereinander und zwischen ihnen und dem Diktator. Die Langeweile, die doch mangelnde Beziehung zu den Dingen ist, lag während des ganzen Faschismus geradezu in der Luft, die man atmete. Zu dieser sozialen Langeweile kam dann noch die Langeweile, die durch den sexuellen Drang verursacht wurde, der, wie in jenem Alter üblich, mir die Beziehung zu denselben Frauen unmöglich machte, mit denen ich meinen Trieb glaubte ausleben zu können. Dafür rettete mich die Langeweile vor dem Bürgerkrieg, der kurze Zeit später Italien zwei Jahre lang verwüstete. Das kam so: Ich war bei einer in Rom liegenden Division eingerückt. Kaum wurde der Waffenstillstand verkündet, da zog ich meine Uniform aus und ging nach Hause. Später wurde ein Aufruf erlassen, wonach alle Soldaten bei Todesstrafe zu ihren Truppenteilen zurück zukehren hatten. Mit dem charakteristischen Gehorsam gegenüber den Behörden – das waren in jenem Augenblick die Faschisten und die Deutschen –, riet mir meine Mutter, die Uniform wieder anzuziehen und mich zu melden. Sie wollte mich retten; in Wirklichkeit aber trieb sie mich der Deportation und vielleicht dem Tod in einem nazistischen Konzentrationslager entgegen, wie es vielen meiner Kriegskameraden erging. Was mich rettete, war nichts weiter als die Langeweile, das heißt die Unmöglichkeit, irgendeinen Zusammenhang zwischen mir und jenem Aufruf, zwischen mir und der Uniform, zwischen mir und den Faschisten herzustellen, jene Langeweile, an der ich zwanzig Jahre lang gelitten hatte und die jetzt in meinen Augen das große Reich des Fascio und des Hakenkreuzes als nichtexistierend erscheinen ließ. Trotz der Bitten meiner Mutter flüchtete ich aufs Land, in die Villa eines Freundes, und verbrachte dort die ganze Zeit des Bürgerkrieges mit Malen – eine Möglichkeit wie jede andere, die Zeit totzuschlagen. Damals wurde ich zum Maler, das heißt, ich hoffte ein für allemal, den Zusammenhang mit der Wirklichkeit auf dem Weg des künstlerischen Ausdrucks wiederherstellen zu können. In der ersten Erleichterung, die mir meine Begeisterung für die Malerei verschaffte, redete ich mir ein, daß meine Langeweile bisher nichts anderes gewesen sei als Langeweile eines Künstlers, der nicht weiß, daß er ein solcher ist. Das war ein Irrtum; aber für eine Weile lebte ich in der Illusion, das Heilmittel gefunden zu haben.
Am Ende des Krieges kehrte ich zu meiner Mutter zurück, die inzwischen eine große Villa an der Via Appia gekauft hatte. Wie gesagt, hoffte ich, die Malerei habe die Langeweile endgültig überwunden. Aber ich merkte bald, daß dies nicht der Fall war. Ich litt also wieder unter Langeweile, trotz meiner Malerei; ja, da die Langeweile automatisch das Malen unterbrach, legte ich mir über die Intensität und Häufigkeit der Anfälle meines alten Leidens erst jetzt richtig Rechenschaft ab, weit genauer als zu den Zeiten, da ich noch nicht gemalt hatte. Das Problem der Langeweile präsentierte sich also von neuem in unveränderter Stärke. Ich begann, mich nach Motiven dafür zu fragen, und gelangte, indem ich einen nach dem anderen Grund ausschloß, zu dem Ergebnis, daß ich mich vielleicht deshalb langweilte, weil ich reich war, und daß ich mich, wenn ich arm wäre, weniger langweilen würde. Diese Folgerung war damals nicht so klar und bewußt wie jetzt, da ich sie zu Papier gebracht habe. Es handelte sich auch weniger um eine Folgerung als um den fast manischen Verdacht, es könne ein unbezweifelbarer, wenngleich unklarer Zusammenhang zwischen Langeweile und Geld bestehen. Ich will mich bei jener höchst unangenehmen Periode meines Lebens nicht lange aufhalten. Da ich mich langweilte und da ich, wenn ich mich langweilte, nicht malte, begann ich, die Villa meiner Mutter und die Annehmlichkeiten des dortigen Lebens aus ganzer Seele zu hassen. Ich gab der Villa die Schuld an meiner Langeweile und der hieraus sich ergebenden Unfähigkeit zu malen. Und ich sehnte mich danach wegzugehen. Da es sich aber, wie gesagt, nur um einen Verdacht handelte, gelang es mir nicht, meiner Mutter klar zu sagen, was ich ihr hätte sagen sollen: »Ich will nicht mit dir leben, weil du reich bist, weil der Reichtum mich langweilt, weil die Langeweile mich am Malen hindert.« Statt dessen versuchte ich instinktiv, unerträglich zu sein und ihr dadurch meinen Wegzug aus der Villa zu suggerieren, in gewissem Sinne aufzuzwingen. Ich erinnere mich an jene Tage als an eine Zeit ewig schlechter Laune, hartnäckiger Feindseligkeit, obstinater Ablehnung, beinahe krankhafter Antipathie. Nie habe ich meine Mutter schlechter behandelt als in jener Zeit, und so kam zu der bedrückenden Langeweile auch noch mein Mitleid für sie hinzu, die sich meine Unfreundlichkeit in keiner Weise erklären konnte. Vor allem aber litt ich unter einer Art Lähmung aller meiner Fähigkeiten, so daß ich mir stumm, apathisch und dumpf vorkam, lebendig in mir selbst eingemauert – als befände ich mich in einem undurchdringlichen, erstickenden Gefängnis.
Mein Aufenthalt in der Villa und mein daraus resultierender Gemütszustand hätten sich wahrscheinlich noch länger hingezogen, wenn meine Mutter nicht glücklicherweise geglaubt hätte, in meiner Langeweile ein Gefühl wiederzuerkennen, ähnlich dem, das ihre Beziehung zu meinem Vater zerstört hatte. So ist jetzt der Augenblick gekommen, ein wenig von meinem Vater zu erzählen, und sei es auch nur, weil er mir auf dem Weg der Langeweile vorausgegangen ist.
Mein Vater also war, soweit ich das rekonstruieren konnte, ein geborener Vagabund, das heißt einer dieser Männer, die daheim allmählich verstummen, den Appetit einbüßen, kurz, allen Lebenswillen verlieren, ein wenig wie jene Vögel, die das Eingeschlossensein in einem Käfig nicht ertragen. Kaum aber befinden sie sich auf Deck eines Schiffes oder in einem Zugabteil, da gewinnen sie ihre ganze Vitalität zurück. Er war hochgewachsen, athletisch, blauäugig und blond wie ich, nur daß ich nicht besonders gut aussehe, weil ich vorzeitig kahl geworden bin und ein eher graues, düsteres Gesicht habe. Er aber war ein schöner Mann, wenigstens nach den Lobpreisungen meiner Mutter, die ihn unbedingt hatte heiraten wollen, obwohl er ihr dauernd wiederholte, daß er sie nicht liebe und sie so schnell wie möglich verlassen werde. Ich hatte ihn nur wenige Male gesehen, denn er war ständig auf Reisen. Als ich ihn zuletzt sah, waren seine blonden Haare fast grau geworden und sein Jünglingsgesicht war von feinen, tiefen Falten durchfurcht; aber er trug noch seine flotten Schmetterlingskrawatten und die schachbrettartig gemusterten Anzüge seiner Jugendzeit. Er kam und ging, das heißt er floh vor meiner Mutter, mit der er sich langweilte, und kehrte wieder zu ihr zurück, wahrscheinlich um sich für eine neue Flucht mit Geld zu versorgen, denn er hatte keinen Pfennig, wenngleich er sich theoretisch mit ›Import und Export‹ beschäftigte. Am Ende kam er nicht mehr wieder. Ein Sturm auf der japanischen Binnensee brachte ein Fährboot mit etwa hundert Passagieren zum Kentern, und mein Vater ertrank mit ihnen. Was er in Japan zu suchen hatte, ob er für seinen ›Import und Export‹ dort war oder aus anderen Gründen, habe ich nie erfahren. Nach meiner Mutter, die eine Vorliebe für wissenschaftliche oder wissenschaftlich klingende Definitionen hatte, war mein Vater von Dromomanie befallen, das heißt von Bewegungsmanie. Dieser Manie, so bemerkte sie nachdenklich, war vielleicht seine Leidenschaft für Briefmarken zuzuschreiben, für diese kleinen, farbigen Dokumente der Vielfalt und Weite der Welt, von denen er eine schöne Sammlung angelegt hatte, die von der Witwe noch immer aufbewahrt wurde. Auch war er in Geographie sehr tüchtig gewesen, dem einzigen Fach, mit dem er sich in der Schule wirklich beschäftigt hatte. Während meine Mutter in dieser Dromomanie meines Vaters einen rein individuellen und im Grunde belanglosen Charakterzug erblickte, konnte ich nicht umhin, eine Art brüderlichen Mitgefühls für diese unglückliche, halbverblaßte Gestalt zu empfinden, die immer blasser wurde, je mehr Zeit verstrich. Ich glaube an meinem Vater – zumindest was das Verhältnis zu meiner Mutter anging – einige Züge zu entdecken, die ich mit ihm gemeinsam hatte. Aber es waren nur äußerliche Züge, wie ich bei genauerem Nachdenken erkannte. Gewiß hatte auch mein Vater an Langeweile gelitten, aber bei ihm hatte sich dieses Leiden durch ein fröhliches Vagabundieren in der Welt gelöst. Mit anderen Worten, seine Langeweile war Langeweile im gewöhnlichen Sinn gewesen, die nach nichts weiter verlangt als nach Erleichterung durch neue und seltene Sensationen. Mein Vater hatte wirklich an die Welt geglaubt, zumindest an die der Geographie, während ich es nicht einmal fertigbrachte, an ein Glas zu glauben.
Jedenfalls nahm es meine Mutter nicht so genau und vermutete hinter meiner Langeweile denselben oberflächlichen Überdruß, der die Beziehung zu ihrem Mann schwierig gemacht hatte. »Leider bist du mehr nach deinem Vater geschlagen als nach mir«, sagte sie schließlich eines Tages kurzerhand. »Ich weiß, wenn es euch erwischt, bleibt nichts anderes übrig, als euch wegzuschicken. Verreise, fahr hin, wohin du willst, und wenn es vorbei ist, komm wieder!«
Erleichtert antwortete ich sogleich, daß es keineswegs meine Absicht sei zu verreisen. Reisen interessierte mich nämlich gar nicht. Ich wollte nur von daheim fort und auf eigene Rechnung leben. Meine Mutter wandte ein, daß es absurd sei, auf eigene Rechnung leben zu wollen, während ich doch die große Villa, die wir bewohnten, zur Verfügung hätte, in der ich ohnehin tun und lassen könne, was ich wolle. Ich aber war nun fest entschlossen, die Gelegenheit zu ergreifen, und antwortete heftig, ich gedächte am nächsten Tag und keine Stunde später wegzugehen. Da begriff meine Mutter, daß es mir ernst war. Sie beschränkte sich darauf, mit erprobter Bitterkeit zu wiederholen, sie erkenne in meiner Antwort sogar den Ton meines Vaters wieder. Ich möge also tun, was mir beliebe, und wohnen, wo es mir passe.
Blieb noch die Geldfrage. Wie gesagt, wir waren reich, und ich hatte bis dahin über einen nahezu unbeschränkten Kredit verfügt. Ich hob vom Bankkonto meiner Mutter jedesmal Geld ab, wenn ich etwas brauchte. Aber meine Mutter, die vorhersah, daß sie mit mir dieselben Erfahrungen machen würde wie mit meinem Vater, dem sie zwar immer genug Geld für seine Fluchten gegeben hatte, aber doch nicht so viel, daß er lange wegbleiben konnte, kündigte mir trocken an, sie wolle mir von jetzt an einen Monatswechsel ausstellen. Ich erwiderte, daß ich mir nichts anderes wünschte. Und als sie mir ärgerlich-reuig die Summe nannte, die sie mir anzuweisen gedachte, erklärte ich sogleich, die Hälfte davon genüge. Meine Mutter, auf derlei Diskussionen gefaßt, wie sie seinerzeit zwischen ihr und meinem Vater ausgefochten worden waren, dem das Geld nie genügte, wunderte sich über meine unerwartete Bescheidenheit. »Aber mit so wenig wirst du kaum leben können, Dino«, rief sie fast gegen ihren Willen. Ich antwortete, das sei meine Sache. Und um mir nicht den Anstrich eines Asketen zu geben, fügte ich hinzu, ich hoffte, sehr bald von dem Ertrag meiner Malerei leben zu können. Mir schien, als blicke mich meine Mutter ungläubig an. Wie ich wußte, hielt sie nichts von meinen künstlerischen Fähigkeiten. Wenige Tage später fand ich ein Atelier in der Via Margutta und zog mit meiner Habe dorthin.
Natürlich brachte der Wohnungswechsel keinerlei Veränderung meines Gemütszustandes mit sich. Ich meine damit: Nach dem Verblassen der ersten, mit jeder Veränderung verbundenen Erleichterung fing ich wieder an, mich von Zeit zu Zeit zu langweilen wie zuvor. Ich habe »natürlich« gesagt, weil ich hätte vorhersehen können, daß die Langeweile nicht mit einem einfachen Wohnungswechsel verschwinden würde. Zudem war ich ja nicht darum reich, weil ich in der Via Appia wohnte, sondern weil ich über eine bestimmte Summe Geldes verfügte. Daß ich von diesem Geld keinen Gebrauch machen wollte, änderte im Grunde nur wenig. Auch gewisse reiche Geizhälse geben nur einen kleinen Teil ihrer Einkünfte aus und leben armselig; deswegen würde niemand daran denken, sie für arm zu halten. Auf den ersten Gedanken oder, besser gesagt, die erste fixe Idee, daß meine Langeweile und die daraus folgende künstlerische Unfruchtbarkeit auf das Leben bei meiner Mutter zurückzuführen sei, folgte langsam und schrittweise eine zweite, noch schlimmere Manie: die Unmöglichkeit, auf den Reichtum zu verzichten. Reich sein war wie blaue Augen oder eine Adlernase haben. Eine geheime Vorherbestimmung verband den Reichen mit seinem Geld und färbte sogar seinen Entschluß, keinen Gebrauch davon zu machen. Mit einem Wort, ich war kein Armer, der reich gewesen war, sondern ich war ein Reicher, der sich den anderen und sich selbst gegenüber so verhielt, als sei er arm.
Daß dies so war, bewies ich mir auf folgende Weise: Was tut ein wirklich Armer, fragte ich mich, wenn er kein Geld hat? Er verhungert. Und was würde ich in einem ähnlichen Fall tun? Ich würde meine Mutter um Hilfe bitten. Und wenn ich dies nicht täte, würde man mich deshalb noch lange nicht für einen Armen halten, sondern bloß für einen Verrückten. Aber mein Fall war, wie ich sogleich überlegte, kein Extremfall. Es war ein durchschnittlicher Fall, denn ich ließ mich ja von meiner Mutter aushalten. Nur daß ich die Summe auf das unbedingt Notwendige beschränkte. Verglichen mit den echten Armen befand ich mich also in der bevorzugten und unanständigen Lage des reichen Spielers: Der eine kann unbegrenzt verlieren, der andere nicht. Vor allem aber kann der Reiche wirklich ›spielen‹, das heißt sich amüsieren, während der Arme nur versuchen kann zu gewinnen.
Es ist schwierig zu sagen, was ich empfand, wenn ich über diese Dinge nachdachte: ein Gefühl jämmerlicher Verhextheit, gegen das ich ohnmächtig war, denn ich konnte nicht wissen, wie, wann oder wo die Zauberei ausgeübt wurde, deren Bann mich gefangenhielt. Manchmal dachte ich an das Wort des Evangeliums: »Es ist leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als daß ein Reicher in den Himmel kommt.« Und ich fragte mich, was es eigentlich bedeutete, reich zu sein. War man reich, weil man über viel Geld verfügte? Oder weil man einer reichen Familie entstammte? Oder weil man in einer Gesellschaft lebte, die Reichtum über alle anderen Güter stellte? Oder weil man an Reichtum glaubte, reich zu werden wünschte oder verlorenem Reichtum nachtrauerte? Oder weil man, wie es in meinem Fall war, nicht reich sein wollte? Je mehr ich darüber nachdachte, desto schwieriger schien es mir, das Gefühl der Vorherbestimmung näher zu erklären, das mir der Reichtum gab. Es versteht sich, daß ich dieses Gefühl nicht gehabt hätte, wenn es mir gelungen wäre, mich von meiner ursprünglichen fixen Idee zu befreien, wonach sowohl die Langeweile als auch die künstlerische Unfruchtbarkeit vom Reichtum abhing. Aber alle unsere Überlegungen, auch die vernünftigsten, entspringen einem dunklen Gefühl. Und von Gefühlen kann man sich nicht so leicht befreien wie von Ideen. Ideen kommen und gehen, aber die Gefühle bleiben.
Hier wird man einwenden, daß ich, alles in allem, nichts weiter war als ein gescheiterter Maler, der – was ungewöhnlich sein mochte – von seinem Scheitern wußte. Das war alles. Aber das stimmt nur bis zu einem gewissen Punkt. Sicher war ich gescheitert, doch nicht darum, weil ich außerstande gewesen wäre, Bilder zu malen, die anderen Leuten gefallen hätten, sondern weil ich spürte, daß meine Bilder es mir nicht gestatteten, mich selbst auszudrücken, mir die Illusion einer Beziehung zu den Dingen zu geben. Mit einem Wort: Sie hinderten mich nicht daran, mich zu langweilen. Nun hatte ich aber im Grunde doch zu malen begonnen, um der Langeweile zu entfliehen. Da ich mich also weiter langweilte, warum malte ich dann noch?
Wenn ich mich recht erinnere, verließ ich die Villa meiner Mutter im März 1947. Weniger als zehn Jahre später zerstörte ich, wie schon erzählt, mein letztes Bild und beschloß, nicht mehr zu malen. Sogleich befiel mich die Langeweile, die die Ausübung der Malerei bisher in gewissem Maße in Schach gehalten hatte, mit unerhörter Heftigkeit. Ich habe bereits bemerkt, daß diese Langeweile im Grunde ein Fehlen der Beziehung zu den Dingen ist; in jenen Tagen kam es mir vor, als sei sie auch ein Fehlen der Beziehung zu mir selbst. Ich weiß, diese Dinge sind schwer zu erklären. Ich will mich daher auf einen Vergleich beschränken: In den Tagen nach meinem Entschluß, die Malerei aufzugeben, kam ich mir beinahe so vor wie ein aus verschiedenen Gründen unerträgliches Individuum, das ein Reisender beim Antritt einer langen Fahrt in seinem Abteil antrifft. Das Abteil ist von alter Bauart, ohne Verbindung zu den anderen Abteilen des Zuges. Der Zug hält erst am Schluß der Reise. Der Fahrgast ist also genötigt, bis zum Ende der Fahrt mit seinem unangenehmen Gefährten beisammenzubleiben. Die Langeweile hatte in jenen Jahren auch unterhalb der Oberfläche meines Malerberufes mein Leben tief zerfressen. Sie hatte nichts darin heil gelassen, so daß ich, ohne es selbst zu bemerken, zu einer Art Ruine oder Trümmerrest geworden war, als ich das Malen aufgab. Nun bestand aber, wie ich ausgeführt habe, der Hauptaspekt der Langeweile in der praktischen Unmöglichkeit, mit mir selbst beisammen zu sein, der einzigen Person auf der Welt, die ich andererseits in keiner Weise loswerden konnte.
Eine außerordentliche Unruhe beherrschte mein Leben in jenen Tagen. Nichts von dem, was ich tat, gefiel mir oder schien mir wert, getan zu werden; andererseits konnte ich mir auch nichts ausdenken, das mir Freude machen, das heißt, mich auf die Dauer hätte beschäftigen können. Ich tat nichts anderes, als mein Atelier zu betreten und unter irgendeinem nichtigen Vorwand wieder zu verlassen, um nicht darin bleiben zu müssen: Ich kaufte Zigaretten, die ich gar nicht brauchte, trank einen Kaffee, auf den ich gar keinen Appetit hatte, erwarb eine Zeitung, die mich nicht interessierte, besuchte eine Bilderausstellung, für die ich keinerlei Neugier empfand – und so weiter. Dabei spürte ich, daß diese Beschäftigungen nichts anderes waren als hektische Verkleidungen der Langeweile, und ich fühlte dies so deutlich, daß ich mitunter die begonnenen Dinge nicht zu Ende führte und – statt die Zeitung zu kaufen, den Kaffee zu trinken oder die Ausstellung zu besuchen – schon nach wenigen Schritten umkehrte und in das Atelier zurückging, aus dem ich wenige Minuten zuvor davongeeilt war. Aber im Atelier wartete natürlich die Langeweile auf mich, und alles begann von neuem.
Ich griff zu einem Buch. Ich besaß eine kleine Bibliothek und bin immer ein guter Leser gewesen. Bald aber ließ ich das Buch fallen. Romane, Essays, Gedichte, Dramen – die ganze Weltliteratur enthielt nicht eine einzige Seite, die meine Aufmerksamkeit zu fesseln vermochte. Und warum hätte sie das auch tun sollen? Worte sind Symbole für Dinge, und zu den Dingen hatte ich ja in den Momenten der Langeweile keinerlei Beziehung. Ich ließ also das Buch sinken oder schleuderte es in einem Wutanfall in eine Ecke und nahm meine Zuflucht zur Musik. Ich hatte einen ausgezeichneten Plattenspieler, ein Geschenk meiner Mutter, und etwa hundert Platten. Aber wer behauptet, daß Musik eine so große Wirkung ausübt, daß sie selbst einen zerstreuten Menschen sozusagen mit Gewalt zum Zuhören zwingt, sagt etwas Unwahres. In Wirklichkeit weigerten sich meine Ohren nicht nur zuzuhören, sondern überhaupt zu hören. Und wenn ich dabeiwar, eine Platte auszuwählen, lähmte mich der Gedanke: Welche Musik kann in einem Augenblick der Langeweile angehört werden? So schloß ich den Plattenspieler, warf mich auf den Diwan und begann darüber nachzudenken, was ich unternehmen könnte.
Vor allem traf mich der Umstand, daß ich absolut nichts tun mochte, dabei aber glühend wünschte, etwas zu tun. Was immer ich mir vorstellte, war sozusagen mit seinem siamesischen Zwilling verbunden, nämlich mit dem Gegenteil – der Absicht, nichts zu unternehmen. So spürte ich, daß ich keine Leute sehen, aber auch nicht allein sein wollte; daß ich nicht daheimbleiben, aber auch nicht ausgehen wollte; daß ich nicht reisen, aber auch nicht in Rom bleiben wollte; daß ich nicht malen, aber auch nicht ohne Malen leben wollte; daß ich nicht wachen, aber auch nicht schlafen wollte; daß ich nicht lieben, aber auch nicht ohne Liebe sein wollte – und so weiter. Ich sage: Ich spürte das. Besser jedoch müßte ich sagen: Ich empfand Widerwillen, Ekel und Abscheu.
Mitunter fragte ich mich in diesen Geistesverwirrungen der Langeweile, ob ich nicht etwa zu sterben wünschte. Die Frage war durchaus vernünftig, da mir das Leben doch so unerfreulich erschien. Dann aber bemerkte ich erstaunt, daß mich zwar das Leben nicht freute, daß ich aber auch nicht sterben wollte. Diese miteinander verbundenen Alternativen, die wie in einem düsteren Ballett vor meinem Geist vorbeizogen, machten also nicht einmal halt vor der Wahl zwischen Leben und Tod. In Wirklichkeit, so dachte ich manchmal, wollte ich nicht etwa sterben, sondern nur nicht so weiterleben, wie ich lebte.
1. Kapitel
Nachdem ich in das Atelier in der Via Margutta gezogen war, gelang es mir, den unvernünftigen und beinahe abergläubischen Widerwillen zu überwinden, den mir die Villa in der Via Appia einflößte, und ich konnte halbwegs normale Beziehungen zu meiner Mutter aufnehmen. Einmal in der Woche ging ich zum Mittagessen zu ihr, denn ich wußte, daß ich sie um diese Tageszeit allein antreffen würde. Ich blieb dann ein paar Stunden und führte die üblichen Gespräche, die ich auswendig kannte und die sich auf die einzigen zwei Dinge bezogen, für die sich meine Mutter interessierte: Botanik – das heißt die Blumen und Pflanzen, die sie in ihrem Garten zog – und Geschäfte, denen sie sich sozusagen seit ihrem Vernünftigwerden widmete. Meine Mutter hätte es gern gehabt, wenn ich häufiger und auch zu anderen Tageszeiten zu ihr gekommen wäre, zum Beispiel während sie ihre Freunde oder Leute ihres gesellschaftlichen Kreises empfing. Aber nach ein paar Einladungen, die ich mit Entschiedenheit ablehnte, schien sie sich mit der Seltenheit meiner Besuche abgefunden zu haben. Natürlich war ihre Resignation nur erzwungen und konnte bei der ersten Gelegenheit wieder verschwinden. »Eines Tages wirst du darauf kommen«, sagte sie und sprach dabei von sich selbst in der dritten Person, was sie immer dann tat, wenn sie ein starkes Gefühl zu verbergen wünschte, »daß deine Mutter nicht eine beliebige Dame ist, der man einen Höflichkeitsbesuch abstattet, und daß deine wirkliche Wohnung hier ist und nicht in der Via Margutta.«
An einem solchen Tag, kurze Zeit nachdem ich mit dem Malen aufgehört hatte, begab ich mich zu dem üblichen wöchentlichen Mittagessen in das Haus meiner Mutter. In Wirklichkeit war es ein etwas ungewöhnliches Mittagessen: Auf diesen Tag fiel nämlich mein Geburtstag. Meine Mutter hatte mich für den Fall, daß ich dies vergessen sollte, noch am Morgen daran erinnert, indem sie mir am Telefon in ihrer seltsamen pedantischen und zeremoniellen Art sagte: »Heute wirst du fünfunddreißig Jahre alt. Ich gratuliere dir auf das herzlichste und wünsche dir alles Gute.« Gleichzeitig ließ sie mich wissen, daß sie eine ›Überraschung‹ für mich habe.
Gegen Mittag bestieg ich also meinen alten, klapprigen Wagen und fuhr durch die Stadt mit dem üblichen Gefühl des Unbehagens und Widerwillens, das immer weiter zunahm, je mehr ich mich meinem Ziel näherte. Mein Herz war von schwerer Beklemmung erfüllt, als ich schließlich in die Via Appia einbog und zwischen Zypressen, Pinien und Ziegelruinen an den rasenbewachsenen Böschungen dahinfuhr. Das Gartentor meiner Mutter befand sich rechts auf halber Höhe der Via Appia, und ich suchte es wie gewöhnlich mit den Blicken, fast hoffend, dank irgendeines Wunders nichts mehr zu finden und geradewegs bis zu den Castelli weiterfahren und dann nach Rom zurückkehren zu können. Aber da war es, dieses Gartentor, weit aufgerissen, eigens für mich, um mich – wie es mir vorkam – im Vorbeifahren aufzuhalten und zu verschlingen. Ich bremste, vollführte eine brüske Wendung und fuhr mit einem dumpfen, weichen Hüpfen der Räder in die kiesbestreute Zufahrt ein und zwischen zwei Reihen Zypressen hindurch. Der Weg stieg bis zur Villa, die am Ende sichtbar wurde, sanft an. Dann schaute ich auf die kleinen schwarzen, staubigen, gelockten Zypressen und auf die niedrige rote Villa, die sich unter grauen, schmutzigen Wattebäuschen ähnelnden Wolken duckte, und ich fühlte wieder jenes niederschmetternde Entsetzen, das mich jedesmal überkam, wenn ich meine Mutter besuchte: Ich glich einem Menschen, der die Absicht hat, einen Akt wider die Natur zu begehen, als hätte ich mich angeschickt, während ich diesen Weg herauffuhr, sozusagen in den Schoß zurückzukehren, aus dem ich geboren war. Ich versuchte, dieses unangenehme Gefühl der Regression zu verscheuchen, indem ich aus Leibeskräften das Horn betätigte, um meine Ankunft anzukündigen. Dann vollführte ich einen halben Kreis auf dem Kies, hielt meinen Wagen auf dem Vorplatz an und sprang hinaus. Fast sofort öffnete sich ein Fenster im Erdgeschoß, und ein Dienstmädchen erschien auf der Schwelle.
Ich war ihr nie zuvor begegnet. Meine Mutter hatte es sich in den Kopf gesetzt, die Villa mit einem Personal in Ordnung zu halten, das kaum für eine Fünfzimmerwohnung ausgereicht hätte. Deshalb war sie genötigt, die Bediensteten oft zu wechseln. Hochgewachsen, mit kräftigen und robusten Hüften und Brüsten, hatte dieses Mädchen seltsam kurze, schlechtgeschnittene Haare, ähnlich denen von Strafgefangenen oder Rekonvaleszenten. Auf dem blassen, etwas sommersprossigen Gesicht lag ein schläfriger Ausdruck, vielleicht verursacht durch eine enorme schwarzgeränderte Brille, die ihre Augen verdeckte. Mir fiel besonders ihr Mund auf. Er hatte die Form einer zerdrückten Blume und war zart geranienrot. Ich fragte sie, wo meine Mutter sei, und sie fragte ihrerseits mit sehr sanfter Stimme: »Sind Sie Signor Dino?«
»Ja.«
»Die Signora ist im Garten bei den Glashäusern.«
Ich setzte mich in diese Richtung in Bewegung, nicht ohne vorher einen erstaunten Blick auf ein anderes Auto zu werfen, das auf dem Vorplatz neben dem meinen stand. Es war ein Sportwagen, niedrig und robust, mit einem metallisch-blauen Schiebedach. Hatte meine Mutter noch jemanden zum Mittagessen eingeladen? Indem ich diese unerfreuliche Möglichkeit bedachte, ging ich auf dem mit Ziegeln gepflasterten Fußpfad um die Villa herum, beschattet von dreieckigen, quadratischen und kreisförmigen Hecken und ballförmig, pyramidisch und kegelförmig beschnittenen Sträuchern. Ein breiterer, gerader Weg unter einer Pergola aus weißlackiertem Eisen, die von Weinranken umschlungen war, schnitt den Garten in zwei Teile. Er führte von der Villa bis zum Ende des Grundstücks. Dort waren etliche Gewächshäuser an die Umfassungsmauer gebaut, deren Fensterscheiben funkelten. Auf halbem Weg zwischen der Villa und den Gewächshäusern sah ich unter der Pergola meine Mutter. Sie ging allein dahin und wandte mir den Rücken zu. Für einen Augenblick verzichtete ich darauf, sie zu rufen, und betrachtete sie.
Sie ging langsam, sehr langsam – wie jemand, der sich an dem freut, was er sieht, und darum so lange wie möglich bei seiner Betrachtung verweilt. Meine Mutter hatte ein zweiteiliges türkisblaues Kleid an, mit einer unten sehr engen und an den Schultern sehr weiten Jacke. Der Rock war äußerst enganliegend, fast wie ein Handschuh. Sie trug immer sehr schmal geschnittene Kleider, die ihre kleine Gestalt noch schlanker, steifer und puppenhafter erscheinen ließen. Ihr großer Kopf saß auf einem langen, nervösen Hals, ihre Haare waren blond, gekräuselt und immer sehr sorgfältig onduliert. Von weitem schon sah man an ihrem Hals die Perlen ihrer Kette – so groß waren sie. Meine Mutter liebte es, sich mit auffälligen Juwelen zu schmücken: massige Ringe, die um ihre zarten Finger tanzten, riesige Armbänder, behängt mit Amuletten und Anhängern, die aussahen, als müßten sie jeden Augenblick von den knochigen Gelenken gleiten, Nadeln, die zu reich für ihren mageren Busen waren, Ohrringe, zu groß für ihre häßlichen, verknorpelten Ohren. Wieder einmal bemerkte ich mit einem Gefühl, gemischt aus Vertraulichkeit und Ärger, daß die Schuhe, die sie an den Füßen, und die Handtasche, die sie unter dem Arm trug, zu groß zu sein schienen. Schließlich entschloß ich mich zu rufen: »Mama!«
Mit einem für sie bezeichnenden Mißtrauen blieb sie plötzlich stehen, als hätte ihr jemand die Hand auf die Schulter gelegt. Darauf drehte sie sich nur mit dem Oberkörper herum, ohne die Beine zu bewegen. Ich sah ihr scharfgeschnittenes Gesicht, die ausgehöhlten Wangen, den verkniffenen Mund, die lange, gerade Nase und die gläsernen blauen Augen, die mich schräg anstarrten. Dann lächelte sie, wandte sich ganz um und kam auf mich zu, den Kopf gesenkt, die Augen auf den Boden geheftet. Wie pflichtgemäß sagte sie: »Grüß dich! Und alle meine besten Wünsche!« Obgleich dies mit zärtlichen Absichten gesagt war, konnte ich nicht umhin zu bemerken, daß der Klang ihrer Stimme wie immer trocken und krächzend war, fast wie bei einer Krähe. In meiner Nähe angelangt, wiederholte sie: »Meine herzlichsten Glückwünsche«, und ich drückte ihr einen Kuß auf die Wange. Nebeneinander gingen wir auf das Ende des Weges zu. Sogleich deutete meine Mutter auf das Weinlaub, das die Pergola bedeckte, und fragte: »Weißt du, was ich gerade besichtige? Meine Weintrauben. Schau her!«
Ich hob den Blick und bemerkte, daß die Trauben alle mehr oder weniger angenagt und ausgesaugt aussahen.
»Die Eidechsen!« erklärte meine Mutter in dem seltsamen intimen, zärtlichen und zugleich wissenschaftlichen Ton, den sie immer anschlug, wenn sie von ihren Blumen oder Pflanzen sprach. »Diese Mistviecher klettern an den Pfählen der Pergola hinauf und fressen die Trauben. Sie verderben mir die ganze Pergola, denn die dunkelroten Trauben zwischen den grünen Ranken sehen wunderschön aus, aber wenn die Trauben halb angenagt sind, ist dieser Effekt beim Teufel.«
Ich sagte irgend etwas über ein Deckengemälde von Zuccari in einem römischen Palast, auf dem das gleiche Motiv – eine goldene Pergola mit dunkelroten Trauben und grünen Ranken – zu sehen ist, und sie fuhr fort: »Unlängst ist, ich weiß selbst nicht wie, eine Henne der Nachbarn in meinen Garten geraten. Eine von diesen Eidechsen saß auf der Pergola und fraß natürlich an meinen Trauben. Plötzlich rutschte sie aus und fiel herunter. Denk dir, sie kam nicht einmal bis zum Boden. Die Henne schnappte sie in der Luft und fraß sie auf. Verschlang sie richtig.«
Ich sagte: »Dann mußt du dir also Hühner halten. Die werden die Eidechsen fressen, und deine Trauben werden dann in Ruhe gelassen werden.«
»Mein Gott, die Hühner ruinieren ja alles, wo sie hinkommen! Da behalte ich lieber die Eidechsen!«
Wir setzten unseren Rundgang durch den Garten fort, gingen den Weg unter der Pergola entlang, bis zu der Umfassungsmauer, und schritten dann die Front der Glashäuser ab. Meine Mutter beugte sich nieder, ergriff eine über Nacht aufgeblühte Blume und hielt sie zwischen zwei Fingern in der Hand. Darauf geriet sie mit völlig verglasten Augen vor einer kleinen Terrakottavase in Verzückung – das ist das rechte Wort –, aus der eine Pflanze, die aussah wie eine grüne, haarige Schlange, bis zur Erde hinabreichte, so daß man sich wunderte, sie nicht zischen zu hören. Dann wieder lieferte sie mir in trocken-lehrhafter Art eine Menge botanischer Informationen, gewonnen aus der genauesten Lektüre von Handbüchern der Blumenpflege wie auch aus langen Gesprächen mit den beiden Gärtnern, die sehr gut bezahlt und daher ungemein geduldig waren und denen sie während der ganzen Zeit der Gartenarbeit ihre Gegenwart aufnötigte. Die Liebe meiner Mutter zu Blumen und Pflanzen war das einzig Poetische an ihrem sonst völlig prosaischen Leben. Gewiß, manchmal liebte sie mich, und der Vermehrung unseres Vermögens widmete sie eine unglaubliche Leidenschaft. Aber in den Geschäften wie in ihrem Verhältnis zu mir überwog ihr autoritärer, skrupelloser, interessierter und mißtrauischer Charakter. Die Blumen und Pflanzen hingegen liebte sie völlig interessefrei, hingebungsvoll und ohne Nebenabsichten. Und meinen Vater, wie hatte sie den geliebt? Wie gewöhnlich kam mir auch jetzt wieder der Gedanke, daß mein Vater und ich einander wenigstens in einem Punkt ähnelten: Wir wollten nicht mit meiner Mutter zusammen leben. Ich fragte sie brüsk: »Apropos, kannst du mir sagen, warum mein Vater immer davonlief, fort von dir?«
Ich sah sie die Nase rümpfen, wie sie das immer tat, wenn ich von meinem Vater sprach. »Was heißt hier apropos?«
»Das ist unwichtig. Antworte auf meine Frage!«
»Dein Vater lief nicht vor mir davon«, erwiderte sie nach einem Augenblick mit kalter Würde. »Er reiste gern, das war alles. Aber sieh diese Rosen an, sind sie nicht herrlich?«
Ich sagte in entschlossenem Ton: »Ich möchte, daß du mir von meinem Vater erzählst. Wenn es wahr ist, daß er nicht vor dir davonlief, warum bist du dann nicht mit ihm gereist?«
»Vor allem mußte jemand in Rom bleiben und sich um unsere Interessen kümmern.«
»Du meinst deine Interessen.«
»Die Interessen der Familie! Und dann paßte mir seine Art zu reisen nicht. Ich reise gern mit allen Bequemlichkeiten – an Orte, wo es gute Hotels gibt und Leute, die ich kenne. Zum Beispiel nach Paris, London, Wien. Er aber hätte mich Gott weiß wohin geschleppt, nach Afghanistan oder nach Bolivien. Ich kann Unbequemlichkeiten und exotische Länder nicht vertragen.«
Ich beharrte: »Aber warum lief er von daheim fort? Oder, wie du dich ausdrückst, warum reiste er? Warum blieb er nicht bei dir?«
»Weil er nicht gern zu Hause war.«
»Und warum war er nicht gern zu Hause? Langweilte er sich da?«
»Ich habe mir nie die Mühe gegeben, das herauszubekommen. Ich weiß nur, daß er traurig wurde, nicht mehr redete, nie mehr ausging … Zuletzt war ich es selbst, die ihm das Geld gab und ihm sagte: Nimm das, geh; es ist besser, wenn du gehst.«
»Glaubst du nicht, daß er geblieben wäre, wenn er dich geliebt hätte?«
»Tja«, antwortete sie ruhig mit ihrer unerfreulichen Stimme, und es war ihr offenbar angenehm, die Wahrheit zu sagen. »Aber er liebte mich nicht.«
»Warum hat er dich dann geheiratet?«
»Ich war es, die ihn heiraten wollte. Er hätte vielleicht darauf verzichtet.«
»Er war arm, nicht? Und du warst reich?«
»Ja, er hatte keinen Heller. Er war aus guter Familie. Das ist aber auch alles.«
»Glaubst du nicht, daß es eine Geldheirat war?«
»O nein! Dein Vater war nicht an Geld interessiert. Darin war er wie du. Er hatte zwar immer Geld nötig, aber er maß ihm keine Bedeutung bei.«
»Weißt du, warum ich dir alle diese Fragen nach meinem Vater stelle?«
»Das weiß ich wirklich nicht.«
»Weil mir der Gedanke gekommen ist, daß ich ihm wenigstens in einem Punkt ähnlich bin. Auch ich laufe unausgesetzt vor dir davon.«
Ich sah, wie sie sich bückte und mit einer kleinen Schere, die ich bisher nicht bemerkt hatte, sauber eine rote Blume abschnitt. Dann richtete sie sich wieder auf und fragte: »Was macht deine Arbeit?«
Bei dieser Frage fühlte ich, wie sich plötzlich meine Kehle zuschnürte; es entstand ein Gefühl grauer, eisiger Niedergeschlagenheit. In immer weiter sich verbreitenden Wellen schien es von mir auszugehen, wie wenn sich eine Wolke zwischen die Sonne und die Erde schiebt. Mit einer Stimme, die gegen meinen Willen erstickt klang, antwortete ich: »Ich male nicht mehr.«
»Was heißt das, du malst nicht mehr?«
»Ich habe beschlossen, mit der Malerei aufzuhören.«
Meine Mutter hatte niemals Sympathie für meine Tätigkeit empfunden, vor allem, weil sie nichts davon verstand – was sie aber ungern hörte und zugab –, außerdem, weil sie nicht zu Unrecht vermutete, daß mich die Malerei ihr entfremdet hatte. Wieder einmal mußte ich ihre Selbstbeherrschung bewundern. Ein anderer hätte sich an ihrer Stelle wenigstens eine gewisse Genugtuung anmerken lassen. Sie aber nahm die Mitteilung gleichmütig entgegen. »Und warum«, fragte sie nach einem Augenblick im Ton träger, fast mondäner Neugier, »hast du beschlossen, mit der Malerei aufzuhören?«
Wir waren inzwischen fast bis zur Villa gelangt. Ein Geruch nach Küche, nach ausgezeichneter Küche, lag in der Luft. Gleichzeitig fühlte ich, wie meine Verzweiflung zu- statt abnahm, obwohl ich mir wütend vorsagte: Jetzt geht es vorüber, jetzt geht es vorüber! Da tauchte eine Erinnerung in mir auf: Ich sah mich selbst als fünfjähriges Kind, wie ich mit einem blutigen Knie verzweifelt schluchzend durch einen anderen Garten lief und mich in die Arme meiner Mutter warf. Und meine Mutter beugte sich über mich und sagte mit ihrer häßlichen Krähenstimme: »Nicht weinen! Laß sehen! Nicht weinen, weißt du denn nicht, daß Männer nicht weinen?« Ich blickte meine Mutter an, und zum erstenmal seit langer Zeit schien es mir, als verspürte ich ein Gefühl der Zuneigung für sie. Folglich sagte ich: »So.« Als Antwort auf ihre Frage benutzte ich das kürzeste Wort, das ich finden konnte, denn ich schämte mich meiner Verzweiflung und wollte sie mir nicht anmerken lassen.
Aber ich erkannte sogleich, daß es nichts half, »so« zu sagen. Das jammervolle Gefühl hörte deswegen nicht auf, eine Gänsehaut überlief mich, und es kribbelte mich an den Haarwurzeln. Die ganze Welt ringsum schien durch mein Gefühl farblos und sinnlos geworden zu sein. Dann wehte ein leiser Windhauch jenen Geruch nach guter Küche in meine Nase, und fast fühlte ich den Drang, mich schluchzend in die Arme meiner Mutter zu werfen, wie mit fünf Jahren – in der Hoffnung, von ihr wegen des Abbruchs meiner Malerei genauso getröstet zu werden wie damals wegen meines zerschundenen Knies. Völlig unerwartet sagte ich plötzlich: »Übrigens habe ich vergessen, dir mitzuteilen, daß ich das Atelier aufgebe, da es ja nun keinen Zweck mehr für mich hat. Ich kehre zu dir zurück.« Einen Augenblick verstummte ich, verblüfft über meine eigenen Worte, die auszusprechen ich zuvor nicht die mindeste Absicht gehabt hatte und die mir von Gott weiß woher zugeflogen waren. Dann wurde mir klar, daß ich jetzt keine Rückzugsmöglichkeit mehr hatte, und fügte gezwungen hinzu: »Vorausgesetzt, daß du mich willst.«
Ungeachtet des Staunens, in das mich mein eigener Vorschlag gestürzt hatte, konnte ich nicht umhin, zum zweitenmal die Beherrschung meiner Mutter zu bewundern, jene Fähigkeit, die sie in ihrer mondänen Sprache »die Form« nannte. Ich hatte ihr etwas gesagt, worauf sie seit Jahren wartete, das einzige vielleicht, das ihr wirklich Freude machen konnte; aber auf ihrem ausgetrockneten, hölzernen Gesicht, in ihren gläsernen Augen wurde keinerlei Regung sichtbar. Langsam antwortete sie mit einer noch unangenehmeren Stimme als sonst, fast im Ton einer Frau, die in einem Salon auf ein völlig gleichgültiges Kompliment erwidert: »Natürlich will ich. In diesem Hause wirst du immer mit offenen Armen aufgenommen werden. Wann würdest du also kommen?«
»Heute abend oder morgen früh.«
»Besser morgen früh, da habe ich Zeit, dir dein Zimmer vorbereiten zu lassen.«
»Also dann morgen früh.«
Nach diesen Worten sprachen wir eine ganze Zeit hindurch nichts mehr. Ich fragte mich, was mir zugestoßen sei und ob vielleicht meine wahre Berufung darin bestehe, daheim bei meiner Mutter zu bleiben, die Langeweile hinzunehmen, unser Vermögen zu verwalten und reich zu sein. Meine Mutter ihrerseits schien jetzt die Phase des Staunens und der Freude über den unverhofften Sieg überwunden zu haben. Wie man aus dem nachdenklichen Ausdruck ihres bewegungslosen Gesichts ersehen konnte, war sie schon dabei, diesen Sieg zu organisieren und Pläne für meine und ihre Zukunft zu entwerfen. Schließlich sagte sie in beiläufigem Ton: »Ich weiß nicht, ob es deine Absicht war, aber auf jeden Fall ist es ein gutes Vorzeichen, daß du dich gerade heute an deinem Geburtstag entschlossen hast, wieder hierher zurückzukehren. Ich habe dir heute früh gesagt, ich hätte eine Überraschung für dich. Sie soll für beide Anlässe zusammen gelten.«
Ich fragte beiläufig: »Was ist das denn für eine Überraschung?«
»Komm mit mir, ich zeige sie dir.«
Sarkastisch sagte ich: »Heute wollen wir auf jeden Fall nur einen der beiden Anlässe feiern: meine Rückkehr nach Hause. Das ist das wahre heutige Fest.«
Bemerkte meine Mutter meinen Sarkasmus? Oder merkte sie nichts? Sicher ist, daß sie keine Antwort gab. Sie ging mir voraus, rings an der Mauer der Villa entlang bis zum Vorplatz. Dort sah ich sie auf den neben meinem Auto geparkten schönen Sportwagen zuschreiten und dann stehenbleiben, eine Hand auf der Motorhaube, ungefähr in der Haltung eines Fotomodells für eine Autofabrik. »Du hast mir einmal gesagt«, erklärte sie, »daß du gern einen sehr schnellen Wagen hättest. Zuerst hatte ich daran gedacht, dir einen richtigen Rennwagen zu kaufen, aber die sind zu gefährlich, und so habe ich dieses Kabriolett gewählt. Der Vertreter hat mir versichert, es sei das allerneueste Modell; es ist erst vor wenigen Monaten herausgekommen. Es macht seine zweihundert Kilometer in der Stunde.«
Langsam trat ich näher und fragte mich dabei, wieviel der Wagen kosten mochte, den meine Mutter mir schenken wollte. Es war eine ausländische Marke mit Luxuskarosserie. Ich wußte, daß diese Art Autos sehr teuer war. Meine Mutter sprach jetzt von dem Wagen in demselben sachkundigen, gelösten, leicht neugierigen, fast liebevollen Ton, mit dem sie von den Blumen in ihrem Garten redete. »Mir gefällt besonders das hier«, sagte sie und wies auf das Armaturenbrett mit dem schwarzen Hintergrund, auf dem die vernickelten Knöpfe und Hebel funkelten wie Diamanten auf dem schwarzen Samt des Juweliers, »deswegen allein hätte ich den Wagen gekauft. Dann gefällt er mir, weil er die Solidität eines schönen Paars robuster, handgearbeiteter Schuhe für lange Wanderungen hat. Eine beruhigende Solidität. Willst du ihn also ausprobieren? Wir haben noch Zeit, vor dem Essen eine kleine Rundfahrt zu unternehmen – ein paar Minuten, nicht länger, denn es gibt einen Gang, der nicht aufgewärmt werden kann. Die Köchin legt großen Wert darauf, daß du ihn kostest, sie hat ihn eigens für dich gemacht.«
Ich betrachtete verträumt den Wagen und murmelte: »Wie du willst.«
»Ja, probiere ihn, auch weil ich dem Vertreter den Kauf bestätigen muß.«
Ich sagte nichts, öffnete die Wagentür und stieg ein. Meine Mutter setzte sich neben mich, und während ich den Motor anließ und die Schaltung betätigte, sagte sie in ihrem üblichen intimen und zugleich neutralen Ton: »Der Vertreter hat mir versichert, daß das Verdeck im Winter keinen noch so leisen Lufthauch durchläßt. Im übrigen gibt es eine Heizung. Im Sommer läßt sich das Dach zurückschlagen. Es ist hübscher, ohne Dach zu fahren.«
»Ja, es ist hübscher.«
»Gefällt dir die Farbe? Mir schien sie sehr schön, so daß ich gar keinen anderen Wagen mehr sehen wollte. Der Vertreter hat mir gesagt, der Lack sei nach einem zwar kostspieligen, aber sehr wirkungsvollen Verfahren metallisiert.«
Ich sagte aufs Geratewohl: »Er ist sehr fein und empfindlich.«
»Wenn er sich abgenützt hat, läßt du ihn erneuern.«
Der Wagen gab ein dunkles Brummen von sich, wie ein Rennwagen; dann ließ ich ihn um den Vorplatz herumfahren und schließlich die Zufahrtsstraße entlang. Es war ein sehr starker und gleichzeitig empfindlicher Wagen, wie ich feststellen konnte, denn er schoß bei dem geringsten Druck auf das Gaspedal buchstäblich davon. Wir durchfuhren das Parktor, und ich konnte nicht umhin, mich an das Gefühl zu erinnern, das ich kurz zuvor auf der Fahrt zur Villa gehabt hatte: wieder in den Schoß zurückzukehren, der mich geboren hatte. Und jetzt? Jetzt war ich drin und würde ihn wohl nie mehr verlassen.
Gleich hinter der Gartentür wandte ich mich nach rechts und fuhr die Via Appia entlang, in Richtung Castelli. Der trübe Schirokkotag hatte um den Monte Cavo eine Art schwarzen, ungewissen Ring aus Gewitterwolken gelegt. Längs der Via Appia schien alles trüb von Staub und sommerlicher Gluthitze – Pinien, Zypressen, Ruinen, Hecken, Felder. Inzwischen hörte meine Mutter nicht auf, ein Loblied auf das Auto zu singen, doch in beiläufiger und mondäner Art, als entdeckte sie nach und nach seine Vorzüge. Ohne ein Wort zu sprechen, fuhr ich die Via Appia bis zur Gabelung entlang, wandte mich dann nach links, fuhr sehr schnell bis zur Via Appia Nuova hinab, drehte an der Ampel und kehrte um.
»Wie findest du den Wagen?« fragte meine Mutter in dem Augenblick, als wir wieder die Via Appia erreichten.
»Er scheint mir in jeder Hinsicht ausgezeichnet! Übrigens kannte ich ihn schon.«
»Aber wenn es doch ein neues, kaum vor einem Monat herausgekommenes Modell ist –«
»Ich meine, ich kannte schon Wagen dieser Marke.«
Da war das Gartentor wieder, die Zypressenallee, die Villa am Ende des Vorplatzes. Ich hielt an, zog die Handbremse, blieb einen Augenblick regungslos und schweigend sitzen, wandte mich dann plötzlich zu meiner Mutter um und sagte: »Danke!«
Sie antwortete: »Ich habe den Wagen hauptsächlich deshalb gekauft, weil er mir so gut gefiel. Wenn ich ihn nicht für dich gekauft hätte, hätte ich ihn für mich selbst gekauft.«