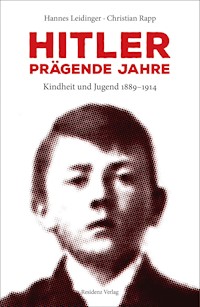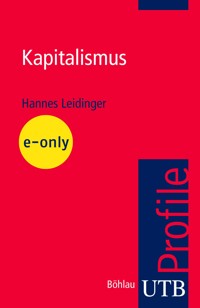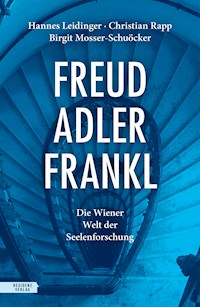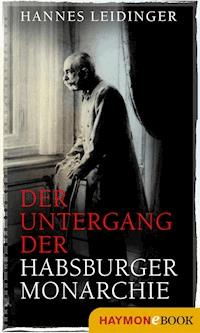
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1918: DAS ENDE EINER ÜBER 600 JAHRE ANDAUERNDEN DYNASTIE November 1918: Die Habsburgermonarchie liegt in Trümmern. Die Armee löst sich auf, und Kaiser Karl verlässt Schloss Schönbrunn durch die Hintertür. War dieses Ende wirklich unausweichlich, gar verspätet? Denn mit dem Tod von Kaiser Franz Joseph war der Monarchie 1916 nicht nur die Symbolfigur abhanden gekommen. Oder war es genau umgekehrt, der Untergang lediglich eine Verkettung unglücklicher Umstände? Der Krieg hatte die Lage Österreich-Ungarns zwar keineswegs vereinfacht. Aber die Anzeichen eines völligen Zusammenbruchs hielten sich trotz sozialer Spannungen und wirtschaftlicher Krisen in Grenzen. EIN NEUER BLICK AUF DIE GESCHICHTE DER HABSBURGER VOM BELIEBTEN SACHBUCH-HISTORIKER AUFBEREITET Hannes Leidinger bürstet die Geschichte der Jahre bis 1918 gegen den überlieferten Strich, erzählt von Alltagsgeschichte ebenso wie von alten und neuen "Herren", deren Taten und Beschlüsse weitreichende Konsequenzen für Europa hatten und immer noch haben. Und er geht erstmals der spannenden Frage nach, ob die Monarchie nicht in vielen kleinen Imperien bis heute weiterlebt. ************************* Leserstimmen: "Hätte ein Fortbestehen der Monarchie dem Jahrhundert der Kriege und damit Europa eine andere, friedvollere Richtung geben können? Oder lebte der Geist der Monarchie gar in den Nationalstaaten weiter? Hannes Leidinger stellt spannende Fragen und liefert fundierte, aufschlussreiche Antworten." "Hannes Leidinger liebt das Spiel 'was wäre gewesen, wenn'. Das Tolle an dem Buch ist, dass diese Spekulationen alle auf Quellen und Fakten basieren." "Hannes Leidinger schafft es immer wieder, Geschichte neu zu erzählen. Und das äußerst unterhaltsam. Sehr lesenswert!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannes Leidinger
Der Untergang der Habsburgermonarchie
Vorwort – Eine kleine Trilogie
Der Mann ohne Eigenschaften
Teil I: Der Blick von der Oberfläche in die Tiefe
Wahrhaft monumentale Werke – oft auf hohem wissenschaftlichem Niveau – sind in den letzten Jahren zur Habsburgermonarchie und zum Ersten Weltkrieg erschienen. Jeden, der an weiterführenden Informationen interessiert ist, muss es positiv stimmen, dass diese umfangreichen Studien vielfach eine große Leserschaft gefunden haben.
Die erhöhte Nachfrage konterkariert zugleich Tendenzen unter anderem im Bildungswesen, „Sachwissen“ – gerade im „Fach Geschichte“ – zugunsten sogenannter „Schlüsselqualifikationen“ in den Hintergrund zu drängen. Das dabei geäußerte Bedürfnis, von der uferlosen Aneignung der Datenmengen wegzukommen und „pädagogische Orientierungshilfen“ anzubieten, verlangt bisweilen mit gutem Grund nach übersichtlichen Darlegungen in „Grundzügen“. Vereinfachungen werden eingefordert. Und tatsächlich scheint es oft möglich, die jeweilige Sachlage nicht unnötig zu verkomplizieren.
Andererseits bleibt unbestritten, dass komplexe Verhältnisse – vor allem in der „großen historischen Erzählung“ über ganze Länder und Epochen oder sogar darüber hinaus – nur um einen mitunter hohen Preis zu simplifizieren sind. Geschichte mag in Archiven und Bibliotheken, in Aktenkartons, „Beschlagwortungen“ und Publikationen „strukturiert“ erscheinen. Das „Urmaterial“, die Zeugnisse der Vergangenheit, aber auch die wachsende Zahl von nachfolgenden Interpretationen bilden in Summe jedoch ein zeitweilig irritierendes Datenchaos.
Ordnung ist immer wieder aufs Neue nicht nur zu hinterfragen, sondern auch zu schaffen. Kategorien und Zuschreibungen werden gleichermaßen überdacht wie hervorgebracht. Im Gliederungsprozess widersetzen sich manche Aspekte der Ein- und Unterordnung. Erweisen sie sich als repräsentativ, bilden sie Gegennarrative. Wir müssen ihnen Raum geben.
Diese allgemeine Erfahrung im Umgang mit Geschichte gilt in gesteigertem Maße für fragile Gemeinwesen und Reichsgefüge, für Herrschafts- und Gesellschaftssysteme, deren Fortbestand – oft über längere Zeit – im fast buchstäblichen Sinn auf „des Messers Schneide“ stand. Die Habsburgermonarchie, ihre „Länder, Völker und Kulturen“ sind dafür ein gutes Beispiel.
Die Geschichte, die hier zu erzählen ist, besteht nicht bloß aus der Abfolge von Krisen bis hin zur „Zerreißprobe“ einerseits und Phasen der Entspannung andererseits. Ebenso wenig geht es lediglich um divergierende Perspektiven von einzelnen Akteuren, sozialen Gruppen oder Schichten. Vielmehr schaffen es gerade bei gründlicher Betrachtung selbst ein und dieselben Fakten, gänzlich unterschiedliche Konsequenzen hervorzubringen. Diese Gegensätze, ihre Verflechtung oder Auflösung, münden in Irritationen und regelrechte Paradoxien.
Sie bewirken außerdem, dass das „Spiel“ der Kräfte mehr als nur aus einem Blickwinkel lange offenbleibt, ja bis kurz vor dem Ende unentschieden ist. Man kann sogar noch weitergehen und fragen: Wurde es vielleicht auf bestimmten Ebenen über die vermeintliche „Schlussminute“ hinaus noch fortgesetzt?
Die Kapitel dieses Buches, und zunächst einmal explizit die nachfolgenden Texte der „Vorwort-Trilogie“, haben sich unzähligen Vertiefungen und Kausalitätsproblemen zu stellen. Sie betreten zuerst den Raum unterschiedlicher Lesarten der (habsburgischen) Geschichte, öffnen sich dann der Mehrdimensionalität und den Verzahnungen historischer Entwicklungen und Phänomene, um sich dann in einer sehr „kakanischen“ Art und Weise vor dem Hintergrund der „Gefahr des Untergangs“ mit Erkenntniszweifel und existenzieller Skepsis zu befassen.
Diese Abschnitte der „Vorwort-Trilogie“ sind – zugegeben – keine „Schonkost“, aber dem Thema angemessen. Wer dennoch „Abkürzungen“ auf dem Weg zum Hauptteil des Buches bevorzugt, dem sei der Wiedereinstieg am Beginn des Kapitels „Die Beständigkeit der Fragilität“ anempfohlen. Hier wird skizzenhaft – in kurzen Gedankenfeldern – eine weiter zurückliegende, ferne Geschichte erfasst, die uns zu den letztlich alles entscheidenden Dekaden, Jahren, Monaten und schließlich Wochen bis zum Untergang der Habsburgermonarchie hinführt.
Teil II: Pfade durch das Dickicht der Widersprüche und Mehrdimensionalität – Schlüsselfragen und „Architektur“ des Buches
Aktuelle Deutungen
„Konnte es wenigstens für ein föderalistisches Österreich eine Zukunft geben“, nachdem es bei Königgrätz von Preußen besiegt und aus „Deutschland hinausgedrängt“ worden war? Konrad Canis’ aktuelle Veröffentlichung zur „bedrängten Großmacht“ Österreich-Ungarn im „europäischen Mächtesystem“ stellt diese Schlüsselfrage und widmet sich dabei der Zeit bis 1914. In einer äußerst differenzierten Darstellung, die internationale Beziehungen immer wieder mit innenpolitischen Entwicklungen abgleicht, gelangt Canis zu einem insgesamt eher negativen Ergebnis: Für ein Weiterbestehen „gab es kaum Aussichten. So zeichnete sich bereits 1866 das Dilemma ab. Allein halbe und instabile Kompromisse schienen möglich. Deshalb ist die Auffassung ziemlich verbreitet, daß dem danach neukonstruierten System die Gefahr des Verfalls von Anfang an eigen war“.1
Obwohl sich die Habsburger aus der „revolutionären Krise“ von 1848 „herauswinden konnten“, war ihnen auf dem diplomatischen Parkett der „Stempel der Reaktion und des Stillstandes aufgedrückt“, mangelte es ihrem Reich „an wirtschaftlichem, politischem, militärischem und finanziellem Potential“, so der Befund. Und weiter: „Alle Faktoren zusammengenommen lassen erkennen, wie begrenzt die Zukunftsaussichten des Systems“ waren. „Nach Königgrätz schien lediglich Zeit gewonnen“, um „vorläufig eine gewisse innere Sicherheit und Voraussetzungen für eine Großmachtpolitik zu gewinnen, deren Grenzen sich jedoch rasch zeigen sollten. Eine Gewähr, gar eine sichere Entscheidung für die Zukunft bedeutete“ das aber nicht.2
Trotzdem gilt die Einschränkung: „Das Urteil, den Anfang a priori auf ein absehbares unvermeidliches Ende der Doppelmonarchie zulaufen zu sehen“, geht „zu weit, wenngleich durch den Verlauf bis zum Ende dieser Weg vorgezeichnet scheint“.3
Wie aber mit dieser Einschätzung umgehen? Gewiss stimmt es, dass Ideen, Pläne und Konzepte existierten, „die nicht alle von vornherein zum Scheitern verurteilt sein mußten“. Und ebenso zutreffend ist es, dass auch in der Vergangenheit die „Perspektiven für die Zukunft“ erst „einmal offen“ waren. Krisen „konnten sich verstetigen oder sogar verschärfen. Doch sie konnten sich auch abschwächen. Es konnten neue Entwicklungen eintreten, die Chancen boten, nach innen wie nach außen“.4
Diesen Ansatz greift ein fast zeitgleich erschienenes Buch von Pieter M. Judson auf, das sich im englischen Original als „neue Geschichte“ des habsburgischen Imperiums versteht und dessen Überlebensfähigkeit betont: „Die Beamten und Parteipolitiker“ des Reiches „hatten schon seit langem Flexibilität und Kreativität an den Tag gelegt, wenn es darum ging, strukturelle Änderungen auszuhandeln, die zu einem besseren Funktionieren“ des Gemeinwesens „beitragen und ihm langfristige Stabilität verleihen sollten“.5 Auch als Hort der Abwehr gegen Modernisierungserscheinungen lasse sich die Donaumonarchie nicht begreifen, heißt es hier des Weiteren. Denn: Unter anderem die Wahlen bestätigten, „dass die Hoffnungen der Regierung, und sogar des Kaisers, die Reform könnte überregionale Parteien an die Macht bringen, die darauf aus waren, das Reich gegen die regionalen Kräfte des Nationalismus zu stärken, berechtigt gewesen waren“.6 Also ein System „mit Zukunft“, dem im Übrigen auch auf der Mikroebene keineswegs der Todesbazillus eingepflanzt war? Schließlich zeigten Untersuchungen, dass sich „Gegensätze“ größtenteils „in Luft auflösten, wenn man Ergebnisse aus der Untersuchung lokaler Gesellschaften zur Überprüfung heranzieht“.7
Die jüngsten Publikationen widersprechen einander keineswegs diametral, verfügen allerdings nur über beschränkte Schnittmengen. Gegenläufige Argumentationstendenzen scheinen, wie von den Autoren hervorgehoben, vom Fokus abzuhängen, etwa vom Blick auf die inneren Entwicklungen einerseits oder auf grenzüberschreitende Phänomene und Spannungsfelder andererseits.
Erstaunliche Einsichten
Im einen wie im anderen Fall aber überraschen die Ereignisse von 1914 und bis zu einem gewissen Grad sogar die Geschehnisse in den nachfolgenden Jahren: Das System hielt, anders als oft vorhergesagt, dem „Großen Kräftemessen“ zunächst stand: Die Soldaten aller Völker schlugen sich im Ersten Weltkrieg für „ihren Kaiser“ mit bemerkenswertem Gehorsam. Uniformierte wie Zivilisten begehrten nicht gegen den Waffengang auf und lieferten – wenn auch in unterschiedlicher Intensität – Beispiele für „loyales Verhalten“.
Und nicht nur das. Auch aus anderen Blickwinkeln betrachtet konnten die imperialen Eliten noch zur Jahreswende 1916/17 zufrieden sein: Serbien besiegt und besetzt. Rumänien ebenso. Russland zurückgedrängt und im Inneren geschwächt. Italien erfolgreich abgewehrt. Neue Gebiete hinzugewonnen und zukünftig möglicherweise unter dem Einfluss der habsburgischen Dynastie. Mit Karl ein junger Kaiser an der Macht, voll guten Willens und trotz geringer Erfahrungen auf dem Weg, den Völkern der Monarchie die Hand zu reichen. Selbst unter den radikalen Nationalitätenvertretern noch keine eindeutige Abwendung vom gemeinsamen Staat. Ergo: Der Erste Weltkrieg vereinfachte die Lage Österreich-Ungarns zwar keineswegs. Aber die Anzeichen eines völligen Zusammenbruchs hielten sich trotz sozialer Spannungen und wirtschaftlicher Krisen in Grenzen.
Die Umwälzungen der folgenden Jahre waren keine ausgemachte Sache, auch nicht für die „Feindesländer“ – erst recht nicht vor 1914. Zwar sprach die in- und ausländische Presse 1913 von einem skandalgeschüttelten Reich, das keine Idee, sondern lediglich eine Verwaltung besitze und „schwer erkrankt“ das Bett hüten müsse.8 Aber handelte es sich deswegen schon um ernstzunehmende Andeutungen eines nahenden Ablebens?
Die Symbolfigur der „Altersschwäche“ und des Anachronismus, Franz Joseph I., wurde jedenfalls selbst von jenen Kräften, die den „großbürgerlichen-aristokratischen Eliten“ nicht allzu nahestanden, differenzierter gesehen. Bei seinem Regentschaftsjubiläum 1908 war in Bezug auf den k. u. k. Staat außerdem von der „Einschränkung“ weiterer „räumlicher“ Entfaltung die Rede, gleichzeitig aber auch von „unbegrenzten inneren Entwicklungsmöglichkeiten“.
Das Schicksalhafte und der offene Horizont: Fragen an die Vergangenheit
Im Widerspruch dazu standen freilich fortgesetzte ethnische Konflikte und Warnungen vor dem Reichszerfall, gefolgt von der Tatsache, dass der Kollaps im November 1918 Wirklichkeit wurde, es dafür also „gute Gründe“ geben musste. Für manche Beobachter und Kommentatoren präsentierten sich die Geschehnisse jedenfalls als Verkettung unvermeidlicher Umwälzungen. Schicksalhaft trat vor ihr Auge eine „Logik des Zusammenbruchs“.
Die vermeintliche Vorherbestimmtheit des Nieder- und Untergangs in der Retrospektive forderte freilich angesichts der irritierenden Gegenbilder zu Widerspruch heraus, wie auch einige eingangs zitierten Wortmeldungen belegen, die letztlich immer wieder um die Frage kreisen: Hätte es also doch anders kommen können?
Eine vielfach zum Spekulativen verführende Geschichtsdeutung ist allerdings gar nicht nötig. Dem Kontrafaktischen als reizvolles Gedankenspiel treten nachweisbare Alternativen in den Quellen gegenüber. Und mit ihnen drängen sich noch einmal Schlüsselfragen auf: War das Ende 1918 unausweichlich, vielleicht verspätet, vielleicht vorzeitig? Oder existierte die Donaumonarchie in gewisser Weise ohnehin weiter? Nicht bloß als „Erbe des Doppeladlers“, nicht nur – wie so oft belegt – kulturell und mental?9
Bei genauerer Betrachtung löst sich der „November achtzehn“ als scharfer Trennstrich zwischen den Epochen auf. Raumkonzepte, Handelsnetze, Wirtschaftskontakte, Entscheidungsmechanismen, Rechts- und Elitenkontinuitäten geraten in den Blickpunkt. Darüber hinaus wirkt die Zäsur gewissermaßen wie die Umwandlung der einen „Monarchie“ in viele „Imperien“.
Aber bestanden zwischen diesen nur Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten oder vielmehr tiefer gehende Verflechtungen? Gab es einen „Commonwealth“ des Donauraumes, und wenn ja, wie lange? Waren seine multikulturellen, grenz- und milieuüberschreitenden Signaturen geradezu idealtypisch etwa in die jüdischen Lebenswelten eingeschrieben?
Und fern von jeder Nostalgie: Bildeten der Donauraum, „Österreich“ und das „Haus Habsburg“, wie so oft dargestellt, eine untrennbare Einheit, oder gab es Hinweise auf lang zurückreichende Reibungsflächen und Entflechtungen zwischen dem, was angeblich unzertrennlich war?
Die Gliederung des Buches
Das Buch folgt gegenläufigen Erzählungen und Interpretationen, die vielfach von gewohnten Sichtweisen wegführen. Es misst den zweifelsohne erkennbaren Epochenbruch von 1917/18 daher neu ein, zergliedert sich doch die Historie in unterschiedliche geographische, zeitliche, materielle und geistige Räume, Tempi, Kontinuitäten, Beschleunigungen und Zäsuren, Beständigeres und Kurzfristiges oder „Ereignishaftes“. Miteinander verflochten, verursachen sie Zuspitzungen und Entspannungen, schaffen und überwinden sie Widersprüche oder Paradoxien, bringen sie „Wellenbewegungen“ und Zyklen ebenso hervor wie tiefer liegende, lineare, scheinbar zielgerichtete Tendenzen.
Derlei abstrakte Phänomene fordern zur konkreten Überprüfung auf, die nur mit Hilfe von detaillierteren Darstellungen auf verschiedenen Zeitebenen gelingen kann. Bisweilen sind etwa allgemeine Entwicklungen, regionale und epochenspezifische Eigentümlichkeiten oder auch eventuelle „Konstruktionsfehler“ der habsburgischen Herrschaft nur mit einem Blick in die weit zurückliegende, Jahrhunderte entfernte Vergangenheit zu verstehen. Das erste Kapitel, das den Titel „Die Beständigkeit der Fragilität“ trägt, befasst sich unter anderem damit. Schlaglichtartig, in kleinen „Portionen“, wird hier eine Art Vorgeschichte geboten, die das Feld für die weiteren Ausführungen aufbereitet. Zum Verständnis des Folgenden, das ausführlicher – in stetem Abwägen von Pro- und Contra-Argumenten – die Effekte unterschiedlichster Trends und Aspekte aufgreift, sind sie unerlässlich. Ein zweiter Längsschnitt behandelt auf dieser Grundlage dann die Donaumonarchie während der widersprüchlichen und langen „Jahrhundertwende“, die hier in etwa von 1870 bis zum Vorabend des Ersten Weltkrieges reicht. Letzterem sind wiederum die zwei Abschnitte „Gewaltlösungen“ und „Anatomie des Zusammenbruchs“ gewidmet. In ihnen treten die Geschehnisse und Wendepunkte bisweilen innerhalb weniger Monate oder auch nur einiger Wochen in das Blickfeld der Betrachtung. Schließlich weitet sich der Horizont im abschließenden Teil erneut: „Das Erbe“ der Habsburgermonarchie in seinen vielen Facetten und mit seinen unterschiedlich langen Nachwirkungen steht im Mittelpunkt.
Die „Architektur“ dieses Gedankengebäudes verlangt darüber hinaus, um nicht zu theoretisch oder skizzenhaft zu bleiben, nach einer balancierten Zusammenschau von Details und Gesamtheit, von Individuellem und Kollektivem. Atemberaubende Fallhöhen zwischen dem persönlichen Erleben und der „monumentalen“, abstrakten oder „großen Geschichte“ entstehen. Nicht immer können sie ausgeglichen werden. Mitunter lässt sich eine gewisse Unausgewogenheit der Darstellung kaum vermeiden, abgesehen von notwendigen Lücken, um wenigstens ansatzweise den „Bogen zu spannen“.10 Die „großformatigen Narrative“, die spezifische Erkenntnisse miteinander verbinden, sind und bleiben Wagnisse, die weiterhin die Schilderung der „Einzelheiten“ einfordern. Aus ihnen besteht der „Tragbalken“ auch für hinkünftige Versuche, ausgreifende „Erzählstränge“ zu entwerfen.11
Botschaften für die Nachwelt
Die „Qual“ der Auswahl von Signifikantem, die Suche nach dem Repräsentativen, inkludiert mögliche Fehlerquellen bei der Analyse des „historischen Stoffes“ ebenso wie die schwierige Frage nach der Bedeutung des Geschehenen für spätere Epochen. Liegt im Austarieren der Interessen eines „Vielvölkerstaates“ wie der Donaumonarchie sowie in deren Scheitern eine Botschaft für die Nachwelt? Haben bestimmte Pläne, Modelle und Ausgleichsbestrebungen Vorbildcharakter? Oder dienen sie ganz im Gegenteil als Warnung? Befindet sich unter den Zerstörungshorizonten einer fernen Epoche und versunkenen Gesellschaft, die andere Lebenswirklichkeiten, Prinzipien, Regeln und Werte repräsentiert hat, das Leichengift des verwesenden Doppeladlers? Und entfaltet dieses Erbe „Kakaniens“ auch heute noch seine Wirkung?
Carlo Moos stellt in seiner 2016 erschienenen, ausführlichen und multiperspektivischen Untersuchung über das Weiterleben der habsburgischen Welt jedenfalls fest: Ungarn trauerte und „trauert offensichtlich“ selbst gegenwärtig „der Zerschlagung seines tausend Jahre alten Königreichs nach“.12 Und „auf der anderen Seite der Grenze“, nämlich in der Slowakei, steht „keineswegs alles zum Besten. So hat Bratislava“ ein „neues Sprachengesetz in Kraft gesetzt, wonach in dem auch von Magyaren“ bewohnten Süden des Landes „nur noch Slowakisch gesprochen werden darf und die zweisprachigen Ortsschilder verschwinden sollen“.13 Während wiederum ungarische Intellektuelle ihrem eigenen Land einen auch aus den österreichischen Erinnerungskulturen bekannten Hang zum „Verdrängen, Verschweigen“ und „Beschönigen der Wahrheit“ nachsagen14, haben die Balkankriege des ausgehenden 20. Jahrhunderts auf besonders grausame Art Assoziationen geweckt: Sarajewo in den 1990er Jahren und der nationale Hass in weiten Teilen Südosteuropas verwiesen auf Streitpunkte, die weit zurückreichten, am Anfang unheilvoller Ereignisketten standen und offensichtlich nach wie vor ungelöst waren oder noch sind.
Aber nicht immer geht es dabei um die direkte Folge unbewältigter Konflikte oder deren „Wiederauftauen“, beispielsweise nach der „frostigen Ära“ der kommunistischen Systeme. Geschichte fungiert auch und vor allem als Reservoir bisweilen fragwürdiger Neubewertungen und Konstruktionen. Im Dienste aktueller Interessen gleicht der vorhandene, beliebig verwendbare „Datenschatz“ manchmal einem Giftschrank, der besser geschlossen bliebe. Kritische Gedächtniskultur und entmythisierende Historiographie sind daher gefordert.
Der widersprüchliche Nachlass
Die unvoreingenommene Analyse könnte im Falle der Donaumonarchie und speziell in den letzten Dekaden ihres Bestehens aber auch einiges an Positivem zu Tage fördern: Kulturelle Vielfalt, wissenschaftliche Innovation, künstlerische Kreativität, Kompromiss- und Ausgleichsbemühungen, (zarte) Ansätze eines Sozialstaates, (halbwegs) zufriedenstellende Konjunkturdaten vor 1914, Modernisierungs- und insbesondere auch Emanzipierungs- beziehungsweise Demokratisierungsprozesse, die konstitutionelle Schiedsrichter- und Vermittlerfunktion zentraler Reichsinstitutionen, vor allem für bestimmte Schichten das Stabilitätsgefühl der alten Ordnung, eine maßvolle Politik der kleinen Schritte mit der Tendenz zur „wohltemperierten Unzufriedenheit“.15
An diesem Punkt wäre freilich mit einer nicht minder langen Liste von Defiziten fortzusetzen: religiöse Intoleranz, rassistischer Hass, „völkische“ Aggression und Herrschsucht, Standesdünkel, antiquierte Ehrbegriffe, hierarchisches und autoritäres Denken, Klassengegensätze und eine ungerechte Vermögensverteilung, imperiale Überheblichkeit und kolonialistische Attitüden, rücksichtslose Kriegsbereitschaft als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, statt einem Miteinander vor allem auch in nationaler Hinsicht ein Nebeneinander und schließlich ein Abrücken voneinander.
Darüber hinaus existieren gute Gründe, vor allem die Tätigkeit und die Entscheidungen der Hof- und Regierungskreise kritisch zu bewerten, gesellschaftliche und individuelle Aktionsradien zu rekonstruieren und Verantwortlichkeiten zu benennen. Ebenso richtig und wichtig erscheint es aber gleichfalls, den zeitlichen Kontext im internationalen Vergleich zu erfassen. Zurecht wird mithilfe dieses Blickwechsels manches, was auf der Haben- oder Sollseite der Donaumonarchie zu verbuchen ist, seine scheinbar spezifische „kakanische Färbung“ verlieren. Es kommen – speziell hinsichtlich der „langen Jahrhundertwende“ – Phänomene und Erscheinungsformen zur Sprache, Begrifflichkeiten oder Untersuchungsverfahren zur Anwendung, die auf grenzübergreifende, mitunter sogar globale Trends und bisweilen einfach auf Facetten des Allgemeinmenschlichen rekurrieren. Naturgemäß orientieren sich diese letztlich nicht an den habsburgischen Macht- und Einflusssphären – weder in geographischer noch in zeitlicher Hinsicht. Gerade darin liegt aber ebenso die Möglichkeit eines Erkenntnisgewinnes. Wie die Resultate der Analysen auch ausfallen mögen und beurteilt werden: Sie verweisen jedenfalls immer wieder auf die Gegenwart. Im Generellen wie Spezifischen gilt daher vor diesem Hintergrund: Die Vergangenheit, gerade die habsburgische, kann gelegentlich tatsächlich als „Lehrmeisterin“ für die Nachgeborenen und die augenblicklichen Entscheidungsträger wahrgenommen werden. Die österreichische Geschichtserfahrung hat – zumindest – europäische Relevanz.
Teil III: Geschichte und Kakanien oder: „Ulrichs Welt“
Wohin gehen wir? Ist alles unwägbar?
„Der Weg der Geschichte ist also nicht der eines Billardballs, der, einmal abgestoßen, eine bestimmte Bahn durchläuft, sondern er ähnelt dem Weg der Wolken, ähnelt dem Weg eines durch die Gassen Streichenden, der hier von einem Schatten, dort von einer Menschengruppe oder einer seltsamen Verschneidung von Häuserfronten abgelenkt wird und schließlich an eine Stelle gerät, die er weder gekannt hat, noch erreichen wollte. Es liegt im Verlauf der Weltgeschichte ein gewisses Sich-Verlaufen“, denkt Ulrich, der Mathematiker, Philosoph und „Nicht-Held“ in Robert Musils Klassiker „Der Mann ohne Eigenschaften“.16 Den gedanklichen „Abschweifungen“ folgend, kommt Ulrich selbst vom Weg ab, muss „einen Augenblick anhalten“ und sich neu orientieren, um „den Weg nach Hause [zu] finden“. Inmitten der Irritation denkt er auch an „seine Militärzeit: Die Eskadron reitet in Zweierreihen, und man läßt ‚Befehl weitersagen‘ üben, wobei ein leise gesprochener Befehl von Mann zu Mann weitergegeben wird; befiehlt man nun vorne: ‚Der Wachtmeister soll vorreiten‘, so kommt hinten heraus: ‚Acht Reiter sollen sofort erschossen werden‘ oder so ähnlich. Auf die gleiche Weise entsteht auch Weltgeschichte“.17
Diese Unwägbarkeiten rufen in ihm jedoch eine Art Protest hervor, das Verlangen nach Gestaltung und Zielstrebigkeit: „Warum macht der Mensch nicht Geschichte, das heißt, warum greift er aktiv Geschichte nur wie ein Tier an, wenn er verwundet ist, wenn es hinter ihm brennt, warum macht er, mit einem Wort, nur im Notfall Geschichte?“18
Ob sich solcherart auch Maximilian Wladimir Freiherr von Beck angesprochen fühlte, der als k. k. Ministerpräsident zwischen 1906 und 1908 bedeutende Reformen auf den Weg brachte? Einige Zeit später, im Dezember 1913, schien sich in ihm jedenfalls Ulrichs Gefühl des „Sich-Verlaufens“ breitgemacht zu haben. Als Mitglied des Wiener Parlaments, des „Reichsrates“, konstatierte er hinsichtlich der jüngst ausgetragenen gewaltsamen Auseinandersetzungen auf dem Balkan und der danach „abgeschlossenen Vereinbarungen“, dass hauptsächlich „auf dem Gebiete der Weltgeschichte die Dinge oft ganz anders kommen, als die Betreffenden, die einen Blick in die Zukunft tun wollen, vermeinen“.19
Wie sehr er damit in Bezug auf seinen Kollegen Josef Maria Baernreither, der 1916/17 Minister „ohne Portefeuille“ werden sollte, Recht behielt, konnte Beck freilich nicht annähernd erahnen. Wenig Monate vor dem Attentat auf den habsburgischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gemahlin in Sarajewo, am Vorabend des „Weltenbrandes“, hatte Baernreither den Parlamentariern prophezeit: „Wir treten jetzt in eine Periode relativer Ruhe ein. Es ist uns wieder einmal eine Frist gegeben zu innerer Arbeit. […] Und es ist höchste Zeit, dass wir den Andeutungen, den Mahnungen der Geschichte, die uns auf diesen Weg drängen, nachkommen und sie befolgen. Denn dessen seien Sie versichert, meine Herren, das Auftreten des Staates in der Zukunft, die Möglichkeit, in der Zukunft vielleicht kräftiger und entschiedener aufzutreten, als das bis heute der Fall war, hängt lediglich davon ab, ob und wie wir unsere inneren Verhältnisse zu konsolidieren imstande sind.“20
Das Plädoyer, nicht nur im „Notfall“ – wie ein „verwundetes Tier“ – zu handeln, entsprach keineswegs bloß dem Geschmack des fiktiven „Mannes ohne Eigenschaften“. Baernreithers reale Zuhörerschaft war gleichfalls begeistert. Er wurde zu seinen Worten „beglückwünscht“. Das Auditorium spendete „lebhaften Beifall“.21
Unsere Schritte werden gelenkt
Dem hier akklamierten „Tatmenschen“ oder „Geschichte Machenden“ tritt jedoch nicht allein die Figur „des durch die Gassen Streichenden“ gegenüber. Ulrichs Bild des „Sichverlaufens“, des „Verlorenseins“ und „Verlorengehens“, der Unvorhersagbarkeit, Willkür und Zufälligkeit wird fast unauffällig auf eine ganz andere Weise ebenfalls konterkariert. Schließlich lenken „Menschengruppen“ und die „Verschneidung der Häuserfronten“ viele Schritte des „Nicht-Helden“. Die Stadt, die vor unserem geistigen Auge entsteht, ihre Einwohner, Architektur, Straßenzüge und Gebäude erweisen sich als geeignete Metapher für die „Begrenzung der Unwägbarkeiten“.
In Modellen der historischen Zeiten sind demzufolge die menschlichen Handlungen im Wesentlichen von grundlegenden „Konjunkturen und Strukturen“ bestimmt. Diese Synonyme für die „Menschengruppen“ und „Häuserfronten“ lassen in manchen Betrachtungsweisen wenig Platz zur Um- und Neugestaltung. Man kann hier auch maritime Bilder heranziehen: „Majestätisch wie das in seiner Tiefe unbewegte Meer“ ist die fast stationäre Zeit des geographischen Raumes, die „anonyme, tiefe und oft stille Geschichte, die eher die Menschen macht, als von ihnen gemacht wird“. Rasch bewegt, wie die Wellen, die über die Wasseroberfläche „huschen, und flüchtig, wie der Schaum, der sie bekrönt“, ist andererseits die Zeit der Ereignisse. Diese ist eine „blinde Welt wie jede lebendige, wie die unsere“, die sich nicht um jene Gewässer kümmert, „auf denen unsere Barke wie das trunkenste aller Schiffe dahintreibt“.22
Die darin enthaltene Tendenz zu einer neuen Variante des Determinismus ruft allerdings Widerspruch hervor. Gerade die Erfahrungen der „Kakanier“ Beck und Baernreither, ihre Einbettung in Entscheidungsmomente mit offenem Ausgang, sollten vor allem Historiker davor bewahren, aus dem Übermut des Nachgeborenen, der Retrospektive und dem Wissen, was folgte, zum „rückwärtsgewandten Propheten“ zu mutieren. Die „große Geschichte“ hat vielmehr auf ihre Bausteine hin untersucht zu werden, speziell auf die „ständige Gegenwart des Menschen, der in den Küsten, Gebirgen und Wasserebenen anwesend ist“, der also keineswegs allein zum Schöpfer von Kulturen, Gesellschaften und Staatswesen, sondern durchaus auch von Naturräumen werden kann.23
Die „Ausweitung der Zivilisation“24 untermauert dieses Argument, wobei sich das „gestaltende Individuum“ mit neuen Herausforderungen zu befassen hat. Ansatzweise ließ dies Robert Musil auch seine Hauptfigur erkennen – mit einer bemerkenswerten Wandlung des Menschenbildes. Ein Gesprächspartner Ulrichs erklärte nämlich zunächst eher beiläufig, dass man schon froh sein müsse, „wenn die Politiker und die Geistlichen und die großen Herren, die nichts zu tun haben, und alle anderen Menschen, die mit einer fixen Idee herumrennen, das tägliche Leben nicht stören“.25
Der handelnde Mensch und sein Umfeld
Das hatte weitreichendere Implikationen, als der vorhergehende Satz zunächst vermuten ließ: Schließlich wurde dabei ein Gegengefühl zum „Tatmenschen“ immer „lebendiger“ – und damit der Befund, dass „sich die Zeit der heroisch-politischen Geschichte, die vom Zufall und seinen Rittern gemacht wird, zum Teil überlebt hat und durch eine planmäßige Lösung, an der alle beteiligt sind, die es angeht, ersetzt werden muß“. An anderer Stelle dazu Ulrich: Der „exakte Mensch ist heute vorhanden! Als Mensch im Menschen lebt er nicht nur im Forscher, sondern auch im Kaufmann, im Organisator, im Sportsmann, im Techniker; wenn auch vorläufig nur während jener Haupttageszeiten, die sie nicht ihr Leben, sondern ihren Beruf nennen“. Der andere, „leidenschaftliche“, „urfeuerähnliche Teil“ könne daher aber auch nicht übersehen werden: Es „herrsche eine paradoxe Verbindung von Genauigkeit und Unbestimmtheit“, ein Ineinandergreifen der Widersprüche.26
Diese Verflechtung spiegelt sich zudem im wechselseitigen Verhältnis von „Kulturformationen“ und damit verknüpften Zeitschichten wider, in denen der Mensch agiert. Vor allem die simple Dichotomie eines vermeintlichen Gegensatzpaares „Ereignis und Struktur“ sowie die vielfach angedeutete Trennung in eine Geschichte der „kurzen“, „mittleren“ und „langen Dauer“ erweisen sich als fragwürdige Konstruktionen. Nicht allein zwei oder drei, im Übrigen oft wenig dynamisch konzipierte Zeitebenen stehen sich gegenüber. Im Gegenteil. Zahleiche Phänomene mit verschiedener „temporaler Erstreckung“, vielfach und immer öfter von Menschen hervorgebracht, sind ineinander verwoben und fordern als Angebote, Möglichkeiten und Alternativen nachgerade den Einzelnen zur Aktion auf. Denn auch das hatte Freiherr von Beck nachdrücklich verlangt: Dass nämlich „eigentlich der feste Ausgangspunkt für den Weg in die Zukunft in der eigenen Kraft und in dem auf diese gestützten Selbstvertrauen gesucht werden“ müsse.27
So sehr der Akteur in seinem Handlungsspielraum eingeengt scheint, von Strukturen, langsamen und anonymen Transformationen, von „Kultur- und Naturformationen“ umstellt sein mag: Er bringt diese doch wenigstens mit hervor. Der kurze Moment sowie ein an seiner Rationalität und seinen Möglichkeiten (vielleicht) zweifelndes Individuum sind die „atomaren Bausteine“ des Geschichtsstoffes. Sie sind unterscheidbar, wie – zugegeben ein wenig schmeichelhafter Vergleich – der „Hund, der heute gestorben ist, von jenem, der Morgen stirbt“.28 Und für den Prozess des Historischen noch wichtiger: Der Augenblick und die menschlichen Taten gliedern sich in Typen, die einmal eher Beharrung oder Kontinuität und ein anderes Mal Veränderungen, Beschleunigungen oder Brüche zur Folge haben. Sie repräsentieren den kürzesten Moment ebenso wie den „Baustoff“ für langandauernde Haupt- und Weltereignisse, für (beinahe) Allgemeingültiges und (scheinbar) Unabänderliches. Dieser Spannungsbogen gleicht dem „kakanischen Aktionsraum“ – vom beinahe verwirklichten Anspruch auf Weltordnung und Universalherrschaft bis zu den Paradoxien oder der Auflösung von Kategorien und Mikro-Kosmen in „Ulrichs Welt“.
Die Beständigkeit der Fragilität
Wiener Oktoberaufstand 1848. Dachbrand der Hofbibliothek © ÖNB/Wien, 302604-B
Habsburgs Welt der Vielfalt
Die Einengung der Aktionsräume: Für die Habsburger gehört sie zu einer zentralen Erfahrung. Damit geraten vor allem die Geschehnisse eines „langen 19. Jahrhunderts“ ins Blickfeld, von der Zeit der Französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg. Das „Weltunternehmen der Habsburger“ tritt hingegen in den Hintergrund, jenes aus der Einheirat in die führenden spanischen Fürstenhäuser entstandene Reich, in dem für eine bestimmte Epoche die „Sonne nicht unterging“. Dass sich die „Casa de Austria“ schon damals, knapp nach 1500, in eine spanische und eine österreichische Linie spaltete, änderte zwar am Zusammenhalt einer bisweilen in globalen Maßstäben denkenden Dynastie zunächst nichts. Bis man auf der iberischen Halbinsel gegen französische Konkurrenten unterlag, wurde aber bereits an einer seit dem Spätmittelalter erkennbaren Hausmacht in Zentraleuropa gearbeitet. Die Donaumonarchie entstand, an deren Spitze wiederum ein Regent das „Erbe Karls des Großen“ vertrat: Neben dem eigenen Besitz repräsentierten die Habsburger als Könige und Kaiser mit ganz kurzen Unterbrechungen seit dem 15. Jahrhundert das Heilige Römische Reich.
Dieses „Sacrum Imperium“ stellte einen eher losen Verband aus städtischen Kommunen, vor allem aber geistlichen und weltlichen Fürstentümern dar, und auch das „engere Machtgebiet“ des „Hauses Österreich“ ähnelte speziell vor dem Hintergrund der Kämpfe gegen das Osmanische Reich einem um Böhmen und Ungarn erweiterten Länderkonglomerat, einer „monarchischen Union von Ständestaaten“, wodurch Zeitzeugen wie späteren Kommentatoren der Eindruck vermittelt wurde, die „Macht Habsburgs“ stünde in ganz besonderer Weise auf tönernen Füßen. Dass man nach der Verdrängung aus Spanien und seinem Kolonialreich hauptsächlich in der Reformära unter Maria Theresia und Joseph II. eine homogenere, wirtschaftlich, politisch und militärisch potentere „Monarchia Austriaca“ zu schaffen versuchte, änderte an diesem Gesamtbild wenig. Die Brüchigkeit des „königlich-kaiserlichen Systems“ wirkte „angeboren“ und im Einklang mit den Wirrungen und Irrungen des historischen Wandels. Robert Musil drückte es in seinem Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ folgendermaßen aus: „Das Gesetz der Weltgeschichte […] ist nichts anderes als der Staatsgrundsatz des ‚Fortwurstelns‘ im alten Kakanien. Kakanien war ein ungeheuer kluger Staat.“1
Pieter Judson als einer seiner besten Kenner hat diese „fragile Heterogenität“ allerdings jüngst als keinerlei Spezifikum bewertet. Trotz „Vielfalt in der Religion“ und der Tatsache, dass die k.(u.)k. Herrscher über Territorien obwalteten, „die sich in heutiger Zeit auf zwölf verschiedene europäische Staaten verteilen“ und „deren Untertanen“ sich im „späten achtzehnten Jahrhundert in Sprachen“ verständigten, „die heute als Deutsch, Flämisch, Französisch, Italienisch, Jiddisch, Kroatisch, Ladinisch, Polnisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Ungarisch und Ukrainisch bekannt sind“: Eine „solche sprachliche und konfessionelle Diversität“, so Judson, „war für größere Staatsgebilde im Europa der frühen Neuzeit typisch, für die Reiche der Spanier und der Franzosen im Westen ebenso wie für die polnisch-litauische Adelsrepublik oder das sich entwickelnde russische Reich“.2
Staaten und Reiche auf tönernen Füßen
Russland erlebte übrigens eine existenzielle Krise in der „Zeit der Wirren“ Anfang des 17. Jahrhundert, Polen-Litauen zerfiel in der Folge überhaupt und wurde unter seinen expansionistischen Nachbarn aufgeteilt. Die Möglichkeit des Untergangs war stets vielerorts gegeben. „Wellenartig aufeinander folgende Zusammenbrüche von Imperien und Reichen“ traten als geschichtliche Erfahrung ebenso wie als drohende Gefahr in Erscheinung. Vor diesem Hintergrund galten vornehmlich das Osmanische Reich, das Romanovimperium und die Habsburgermonarchie als „kranke Männer am Bosporus, an der Newa und an der Donau“.3
Joseph Chamberlain, britischer Staatsmann, der das „Empire“ im Streit mit irischen Selbstverwaltungstendenzen, den Eigenständigkeitsbestrebungen der Kolonien und den rivalisierenden Großmächten gefährdet sah und dabei nicht ohne rassistische Denkmuster vom englischen „Herrenmenschentum“ träumte, warnte indes gleichfalls vor den Gefahren für sein Land: Über das Vereinigte Königreich hinaus, so er und seine Anhänger, müsse London ein einheitliches und globales Machtgefüge erhalten und erweitern, um es mit den Konkurrenten Deutschland, Russland und Amerika aufnehmen zu können.4
Chamberlains Plädoyers und Ideale reflektierten realiter eher eine Schwäche. Großbritannien, wie auch andere Groß- und Seemächte, hatte schon in der Vergangenheit schwere Niederlagen hinnehmen müssen. Die „nordamerikanische Revolution“ war den Engländern ein warnendes Beispiel, umso mehr als die USA speziell gegen Ende des 19. Jahrhunderts das britische Weltreich nicht bloß herausforderten, sondern als führenden Industriestaat bereits ablösten. Parallel dazu gingen die Dominien schrittweise auf Distanz zu London. Kanada, Australien und Südafrika entstanden dabei schon vor 1914 als territoriale Einheiten. Der Weg führte zur Umwandlung des „Empires“ in einen „Commonwealth“, ein Transformationsprozess, der letztlich nicht ohne Wirkung insbesondere auf andere Kolonialmächte mit „überseeischen Besitzungen“ bleiben sollte.5
Die Vereinigten Staaten als kommende Supermacht, potentieller Herausforderer, aber auch als Verbündeter Englands, hatten indes wenig Grund, sich allzu sicher zu fühlen. Als Washington im Gefolge der Revolution von 1848 mit den gegen Wien aufbegehrenden Ungarn diplomatische Beziehungen aufnehmen wollte und es darüber schließlich sogar zu Kriegsdrohungen kam, warnte der Vertreter der österreichischen Regierung, Johann Georg Hülsemann: „Von Zeit zu Zeit müssen alle Länder gegen innere Schwierigkeiten ankämpfen; jede Regierungsform ist solchen unangenehmen Zwischenfällen ausgesetzt … ein Bürgerkrieg kann überall ausbrechen; die Ermunterung, die Aufruhr und Empörung erfahren, kehrt sich dann sehr oft gegen eben jene, die ihre ursprüngliche Entwicklung gefördert haben.“6
Hülsemann drohte damit nicht nur den US-Entscheidungsträgern, er traf auch einen wunden Punkt der „Union“. Ihre Bundesstaaten tendierten politisch und ökonomisch oftmals und insbesondere hinsichtlich der Frage der Sklaverei in verschiedene Richtungen. Der Sezessions- oder Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 stellte den Gesamtstaat und seine Prinzipien noch einmal in Frage, es bedurfte eines zweiten Gründungaktes mit langfristigen, bisweilen traumatischen Konsequenzen.
Unabhängig davon gab es innerhalb der politischen Führung in den Vereinigten Staaten aber auch noch eine allgemeiner gehaltene Kritik an einem proungarischen, antiösterreichischen Kurs. Senator John Parker Hale aus New Hampshire warnte beispielsweise davor, die USA zu einem „Obersten Gerichtshof in Sachen Empörung“ zu machen. Über alle „Nationen der Erde“ müssten „wir das Urteil sprechen“. Nach dem „Despotismus“ Österreichs und Russlands wären Irland und dann „Indien an der Reihe“. „Großbritannien muß sich für die jahrhundertelange Unterdrückung“ verantworten. Schließlich „sollte Frankreich vor Gericht erscheinen“ und dann „der Sultan der Türkei“. „Ich bin keinesfalls sicher“, schloss Hale, „ob nicht die ganze Welt sagen würde, daß, […] so gerecht die Empörung war, die die Vereinigten Staaten empfanden, auch sie neben all den Nationen, die sie verurteilt haben, im Staube liegen müssen …“7
Schritte in die „neue Zeit“: Homogenisierungstrends und Gegentendenzen
Der Senator aus New Hampshire benannte damit zusätzliche Schwachpunkte, die zum Verfall der Staaten und Reiche beitragen konnten. Die alten Herrschaftssysteme – auf Diversität und mehr oder minder festen personellen Verbindungen beruhend – mochten regelmäßig unter anderem durch Konflikte innerhalb der Aristokratie, infolge dynastischer Verbindungen und Tauschabkommen, durch religiöse Gegensätze und Unzufriedenheit in einer im Wesentlichen auf knappe Ressourcen und „Subsistenzwirtschaft“ angewiesenen Agrargesellschaft gefährdet sein. Eine wahrhaft gewandelte Denkweise und Systemtransformation kennzeichnete hingegen eine Ära der Menschheitsgeschichte, die mit Recht als „Neuzeit“ verstanden wurde. Diese brachte zunächst Veränderungen für überschaubare Gruppen von Akteuren mit sich, um schließlich – nach einer engen Verflechtung der „Krise des Alten“ mit „Andeutungen des Zukünftigen“ – in politische, gesellschaftliche, mentale, wissenschaftliche, wirtschaftliche, technische und organisatorische „Modernitäten“ zu münden. Sie wurden nun für weite Teile der Bevölkerung erfahr- und begreifbar. Hale hatte demgemäß neue Vorstellungen der Menschlichkeit, des Naturrechts und der Mitbestimmung angedeutet, die ohne Aufklärung und die Umwälzungen im 18. Jahrhundert nicht zu denken waren.8
Allerdings ging diesen Entwicklungen schon eine geistige Veränderung im Sog von Humanismus, Rationalismus und Empirismus voraus. Die etappenweise Formierung globaler Handels- und Herrschaftsnetze sowie koloniale Ansprüche, welche sich hinter dem Wort „Entdeckungsreise“ verbargen, folgten. Der Machtzuwachs landesfürstlicher Höfe gegenüber den übrigen Adelsgeschlechtern, der Ansehensverlust des Papsttums und einsetzende Säkularisierungsprozesse, die entstehenden Zentraladministrationen vor dem Hintergrund europäischer Bürger- und Glaubenskriege, Kriegstechnik, Söldner beziehungsweise stehende Heere, die Rolle der „Herren“ und Fürsten bei proto- und frühkapitalistischen Initiativen, die tendenzielle Monopolisierung des Steuerwesens durch die Krone, die Verbesserung der Kommunikations- und Verkehrswege, oder auch die Reformierungsbestrebungen von Rechts- und Verwaltungsgrundlagen bildeten eine wichtige Basis für die Ausbildung „moderner Staatlichkeit“ und einer damit verbundenen Neigung zur „Homogenisierung“.9
„Atlantische Revolutionen“, die Prinzipien der neugegründeten Vereinigten Staaten und speziell die Losungen der Französischen Revolution stellten dann eine offene Kampfansage an die Sonderrechte und Privilegien des „Ancien Régime“ dar. Vor allem die „Grande Nation“ wurde im Fahrwasser der „Volkssouveränität“, der Idee des „einheitlichen Nation“, zum Protagonisten eines Feldzugs gegen die Bevorzugung und „Freiheiten“, aber auch Zwänge und „Bindungen“ von Konfessionen und Ethnien, von Zünften und Gesellschaftsschichten, Regionen, Orten und Städten.10
Tatsächlich brachte der Ruf nach deren Überwindung im Geiste der „Gleichheit“ und „Brüderlichkeit“ schon wenige Jahre nach dem Sturm auf die Bastille die Erfahrung neuer Uneinheitlichkeit mit sich. Von 1789 bis 1815 präsentierte das von inneren Wirren wie dauernden Kriegszügen erschütterte und seine eigene nationale Einheit erst suchende Frankreich eine bunte Palette von Herrschaftssystemen und Machtpraktiken, welche bei den Zeitzeugen gezwungenermaßen ambivalente Gefühle und widersprüchliche Werthaltungen hervorrufen mussten.11
Zudem offenbarte sich ein Dilemma bei der Anrufung der „einen und einigen Nation“. Ihre Schaffung und Abgrenzung, ihre Benennung der „Anderen“ und damit ihre Ausschließungsmechanismen wurden zum Konfliktstoff – speziell in multiethnischen Gebieten. Der Ruf nach Abspaltung verstärkte ein Gefühl der Zersplitterung, das durch die Ausdifferenzierung von Institutionen und Geisteswelten, durch die Entstehung neuer Wissenschaftsdisziplinen, aber auch durch sozioökonomische Gegensätze und den drohenden „Klassenkampf“ und Bürgerkrieg verstärkt wurde.
Die „Moderne“ kommt auf Touren
Eine „Sattelzeit“ um 1800 vor dem Hintergrund spätfeudaler Krisen und dem Einsetzen „industrieller Revolutionen“ deutete, wie später das (lange) „Fin de Siècle“ um 1900, auf verschiedene Beschleunigungsstufen der neuzeitlichen, „modernistischen“ Entwicklung hin. Sie war der Jahrtausende währenden, agrarisch geprägten und im Wesentlichen von einer anderen – fatalistischeren, gottgegebenen – Naturerfahrung dominierten „Vormoderne“ gefolgt.12
Seit den Ereignissen von 1789 erwiesen sich demgemäß sogar gewohnte Zeitkonzepte als fragwürdig. Der Revolutionsbegriff etwa wurde tendenziell neu gedeutet. Verstand man darunter bislang meist die Rückkehr zum bewährten Alten innerhalb eines Kreislaufes, so wurde nun eine diametral entgegengesetzte Erklärung gewählt. Die „Revolution“ stand jetzt für den Fortschritt, den Bruch mit der Tradition, der sich, von tatkräftigen Akteuren herbeigeführt, in Form von Volksaufständen und Rebellionen vollzog.13
Im beginnenden 19. Jahrhundert verbanden sich neue politische und weltanschauliche Konzepte außerdem mit Beschleunigungseffekten, die zu Alltagsphänomenen wurden. Maschinentechnik und industriell-kapitalistische Organisationsformen kurbelten die Produktion an, welche wiederum eine allgemeine Bedürfnissteigerung verursachte. Waren und Menschen gelangten in immer kürzeren Fristen von einem Ort zum anderen. Die Eisenbahnen, hieß es schon 1840, „heben die räumlichen Trennungen durch Annäherungen in der Zeit auf“.14
Der Trend setzte sich fort. Die Einführung der Schnellpresse, dann vor allem die Verwendung von Fotografie und Kinematographie sowie die Erfindung des Telegrafen und des Telefons führten Handlungen und die entsprechenden Nachrichten darüber immer enger zusammen. Eine wahre Explosion von Ereignissen war die Folge.15 Ulrich, die Hauptfigur in Musils „Mann ohne Eigenschaften“, brachte es auf den Punkt: „War eigentlich Balkankrieg oder nicht? Irgendeine Intervention fand wohl statt […]. Es bewegten so viele Dinge die Menschheit. Der Höhenflugrekord war wieder gehoben worden; eine stolze Sache. Wenn er sich nicht irrte, stand er jetzt auf 3.700 Meter, und der Mann hieß Jouhoux. Ein Negerboxer hatte den weißen Champion geschlagen und die Weltmeisterschaft erobert; Johnston hieß er. Der Präsident von Frankreich fuhr nach Rußland; man sprach von Gefährdung des Weltfriedens. Ein neuentdeckter Tenor verdiente in Südafrika Summen, die selbst in Nordamerika noch nie dagewesen waren. Ein fürchterliches Erdbeben hatte Japan heimgesucht; die armen Japaner. Mit einem Wort, es geschah viel, es war eine bewegte Zeit, die um Ende 1913 und Anfang 1914. Aber auch die Zeit zwei oder fünf Jahre vorher war eine bewegte Zeit gewesen, jeder Tag hatte seine Erregungen gehabt.“16
„Menschliche Sandkörnchen“ im Reizstakkato des beschleunigten Wandels
Die rasch wachsenden Städte wurden zum eigentlichen Schauplatz des veränderten Lebensgefühls. Traditionelle soziale Bindungen drohten sich aufzulösen, Wellen der Massenkultur schwappten über ein „schwaches menschliches Sandkörnchen“ hinweg, das die „urbanen Knotenpunkte“ auch als Ort der Einsamkeit und Anonymisierung erlebte. Von der „Vergewaltigung des Individuums“ im „Reizstakkato“ der entstehenden Millionen-Metropolen war die Rede, nicht bloß von „Hysterie“ – die gemeinhin der weiblichen Physis und Psyche zugeordnet wurde –, sondern von der „Neurasthenie“, der „seelischen Zerrüttung“ der Männer und ihren Wunden am „Kampfplatz der neuen Welt“.17
Das Allerweltswort „Neurasthenie“ schmeichelte in mancher Hinsicht dem Selbstbild einer maskulinen Elite, die sich wiederum von Frauenrechten und generellen Demokratisierungstrends herausgefordert sah. Gerade die bedeutendsten Städte der Donaumonarchie, allen voran Budapest, Prag und vornehmlich Wien, das „Mekka der internationalen Medizin“, verkörperten ein europa- und partiell weltweites „Zeitalter der Nervosität“, das zwischen hoffnungsfrohen Zukunftsentwürfen und einer tief empfundenen Verunsicherung schwankte. Eine kulturelle und wissenschaftliche Blüte hauptsächlich in den „Laboratorien der Moderne“, die nicht zuletzt auf die Tätigkeit jüdischer Denker, Künstler und Forscher zurückzuführen war, sah sich permanent bedroht von Antisemitismus, Misogynie, Innovations-, Globalisierungs- und Institutionenkritik, von antiliberalen Phantasmen des „Kollektivismus“, der Verdammung des Wandels und einem latenten Liebäugeln mit Untergangsszenarien, Todes- und Vergänglichkeitskulten.18
„Ulrichs Welt“ basierte auf fundamentalen Antagonismen und Paradoxien, „Widersprüchen und höchst verschiedenen Schlachtrufen“, die immerhin „einen gemeinsamen Atem“ hatten; würde „man jene Zeit zerlegt haben, so würde ein Unsinn herausgekommen sein wie ein eckiger Kreis, der aus hölzernem Eisen bestehen will, aber in Wirklichkeit war alles zu einem schimmernden Sinn verschmolzen. Diese Illusion, die ihre Verkörperung in dem magischen Datum der Jahrhundertwende fand, war so stark, daß sich die einen begeistert auf das neue, noch unbenützte Jahrhundert stürzten, indes die anderen sich noch schnell im alten wie in einem Hause gehen ließen, aus dem man ohnehin auszieht, ohne daß sie diese beiden Verhaltensweisen als sehr unterschiedlich gefühlt hätten“.19
K. (u.) k. Weltlaboratorium: Widersprüche, Paradoxien, Auflösung des Individuums
All das letztlich fast grenzenlose Infragestellen und Zersetzen des Bestehenden war kein „kakanisches Spezifikum“, brachte aber gerade auch in Wien herausragende Wortführer hervor. Ihre weder von den Zeitgenossen noch von den späteren Generationen im Grunde bis heute konsequent erfassten „Denkräume“ legten mit ihren Modernitätsdiskursen gleichzeitig Sprengfallen an die Paradigmen der „neuen Zeit“. Bei Sigmund Freud etwa befand sich der willensstarke, rationale, der „selbstverschuldeten Unmündigkeit entfliehende“ Mensch der Aufklärung im Zustand der Auflösung, in einem steten Kampf mit den Bedürfnissen seines Unbewussten und den Vorgaben des „Über-Ichs“.20 In der k. k. Residenzstadt vertrat der Wissenschaftstheoretiker, Philosoph und Physiker Ernst Mach vergleichbare Ansichten, als er gegen die „Tendenz zur Metaphysik“ zu Felde zog. „Sobald wir erkannt haben, so Mach, daß die vermeintlichen Einheiten ‚Körper‘, ‚Ich‘ nur Notbehelfe zur vorläufigen Orientierung und für bestimmte praktische Zwecke sind, müssen wir sie bei vielen weitergehenden wissenschaftlichen Untersuchungen als unzureichend und unzutreffend aufgeben.“21
Im Spannungsfeld zwischen Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit sollte sich der weidlich ausgeschlachtete „Selbsthass“ des „Juden“ Otto Weininger darauf berufen, um zur Überzeugung zu gelangen: „Mit der allgemeinsten Klassifikation der meisten Lebewesen, ihrer Kennzeichnung schlechtweg als Männchen oder Weibchen, Mann oder Weib, kommen wir den Tatsachen gegenüber nicht länger näher.“22 Die maskulinen und femininen „Protoplasmen“, die der bald durch Suizid aus dem Leben scheidende Weininger in „männlich-schöpferische“ und „weiblich-unschöpferische Substanzen“ trennen wollte, rekurrierten exemplarisch auf die Instrumentalisierung der Biologie im Zuge schwerer männlicher Identitätskrisen.23
Ungeachtet dessen standen alle diese Beispiele – wie Ulrichs „Mensch im Menschen“ – für eine „Identitätsdissoziation“, die für manche Beobachter zur maßgeblichen Erfahrung des beginnenden 20. Jahrhunderts wurde. Nicht von ungefähr, so die hinzugefügte Erläuterung, sei eine „Vorliebe für das Genre der Biographie“ zu gewärtigen. Der lange ungeliebte „Bastard der Geschichtsschreibung“ versuche über den Schwund der geschlossenen, handlungsfähigen Persönlichkeit hinwegzutäuschen.24
„Schwund“, „Dissoziation“, „Zersetzung“, „Zersplitterung“, „Ausdifferenzierung“: Die Schlüsselworte beschrieben einen offensichtlichen Verlust von „Ganzheitlichkeit“. Zur bereits vorhandenen Irritation kam hinzu, dass im Gefolge von Relativitätstheorien und Unschärferelationen alltägliche Wahrnehmungen (wenigstens wissenschaftlich) langfristig kaum mehr Orientierung boten. Und obwohl der Abschied von gewohnten Kausalitäten, Gewissheiten und „gesamtheitlichen“ Denkweisen grenzübergreifende Phänomene waren, mangelte es nicht an allerdings meist oberflächlichen Analogieschlüssen: Ihnen zufolge hing der Anteil hauptsächlich „Wiener Genies“ an der „geistigen Avantgarde“ um 1900 auch mit den Erfahrungen von Fragilität, Vielfalt und Widersprüchlichkeit in der Habsburgermonarchie zusammen.25
Trotz allgemeiner Entwicklungen: Außerhalb Österreichs geht die Historie andere Wege
Sämtliche, mehr als berechtigte Bemühungen, die Entwicklungen im Donauraum in größere Zusammenhänge einzubetten und Ähnlichkeiten zwischen unterschiedlichsten Staaten und (Welt-)Regionen hervorzuheben, sollten jedenfalls nicht dazu führen, signifikante „Andersartigkeiten“ außer Acht zu lassen. Denn schon und gerade in politischer, territorialer und kultureller Hinsicht unterschied sich das Habsburgerreich, speziell in den letzten Jahrhunderten seines Bestehens, sehr wohl auffällig von seinen Nachbarn und wichtigsten Rivalen. Seit dem Spätmittelalter deutete bei den Westmächten vieles auf eine Konsolidierung des jeweiligen Königtums hin. Gewiss muss festgehalten werden, dass die „Grande Nation“ letztlich nicht vor den revolutionären und napoleonischen Kriegen geformt wurde, die Realunion zwischen Schottland und England erst 1707 durch die Vereinigung der beiden Parlamente Wirklichkeit wurde und die „andere Insel“ – Irland – stets ein Problemfall blieb. Im 19. Jahrhundert jedoch bildeten diese europäischen Kerngebiete des „Vereinigten Königreiches“ und des „Hexagon“, wie die Franzosen ihr Land nennen, weitgehend einheitliche Aktionsgemeinschaften, deren Bestehen nur bedingt vom Auf und Ab der überseeischen Kolonialgeschichte berührt wurde.
Die Frage der staatlichen Existenz vor allem – und bisweilen auch des Zerfalls der betreffenden Imperien – ist also vom Streit um die Besitzungen außerhalb des „alten Kontinents“ zu unterscheiden, was in noch höherem Maße für den „moskowitischen“ Herrschaftsbereich zwischen Sankt Petersburg beziehungsweise Charkow und dem Ural galt und gilt. Die anschließenden östlichen und teilweise auch südlichen Expansionszonen stellten als Naturräume „Erschließungsgebiete“ dar. Meist bevölkerungsarme Regionen bildeten hinsichtlich ihrer politischen, „nationalen“ Identität lange kaum echte Barrieren, womit partiell auch der Fortbestand der russisch-sowjetischen Hemisphäre über den Bruch von 1917 hinaus erklärt werden kann. Hatten demgegenüber Italien und Deutschland – abgesehen von vergleichsweise kleineren Minderheiten in den Grenzregionen – ohnehin den Vorteil, den ethnischen Nationalismus für die Schaffung ihrer weitgehend „homogenen Vaterländer“ zu nutzen, so verfügte selbst das Osmanische Reich über jenes „turkmenisch“-türkische Stammgebiet Kleinasiens, das in religiöser und national-kultureller Hinsicht wenigstens gewisse Mehrheiten zuließ.
Mit den unterschiedlichen Demokratisierungsetappen und den genaueren statistischen Erfassungsmethoden wurde das auch zahlenmäßig greifbar. Der Anteil der Russen innerhalb des Zarenreiches betrug im Jahr 1897 44 Prozent: Bei schwach ausgeprägter eigener Identität zahlreicher Weiß- und „Kleinrussen“ beziehungsweise Ukrainer hatten hier andere, und erst recht nichtslawische Ethnien klar das Nachsehen.26
Aussagekräftig sind überdies Auswertungen der Mandatsverteilung in der Zweiten oder Deputiertenkammer der „osmanischen „Volksvertretung“ von 1908. Schon vor den Gebietsverlusten während der Balkankriege 1912/13 stellten türkische Mandatare mit 52,4 Prozent die unangefochtene Mehrheit, gefolgt von den Arabern mit 21,4, den Albanern mit 9,5, den Griechen mit 7,6, und den Armeniern mit 3,6. Nach 1913 stieg dann der Prozentsatz der Türken sogar auf knapp 60, die zweitstärkste Gruppe der Araber repräsentierten nun nicht einmal mehr ein Fünftel der Abgeordneten.27
In Kakanien ist jeder in der Minderheit
Ungeachtet der verzerrten Zahlenverhältnisse durch Wahlsysteme und -missbräuche treten in Summe die Unterschiede zur Habsburgermonarchie deutlich zu Tage. Hier hatte keine Fraktion beziehungsweise Nation auch nur annähernd die Mehrheit: Im Gesamtreich stellten die Deutschsprachigen rund ein Viertel der Bevölkerung, die Ungarn knapp 20, die Tschechen 12,5 und die Polen knapp 10 Prozent. In der westlichen Hälfte gehörten zu den „Deutschen“ etwas mehr als 35 Prozent, gefolgt von Tschechen und Polen mit 23 beziehungsweise 16 Prozent. Bei Erweiterung des Männerwahlrechtes ging sich solcherart im Wiener Reichsrat für die stärkste Nationalität – trotz vor allem mittels Steueraufkommen begründeter wahlarithmetischer Vorteile zu ihren Gunsten – keine Majorität aus.28 Unter Ausklammerung weiter Gesellschaftskreise von der politischen Mitbestimmung und mittels eifriger Magyarisierung gelang es zwar in den östlichen Gebieten, den sogenannten „Ländern der Stephanskrone“, den Anteil der ungarischsprachigen Bevölkerung von 46,6 im Jahr 1880 auf 51,4 Prozent im Jahr 1900 zu erhöhen. Die demokratiepolitischen Defizite und die ungelösten Fragen in der Minderheitenpolitik schufen aber gerade hier eine tiefe Kluft zwischen dem Gros der „Untertanen“ beziehungsweise Staatsbürger und der regierenden Oberschicht.29
Gewiss ist es richtig, dass im Zuge der demographischen Erhebungen Zuordnungen erfolgten, die „Mehrfach-Sympathien“ und multikulturelle Identitäten von Orten, Regionen und Personen(-Gruppen) unzureichend erfassten. Dennoch wird man die Statistiken nicht ausblenden können, reflektierten und beeinflussten sie doch einen Ethnisierungseffekt,30 der die Entwicklungen im Donauraum offensichtlich maßgeblich kennzeichnete, jedoch auch andere Wurzeln hatte. Vergessen wird in diesem Zusammenhang nämlich nicht selten, dass im zentraleuropäischen Raum mit begrenzten imperialen Erweiterungszonen nahezu überall (feudale) Staatstraditionen anzutreffen waren, die gelegentlich bis zum Anfang des Hochmittelalters zurückreichen. Königtum und adelige Ständevertretung waren in Polen, Böhmen und den „Nebenländern des heiligen Wenzel“ ebenso wie in Ungarn, Kroatien und Serbien prägende Elemente einer Herrschafts- und Landesidentität, auf die das „Haus Österreich“ von Anfang an in besonderer Weise Rücksicht zu nehmen hatte. Seinen „absolutistischen“, gegenreformatorischen und zentralistischen Ambitionen begegnete man in den einzelnen Teilen des Reiches keineswegs nur mit Warnungen und unterschwelligen Widerstandströmungen. Speziell in Ungarn kam es im Kampf „gegen Wien“ immer wieder zu offenem Aufruhr und bisweilen sogar zu Bündnissen mit dem osmanischen Erzfeind im Südosten.31
Dass sich das Herrschaftsgebiet der Habsburger zweiteilte und darüber hinaus in den jeweiligen Reichshälften prekäre Mehrheitsverhältnisse entwickelten, war somit keineswegs allein auf die Demokratisierungs- und Nationalisierungseffekte des 19. Jahrhunderts zurückzuführen. Die Heterogenität Zentraleuropas in Form seiner regionalen Eigenheiten, kulturellen, ethnischen und konfessionellen Vielfalt spielte hinsichtlich des Schicksals „Kakaniens“ eine entscheidende Rolle: Denn anders als sonst wo, ging es hier aus der Langzeitperspektive um den „brüchigen Zustand“ des Kerngebietes imperialer Machtentfaltung und nicht – wie etwa im Fall Russlands, Englands und Frankreichs – um deren mehr oder minder weit entfernte und/oder noch erschließbaren Außen- und Erweiterungszonen.
Aus österreichischer Perspektive meinte daher 1908 Maximilian Wladimir Freiherr von Beck in seiner Funktion als k. k. Ministerpräsident: „Uns hat die Vorsehung ein Problem auf den Weg gegeben, wie keinem anderen Staate Europas. 8 Nationalitäten, 17 Länder, 20 parlamentarische Körperschaften, 27 parlamentarische Parteien, […] verschiedene Weltanschauungen, ein kompliziertes Verhältnis zu Ungarn, die durch beiläufig achteinhalb Breiten- und etwa ebenso viele Längengrade gegebenen Kulturdistanzen – alles das auf einen Punkt zu vereinigen, aus alldem eine Resultierende zu ziehen, das ist notwendig, um in Österreich zu regieren!“32
Latenter Überlebenskampf
Neu waren solche Einschätzungen nicht. Die Gefahr und schließlich die Gewissheit des Erlöschens der männlichen Linie des habsburgischen „Erzhauses“ stellte den Charakter der „monarchischen Union“ bereits Anfang des 18. Jahrhunderts deutlich heraus. Überschattet vom Verlust der spanischen Machtsphäre, der „Monarchia Hispanica“, drohte nun auch der Zerfall der „Monarchia Austriaca“, die mit der weiblichen Nachfolge und damit längerfristig mit der Regentschaft Maria Theresias gesichert werden konnte. Basis dieser Entwicklung war das 1713 festgelegte und später „Pragmatische Sanktion“ genannte Staats- und Hausgesetz, das bezeichnenderweise gesondert von den österreichischen Ländern, Ungarn und Siebenbürgen zwischen 1720 und 1723 akzeptiert wurde. Die jüngere Forschung betont nachdrücklich, dass das aus verschiedenen Territorien zusammengesetzte Herrschaftsgefüge des „Hauses Österreich“ nun als „unteilbar und untrennbar“ galt, mehr als zuvor eine politische Einheit bildete und seit dieser Zeit etwa auch von den Kartografen als enger zusammenhängender Besitzkomplex wahrgenommen wurde.33
So wollte es in jedem Fall auch der Wiener Hof sehen, obwohl sich das „Erzhaus“ im Gegenzug nach altem Brauch vor allem auf die Rechte der Länder der Stephanskrone vereidigen lassen musste.34 Prinz Eugen, der wichtigste Berater und Feldherr von Maria Theresias Vater, Karl VI., sah es ohnehin nüchterner. Für ihn lag ein „Stück Pergament ohne Wert“ vor. Kurz vor seinem Tod prophezeite der Prinz: „Hunderttausend Mann und ein gefüllter Schatz sind die besten Garantien der Pragmatischen Sanktion.“35
Tatsächlich hielten wichtige Absprachen keineswegs, ließen sich die gewünschten Ziele lediglich mit Waffengewalt erreichen. Vor allem Preußen wurde im nachfolgenden „Österreichischen Erbfolgekrieg“ zum Hauptfeind. Die k. k. Schutz- und Trutzgemeinschaft zentraleuropäischer Länder blieb äußerlich – wie im Wesentlichen schon im Kampf gegen die Osmanen – bestehen. Dahinter verschwanden vorläufig Bruchlinien. Auch das aus dem politischen und militärischen Überlebenskampf hervorgehende Reich Maria Theresias und ihres Mannes Franz Stephan von Lothringen konnte jedoch trotz Reformen zur Stärkung und Vereinheitlichung des Gesamtstaates die Sonderinteressen der vermeintlich unteil- und untrennbaren Reichsteile nicht überwinden. Jede stärkere Machtkonzentration in Wien stellte eine durchaus existenzielle Gefahr dar, obwohl man der Einheit des Donauraumes absolute Priorität einräumte und beispielsweise Englands Segen für die „Pragmatische Sanktion“ mit dem Verzicht auf koloniale Einflusssphären erkaufte. Die durchaus richtungsweisende Entscheidung gegen weit entfernte Besitzungen und für die Konsolidierung sowie den Zusammenhalt der „Stammländer“ relativierte Joseph II. mit seinem Erneuerungseifer: Bemühungen um den Erwerb von Kolonien stellten dabei noch das geringste Problem dar. Schwerer wogen die Homogenisierungsmaßnahmen in den verschiedenen, Erz-, Erb- und Kronländern.36
Neuerliche Krisen machten sich nahezu erwartungsgemäß zuvorderst in Ungarn bemerkbar. Dort betrachteten alle maßgeblichen Gruppierungen die Dekrete aus Wien als Verfassungsbruch und damit das Herrschaftsrecht der Habsburger als erloschen. Josephs Bruder und Nachfolger Leopold II. befand sich in einer schwierigen Situation. Selbst die Einberufung des ungarischen Reichstages war ihm de jure nicht mehr gestattet. Radikalere Kräfte hatten sich bereits vom bisherigen Herrschergeschlecht abgewandt. Aber selbst in moderateren Kreisen kursierten Konzepte mit weitreichenden Forderungen. Die Anerkennung der „Hoheit“ und des Widerstandrechts der ungarischen Nation wurde verlangt. Als Amtssprache sollte von nun an Magyarisch statt Latein – wie früher – oder Deutsch – wie von Joseph vorgesehen – gelten. Die Wiedervereinigung mit wichtigen Regionen, allen voran Siebenbürgen, beanspruchte man im Sinne der territorialen Integrität des Königreiches. Das ging auch dem kompromissbereiten Leopold zu weit. Eine drohende soziale Revolution, die Nationalitätenopposition sowie die außenpolitische Entwicklung vor dem Hintergrund des Konfliktes mit dem revolutionären Frankreich erleichterten schließlich eine neue, für das „Erzhaus“ günstige Übereinkunft mit den ungarischen Eliten. Sie ermöglichte dann auch die Befriedung der anderen Länder.37
Die Bedrohung durch Napoleon und das österreichische Kaisertum
Indessen ließ sich die Unabhängigkeitsbewegung Belgiens, der vormals spanischen Niederlande, angesichts der offenen Konfrontation mit der „Grande Nation“ nicht mehr dauerhaft unter Kontrolle bringen. Das Vordringen der Franzosen verwandelte dann die Revolutions- und Koalitionskriege in eine Auseinandersetzung um imperiale Hegemonie. Dabei blieb kaum ein Stein auf dem anderen. In Europa ermöglichte die zu keinem geringen Ausmaß auf Bajonetten errichtete Dominanz Napoleons vorübergehend die Schaffung eines Systems aus mehr oder minder notgedrungenen Verbündeten des „korsischen Eroberers“, aus den von Frankreich inkorporierten Gebieten sowie den nicht selten von den Verwandten der Familie Bonaparte regierten Vasallenstaaten.38
Noch bevor diese Ordnung voll etabliert war, brach das alte „Heilige Römische Reich“ nach tausendjährigem Bestand unter der Wucht des Neu- und Umgestaltungsfurors zusammen. Französische Terraingewinne am linken Rheinufer leiteten den Kollaps unmittelbar ein, zumal die daraus folgende Entschädigungspolitik das Gefüge des „Sacrum Imperium“ grundlegend veränderte. Mit dem Reichsdeputationshauptschluss des Jahres 1803 waren 112 kleinere „Reichsstände“, darunter fast alle geistlichen Fürstentümer, von mächtigeren Ländern geschluckt worden. Nutznießer der sogenannten „Mediatisierung“, also des Entzugs der „immediaten Stellung“ beziehungsweise „Reichsunmittelbarkeit“, waren vor allem die mit den Franzosen koalierenden und von Bonaparte in der Folge zu Königen oder Großherzögen aufgewerteten Herrscher Bayerns, Württembergs und Badens. Napoleon griff nach dem Erbe Karls des Großen. Demonstrativ bereiste er Aachen, Köln und Mainz und erhob sich zum „Kaiser der Franzosen“.39
Der habsburgische Regent Franz II., der Leopold auf den Thron gefolgt war, sah sich zur Gegenaktion gezwungen. Wieder erwies sich der uneinheitliche Länderbesitz des „Erzhauses“ als Problem. Wie sollte man mit jenen Teilen umgehen, die zum wankenden „Heiligen Römischen Reich“ gehörten? Wiens Diplomaten trugen sich mit dem Gedanken, die übrigen Gebiete, Ungarn und das im Zuge der Polnischen Teilungen 1772 gewonnene Galizien unter einem eigenen Kaisertum zusammenzufassen. Der Zerfall der Donaumonarchie wäre damit besiegelt gewesen, ein Schreckgespenst für die Berater von Franz seit Beginn seiner Regentschaft. Erneut entschied man sich für die Betonung der Sonderrechte seiner Herrschaftsgebiete, die nominell unter der Bezeichnung „Kaisertum Österreich“ zusammengefasst wurden. Nach „reiflicher Überlegung“, hieß es offiziell, habe sich „Seine Majestät“ entschlossen, den neuen Titel „nicht auf eines“ von seinen „Erbländern in Sonderheit, sondern auf den Complexum“ aller seiner „unabhängigen Staaten und auf die Person des Regenten, der diese Staaten unter seinem Szepter vereinigt, dergestalt“ anzuwenden, „daß die einzelnen Königreiche und Staaten Ihre bisherigen Titel, Verfassungen und Vorrechte ungeschmälert beibehalten; desgleichen auch jene Verhältnisse vollkommen aufrechterhalten werden“, durch welche seine „deutschen Erblande mit dem deutschen Reich verknüpft sind“.40
Untergang nach tausend Jahren
Das „Heilige Römische Reich“ verwandelte sich unterdessen in eine leere Hülse. Die Habsburger gingen ihrer Funktion als geistliche Schirmherren weitgehend verlustig, in den Kollegien und Räten dominierten die Protestanten, während von Paris aus schon der Todesstoß für das alte Imperium vorbereitet wurde. Maßgebliche deutsche Fürstentümer schlossen sich im Rahmen des „Rheinbundes“ noch enger an die augenblickliche französische Hegemonialmacht an. Sie erklärten dann am 1. August 1806 den Austritt aus dem „Heiligen Römischen Reich“, für das Franz, der von Napoleon auch militärisch bedroht wurde, schließlich keine Zukunft mehr sah. Wer noch zu ihm hielt, wurde seiner Pflichten entbunden.41 Die Kapitulation Wiens bedeutete die Reichsauflösung, ein juristisch durchaus anfechtbarer Entschluss. Schließlich konnte der Kaiser nur abdanken, nicht aber das ganze tausendjährige Herrschaftsgefüge „nullifizieren“. Die Einwände dagegen standen jedoch nicht bloß in keinem Verhältnis zum bereits vollzogenen Abfall vieler wichtiger Territorien des traditionsreichen Imperiums. Franz und seine Ratgeber wollten vor allem auch verhindern, dass die Reichskrone in „fremde Hände“ gelangte und als „okzidentales Kaisertum“ Bonapartes weiterbestand.42
Das Verschwinden des „alten Reiches“ stellte einen der massivsten Brüche der deutschen Geschichte dar. Immerhin konnten sich die Entscheidungsträger nach dem Ende der napoleonischen Ära gerade diesbezüglich für keine „Restauration“ erwärmen. Schon ab 1806 zeigten sich überdies die schwerwiegenden mentalen Konsequenzen. Eine um sich greifende, oftmals an einem idealisierten Mittelalter orientierte Romantik kennzeichnete die Zeitstimmung.43 Aus unzähligen Reaktionen sprach eine tiefe Erschütterung, ebenso wie die Hinwendung zur „altehrwürdigen Herrscherdynastie“, um die sich antifranzösische und antirevolutionäre Kräfte scharten. Das „Haus Österreich“ wurde zum Sammellager gegen die tonangebende „Grande Nation“ und zugleich in hohem Maße zum Hort konservativ-aufklärungsfeindlicher Ressentiments.44
Hilfe im Moment der großen Schwäche
Das verbliebene „Kaisertum Österreich“ fürchtete währenddessen, im Gefolge von zwei verlorenen Kriegen gegen den „Empereur“, überhaupt um sein Weiterbestehen. Nach der Niederlage bei Austerlitz Ende 1805 hatte es bereits empfindliche Gebietsverluste an der Adria und im Westen hinnehmen müssen. Ein weiterer Versuch, Napoleon in die Schranken zu weisen, endete 1809 mit der Reduzierung der k. k. Herrschaft auf eine „mittlere Macht“ ohne Zugang zum Meer. Obwohl in diesem Zusammenhang nicht ohne Erfolg auf den „Reichspatriotismus“ der Bevölkerung gesetzt worden war, vermochte der nun auch wirtschaftlich vor dem Bankrott stehende „Binnenstaat“, in dem obendrein wichtige staatliche Reformen scheiterten, nur noch auf der Grundlage einer auch durch die Ehe Bonapartes mit der Habsburgerin Marie Louise gefestigten Allianz zwischen Wien und Paris zu überleben.45
Wie groß die Gefahr des Untergangs der Donaumonarchie Anfang des 19. Jahrhunderts erneut war, zeigt ein Brief, den der erfahrene Diplomat und mehrmalige Außenminister Frankreichs, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, bereits drei Tage nach der Schlacht von Austerlitz an Napoleon schrieb. „Eure Majestät können nun die österreichische Monarchie zerbrechen oder erheben. Einmal zerbrochen, stünde es selbst nicht in der Macht eurer Majestät, die zerstreuten Reste zu sammeln und wieder zu einem einheitlichen Ganzen zusammenzufügen. Nun aber ist die Existenz dieses Ganzen notwendig; sie ist unerläßlich für das zukünftige Heil der zivilisierten Nationen.“ Zwar sei Österreich – im Gegensatz zur französischen „masse homogène“ – ein „composé mal assorti“ verschiedener Staaten, Sprachen, Sitten und Religionen. Aber, gab Talleyrand zu bedenken: „Wenn Österreich im Westen zu schwer geschwächt werde, könnte es die Ungarn nicht mehr unter seinem Szepter halten. Ungarn aber sei zu schwach, um einen eigenen Staat zu bilden, es würde sich Rußland ausliefern. Auch andere Trümmer des Reiches würden sich, wenn man das bereits so schwache Band noch mehr lockerte, das die heterogenen Teile seines Bestandes zusammenhielt, eher an Rußland anschließen“.46 Österreich, wie er sich ausdrückte, in „einer für Europa nützlichen Weise“ zu erhalten, erwies sich als eine zukunftsweisende, fast visionäre Sicht, die maßgeblich nicht bloß den Geist des Wiener Kongresses 1814/15, sondern die internationalen Beziehungen der folgenden Dekaden prägte.47
Auf dieser diplomatischen Klaviatur spielte Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich als Außenminister und nachmaliger Haus-, Hof- und Staatskanzler des Habsburgerreiches. Nur zu sehr war ihm bewusst, dass vielleicht London, Paris, Sankt Petersburg und in gewisser Weise auch schon Berlin über größere Aktionsradien verfügten. Wien aber vermochte den eigenen Status nur in Absprache mit anderen, größeren Mächten zu sichern. Angesichts dessen galt die vom „Erzhaus“ mehr recht als schlecht kontrollierte Ländermasse vor allem als „anlehnungsbedürftig“. Das spiegelte sich nicht zuletzt im besonderen Bemühen Metternichs um Bündnissysteme, vertragliche Vereinbarungen und feste Prinzipien wider.48
„Balance“ als Rettungsanker
Das „Konzert“ und das „Gleichgewicht“ der Mächte wurden solcherart zu fixen Ideen, obwohl es in dieser Hinsicht seit Langem kontroverse Debatten gab. Immerhin zeigten die Erfahrungen der vergangenen Jahrhunderte, dass damit oft genug aggressive politische Programme bemäntelt wurden. 1712 hatte zudem – stellvertretend für viele andere Stellungnahmen – eine in London herausgegebene Schrift auf die Unmöglichkeit hingewiesen, die „Kenntnisse“, Organisationen, Denkweisen, den „Fleiß“, den „Mut“ und die „Aufrichtigkeit“ sowie die Güter bis hin zum „letzten Getreidekorn“ in jener Balance zu halten, die zwischen „allen Nationen der Erde“ Gleichheit schaffen könne. Eine solche Äquivalenz empfand auch ein französischer Kommentator vor allem hinsichtlich langfristiger Entwicklungen als „Schimäre“.49 Gerade das im Vergleich zu anderen Staaten an Einfluss verlierende Österreich musste darauf eine Antwort finden. Ein enger Mitarbeiter Metternichs, Friedrich von Gentz, meinte daher: „Die Absicht“ des Gleich- oder besser Gegengewichtssystems „war nie, wie man ihm oft zu Unrecht vorgeworfen hat, dass alle Staaten ungefähr gleich mächtig seyn sollten; sie ging nur dahin, die schwächeren, durch ihre Verbindung mit den mächtigeren, gegen die Unternehmungen eines präponderirenden Staates, so viel als möglich, sicher zu stellen.“50
Derartige Überzeugungen inkludierten allerdings einige Unwägbarkeiten. Das Verhalten jener, welche eine „Präponderanz“ erlangten, blieb unkalkulierbar. Zudem waren die Gentzschen Vorstellungen schwer auf bestimmte Staaten einzugrenzen: Schon am Wiener Kongress hätte sich damit der Führungsanspruch der vier „triumphierenden Alliierten“ gegenüber den „Mindermächtigen“ in Frage stellen lassen können. Für den Augenblick aber trug nach mehreren Dekaden der Unruhe und der Kriegshandlungen die „Pragmatik der Balance“ auf der Basis der „Pentarchie“ unter Einschluss Frankreichs den Sieg davon. Als dienlich erwies sich diesbezüglich auch das Negativbeispiel Bonapartes, der aufgrund seiner Hegemonialpläne zur Karikatur verkam und überdies ältere „Europakonzeptionen“ mit ihrer mehr oder minder deutlichen Bevorzugung eines einzigen Landes nachhaltig diskreditierte.51