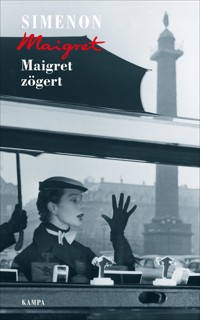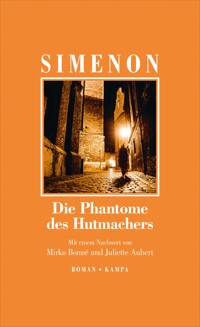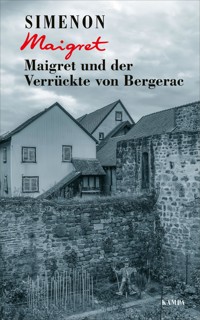9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Taugenichts Élie und die Tänzerin Sylvie lernen sich an Bord eines Schiffes kennen; Sylvie ist auf der Rückreise von Kairo und Élie auf dem Weg von Istanbul nach Brüssel zu lukrativen Geschäften. Doch Élies Geschäfte laufen nicht gut, und nach einem Raubüberfall steht er plötzlich als Mörder da. Kurzerhand versteckt Sylvie die Beute und bringt Élie bei ihrer Mutter unter, die in Charleroi eine Pension führt – bis schließlich auch der Mutter dämmert, dass sie einen gesuchten Mörder beherbergt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Georges Simenon
Der Untermieter
Roman
Aus dem Französischen von Ralph Eue
Atlantik
1
Mach das Fenster zu!«, jammerte Élie und zog sich die Decke bis zum Kinn. »Bist du verrückt geworden?«
»Hier riecht’s nach Krankheit«, erwiderte Sylvie, deren nackter Körper sich zwischen dem Bett und dem grauen Fenster abzeichnete. »Du hast vielleicht geschwitzt heute Nacht!«
Er schniefte kurz und rollte seinen mageren Körper zusammen, während die Frau in das warme Licht des Badezimmers trat und Wasser in die Wanne laufen ließ. Für einige Minuten erübrigte es sich zu sprechen, denn das Rauschen aus den Wasserhähnen übertönte alles andere. Mit einem Auge sah Élie mal zum Fenster, mal zum Bad. Die Scheibe glitzerte in tückischem Weiß. Frühaufsteher hatten es sicher schneien sehen. Inzwischen war es elf Uhr, und aus dem gelblichen Himmel, der über den Dächern von Brüssel hing, lösten sich keine Flocken mehr. In der Avenue du Jardin Botanique brannten noch die Straßenlaternen und die Lichter in den Schaufenstern.
Von seinem Platz aus konnte Élie gut die schwarz schimmernde Straße sehen, auf der eine Straßenbahn nach der anderen vorbeifuhr. Außerdem fiel sein Blick auf den Botanischen Garten, den liegen gebliebenen Schnee, den halb zugefrorenen Teich und drei Schwäne, die erstarrt in einem Rest dunklen Wassers trieben.
»Stehst du nicht auf?«
»Ich bin krank.«
Sie waren bis drei Uhr morgens im Merry Grill geblieben. Élie, dessen Nase wund war vom vielen Schnäuzen, hatte längst gedrängt, nach Hause zu gehen. Er hatte eine schlimme Erkältung, vielleicht sogar eine Grippe oder Bronchitis. Er war nass geschwitzt und fühlte sich wehrlos einer feindlichen Umgebung ausgeliefert.
»Mach das Fenster zu, Sylvie!«
Sie drehte den Wasserhahn ab und durchquerte das Zimmer. Der Badezimmerspiegel war beschlagen.
»Wie lang van der Sowieso wohl pennt? Findest du es nicht ulkig, dass er auch im Palace wohnt und auch noch direkt neben uns?«
Élie Nagéar war nicht in der Stimmung, irgendetwas ulkig zu finden, und er knurrte:
»Ich weiß schon, dass du mich seinetwegen bis drei Uhr auf den Beinen gehalten hast.«
»Idiot!«
Es stimmte zwar, aber es lohnte nicht, darauf zu bestehen. Außer einigen Animierdamen, die vor leeren Gläsern saßen, war fast niemand mehr im Merry Grill gewesen. Die Kapelle musizierte lustlos, und Sylvie gähnte. Doch dann wurde ein dicker Holländer von zwei Brüsselern hereingelotst, und alles hatte sich nur noch um sie gedreht.
Der Holländer wollte sich amüsieren. Er hatte ein helles, fast kindliches Lachen. Nach einigen Minuten saßen bereits vier Frauen bei ihm am Tisch. Der Champagner floss in Strömen, und es wurden gute Zigaretten und Havannas geraucht.
Sylvie, die mit Élie an der Bar saß, ließ die lärmende Gruppe nicht aus den Augen.
»Wenn du krank bist, geh schlafen!«
Er war nicht eifersüchtig, blieb aber trotzdem, vielleicht nur, um sie zu ärgern.
»Ist es van der Sowieso, der dich interessiert?«
Ein Name, den Sylvie dem Holländer einfach nur so gegeben hatte. Es hatte sie geärgert, die anderen Frauen prassen zu sehen, während sie vor ihrem Gin-Fizz saß. Sie fand sie hässlich.
»Gehen wir!«
Als sie auf dem Weg in ihr Zimmer durch die Halle des Palace gingen, waren sie van der Sowieso begegnet. Es war den vier Frauen also nicht gelungen, ihn zu halten. Er war allein! Im Fahrstuhl blickte er Sylvie mit einer schmeichelhaften Verwunderung an.
Und Sylvie musste die Nacht mit Élie Nagéar verbringen, der schwitzte, eine geschwollene Nase und rote Augen hatte und keinen Sou mehr besaß.
»Was hast du vor, draußen um diese Zeit?«
»Keine Ahnung«, antwortete sie und zog ihre Strümpfe an. »Auf alle Fälle brauche ich Geld.«
»Ich habe keins.«
Bis jetzt hatte nur im Bad das Licht gebrannt, und das Zimmer lag gleichsam unter einem grauen Staubschleier. Nachdem Sylvie die Strümpfe an den schwarzen Strapsen ihres Strumpfgürtels befestigt hatte, drehte sie am Lichtschalter, und das Bild, das sich dem Auge im Fensterrahmen dargeboten hatte, verschwamm bis zur Unkenntlichkeit.
Das Zimmer wirkte mit einem Mal luxuriös. Auf dem Toilettentisch, zwischen den großen Leuchtern mit rosa-seidenen Schirmen, glitzerten Glasflacons mit Silbermontierung und Kristallbehälter für Schminkutensilien. Sylvie zog eine dünne Bluse über ihre nackten Brüste.
»Du hast doch noch ein paar Hundert Franc.«
»Du wirst wohl deinen Goldklumpen verkaufen müssen«, brummte er, während er sich die Nase putzte.
Die Berührung seiner gereizten Haut mit dem Taschentuch war so schmerzhaft, dass er sich nur mit äußerster Vorsicht schnäuzte.
»Glaubst du, dass ich mich davon trenne?«
Er glaubte überhaupt nichts. Er hatte von nichts mehr eine Vorstellung. Er schwitzte. Das Bett roch verschwitzt. Der Pyjama klebte an seiner Haut, und das Licht war ihm unangenehm.
Er hatte Sylvie zwei Wochen zuvor an Bord der Théophile Gautier kennengelernt. Sie war auf der Rückreise von Kairo, wo sie in irgendeinem Nachtclub Barmädchen gewesen war. Er fuhr von Istanbul nach Brüssel, wo er ein Teppichgeschäft abwickeln wollte: Es ging darum, eine Million Teppiche, die nicht durch den Zoll gegangen waren, möglichst schnell zu verkaufen.
Es waren nicht seine Teppiche. Die Angelegenheit zog sich schon Monate hin. Zwanzig Zwischenhändler waren darin verwickelt, in Pera, in Athen und selbst in Paris. Man wusste nicht mehr, wem die Ware eigentlich gehörte und wer welchen Anteil zu bekommen hatte.
Élie Nagéar, der Beziehungen in Brüssel hatte, war in das Geschäft eingestiegen und war so zuversichtlich aufgetreten, dass er einen Vorschuss auf seinen Anteil erhalten hatte.
Es war klar: Wenn er die Teppiche verkaufte, würde er zweihunderttausend Franc kassieren.
Sylvie reiste zweiter Klasse. Seit dem ersten Tag schwirrten ständig vier oder fünf Männer um sie herum, und sie blieb bis zwei oder drei Uhr morgens an Deck.
Wer ihr den Zuschlag für die erste Klasse gezahlt hatte? Auf jeden Fall war es nicht Nagéar, der ihr zu dem Zeitpunkt noch nicht nähergekommen war. Das war ihm erst kurz vor der Ankunft in Neapel gelungen, als sie ihm anvertraut hatte, dass ihr Ticket nur bis zu diesem Hafen ging.
Er hatte ihr die Strecke Neapel – Marseille bezahlt, sie nach Paris mitgenommen und später nach Brüssel. Nun waren sie seit ein paar Tagen hier, und was die Teppiche betraf, gab es keine Hoffnung mehr.
Élie war obendrein noch krank und hatte kaum mehr tausend Franc in der Tasche. Er hatte den Kopf halb unter der Decke, doch mit einem Auge fixierte er Sylvie, die sich gerade Lippenstift auftrug.
»Ich frage mich, was du um diese Zeit draußen vorhaben kannst!«
»Das ist meine Sache.«
»Es sei denn, du willst van der Sowieso treffen.«
»Warum auch nicht?«
Er war nicht mehr eifersüchtig. An Bord war er es noch gewesen, denn die Männer stritten sich um Sylvie und wussten immer genau, was sie gerade trieb.
Inzwischen kannte er sie besser. Er hatte sie im Bett gesehen, morgens, wenn man ihre Sommersprossen unter den Augen besser erkennen konnte und sich das Gewöhnliche ihres Körpers enthüllte.
»Gib mir Geld«, sagte sie und zog ihren engen Rock über die Hüften.
Er rührte sich nicht, selbst als sie seine Brieftasche aus seiner Jacketttasche zog. Er sah, wie sie vier, fünf, sechs Hundertfrancscheine abzählte und in ihre Tasche steckte. Unentwegt fuhren Straßenbahnen mit ihren großen Lichtern die Avenue du Jardin Botanique hinauf und hinunter.
»Soll ich etwas für dich bestellen?«
Sie wandte sich um und sah ihn erstaunt an.
»Was ist? Antwortest du nicht? … Du bist blöd! …«
Nein, er antwortete nicht. Er sah sie mit einem Auge an, und sie ärgerte sich, weil sie nicht wusste, was er dachte.
»Bis heute Abend.«
Er rührte sich auch nicht, als sie sich ihren Pelzmantel über die Schultern warf.
»Sagst du mir nicht auf Wiedersehen?«
Sie löschte das Licht im Badezimmer, suchte ihre Handschuhe, und ihr Blick fiel auf das trostlose Panorama des Botanischen Gartens.
»Dann eben nicht!«
Doch auch er war nicht mehr derselbe. An Bord der Théophile Gautier hatte er jung und elegant gewirkt. Er war ein Mann von fünfunddreißig Jahren, sehr schlank, mit schwarzen Haaren und einer etwas zu kräftigen Nase.
»Bist du Türke?«
»Ich bin portugiesischer Herkunft.«
Er war geistreich, oder er hatte vielmehr eine hinreißend skeptische Einstellung. Nachdem sie ihm gesagt hatte, dass sie Tänzerin war, wollte er wissen, in welchem Nachtclub in Kairo sie gearbeitet hatte.
»Im Tabarin.«
»Tausend Franc im Monat und Anteil beim Champagner«, wusste er.
Das stimmte genau! Er kannte Kairo. Er kannte auch Bukarest, wo sie zwei Monate im Maxim gewesen war. Er erzählte ihr von den Männern, mit denen sie Geld verjubelt hatte.
»Bist du reich?«
»Ich werde zweihunderttausend Franc kassieren, wenn ich in Brüssel ankomme.«
Von wegen! Es war aus und vorbei! Er war krank! Er war trübsinnig! Er war hässlich!
»Bis heute Abend.«
Sie ließ ihr Gepäck im Zimmer. Im Vorbeigehen warf sie einen Blick auf van der Sowiesos Tür und sah dicke holländische Zeitungen aus seinem Briefkasten ragen.
Élie dachte nicht weiter an sie. Er betrachtete die Zimmerdecke, dann das Fenster, dann die erloschenen Lampen. Er zögerte das Naseputzen hinaus, denn es würde ihm wehtun. Er spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach und über den Körper rann.
»Ich hätte gern einen Wagen«, sagte sie zum Portier.
»Ein Taxi?«
»Ich möchte nach Charleroi.«
»Dann bestelle ich Ihnen eine Pauschalfahrt.«
Auch die Halle war erleuchtet. Sylvie wartete und ging vor den mit Kupfer eingefassten Vitrinen auf und ab. Kurze Zeit später nahm sie in einem alten herrschaftlichen Wagen Platz, der von einem livrierten Chauffeur gefahren wurde.
»Fahren Sie mich zuerst zum Bon Marché.«
Im Bon Marché brannten die kugeligen Milchglaslampen. Es war weder Tag noch Nacht. Durch die Drehtüren drang Kälte ins Innere. Die Verkäuferinnen trugen Wollpullover unter ihren Kleidern.
Sylvie wusste nicht recht, was sie wollte. Sie kaufte blaue Lederpantoffeln, einen Pullover, zwei Pfeifen, Seidenstrümpfe und eine Handtasche. In ihrem Pelzmantel machte sie den Eindruck einer vornehmen Dame.
»Das sind alles Geschenke«, erklärte sie der Verkäuferin, die ihr die Pakete zum Auto trug.
Der Wagen fuhr aus der Stadt in Richtung Charleroi. Im Wald lag noch Schnee. Die Scheiben beschlugen. Sylvie wischte sie mit der Hand frei, um die Gegend betrachten zu können, besonders als die ersten Kohlehalden und Siedlungen auftauchten.
Als sie in die Stadt kamen, öffnete Sylvie ihre Tasche und erneuerte ihr Make-up.
»Biegen Sie links ab!«, sagte sie. »Noch mal links. Und jetzt über die Brücke! Fahren Sie den Straßenbahnschienen nach!«
Auf den großen schwarzen Kohlehalden, die kegelförmig zum Himmel ragten, lagen noch, wie Ekzeme, ein paar Schneereste. Sie fuhren eine endlose Straße entlang, gesäumt von gleich aussehenden eingeschossigen Häusern, deren rotbraune Ziegel schwarz verfärbt waren. Ab und zu schwebte ein Förderkorb über die Straße, oder ein kleiner Zug, auf dem vorn ein Arbeiter stand und ein rotes Tuch schwenkte, kreuzte sie.
Hier war weder Stadt noch Land. Zwischen zwei Häusern tat sich eine Art Niemandsland auf, doch es war kein Niemandsland, sondern vielmehr eine Zeche. Es war eine einzige, endlose Fabrik. Maschinenkeuchen war zu hören.
»Halten Sie vor Nummer dreiundfünfzig.«
Das Haus sah aus wie alle anderen. Im Fenster des Erdgeschosses hingen sehr weiße Gardinen, die einen Kupfertopf umrahmten, in dem eine Grünpflanze wuchs. Der Chauffeur wollte klingeln.
»Nein! Nehmen Sie die Pakete! …«
Sylvie klappte den Briefschlitz hoch und schaute durch das Schlüsselloch. Eine Frau um die vierzig öffnete die Tür, musterte einen Moment lang die Besucherin und wischte sich dabei ihre feuchten Hände an der blauen Leinenschürze ab.
»Erkennst du mich nicht, Mama?«
Sylvie umarmte sie. Ihre Mutter ließ es geschehen, mehr verblüfft als gerührt, und sah dann den Chauffeur an.
»Was ist das?«
»Ein paar Mitbringsel … Geben Sie her, Jean! … Sie können in der Stadt essen gehen. Kommen Sie danach wieder, und holen Sie mich ab.«
Am anderen Ende des Korridors stand die Glastür zur Küche offen. Man konnte einen jungen Mann erkennen, der seine Füße in der Backröhre hatte und ein Buch auf den Knien hielt.
»Monsieur Moïse«, stellte die Mutter vor.
Es klang, als zögerte sie fortzufahren.
»Meine Tochter, eben aus Ägypten zurück … Es war doch Ägypten, wo du zuletzt warst?«
Monsieur Moïse war aufgestanden und entfloh in die erste Etage.
»Vermietest du immer noch möblierte Zimmer?«
»Was glaubst du, wovon wir leben?«
Ein riesiger Suppentopf stand auf dem Herd und daneben eine Kaffeekanne, die immer voll war. Sylvie hatte ihren Mantel über einen Stuhl gehängt, und ihre Mutter strich ganz sachte über den Pelz.
»Warum hast du dem Chauffeur gesagt, er soll zurückkommen?«
»Ich muss wieder weg.«
»Aha! …«
Jetzt füllte Madame Baron eine Tasse mit Kaffee, ganz automatisch, so wie sie es immer machte, wenn jemand bei ihr hereinschaute. Sie trug Arbeitskleidung: ein altes, dunkles Kleid und eine blaue Leinenschürze. Sylvie öffnete ihre Pakete und packte die Pantoffeln aus.
»Gefallen sie dir?«
»Glaubst du denn, heute ist Karneval?«
»Wo ist Antoinette?«
»Sie macht die Zimmer.«
Das stimmte nicht ganz, denn Antoinette kam gerade mit einem Eimer und einem Scheuerlappen in der Hand die Treppe herunter und sah ihre Schwester wortlos an.
»Donnerwetter!«, rief sie schließlich aus.
»Was?«
»Ich sagte, Donnerwetter! Du hast dich ganz schön herausgeputzt! …«
Sie umarmten sich flüchtig, und Antoinette blinzelte verstohlen zu den blauen Pantoffeln.
»Sind die für mich?«
»Wenn Mama sie nicht will … Dir habe ich Strümpfe mitgebracht, einen Unterrock …«
Ohne Begeisterung packte Sylvie weiter aus. Eine Pfeife fiel herunter und ging zu Bruch.
»Kommt Vater bald nach Hause?«
»Nicht vor heute Abend. Er fährt den Ostende-Zug. Ich hoffe, du wartest auf ihn.«
»Heute nicht. Ich komme wieder.«
Ihre Mutter musterte sie misstrauisch. Die Schwester mit ihren staksigen Beinen saß auf einem Stuhl und probierte die neuen Strümpfe an. Suppengeruch hing in der Küche, und man hörte das gleichmäßige Geräusch von brodelndem Wasser und einem gut ziehenden Feuer.
»Sind alle Zimmer belegt?«
»Hast du das Schild nicht gelesen? Eins ist noch frei. Das im Erdgeschoss. Das teuerste natürlich. In diesen Zeiten haben die Ausländer keinen Sou. Du hast ja Monsieur Moïse gesehen. Er kommt zum Lernen in die Küche, um Kohlen zu sparen. Deck den Tisch, Antoinette! Wir essen, bevor die Mieter zurückkommen.«
»Kochst du noch für sie?«
»Zwei essen zu Mittag. Ansonsten wollen sie heißes Wasser für Kaffee oder zum Eierkochen und machen Dreck in ihren Zimmern.«
Madame Baron war klein und untersetzt. Antoinette, kleiner und dünner als ihre Schwester, hatte unregelmäßige Gesichtszüge und helle Augen, die immer lachten.
»Legst du dir neuerdings Rouge auf?«, fragte Sylvie.
»Warum solltest du es benutzen können, und ich nicht?«
»Es steht dir nicht. In deinem Alter …«
»Als ob du dich in meinem Alter nicht auch schon geschminkt hättest!«
Ihre Mutter stand am Herd und strich die Suppe durch ein Sieb. Es war warm in der Küche. Durch das Fenster sah man auf einen kleinen Hof, und vom Dach fielen dicke, durchsichtige Tropfen geschmolzenen Schnees.
Die Hand über der Sprechmuschel, raunte der Portier des Palace in Brüssel ins Telefon:
»Hallo! Monsieur van der Cruyssen? Monsieur Blanqui ist hier unten. Er möchte Sie gerne sprechen. Darf ich ihn hochschicken? … Würden Sie bitte hinaufgehen, Monsieur? Zimmer vierhundertdreizehn, im vierten.«
Élie hatte sich endlich doch aus den verschwitzten Laken gequält. Er hatte sich einen Seidenschal um den Hals gelegt und Pantoffeln angezogen. Er wusste weder, wo er sich hinsetzen, noch, was er tun sollte. Er hatte gehört, dass im Nebenzimmer telefoniert wurde. Einen Augenblick lang blieb er am Fenster stehen und betrachtete die schmutzig graue Stadt und den Teich, in dem sich die Schwäne langweilten. Der Lärm der Straßenbahnen und Autos hallte in seinem leeren Kopf wider.
»Herein!«
Das war nebenan. Die zwei Appartements, die man bei Bedarf zusammenlegen konnte, waren lediglich durch eine verriegelte Tür voneinander getrennt. Die Stimmen waren genauso deutlich zu hören wie das lästige Gebimmel der Straßenbahnen.
»Wie geht es Ihnen? Ich komme zu spät, aber ich musste noch zur Bank.«
Élie hörte mit, ohne es zu wollen. Ihm war heiß und kalt. Er war drauf und dran, ein Bad zu nehmen, konnte sich dann aber doch nicht dazu aufraffen.
»Sie fahren noch heute Nacht?«
»Mit dem letzten Zug nach Paris. Was trinken Sie? Einen Portwein?«
Die Stimme telefonierte mit dem Kellner.
Als aufgelegt wurde, rief auch Élie an und bestellte einen Grog. Er besah sein Gesicht im Spiegel und war erstaunt, es so hässlich zu finden. Allerdings war er auch unrasiert, und der malvenfarbene Schal betonte sein mürrisches Gesicht.
»Gemäß Ihrer Anweisung habe ich französische Scheine genommen.«
Élie bückte sich, um durchs Schlüsselloch zu sehen. Er erkannte einen kleinen Mann, der wie ein Buchhalter aussah und nun sechs Bündel Banknoten auf den Tisch im Nachbarzimmer legte.
»Zählen Sie bitte nach!«
Monsieur van der Sowieso – er trug einen schwarzseidenen Morgenrock und rote Lederschuhe – zählte mit der Routine eines an den Umgang mit Banknoten gewohnten Mannes jedes Bündel schnell durch und öffnete dann eine Schweinsledertasche, in der er die Scheine verstaute.
»Herein!«
Es war der Kellner mit einer Flasche Portwein und einer Flasche Rum. Der Rum war für Élie, der zuerst ein paar Schritte rückwärts machte. Dann sagte er ebenfalls:
»Herein!«
Bei den Barons fing man mit dem Mittagessen an, doch die Mutter blieb misstrauisch stehen und bediente ihre Töchter und die beiden gerade zurückgekommenen Mieter, Monsieur Domb und Monsieur Valesco. Neugierig betrachteten die beiden Männer Sylvie; diese grinste über deren Verwunderung und über Antoinettes griesgrämige Miene.
»Sie kennen Bukarest?«, brummte Plutarch Valesco, ein Rumäne.
»Ebenso gut wie Sie! Ich kenne sogar fast alle Ihre Minister.«
»Es ist ein schönes Land, finden Sie nicht?«
»Mag sein, aber die Leute haben alle kein Geld.«
Élie saß auf der Armlehne seines Lehnstuhls, trank löffelweise seinen heißen Grog und betrachtete die Avenue du Jardin Botanique, die am Mittag von einer großen Menschenmenge bevölkert war. Aus dem gelben Himmel fielen wieder winzige Schneeflocken.
»Auf Wiedersehen … Gute Fahrt!«
»Danke … Bis Mittwoch!«
Und im Badezimmer von Monsieur van der Sowieso rauschte Wasser in die Wanne.
Als es an diesem Tag kurz vor halb vier dunkel wurde, lag Élie auf seinem Bett und blickte zur Decke, wo die Lichtreflexe der Straße tanzten.
Um vier Uhr sah ihn der Portier vorbeigehen, dem auffiel, dass er unrasiert war. Vielleicht hatte er noch nicht einmal frische Wäsche an, denn er machte einen etwas zerknitterten Eindruck.
»Soll ich etwas ausrichten, wenn Madame zurückkommt?«
»Nichts … Ich komme zurück!«
Er hatte rote Flecken auf den Wangen, wie ein Schwindsüchtiger.
Das Auto fuhr die Straße entlang, und die Scheinwerfer erhellten die verregnete Landschaft. Die Scheibe zwischen Fahrgastraum und Chauffeur war geöffnet.
»Ich bin hier ganz in der Nähe geboren, in Marcinelles«, erklärte dieser. »Ich habe die Gelegenheit genutzt, um meinen Bruder zu besuchen. Ich habe mir gedacht, dass Sie es nicht eilig haben.«
»Was macht er?«
»Nichts Besonderes. Er ist Angestellter im Gaswerk.«
Sie erreichten Brüssel, kamen an erleuchteten Cafés vorbei und fuhren um Verkehrsinseln herum, auf denen die weißen Helme der Polizisten leuchteten.
»Monsieur ist eben weggegangen«, teilte der Portier Sylvie mit, als sie zum Lift ging.
»Ach! Hat er nichts gesagt?«
Acht Uhr. Er war immer noch nicht zurück. Sie ging in den Grillraum hinunter und nahm zwei Tische neben van der Sowieso Platz. Sie aß nur einen Hummersalat und spürte zehnmal die taxierenden Blicke des Holländers. Doch als sie ging und in der Halle von einer Auslage zur anderen spazierte, folgte er ihr nicht.
Sie fuhr wieder hoch. Kurz danach hörte sie, wie im Nebenzimmer Koffer gepackt und dem Zimmerdiener Anweisungen gegeben wurden.
»Nein, nicht zum Schlafwagen! Es war alles besetzt. Liegewagen erster Klasse. Halten Sie mir einen Platz in Fahrtrichtung frei.«
Sie zog sich um und seufzte. Sie war erschöpft, vielleicht sogar niedergeschlagen. Élie kam nicht. Sie zählte das Geld, das sie noch in der Tasche hatte: hundertfünfzehn Franc.
Ohne recht zu wissen, wohin sie ging, lenkte sie ihre Schritte zum Lift. Unten blieb sie beim Portier stehen, um ihren Schlüssel abzugeben.
»Schade, dass er abreisen muss!«, sagte er zu ihr, als wären sie schon immer Freunde gewesen.
»Warum?«
»Er hat sich bei mir nach Ihnen erkundigt. Er ist sehr beeindruckt. Aber Monsieur Élie mag er nicht.«
Sie zuckte die Schultern, nahm eine Zigarette, und er gab ihr Feuer. In diesem Moment verließ van der Sowieso den Fahrstuhl, zögerte einen Augenblick und ging dann zum Portier hinüber, währenddem er zu der jungen Frau sagte:
»Sie gestatten?«
»Sie reisen schon ab?«, fragte der Chefportier.
»Es muss sein!«
Er legte ein besonderes Gewicht in diese Worte und sah kurz zu Sylvie herüber. Gleichzeitig drückte er dem Portier einige zerknüllte Scheine in die Hand.
»Bis nächste Woche …«
Er ging durch die Halle davon. Nach zehn Schritten blieb er noch einmal stehen, drehte sich um und ging dann mit einem Schulterzucken zur Drehtür.
»Das ist ein bedeutender Bankier aus Amsterdam«, sagte der Portier zu Sylvie. »Er kommt immer mittwochs. Wenn Sie nächste Woche noch hier sind …«
Mit einem Augenaufschlag seufzte sie:
»Wenn Monsieur Élie zurückkommt, sagen Sie ihm, dass ich im Merry Grill bin … Oder besser, sagen Sie ihm gar nichts. Das wird ihm eine Lehre sein … Boy! Ein Taxi!«
Es schneite in dicken Flocken, die schmolzen, sobald sie den Asphalt berührten. Züge pfiffen hundert Meter weiter auf den Gleisen der Gare du Nord.
2
Vor den Schaufenstern eines Tabakladens, an einer Ecke der Rue Neuve auf dem Bürgersteig, im Gedränge neben einem Jungen, der Tombolalose verkaufte, wurde sich Élie plötzlich des Weges bewusst, den er seit Istanbul zurückgelegt hatte. Die Schaufenster waren vollgestopft, und zwischen den übereinandergestapelten Tabaksdosen befanden sich auch weiße, auf denen das Wort ›Abdullah‹ zu lesen war.
Auch das angesagte Restaurant in der Hauptstraße von Pera hatte Abdullah geheißen. Élie hatte dort noch am Vorabend seiner Abreise mit seinen Freunden gegessen. Er kannte jeden und ging grüßend von Tisch zu Tisch.
»Morgen schiffe ich mich ein.«
»Glückspilz!«
Doch in Wahrheit war er, als er mit den Händen in den Taschen und bis zum Kinn hochgeschlagenem Mantelkragen an der Ecke zur Rue Neuve stand, gar nicht in der Lage, die Erinnerung an das Abdullah in der Türkei wachzurufen.
Eine theoretische Erinnerung, ja, das war einfach. Aber um die ging es nicht. Warum war er zum Beispiel aufgebrochen, obwohl er wusste, dass die Sache mit den Teppichen schiefgehen würde? Er war den Leuten hinterhergelaufen, hatte ihnen wie siegestrunken angekündigt:
»Ich fahre nach Marseille!«
Er hatte die Neuigkeit auf der Hauptstraße herumposaunt, während dort unzählige Menschen mit gemächlichen Schritten ihren Abendspaziergang machten.
Jetzt war das alles so weit weg, dass es ihm schon unwirklich vorkam. Das Wirkliche war der Schnee, der den Gehsteig mit einer braunen glitschigen Schicht überzog, die Kälte, das Fieber, seine schmerzende Nase und die quälende Erschöpfung, die zwischen seinen Schulterblättern saß.
»Geben Sie mir ein Päckchen türkische Zigaretten«, sagte er zu dem Verkäufer.
Die blaue Flamme eines Zigarrenfeuerzeugs tanzte vor seinen Augen. Der Verkäufer war dick und rosig. Jenseits der Schaufenster gingen undeutliche Gestalten vorbei.
»Das sind keine türkischen Zigaretten«, sagte er und betrachtete die Schachtel, die ihm hingehalten wurde.
»Es sind ägyptische. Die sind noch besser.«
»In Ägypten gibt’s keinen Tabak!«
»Keinen Tabak in Ägypten? Also …«
»In Ägypten gibt’s keinen Tabak!«, wiederholte er, und dem dicken Mann blieb vor Entrüstung die Luft weg. »Die Ägypter importieren türkischen und bulgarischen Tabak.«
Er fragte sich, warum er das gesagt hatte. Er tauchte wieder in die Menge der Rue Neuve ein und schleppte sich weiter. Manchmal blieb er vor Schaufenstern stehen, besonders vor solchen mit Spiegeln, in denen er sich betrachten konnte.
Er trug einen Kamelhaarmantel, einen eleganten Filzhut und einen gutgeschnittenen Anzug.
Warum war ihm plötzlich so elend? Wegen seines zwei Tage alten Bartes? Wegen seines verquollenen Gesichts?
Auf jeden Fall fühlte er sich mitgenommen, erbärmlich. Jemand stieß ihn an, und er zuckte zusammen, als wäre er geschlagen worden.
Er suchte ein Juweliergeschäft. Er sah zwar mehrere, ging aber erst in das vierte hinein und legte ein Stück Gold von der Größe einer Nuss auf die Ladentheke. Es war Sylvies Goldbarren. Sie hatte ihn seit zwei Jahren immer bei sich, für den Fall, dass sie sich einmal ohne Geld in einer fremden Stadt befinden würde.