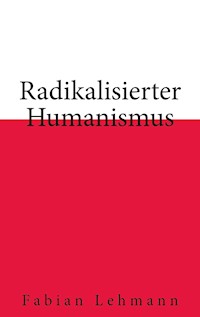Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein tiefgründiger und doch erstaunlich lesbarer Ritt von dem innersten Selbst bis hin zu gesellschaftlichen Zusammenhängen, über das eigene Gehirn bis hin zu künstlicher Intelligenz. Mit dem Ziel, dich und die Gesellschaft zu ermächtigen, werden Zusammenhänge, Probleme und Lösungen aufgezeigt. Die moderne Welt lässt sich in ihrer Komplexität nur begreifen, wenn die verschiedenen Bereiche nicht getrennt voneinander, sondern als Gesamtheit verstanden werden. Dieses Buch nimmt sich dem Spagat zwischen Psychologie, Wirtschaft und Politik, zwischen Philosophie, Wissenschaft und Alltag an, ohne sich dabei in Fachwissenschaften zu verlieren. Auf dass wir nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Gesellschaft besser verstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Schwestern.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I Selbstfindung
1 Der Affe in uns
1.1 Hunger
1.2 Angst
1.3 Verständnis
2 Warum diese Welt deine ist
2.1 Deine Welt
2.2 Sich selbst finden
2.3 Sich selbst suchen
3 Einfache Verkomplizierungen
3.1 Ganz einfach
3.2 Ist so
3.3 Deine Meinung
4 Farben sehen
4.1 Differenzieren
4.2 Dekomprimieren
4.3 Definieren
5 Deine Zukunft
5.1 Du wirst dich wandeln
5.2 Allein verloren
II Andere Menschen
6 Andere Menschen sehen
6.1 Du bist genauso anders
6.2 In der dritten Person
6.3 Die Menschen
7 Andere Menschen sein
7.1 Leitfaden ethischer Interaktion
7.2 Zwischenmenschliche Entfaltung
7.3 Sprechen als Gewaltform
8 Bessere Menschen
8.1 Niemand ist besser
8.2 Leistungsgesellschaft
8.3 Allem Anfang liegt die Unsicherheit inne
III Unsere Welt
9 Strukturen der Macht
9.1 Machterhaltungssatz
9.2 Kapitalismus als quantifizierte Religion
9.3 Faschismus und Trolle
9.4 Religionismus um dich zu binden
10 Leitzahlen des Wirtschaftsfundamentalismus
10.1 Was ist Geld
10.2 Wirtschaftswachstum und Du
10.3 Inflation erklärt für Kinder
10.4 Wirtschaftsgut Mensch
10.5 Tech-Giganten werden Meta
11 Strukturen der Ermächtigung
11.1 Ideologie und Gesellschaft
11.2 Systemwandel mit System
11.3 Klimawandelbewegung
12 Politik im digitalen Zeitalter
12.1 Das politische Regelsystem
12.2 Ethische Machtpolitik
12.3 Politische Infrastruktur
13 Koassistive Intelligenz
13.1 Digitales Handwerk
13.2 Die Gesellschaft der Zukunft
13.3 Evolution und Unsterblichkeit
Nachwort
Literatur
Inhaltsübersicht
Vorwort
Dieses Buch möchte niederschwellig und zugleich tiefgreifend sein. Es soll einfach zu verstehen, aber nicht einfach zu vergessen sein. Es wird wohl kein Buch sein, welches dich in deiner Welt bestätigt; vielmehr sollen Strukturen aufgebrochen, Gewohnheiten erschüttert und Verständnisse erweitert werden - nicht um dich zu ändern, sondern um dir die Chance einer Wahl zu geben. Dieses Buch ist eine Einführung in Denk- und Machtzusammenhänge, startend von dir selbst bis hin zur Gesellschaft. In komplexen Systemen, wie unserer, miteinander verbundenen Welt, lassen sich viele Sachverhalte und Dynamiken nur unter Einbeziehung des gesamten Umfangs verstehen; es reicht nicht, sich einzelne Details anzusehen, wenn man wissen möchte, wie etwas funktioniert. Aufgebaut ist das Buch dabei wie deine Fähigkeit, die Welt zu verstehen - bei deinem eigenen Inneren startend, durch Interaktionen mit anderen Menschen erweitern und schließlich die Außenwelt entdecken. Denn wie willst du die Welt erkennen, wenn du deine Augen nicht verstehst? So sind die einzelnen Kapitel aufeinander aufbauend und dennoch für sich stehend - also starte, wo es dir beliebt, und finde zurück, wenn dir etwas fehlt. Dieses Buch möchte dir die Werkzeuge geben, Zusammenhänge selbstständig betrachten, auswerten und analysieren zu können. Eine Ermächtigung, welche über die direkten Inhalte des Buches hinaus geht - denn es gibt noch so viel mehr Wichtiges in der Welt zu sehen, zu verstehen und zu schaffen. So kann in der Kürze eines Buches nur ein Anreißen vieler Themen erfolgen, dieses Werk wird also weder komplett sein, noch wird es allen Details gerecht werden können. In jedem einzelnen Bereich gibt es andere Personen, welche mehr und besser Bescheid wissen und ich ermutige, bei Interesse, die Werke dieser zu studieren. Dieses Buch hingegen will einen bisher nicht gesehenen Überblick bieten, indem es miteinander verbundene Themenbereiche in einem Gesamtzusammenhang betrachtet. Es ist genau diese übergeordnete Ebene, die ob ihrer Komplexität meist ausgeklammert wird und doch immer eine Rolle spielt, selbst wenn es sich ausschließlich um einzelne natur-, sozial- oder wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse handeln sollte. Um dieser Rolle gerecht zu werden, ist es wichtig, zuerst dich zu erkennen und dein Handeln mit anderen Menschen zu verstehen, bevor du die Gesellschaft zu begreifen versuchst. Nichts in dieser Welt ist außerhalb dieser Kontexte für uns wahrnehmbar; wir haben kein anderes Tor zur Welt außer uns.
Dieses Buch will dein Werkzeug der Ermächtigung sein. Das Buch bleibt dabei weniger praktisch, als ich es gerne hätte - es kann dir eine Hand reichen, aber die Wirkung hängt letztlich von dir ab. Du bist hier mächtiger, als du vermuten magst. Dies wird keine Aufforderung werden, einem Weg zu folgen, sondern den deinen zu gehen. Wenn dir das Buch dabei hilft, unterstütze es, so wie du es unterstützen kannst. Die Inhalte sind dabei wichtiger, als das Buch selbst, und Reichweite ein Multiplikator von Ideen, darum zögere nicht, mit anderen zu teilen. Lass uns anfangen.
Teil I Selbstfindung
1 Der Affe in uns
1.1 Hunger
Der Mensch ist ein komplexes biologisches System. All unsere Kultur, unsere Bildung und unser Verhalten hat doch unsere Biologie als Grundlage. Unser stärker entwickeltes Gehirn mag uns von von den anderen Lebewesen unterscheiden und ist doch von gleicher, evolutionärer Herkunft, wie auch der Rest unseres Körpers. Die ausgeprägt lange Zeit des Heranwachsens, unsere Kindheit, erlaubt uns kulturelle, technische und wissenschaftliche Evolution an der reinen Biologie vorbei: durch Kommunikation, durch Lehren und Lernen, sowie durch Spielen und Forschen. So haben wir uns als moderne Menschen in vielen Bereichen emanzipiert von unserer biologischen Basis. Wir entwickeln uns als Gemeinschaft viel schneller voran, als unser Körper dies je könnte. Man überlege nur, wie stark sich das moderne Leben von dem vor Hundert Jahren unterscheidet, während unsere Körper doch nahezu die gleichen sind.
Was bleibt also von unserer biologischen Herkunft, was ist uns evolutionär bedingt angeboren? Natürlich unsere physischen Körper, die unser ganzes Umfeld definieren und als Schnittstelle zwischen uns und der restlichen Welt fungieren. Aber da ist noch mehr, etwas, das nicht definiert, wie wir aussehen, sondern wie wir uns verhalten. Vieles von unserem Verhalten ist nicht angeboren, sondern erlernt. Kurzfristig Erlerntes lässt sich auch schnell wieder vergessen, wendest du ein Verhalten aber die ganze Zeit über an, wird es deutlich schwieriger, dieses zu verlernen. Beispielsweise passieren viele unser körperlichen Bewegungen ganz unbewusst nebenbei und sind wie Gewohnheiten, etwas, was man gar nicht so leicht ablegen kann und nicht immer wahrnimmt. Nun überlege dir, du folgst einer Gewohnheit nicht dein Leben lang, sondern Millionen Jahre oder gar länger. Nicht als du selbst, sondern als Teil der Evolution der Menschheit. Diese Dinge sind so tief in dir, dass du gar nicht merkst, dass sie da sind, weil sie eben "immer" schon da waren: Nicht wie du dich durch die Sozialen Medien bewegst, aber wie du auf grelle Farben reagierst. Nicht wie wir Nahrung zubereiten, aber wie schmackhaft etwas auf uns wirkt. Nicht wie wir unsere Finanzen planen, aber was wir als Motivation empfinden. Worauf ich hier hinaus möchte, sind Gefühle, undefinierbare Empfindungen und Triebe. Alles, was häufig unterbewusst stattfindet, also oft gar nicht wahrgenommen wird, und dennoch unser Leben stark beeinflusst. Solche Funktionalitäten, die ehemals evolutionär entscheidend waren, können heute aber einschränkend wirken. Um zu verdeutlichen, was ich meine, ein weiteres Beispiel: Du hast Hunger. Sinnvoll, dass dein Körper es schafft, deinem Bewusstsein zu melden, dass er Energie braucht. Dazu kommt dann erlerntes Bewusstsein: Es ist gut, in regelmäßigen Abständen etwas zu essen. Aber worauf hast du Hunger? Auch hier kann uns, bei gut funktionierender Biologie, der Körper Hinweise geben, was gerade besonders gebraucht wird. Hast du Lust auf stärkende Hülsenfrüchte oder doch lieber auf einen frischen Apfel? Vielleicht werden gerade Eiweiße zum Muskelaufbau benötigt oder es besteht ein Vitaminbedarf. Gerade nicht? Kein Problem, denn was ist schon immer lecker? Nun, vielleicht Chips, Süßigkeiten, Zuckergetränke? Zucker, Fett und Salz sind einfache Beispiele evolutionärer Überbleibsel: Der Mensch hatte nie genug davon, um evolutionsbiologisch zu "erlernen", wann er1 davon zu viel hat. Und hier wird es für den modernen Menschen, der sich von all den niederen Instinkten losgesagt hat, interessant: Denn sicherlich weißt du, dass fettiges Essen eher ungesund ist und doch ist es lecker. Süßigkeiten sind schlecht für Zähne und Verdauung und dennoch essen wir diese liebend gern. Salz hat unser Körper im heutigen Durchschnitt mehr als genug und doch geht meist noch eine Prise extra. Natürlich braucht unser Körper diese Substanzen, aber eben in einem Maße, welches viel geringer ist, als wir diese meist zu uns nehmen. Sich bewusst gesund zu ernähren, heißt deshalb oft auch, aktiv gegen einen inneren Drang anzukämpfen. Und unser erlerntes Wissen gewinnt den Kampf gegen diesen archaischen Drang selbstverständlich nicht immer. Ist das also etwas, mit dem wir leben müssen? Ja und nein. Ja, weil dies Teil von dir, deinem Körper, deinem Empfinden ist. Du kannst hier Unerwünschtes verneinen, bekämpfst damit aber zeitgleich einen Teil deiner eigenen Identität - ein Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Dich und deine Identität anzunehmen, heißt aber nicht, dass du all deinen Trieben auch nachgeben musst. Nein, deine eigenen Empfindungen bewusst wahrzunehmen, schafft dir die Möglichkeit einer differenzierteren Entscheidung. Um damit zum Beispiel von eben zurückzukommen und eine Motivation zu geben, warum es im Alltag wichtig ist, bewusst mit den eigenen Trieben umzugehen: Es ist wichtig, sich gegen den „Lecker“-Drang zu wehren, selbst wenn du nicht vor hast, dich gesund ernähren zu wollen, denn: Es gibt andere Menschen, die bewusst genau diese archaische Mechanik ausnutzen, um minderwertige Nahrungsmittel teuer als lecker zu verkaufen. Zucker, Salz und Fett kratzen hier nur an der unteren Decke der Möglichkeiten, denn mit moderner Lebensmittelchemie ist so einiges mehr möglich, oft auf Kosten der Wertigkeit des Nahrungsmittels. Deshalb ist es sinnvoll, zu wissen, was in einem Produkt drin steckt, wie es produziert wurde und was das mit deinem Körper macht. Deshalb ist es sinnvoll den Lebensmittelmarkt zu regulieren, sodass nicht Müll als Nahrung verkauft werden darf. Und deshalb ist es sinnvoll, deine eigene, unterbewusste Versuchung zu zügeln, wenn etwas eben nur lecker, aber nicht mehr ist.
1.2 Angst
Dieses Kapitel wird etwas fordernder, denn die evolutionäre Prägung, über die ich aufklären will, ist weitaus weniger „lecker“ und deutlich komplizierter zu begreifen (siehe Kapitel 1.1). Unbewusst und stark lauert eine Kraft in uns, die uns Dinge tun lässt, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Oft verschwiegen und persönlich im Auftreten. Schwer zu kontrollieren und schnell im Wirken. Gern missbraucht als Instrument der Macht und doch überlebenswichtig für uns selbst. Angst ist unangenehm im Empfinden und doch jedem Menschen bekannt. Ursprünglich als Motivation, die eigenen Sinne in gefährlichen Situationen zu schärfen und im Zweifel dann hart zu kämpfen oder schnell wegzulaufen, wenn die Angst denn groß genug ist. So sorgt das Empfinden von Angst dafür, dass sich unsere Prioritäten verschieben: Waren eben noch die leckeren Beeren das Zentrum unserer Welt, so ist es nun der Bär, der uns lecker findet. Nun funktioniert die Angst bei jedem Menschen anders, eine gleiche Basis in anderer Ausprägung, oft auch ergänzt durch erlernte Inhalte: Wenn du in der Vergangenheit eine heiße Herdplatte berührt hast, wirst du Herdplatten mit einem anderen Respekt betrachten, als wenn du zwar weißt, heiße Herdplatten nicht zu berühren, aber noch nie Schmerzen durch eine Herdplatte erfahren hast. Dies kann sich bis ins Irrationale verschieben, sodass du Herdplatten selbst in kaltem Zustand ungern berührst. Angst beeinflusst nicht nur deine Sicht auf Dinge, sondern verschiebt auch dein Weltbild. Dein Gehirn sortiert die gesammelten Eindrücke nach Priorität: So hast du gelernt, dass Rot eine Warnfarbe ist, also fallt dir Rot eher auf, als vielleicht Grün, welches dafür entspannter anzusehen ist. Die Priorisierung erfolgt dabei zuerst nach Überlebenswichtigkeit, sprich, wenn du eine Bedrohung wahr-nimmst, ist diese für dich vorrangig, auch wenn vielleicht zeitgleich ein Beerenbusch auf dich wartet. Damit dies funktioniert, muss Angst als Emotion vergleichsweise stark sein und andere Empfindungen, wie Müdigkeit, Hunger oder Lust überwinden können. Sie ist evolutionär direkt mit Überleben verknüpft, denn falls dich ein Bär erwischt, sind all die Beerenbüsche egal, auch wenn die nahrhaftesten Beeren daran hängen. Was nun aber evolutionär sehr wichtig und hilfreich war, muss das heutzutage nicht mehr zwingend sein. So, wie wir gelernt haben, dass der Bär im Zoo keine Bedrohung für uns darstellt, so haben wir gelernt Flugzeugabstürze, Mieterhöhungen oder Börsencrashs zu fürchten. Die grundlegenden, funktionalen Muster sind durch ihre lange Wichtigkeit tief in uns verankert, auch wenn unsere moderne Welt nicht mehr viel mit unserer ursprünglichen Umgebung zu tun hat. Selbst wenn wir wissen, dass manche unserer Befürchtungen reichlich unbegründet sind, so können wir uns doch oft nicht gegen die Empfindung der Angst selbst wehren. Und ich rede hier noch nicht von Angststörungen, welche nochmals deutlich ausgeprägter sein können, sondern, dass selbst schon "kleine" Empfindungen der Angst ausreichen, um uns mit einer Furchtvision zu beschäftigen. Hast du beispielsweise Furcht vor dem Fliegen, so wird ein an sich entspannter Flug zur stressigen Angstpassage, nur, weil eine wenig begründete Furcht ihren Weg zu dir findet. Nun ist dieses Beispiel ein recht individuelles Problem, es betrifft dich entweder oder nicht, und selbst wenn, betrifft es eben hauptsächlich dich selbst mit nur wenigen Auswirkungen auf deine Mitmenschen. Das ist nicht immer so, hast du Furcht vor Wohlstandsverlust und wählst deswegen rechtsextreme Parteien, anstatt tatsächliche Probleme anzugehen (10), beeinflusst das die Politik eines ganzen Gesellschaft. Es geht hier nicht um inhaltliche Auseinandersetzungen mit dem Sachthema, sondern um die innere Empfindung, die damit einhergeht. Unwohlsein, Befürchtungen und letztlich Angst in unterschiedlichen Ausprägungen. Angst, die einen Weg an sachlicher Argumentation vorbei findet. Angst, die dich Dinge tun lässt, die du "normalerweise" nicht tun würdest, die nun aber gerade wichtig sind, eben weil Angst deine Welt neu priorisiert. Als Empfindung vorbei an deinem Verstand und dann von innen heraus doch deinen Verstand dominierend; erst einmal ist Überleben wichtig, alles andere kommt danach. Wenn du vor einem Feuer fliehst, mag Angst ihre Berechtigung haben, wenn du aber deinen geschützten Alltag bewältigst, wird sie zu einer schlechten Ratgeberin. So sehr sie deine Sinne schärft, vernebelt sie doch deinen Verstand. Wie willst du durchdachte Überlegungen anstellen, langfristig planen und verschiedene Gesichtspunkte recherchieren, wenn du Angst hast und dich fürchtest? Angst verlangt Taten, nicht Sinnesfragen, und das lässt sich ausnutzen (9).
Angst macht dich blind. Du reagierst auf Befürchtungen, denn du musst etwas gegen diese Angst machen; so sind wir gebaut (1.1). Und doch bist du blind, so klar, wie du auch die Furcht vor dir siehst, so wenig mehr siehst du noch. Lehrt dich jemand das Fürchten, so kontrolliert die Angst, was du siehst, dominiert, was dir wichtig ist, und du reagierst. Was einst wichtig war ist entrückt und wird durch ängstigende Prioritäten überstrahlt, Furcht ist ein Machtinstrument. Wie willst du dich frei bewegen, wenn du weißt, es könnten jederzeit für Fehltritte Schläge drohen? Wie willst du deinen Wahlzettel frei ausfüllen, wenn dein Arbeitsplatz durch andere bedroht ist? Wie willst du dich um deine Mitmenschen kümmern, wenn doch der Wohlstand deiner Familie gefährdet sein könnte? Wie willst du sachlich über ein Problem denken, wenn du doch innerlich aufgewühlt bist? Richtig, du kannst es nicht. Und das ist problematisch. Wenn dir morgen jemand weismachen würde, dass der Himmel einstürzt, würdest du übermorgen mit Helm herumlaufen (9.4). Es geht in Teil (I) des Buches noch nicht darum, gesellschaftliche Haltungen zu entwickeln, sondern um die Selbstfindung deiner Person. Wenn du tust, was du tust, aus innerer, entspannter Überzeugung, ist das etwas anderes, als wenn du dich gezwungen siehst, etwas zu tun. Und es geht hier nicht um einen tätlichen, äußeren Zwang, sondern um dein inneres Empfinden, auf welches sich der Zwang beruft. Es gibt Menschen, die nicht nur wissen, wie Angst wirkt, sondern diese bei anderen auch bewusst einzusetzen wissen. Im Privaten mag das einschränkend wirken, wirst du beispielsweise aus Furcht zum Abschluss einer überflüssigen Versicherung getrieben. Im Gesellschaftspolitischen wirkt Furcht jedoch zerstörend. Fürchtest du dich vor Wohlstandsverlust, wählst du vielleicht radikaler, als du es sonst tun würdest. Fürchtest du dich vor den Schergen eines Regimes, hältst du deine Füße vielleicht stiller, als du es sonst tun würdest. Und fürchtest du die moderne Welt, erscheint Faschismus dir als natürliche Entwicklung und „es war ja nicht alles schlecht“. So, wie dir Furcht die Sinne vernebelt, nimmt sie der Gesellschaft die Luft zum Atmen. Wie willst du auch auf andere achten, wenn du dich selbst retten musst? Demokratien leben von sachlichem Austausch und Diskurs, welcher alle, insbesondere auch Minderheiten miteinbezieht. Hochkochende Emotionen sind Teil davon, aber in einer emotionalen Dauererregung zu sein, hilft denen, die diese zu lenken wissen.
Wie kann man sich gegen Ausnutzung solcher selbstverfremdenden Mechanismen wehren? Dafür hilft es, sich an den Anfang dieses Kapitels zu erinnern. Diese archaischen Funktionen sind so tief in uns verwurzelt, dass wir sie gar nicht vermeiden können (zumal sie ja auch, zumindest zeitweise, ihre Berechtigung haben). Dieses Bewusstsein ist ein erster wichtiger Schritt, solche Funktionen unseres Gehirns, unseres Körpers, zu erkennen. Ja, wir haben diese Empfindungen, wir wissen woher sie kommen und was sie mit uns machen. Wenn wir das wissen, haben wir die Chance, diese Empfindungen direkt oder auch im Nachgang zu erkennen. Und zwar unabhängig äußerer Einflussnahme: Ob man sich für diese Gefühle schämen müsste oder nicht, spielt keine Rolle, da alles privat in deinem Kopf ist; es geht niemanden etwas an, solange du es nicht teilen möchtest. Hier geht es erst einmal um dich und die Möglichkeiten deiner Entfaltung weg von Fesseln durch Konventionen, Erwartungen anderer oder Auflagen an sich selbst. Erkennst du nun solche Empfindungen wieder, wie beispielsweise Angst, kannst du reagieren, die erkannte Furcht als archaisches Muster einordnen, innehalten und bewusst bewerten, wie relevant die Angst hier tatsächlich ist. Dieser Vorgang ist ein Lernprozess und braucht, wie alles andere, Übung. Du glaubst, es ist nicht möglich, die eigenen Empfindungen zu zähmen? Dazu ein Extrembeispiel in Angst: Man überlege sich, wie Freeclimber*innen wohl denken, wenn sie ohne jede Sicherung, tödlich hohe Wände erklettern. Hierzu ist in Perfektion eine unglaubliche Geistesbeherrschung nötig und möglich. Wo Ungeübte sich bis zum Todesfall panisch an die Wand klammern würden, sobald sie sich der Furcht bewusst werden, schaffen Freeclimber*innen es, ihre Angst zu erkennen und auf den inneren Stapel für „Eingegangen - Unwichtig“ zu legen. Nun ist nicht jede Person Freeclimber*in, wir tun uns schwerer oder leichter, unsere eigenen Empfindungen zu zähmen. Es geht nicht darum, sich der Furcht zu entledigen, es geht nur darum, sie richtig einzuordnen. Und wir können lernen, nicht nur uns selbst zu erkennen, sondern auch zu erkennen, wenn andere diese Schwächen ausnutzen wollen. Warum redet diese Person nur von Gefahr, Feinden und Ängsten? Was bleibt an Inhalt, wenn wir die Aussagen von den archaischen Angst-Triggern lösen? Es geht nicht darum, Furcht zu ignorieren, aber zu schauen, was bleibt eigentlich noch, außer der Angst? Ein Text mit vielen Ausrufezeichen mag als wichtig erscheinen und doch zählen nur die eigentlichen Worte zum Inhalt. Sich den eigenen Empfindungen zu stellen ist selten leicht und nicht immer erfolgreich, und doch lohnt sich der Versuch des Erlernens. Wenn es uns gelingt unsere archaischen Funktionsmuster zu regeln, ist dies ein wertvoller Schritt der Selbstermächtigung: Empfindungen nicht ignorieren, aber auch nicht einfach zulassen, sondern entscheiden, wann es sich lohnt. Selbstverwirklichung kostet Anstrengung, und so sehr wir doch evolutionär vorgeprägt sind, lohnt es sich, zu wissen dagegen zu kämpfen. Wenn du weißt, was Angst bedeutet, weißt du auch, wann du dich darauf verlassen kannst - und wann nicht.
1.3 Verständnis
Zum Abschluss des Überkapitels 1 komme ich noch zu einem weiteren Beispiel unseres "inneren Affen" im Sinne der evolutionär verwurzelten Verhaltensmuster. Unser Gehirn funktioniert, wie es funktioniert, nicht nur aufgrund komplexer Biologie, sondern auch aufgrund physikalisch-mathematischer Grundlagen. Wie viele Farben hat die Welt? Wie viele Regentropfen siehst du, wenn es regnet? Welche Geräusche hörst du gerade und warum weißt du, was diese Geräusche macht? Wir, mithilfe unseres Gehirns, müssen ziemlich gut darin sein, die Millionen Sinneseindrücke zu verarbeiten, die auf uns einprasseln. Nicht nur, dass wir unseren eigenen Körper "nebenbei" managen, sondern auch, dass wir uns in unserer Umwelt zurechtfinden, ja gar dominierend fortbewegen verglichen zu den anderen Lebewesen dieses Planeten. Wie funktioniert das? Wie wird aus all den Photonen, die in dein Auge treffen ein Bild, welches du verstehst? Wie wissen wir, welche Schallwellen belanglos sind und welche interessant? Letztere Frage ist fürs Erste einfacher zu beantworten: Jederzeit treffen Schallwellen auf dein Ohr. Es gibt Geräusche, die du kennst, die einfachstenfalls regelmäßig und monoton sind und rein gar nichts mit dir zu tun haben. Die ferne Autobahn brummt? Die Uhr tickt? Dein Gehirn hat gelernt, diese Töne einzuordnen. Es weiß bereits, dass es meist egal ist, ob diese Geräusche zu hören sind oder nicht, es besteht kein Drang etwas zu tun. Für andere bekannte Geräusche mag das nicht gelten, wenn ein Wecker klingelt oder die Klingel läutet, mag das zwar bekannt und gewohnt sein, aber es ist zugleich mit einer Aufgabe verbunden und bedeutet, je nach gewohnter Häufigkeit, zumindest einen Aufmerksamkeitswechsel oder sogar einen Adrenalinschub. Unser Gehirn hat gelernt, wenn es läutet, folgt darauf ein Zur-Tür-Gehen und zwischenmenschliche Interaktion. Wie ist das nun aber mit Geräuschen, die wir nicht kennen? Diese kann unser Gehirn noch nicht direkt zuordnen, vielleicht besteht eine Idee, was es sein könnte, aber insbesondere dann, wenn nicht, resultiert dies in Neugier oder Grusel. Befinden wir uns in bekannter, sicherer Umgebung, gar in vertrauter Gesellschaft, ist es meist Neugier: Was ist dieses Geräusch? Kenne ich noch nicht, woher kommt das, was macht es? Ganz anders in unbekannter Umgebung, wenn der Körper sowieso schon in Lauerstellung ist, denn hier könnten Gefahren drohen: Läufst du durch einen dunklen Wald und hörst ein Geräusch, wird dieses eher Unbehagen auslösen und als Gefahr wahrgenommen werden, auch wenn du vermutest, dass es wohl nur der Wind in den Blättern war. So oder so, werden unbekannte Geräusche erst einmal als Fremdkörper wahrgenommen, weil sie nicht zu der Welt deines Gehirns passen. Vielleicht gibt es nichts zu befürchten, aber im Zweifelsfall, wie bei der Angst auch (1.2), ist es sicherer fürs Erste eine Gefahr anzunehmen, auch wenn es tatsächlich unwichtig oder gar positiv ist. Nach den vorangegangenen Kapiteln kann hier bereits vermutet werden, dass es nicht immer sinnvoll ist, auf diese ersten, archaischen Empfindungen zu vertrauen. Neugierde ist wohl nicht verkehrt, aber in Alarmstellung zu gehen, nur weil dein Gehirn ein Geräusch nicht verstanden hat, wird heutzutage nur noch selten hilfreich sein.
Bleibt die Frage, wie sich unser Gehirn die Welt zusammenbaut aus all den Eindrücken und Erfahrungen, die wir erleben? Bleiben wir zuerst bei den ganz grundlegenden Funktionen, die so ähnlich auch bei anderen Lebewesen funktionieren: Es geht darum, wie unser Gehirn Wahrnehmungen sortiert: Tritt ein Sinneseindruck in unser System, wird dieser untersucht und dann in eine passende Kiste einsortiert und weitergeleitet. Dabei werden verschiedene Eindrücke zusammen in eine Kiste gesteckt, Auto-Sehen und Auto-Hören gehört zusammen. Je nach Wichtigkeit dieser Kiste, kommt diese dann früher, später oder auch gar nicht zu deinem Bewusstsein. Vielleicht sind rote Autos gerade besonders interessant für dich und diese Kiste wird extra vorgeschoben. Dieser gegenüber gibt es auch Kisten, die soweit hinten anstehen, dass du sie vielleicht Jahre nicht mehr gesehen hast: Die fehlenden Fußleisten sind dir beim Einzug aufgefallen, aber du hast dich daran gewöhnt und Kisten dieser Eindrücke sind so langweilig, dass sie direkt ins Archiv wandern ohne jemals dein Tageslicht zu sehen. Es ist nicht so, als würden deine Augen etwas nicht sehen, es ist vielmehr dein Gehirn, was etwas nicht mehr sieht. Dieser Mechanismus der Informationskomprimierung, kistenförmiger Einordnung und Priorisierung ist essentiell für die Funktionsweise und Effizienz unseres Gehirns und jeder anderen Informationsverarbeitung. Hier geht es nicht darum, diese Funktionsweise als "unobjektiv" zu bekämpfen um dann zu versuchen alles in einer "wahren Echtheit" wahrzunehmen - das ist uns nicht möglich, wir funktionieren nur über diese Vereinfachungen unserer Wahrnehmung. Stattdessen können wir aber versuchen, uns dieser Funktionsweise bewusst zu sein. Denn die letzte, bewusste Bewertung übernehmen immer noch wir selbst direkt, und wir trainieren mit diesen Bewertungen auch unser Gehirn und dessen "automatisierte" Einordnung. Denn auch, wenn die Kisten in unserem Kopf nicht die tatsächliche Welt in aller Genauigkeit enthalten, so definieren diese Kisten dennoch, wie die Welt für uns selbst aussieht. Haben wir eine Kiste für die Bosheit der Welt, sieht unsere Welt ungleich düsterer aus, als wenn wir diese nicht haben; und haben wir keine Kiste für die Ungerechtigkeiten dieser Welt, so ist unsere Welt ungleich naiver als die tatsächliche. Noch kritischer wird es, wenn wir auf ganz Unbekanntes treffen, was in unser globalisierten Gemeinschaft doch häufiger vorkommt, als das bisher im Laufe unserer evolutionären Geschichte der Fall war. Du siehst Personen fremder Kulturen auf deiner Straße, du hörst von Menschen anderer Geschlechter in deinen Medien, du bemerkst ungewohnt ungehörige Verhaltensänderungen deiner Gemeinschaft. Die Welt ist, wie sie ist - erst in deinem Kopf werden aus anderen Menschen Fremde, aus anderen Geschlechtern Neuheiten, bereits deine Unkenntnis lässt anderes Verhalten ungehörig wirken. Unbekanntes, Neues, Fremdes bedeutet für unser archaisches Inneres erst einmal Vorsicht und im Zweifel eher Gefahr und Kampf, wenn wir es nicht schaffen unsere eigene Unsicherheit zu überwinden (1.2). Sind wir unsicher, in welche Kiste etwas einzusortieren ist, landet es gerne einmal in der „Wichtig! Vielleicht gefährlich!“-Kiste, einfach weil wir noch keine bessere Kiste haben, in welche wir diese Eindrücke einsortieren könnten. Kennen wir uns aber selbst und wissen über diese Funktionen unseres Gehirnes Bescheid, so können wir uns verdeutlichen, dass diese Kisten unserer ängstlichen Vergangenheit nicht immer ernstzunehmen sind. Vielleicht ist es gefährlich, meist wissen wir aber nur bloß noch nichts damit anzufangen. Schaffen wir es, diese Kiste bewusst mit genau diesem Gedanken abzufangen, haben wir die Möglichkeit, auch bewusst zu entscheiden, wohin wir diese Kiste einsortieren. Öfter als häufig ist hier der Angst- und Alarmmodus das archaische Überbleibsel, welches wir eben nicht aktivieren wollen, da unser Gehirn und unsere Gesellschaft mittlerweile soviel mehr erlaubt. Doch wohin dann mit dieser schwierigen Kiste? Was du brauchst, ist ein neues Regal, wo diese und weitere Kisten platziert werden können. Ein solches zu bauen, ist ein interessanter Prozess: Du hast hier die Möglichkeit aktiv dein eigenes Gehirn mitzugestalten und dabei zu bestimmen, wie die Welt für dich aussieht. Hier ist genau der Platz für Neugier. Beschäftige dich mit der Fremdheit, versuche dir das Neue genau anzuschauen und analysiere, was das Ungewohnte so ungehörig werden lässt. Und nutze dabei die Hilfsmittel, die dir bekannt sind, während du dich wehrst gegen die Fallen deiner Vorverurteilung und frühzeitiger Schlussfolgerungen. Idealerweise besitzt dein Gehirn dann eine schöne, neue Kiste, in welche solch künftige Eindrücke einsortiert werden können - du siehst ein Stückchen mehr der Welt.
All diese unsere Kisten sind Vorurteile. Vorurteile, im Sinne des Wortes, beschreiben, wie unsere Eindordnung der Welt funktioniert. Wir haben Vorurteile, was ein Baum ist. Wir haben Vorurteile, was die Farbe „Rot“ ist. Nur so schaffen wir es, die Flut an Sinneseindrücken zu verarbeiten. Diese Vorurteile sind überlebenswichtig, wir brauchen sie um uns orientieren zu können; unsere persönliche Welt besteht aus Vorurteilen. Wenn wir also nicht ohne können, wieso ist der Begriff „Vorurteil“ dann so häufig so negativ belegt? Weil wir im klassischen Wortgebrauch dieses Wort meist im Sinne unzulässiger Vorurteile gebrauchen, also Vorverurteilungen, die falsch sind. Und das ergibt auch Sinn: Denn wenn wir unsere Welt schon aus Vorurteilen zusammenbauen müssen, dann doch bitte möglichst akkurat und genau, sodass sich Vorurteil und Realität möglichst wenig unterscheiden. Wir wollen schließlich richtig Vorverurteilen, wir wollen wissen was los ist und mit was zu rechnen ist. Wenn wir wissen, was los ist, können wir uns mit Leichtigkeit durch die Welt bewegen, weil unserer persönlicher Eindruck der Welt, gebaut in unserem Gehirn, mit der realen Welt übereinstimmt. Dass das nie zu Hundert Prozent klappen wird, sollte uns bewusst sein, aber dennoch sollten wir uns anstrengen, falsche Vorurteile, welche gern allzu häufig auf archaischen Funktionen der Angst und Gefahr basieren, aus dem Weg zu räumen. Wir können uns vornehmen, in diese Kisten, die uns unser Gehirn vorsetzt, genau hineinzuschauen und nicht immer alles für bare Münze zu nehmen, was auf der Kiste drauf steht. Bewusstes Hinterfragen der unterbewussten Einordnung lässt dich dein Selbst besser kennenlernen. Archaische Muster bewusst abzufangen, lässt dich selbst entscheiden, wie du deine Kisten bauen und beschreiben willst. Mit Zeit und Übung kannst du es sogar schaffen, bereits vorhandene Regale umzusortieren, alte Kisten neu zu beschriften und Einblicke in Muster deines Unterbewusstseins zu erhaschen, einfach indem du dir nicht nur die Gedanken, sondern auch die Kisten in denen diese ankommen, anschaust. Probiere es aus, Üben lohnt sich. Letztlich braucht so etwas Zeit, denn dein Gehirn ist immer noch Biologie, die eben vor allem erst einmal an Stabilität interessiert ist. Es bleibt ein ewiger Prozess, der aber über Zeit immer leichter fallen wird und dir neue Möglichkeiten eröffnet. Und wenn du die Kisten siehst, in denen die Kisten ankommen, höre nicht auf, dich und deine Welt zu hinterfragen.
2 Warum diese Welt deine ist
2.1 Deine Welt
Die Welt um dich herum ist etwas sehr Individuelles. Auch wenn unsere Umwelt dieselbe sein mag, ist meine Welt eine andere als die deine. Die Sicht, das Verständnis, das Bild der Welt ist von Person zu Person verschieden. Auch wenn wir als Menschen eine ähnliche Biologie teilen, in gemeinsamen Kulturen leben und stetig in kommunikativem Austausch sind, so sind wir nicht nur verschiedene Menschen, sondern wir sind auch ganz unterschiedlich aufgewachsen, leben unter anderen Bedingungen und haben individuelle Träume, Vorstellungen und Ängste. Für einen Menschen als komplexes Lebewesen reichen schon feine Unterschiede aus, um unter doch ähnlichen Voraussetzungen ein gänzlich anderes Leben entstehen zu lassen. Selbst wenn du in einem Dorf aufgewachsen wärest, durchschnittliche Familie, durchschnittliche Umgebung, und dort nicht nur deine Ausbildung, sondern auch den Rest deines Lebens verbracht hättest, so würdest du dennoch nicht auf die Idee kommen, dass deine Nachbarin dir gleicht, selbst wenn ihr Lebensweg ein ganz ähnlicher sein sollte. Vielleicht ist das Hobby deiner Nachbarin das Tunen von Autos, womit du selbst gar nichts anfangen kannst, während deine Passion das Einkochen der eigenen Gartenfrüchte ist. Wenn eine solche Individualität trotz nächster Nähe schon realistisch scheint, überlege, wie anders eine Person auf der anderen Seite der Erde wohl wäre. Sicher wird sie ebenfalls Essen zu schätzen wissen, sicher wird sie auch sozial kommunizieren und ähnliche Gefühle haben. Und dann wird doch alles ganz anders sein, als du es kennst und wahrnimmst - nicht umsonst reisen viele Menschen so gern, um eben etwas Neues zu sehen, auch wenn es dann oft doch wieder Essen, Sehenswürdigkeiten und Entspannung sind. So teilen wir uns eine Erde und sind doch alle eigene Persönlichkeiten. So wie alle Reifen über nahezu dieselben Straßen fahren mögen, so hinterlassen die Straßen doch unterschiedliche Eindrücke auf ganz verschiedenen Reifen verschiedenen Alters, anderen Luftdrucks und unter wechselnder Fahrweise. Während Reifen aber meist eine fest vorgegebene Funktion haben, Bremsleistung, Haltbarkeit und mehr, so haben Menschen keine festgelegte Funktion - je nach philosophischer Denkrichtung darf sogar debattiert werden, ob der Funktionsbegriff als Lebenssinn überhaupt Sinn ergibt. Fest steht, so unterschiedlich, wie unsere Leben sind, so unterschiedlich sind auch unsere Vorstellungen eines erstrebenswerten Lebens. Während für deine Einkoch-Träume prächtige Obstbäume und -büsche wichtig sind, sind dies für deine Nachbarin vielleicht schöne Straßen für ihr getuntes Auto. Während ihr beim Autofahren jedes kleinste Schlagloch auffällt, siehst du vielleicht die schöne Obstwiese am Straßenrand. Deine Welt sieht anders aus als die ihre. Deine Welt ist voll verschiedener Pflanzen, gebunden an Regen- und Frostphasen und gefüllt mit Rezepten zur Haltbarkeitmachung. Die Welt deiner Nachbarin hingegen besteht aus ästhetischen Autoformen und performanter Technik, aus trockenen, nassen und gestreuten Straßen, aus Maschinenklängen, welche ihr je etwas anderes erzählen und doch für dich nicht mehr als lärmender Brei zu sein scheinen. Ihre Welt sieht anders aus als deine. Ihr mögt euch Umwelt, Erziehung und Kultur teilen und doch ist eure Weltsicht so verschieden, wie euer Weltbild. Und das ist auch gut so, allein schon, weil das Leben sonst sehr eintönig wäre. Und doch birgt diese Individualität der Weltsicht auch die Gefahr, dass wir vergessen, dass unsere Weltsichten persönlich sind. Dann wird die Weltsicht zur Welt und alles um uns herum muss genau in diese passen - was trügerisch ist, da die reale Welt natürlich nicht identisch zu der in unserem Kopf ist. Und so ärgern wir uns, weil wir nicht verstehen, wieso etwas ist, was eigentlich nicht sein sollte - statt zu begreifen, dass wir etwas nicht verstehen.
Wir verarbeiten die reale Welt durch einen Prozess, an dessen Ende letztlich unser Bild der Welt steht. Unsere Wahrnehmung lässt unsere Sinne sehen, hören, spüren, aber eben auch nur das, was vor unsere Augen, durch unsere Ohren und in unsere Hände kommt. Diese bereits ganz individuellen Wahrnehmungen werden dann von uns verarbeitet. Diese ungeheure Datenmenge wird verkleinert, sortiert und bewertet, bevor davon überhaupt etwas in unserem Bewusstsein ankommt (1.3). Wie unser Körper, insbesondere unser Gehirn, diese Verarbeitung durchführt, ist geprägt durch die chaotische Biologie des Gehirns: So ähnlich unsere Gehirne von außen aussehen, so ist jedes Detail ganz individuell strukturiert. Je nachdem, womit wir uns beschäftigen oder beschäftigt haben, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind und erzogen wurden, je nachdem, wie unser soziales Umfeld aussieht, haben wir eine andere Verarbeitung derselben Wahrnehmung. Was dann unbewusst in persönlichen Häppchen zerkleinert, vorgekaut und ausgewählt bei uns ankommt, kann dann noch einmal bewusst verarbeitet werden, sofern es uns auffällt. Das passiert beispielsweise dann, wenn du dich fragst, was denn diese Geräusche sind, wenn du fremde Musik hörst, die nicht in dein bisheriges Schema passt. Diese neue Musik kommt noch nicht in deinem Weltbild vor, hier hast du die Gelegenheit dieses zu erweitern und selbst wenn diese Musik unter „Lärm“ abgespeichert wird, ist sie nun nicht mehr neu für dich. Und so geht es uns tagtäglich mit neuen Eindrücken, Interaktionen und Erfahrungen, welche von uns aufgenommen werden und in unserem Weltbild verarbeitet werden. Rückwirkend prägt dieses Weltbild dann aber auch unser Einwirken auf die tatsächliche Welt, wodurch es zu Wechselwirkungen zwischen Einordnungen und Einwirkungen kommt2 (7.2).
Wenn die reale Welt sich nun nicht ändern würde, so wäre es denkbar, mit unglaublich viel Mühe ein perfektes Weltbild aufzubauen. Ein Weltbild, welches exakt der echten Welt entspricht, da du zu jedem Moment alle Orte besucht hast, alle Erfahrungen gemacht hast und soviel Zeit zum Nachdenken hattest, dass alles auch perfekt verarbeitet und verknüpft werden konnte. Es sollte klar sein, dass das natürlich nicht möglich ist - was aber zugleich auch bedeutet, dass damit eines jeden Weltbild fehlerhaft sein muss. Dein Bild der Welt, dein Eindruck der Realität, deine Wahrnehmung deiner Umwelt ist fehlerhaft. Nun magst du entgegnen, dass dein Weltbild dennoch ziemlich genau ist, trotz vielleicht auch kleinere Unwahrheiten, und dir meist gute Dienste leistet. Mag sein, mag nicht sein, es spielt für die Argumentation hier keine Rolle. Was hingegen eine Rolle spielt, ist dein Wunsch nach einem besseren, weil genaueren Weltbild. Wir streben nach Sinn in einer vermeintlich chaotischen Welt und je besser wir diese verstehen, desto entspannter können wir uns in dieser bewegen. Es geht bei diesem Streben nicht darum, ein Weltbild über Bord zu werfen - das wäre auch gefährlich - sondern um Verfeinerung, hier und da an den Details zu arbeiten und regelmäßig Einordnungen zu aktualisieren. Wie macht man das? Wo starten, wenn du doch nur die Welt so kennst, wie sie dir dein Weltbild ist? Wie die reale Welt sehen, wenn uns doch nur unser eigens verarbeitetes Bild dieser zur Verfügung steht? Der Weg klingt einfach und ist doch so schwer: Hinterfrage dich selbst. Allzu oft beginnen wir mit dem Hinterfragen an der Außenwelt, ohne zu bemerken, dass diese Welt nur unsere Sicht dieser ist. Sprich, dass Problem kann auch nur sein, dass deine persönliche Sonnenbrille die Welt dunkel aussehen lässt. Nicht falsch verstehen, viele unserer Probleme bestehen tatsächlich auch in der realen Außenwelt und müssen dort gelöst werden, da hilft auch das Aufklaren deiner persönlichen Weltsicht nichts. Um diese Probleme möglichst gut zu verstehen, ist aber eine möglichst detailgetreue Weltsicht hilfreich, für welche es wiederum nötig ist, das eigene Weltbild regelmäßig aufzubrechen und zu erweitern, was kein leichter Prozess ist, da es Energie und Aufwand braucht. Wie so vieles, lässt sich dies aber erlernen und über die Zeit erweitern. Routine wird es jedoch nie werden, solange du aktiv an deinem Weltbild arbeitest; du gewöhnst dich nur eher daran, auch mal feste Vorstellungen über Board zu werfen, weil du weißt, wie viel interessanter eine schärfere Sicht auf die Welt ist. Daher: Bleibe neugierig dich selbst zu hinterfragen.
2.2 Sich selbst finden
Der gesamte Prozess des Hinterfragens, das Erlernen von diesem und das Finden eines besseren Weltbildes ist von Mensch zu Mensch verschieden, und so gerne ich den einen perfekten Weg zeigen würde, wäre das nicht mehr als anmaßende Raterei - dein Weg ist so individuell wie deine Person, niemand kann diesen für dich beschreiten. Personen aus deinem Umfeld, die dich kennen, können dir Ideen liefern, worüber es sich lohnen könnte, einmal anders nachzudenken. Dir selbst kann auffallen, was dir missfällt und bei der Suche des „Warum“ kannst dich fragen, ob es vielleicht zuerst auch deine eigene Unkenntnis ist. Die archaische Seite der Empfindungen und Informationsverarbeitung sind oftmals Punkte, wo sich ein Hinterfragen lohnt (1.3). Ein Hinterfragen bedeutet zudem nicht ein zwingendes Aufgeben der eigenen Position, sondern kann genauso zur Verfeinerung dieser genutzt werden. In diesem Kapitel gehen wir auf Effekte übergeordneter Mechanismen ein, also was auf höherer, teils sogar bewusster Ebene unseres Gehirns geschieht. Das Ganze hat aufgrund unserer Individualität eher Ideencharakter, meinend Ideen dazu, wo es sich lohnen kann, hinterfragend anzusetzen.
Ein einfaches Beispiel sind Emotionen: Sind wir verliebt, so haben wir eine rosarote Brille auf, sind wir traurig, sieht die Welt grau aus, ebenso beeinflussen uns Freude, Angst, Zufriedenheit, Unsicherheit und viele mehr. Diese Emotionen haben wir und wir können diese auch nur bedingt lenken. Was wir jedoch können, ist das Hinterfragen unserer momentanen Sicht: Wenn wir traurig sind, sieht unabhängig von dem Auslöser oder Ursprung unserer Traurigkeit, die ganze Welt schlechter aus, als das meiste davon wirklich ist. Kennen wir uns und unsere Emotionen, können wir wissen, wozu wir bei welcher Emotion neigen und entsprechend geschickte Gegenfragen an unser eigenes Weltbild stellen, welche anderen Gründe es wohl haben könnte, dass uns die Welt gerade so erscheint. Schwieriger wird es bei weniger grundlegenden Gefühlen, wie Eitelkeit, Verlustfurcht, oder Geltungsdrang. Eitelkeit, also das Empfinden etwas besseres zu sein, ist häufig nicht unwichtig für unser persönliches Selbstwertgefühl, versperrt uns aber auch die Sicht auf reale Zusammenhänge: Wenn wir bereits der Überzeugung sind, wir seien besser, so werden auch unsere Taten, Einstellungen und Schlussfolgerungen besser sein oder wenn nicht immer das, dann zumindest gerechtfertigt sein, da sonst das eitle Weltbild nicht mehr schlüssig ist. Hiervon kann man sich lösen, wenn man sich bewusst macht, was einem selbst eigentlich wichtig ist, was eher nebenwichtige Fassade ist und was einem selbst das Leben tatsächlich bereichert. Wenn du findest, was für dich selbst von Bedeutung ist, und das für dich auch unabhängig anderer Meinungen und Haltungen annehmen kannst, wird Eitelkeit auf einmal überflüssig. Wenn du weißt, was du an Wert für dich gefunden hast, braucht es keine künstliche Emporhebung mehr, da du bereits eine natürliche Wertanlage entdeckt hast.
Bist du dir bewusst, welche Werte du besitzt, bist du geneigt, diese auch zu verteidigen. Gegen reale Gefahren und gegen Gefahren, die du dir in deinem Bild der Welt gebaut hast. Nur weil etwas noch nicht ist, heißt das schließlich nicht, dass etwas nicht sein könnte. Du befürchtest einen Verlust, ohne zu wissen, ob dieser tatsächlich stattfinden wird. Das Problem ist nun, dass diese Verlustfurcht als Angst in deinem Kopf Realität bekommt und damit deine Weltsicht und dein Weltbild verändert. Angst selbst haben wir schon behandelt (1.2), hier kommt aber deine bewusste Kreativität dazu: Was, wenn du befürchtest, jemand wolle dir dein Leben nehmen, auch wenn das in der realen Welt völlig aus der Luft gegriffen wäre? Nehmen wir an du seiest eitel und nehmest dich selbst etwas zu wichtig: Natürlich hättest du dann auch Feinde, und weil du dich so gut und wertvoll für dein Thema einsetzest, wollten sie dich aus dem Weg schaffen, ja müssten gar, wenn sie eine Chance gegen dich haben wollten. Was ich hier deutlich machen möchte, ist, dass wir uns unser Weltbild schon passend zurechtzubasteln wissen, ohne dass uns das meist wirklich bewusst wird. Dieser Prozess ist besonders gefährlich bei starken negativen Gefühlen, wie beispielsweise Verlustangst. In dem eben genannten Beispiel mag das dazu führen, dass du dich in deiner Wohnung verbarrikadierst und damit dein Leben und Lebensgefühl drastisch einschränkst. In anderen Fällen führt das dazu, dass du, statt eine produktive Lösung zu suchen, reaktionär handelst: Du wünscht dir Zeiten zurück, wo du diese Furcht noch nicht hattest, ohne dir Raum zu geben, darüber nachdenken, warum diese Furcht überhaupt in deinem Weltbild ist und wie sich diese einordnen lässt. Dein Angstzustand raubt dir hier dir Möglichkeit, auf übergeordneter Ebene darüber nachzudenken. Und so fällst du beispielsweise Faschismen in die Arme, die deine Ängste füttern, deine Eitelkeiten beflügeln und statt Verständnis einfache Worthülsen liefern, die wichtig klingen ohne deinem Sinn gerecht zu werden (9.3). Denn wozu die Welt verbessern, wenn Weltbilder doch so viel leichter abzuändern sind?
Geltungsdrang ist ein weiteres Gefühl, welches, obwohl dem eigenen Selbst bewusst, oft negative Konsequenzen für dieses hat. Bei ganz unterschiedlichen Ursprüngen, wie fehlender Wertschätzung, Selbstwertüberschätzung oder auch gelangweilter Unzufriedenheit, ist das Ziel dasselbe: Gehört werden ohne Rücksicht auf Inhalt, Umfeld und Art der Reaktion, solange es eine Reaktion gibt. Die Suche nach Rückmeldung ist an sich nicht verkehrt, niemand möchte Zeit und Energie in etwas stecken, ohne etwas zu erreichen. Reaktionen dienen uns als Spiegel unserer Leistungen und sind deshalb essentiell für uns, sei es im sozialen Umfeld oder bei technischen Arbeiten. Dabei ist wichtig, Quantität von Qualität zu unterscheiden, wenige tiefe Rückmeldungen können wertvoller sein, als viele oberflächliche. Doch nun rate, welche der beiden Reaktionsarten schneller bei dir ankommt: Das Einprasseln vieler, für sich wenig bedeutsamer Reaktionen oder die paar wenigen, besonders intensiven Reaktionen? Die Suchtmechanik der Sozialen Medien basiert beispielsweise auf „Like"-Zählern, welche oberflächlicher und quantitativer nicht sein könnten. Das funktioniert, weil es schwieriger ist und länger dauert, die inhaltliche Tiefe einer Rückmeldung zu bewerten, als eine wachsende Zahl zu sehen. Wir sind dazu verdammt, dass uns zuerst eine Reaktion wichtig ist und danach erst der Inhalt - was aber nicht heißt, dass wir uns nicht bewusst dagegen wehren können: Nehmen wir uns die Zeit, uns ein wenig länger mit einer Reaktion zu befassen, können wir einem etwaigen tieferen Wert gerechter werden. Und das ist wichtig, weil wir unser Weltbild entsprechend gestalten und so mehr Wert aus den uns zur Verfügung stehenden Reaktionen ziehen können. Geltungsdrang als solcher ist sozusagen die Antithese zu diesem Verhalten, auch wenn wir tausende laute Reaktionen erhalten, so bleibt deren Gesamtwert doch Null, wenn uns deren Inhalt egal ist. Was im Moment unseres schnelllebigen Lebens schwierig klingen mag, lohnt sich zu trainieren. Hinterfrage die Leitzahlen deines Weltbildes indem du dir anschaust, was dahinter steht.
2.3 Sich selbst suchen
Neben aktiven Faktoren, die deine Weltsicht versperren, gibt es auch schwieriger zu fassende, passive Faktoren, wie Bequemlichkeit, Ignoranz oder Ablenkung. Bequemlichkeit geht mit Routine Hand in Hand. Wir gewöhnen uns gern an Dinge, die uns angenehm sind und mit Gewohnheit kommt Routine, welche es uns abnimmt, weiter über etwas nachdenken zu müssen. Routinen sind wie Energiesparmodi unseres Gehirns, sie geben Kapazitäten frei, damit wir uns mit anderen Dingen beschäftigen können. Nehmen wir als Beispiel das Stricken, als Anfänger*in fällt es doch schwer, sich die Schritte einzuprägen, in welchen Nadel und Faden zur Textilverarbeitung kombiniert werden. Du bist langsam, das Muster ungleichmäßig und es ist anstrengend - ganz im Gegenteil zu Profis, die so nebenbei ganze Strickwerke produzieren können, während sie weiterhin Kapazitäten, beispielsweise für eine Unterhaltung, frei haben. Der Nachteil solcher Routinen ist, dass es schwer fällt, sich davon zu lösen. Zum einen sind sie per Definition unbewusst, uns muss also erst einmal auffallen, dass es sich um eine Routine handelt. Zum anderen kostet es einige Energie, eine Routine zu ändern, wir geben nicht nur den Energiesparmodus auf, sondern müssen uns auch ein neues Verhalten erarbeiten. Aber gerade deshalb lohnt es sich, die eigene Bequemlichkeit zu hinterfragen, denn so können wir bewusst entscheiden, wie zeitgemäß, sinnvoll oder verbesserungswürdig ein Verhalten, eine Einstellung oder Denkweise ist - und diese dann entweder mit gutem Gewissen ändern oder beibehalten.
Ein natürlicher Feind ist hier die Ignoranz, allzu oft durch die eigene Bequemlichkeit gestützt, fällt es doch so viel leichter, etwas so zu lassen, auch wenn es vielleicht veränderungswürdig wäre. Im Gegensatz zu Routinen kann Ignoranz sowohl unbewusst, als auch bewusst eingesetzt werden. Unbewusste Ignoranz ist für uns selbst so gut wie nicht greifbar, da uns maximal eine Lücke in unserem Weltbild auffallen kann, etwas Unsichtbares lässt sich schwer greifen. Wir sind hier also auf den Einfluss unserer Außenwelt angewiesen und sollten diesen auch ernst nehmen, sobald uns unsere unbewusste Ignoranz auffällt. Bewusste Ignoranz oder auch geflissentliche Ignoranz lässt sich hingegen auch selbst erkennen, nicht ganz so leicht wie Eitelkeit, Angst oder andere aktive Gefühle, aber eben doch, sofern wir darauf achten. Wenn wir uns beispielsweise sagen, etwas sei nur nicht so wichtig, etwas täten wir sicher später, etwas sei einfach nicht das unsere. All das sind Formen bewusster Ignoranz, welche wir lernen können zu erkennen, um unsere Ignoranzen dann jeweils auf Sinnhaftigkeit zu hinterfragen. Hierzu muss der innere „Schweinehund“ bekämpft werden, der uns vor Unbequemlichkeiten bewahren möchte - wozu solltest du auch Energie in Erfahrungen stecken, die du sowieso in deinem Weltbild irrelevant glaubst? So wie aber unser Weltbild fehlerhaft und unvollständig sein kann, trifft dies auch auf unsere Einschätzung der Relevanz zu. Es gibt sehr viele Dinge, die für dich nicht interessant sind, unter diesen befinden sich jedoch auch Dinge, deren Wichtigkeit du bisher nur noch nicht erkannt hast. Um dem „Schweinehund“ etwas entgegenzubieten, sieh es als Schatzsuche auf dem verstaubten Dachboden deines Weltbildes: Vieles liegt dort nicht ohne Grund, aber ab und an sind versteckte Schätze dabei, sodass es sich doch lohnt, nicht einfach den ganzen Dachboden zu ignorieren. Ob die Schätze dann auch als solche erkannt werden, hängt auch von der eigenen Erfahrung ab, aber diese sammelt sich mit Übung. Also gerne selbst hinterfragen, ob die eigene Ignoranzen so gerechtfertigt sind oder eben nicht. Dabei wichtig bleibt aber, die eigene Ignoranz nicht ignorieren: Denn sonst erblindet man in diesem Bereichen und muss das Sehen selbst erst aufwändig wieder erlernen.
Die kleine Schwester der Ignoranz ist die Ablenkung, es gibt so viel Interessantes in der Welt und immer etwas anderes, wohin man sich wenden kann. Das ist auch nicht verkehrt, solange du die Kontrolle darüber behältst, sprich nicht durch jede Wahrnehmung abgelenkt wirst: Nur weil du vieles siehst, bedeutet dies nicht, dass du auch viel siehst. Der Unterschied liegt hier wieder zwischen der Menge an Wahrnehmungen und der inhaltlichen Tiefe der Wahrnehmungen. Ein Prozess, der sich zu optimieren lohnt, da wir so oder so nicht alles in uns und um uns herum je werden wahrnehmen können. Passiert diese eigene Ablenkung geflissentlich, also bewusst, auch wenn so getan wird, als wäre sie unbewusst, kommt es zu einer toxischen Symbiose mit der eigenen Ignoranz: Statt ehrlich und damit angreifbar den Kopf in den Sand zu stecken, wird hier bewusst weg geschaut. Energie, die eigentlich auf Problemlösung verwand werden könnte, wird künstlich auf ein Pseudoproblem gelenkt, nur um das eigentliche Problem nicht sehen zu müssen. Sozusagen eine eigene Gehirnwäsche, im negativen Sinne, an sich selbst, die eigene Urteilskraft und Weltsicht trübend. Im extremen Fall führt so etwas zur Verdrängung, der kompletten Verschiebung einer Wahrnehmung ins Unbewusste. Das ist nicht immer negativ, sofern ein vollständiges Vergessen unmöglich ist aufgrund der Intensität der Erfahrung und diese zu negativ beeinflussend ist, als dass sie jemals hilfreich sein wird. Diese Verdrängungen können aber noch immer Einfluss auf unser Weltbild haben, was sich für uns selbst als mysteriöse Fremdwirkung manifestiert, wenn wir diese nicht zuordnen können. Fällt dir so etwas auf, wo du das Gefühl hast, dass es lohnenswert sein könnte, diesen Einfluss anzugehen, versuche dir Hilfe deines Vertrauens zu suchen. Alleine ein solches "Ausbuddeln" anzugehen, ist nicht nur schwierig, sondern kann sogar gefährlich sein, denn so tief vergraben hat dein Gehirn dies nicht umsonst.
Zum Abschluss noch einmal der Hinweis, dies sind alles nur Ideen, Beispiele, wo es sich lohnen kann anzusetzen. Generell lassen sich beim Prozess hin zu einem genaueren Weltbild ganz allgemein Methoden der Analytik anwenden: Dir fällt etwas auf? Schau es dir an. Nicht verstreichen lassen, sondern hinterfragen. Und dort nicht aufhören, hinterfrage dein Hinterfragen. Wo hat dein Weltbild Lücken, was sind deine emotionalen Brennpunkte und warum? Schau dir nicht nur an, was du siehst, sondern wie du siehst: Was kannst du überhaupt sehen und wie genau kannst du schauen? Arbeit an dir selbst ist zugleich Arbeit an deiner Welt. Denn du prägst dein Weltbild durch deine Einstellung, deine Erfahrungen und dein Verhalten. Und dieses prägt wiederum die Welt um dich herum (II).
3 Einfache Verkomplizierungen
3.1 Ganz einfach
Nach den vorangegangenen Kapiteln darf vermutet werden, dass wohl nur sehr weniges ganz einfach ist. Hier gehen wir nun aber einen Schritt weg von dem Selbst, den evolutionär geprägten Mechanismen und der persönlichen Weltsicht. Denn eine Ebene höher wartet die Kommunikation, welche nicht nur als Nutzeroberfläche zu uns selbst funktioniert, sondern der Außenwelt auch als Zugang zu uns dient. Wichtig ist hier zu unterscheiden zwischen tatsächlicher und kommunizierter Information: Kommunikation bedeutet das Nutzen von Zeichen oder Sprache, also das Weitergeben bereits vorverarbeiteter Information; während unsere Augen real vorhandenes Licht nahezu direkt wahrnehmen, wäre eine textliche Beschreibung unserer Sicht deutlich indirekter. Diese Ebene zwischen faktischer Information und kommunizierter Information erlaubt noch ganz andere Funktionsweisen unser Selbst zu prägen, welche wir in diesem Überkapitel (3) behandeln werden.
Kommunikation beeinflusst uns. Wir sind darauf angewiesen, zu verstehen, wie die Welt gerade funktioniert und was unser Umfeld macht; die Grundlage, auf der unsere Kultur baut, ist die Kommunikation. Diese erlaubt uns nicht nur rasanten Informationsaustausch