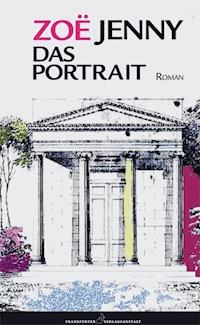Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Leiter des Astronomischen Instituts von Wien dreht sich Martys Leben um die Beschäftigung mit den Weiten des Universums. Die wirkliche Welt schiebt er darüber gerne beiseite, dass seine Frau Marlene bereits insgeheim von einem Leben auf Bali träumt und seine Tochter an ihrem Frausein zweifelt, bleibt ihm verborgen. Nach einem Kongress trifft er auf den Psychoanalytiker Steindorfer, der ihn fragt, warum der Mensch eigentlich mehr über ferne Planeten wisse als über das eigene Bewusstsein, und gibt ihm daraufhin sein Manuskript. Nachdem Marlene nach Bali und Stella an den Atlantik gereist sind, findet Marty im Zimmer seiner Tochter eine Männerperücke. Wie viel weiß er wirklich über seine Frau und seine Tochter? Er erinnert sich an Steindorfer und beginnt, dessen Manuskript zu lesen, das ihn völlig verstört. Er ahnt nun, dass er über seine Sterne sein Leben vergessen hat. In einem letzten Aufbäumen beschließt er, nach Bali zu fliegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Als Leiter des Astronomischen Instituts von Wien dreht sich Martys Leben um die Beschäftigung mit den Weiten des Universums. Die wirkliche Welt, die meist unangenehme Dinge bereithält, schiebt er darüber gerne beiseite. Dass seine Frau Marlene bereits insgeheim von einem Leben auf Bali träumt und seine Tochter an ihrem Frausein zweifelt, bleibt ihm verborgen. Auf dem Rückflug von einem Kongress trifft er auf den Psychoanalytiker Steindorfer, der ihn fragt, warum der Mensch eigentlich mehr über ferne Planeten wisse als über das eigene Bewusstsein, und ihm daraufhin sein Manuskript zu dem Thema überlässt. Nachdem Marlene nach Bali und Stella zur französischen Atlantikküste abgereist sind, findet Marty im Zimmer seiner Tochter eine Männerperücke. Auf der Suche nach einer Antwort, wie viel er wirklich über seine Frau und seine Tochter weiß, erinnert er sich an Steindorfer, offenbar im Besitz der intimsten Gedanken der Menschen, und beginnt, dessen Manuskript zu lesen, das ihn völlig verstört. Nach vergeblichen Versuchen, Steindorfer zu kontaktieren, bleibt er mit seinen Fragen allein, ahnt aber, dass er über seine Sterne sein Leben vergessen hat. In einem letzten Aufbäumen beschließt er, nach Bali zu fliegen.
In Zoë Jennys neuem Roman herrscht eine beunruhigende Atmosphäre. Die fernen Sternenwelten stehen so ganz im Gegensatz zu den sich immer schneller entwickelnden fatalen Ereignissen auf der Erde. Jenny erzählt von gut ausgebildeten, aber arbeitslosen Akademikern, von ewigen Altnazis, von künstlicher Intelligenz, von Diversität und Geschlechtsumwandlung, von persönlicher Freiheit und fehlenden Alternativen, von Klimakrise und Lichtverschmutzung und bewegt sich damit an den Rändern der erkennbaren Wirklichkeit inmitten des Sternenchaos.
Für Naomi
Das Fenster war aus den Angeln gehoben. Eigentlich wollte Marty es nur aus der Kippfunktion lösen, um es ganz zu öffnen. Aber es klemmte. Er rüttelte daran, wobei sich die alten, bereits lockeren Scharniere mitsamt dem Fensterflügel aus dem Rahmen lösten.
Marty verlor das Gleichgewicht; nahm einen Satz rückwärts, um wieder festen Boden unter den Füßen zu bekommen, fluchend, weil er sich dabei am Kaffeetisch anstieß. Taumelnd klammerte er sich an dem Fensterflügel fest. Nicht loslassen, dachte er, nur nicht loslassen. Um ein Haar wäre er damit krachend zu Boden gestürzt.
»Leiter des Astronomischen Instituts Opfer der Schwerkraft.«
Vorsichtig lehnte er den Fensterflügel an die Wand. Er würde den Hausmeister benachrichtigen müssen.
Dort wo sonst das Fenster war, klaffte jetzt ein Loch. Das späte Nachmittagslicht fiel in einem Photonenstrom auf seinen Schreibtisch und verdunkelte den Computerbildschirm. Statt auf das Dokument blickte er ins Schwarze.
»Murphy’s Law«, murmelte er und sah auf die Uhr. Am liebsten wäre er nach Hause gegangen. Doch seine Anwesenheit wurde beim jährlichen Sommerfest des Instituts erwartet. Marlene und Stella müssten schon unterwegs sein.
Auf seinem Schreibtisch lag das Anmeldeformular für den Kongress. Den ganzen Tag hatte er es herausgeschoben, Theresa damit zu konfrontieren. Kurz entschlossen nahm er das Formular und ging durch den dunklen Korridor zum Vestibül.
Vor drei Jahren, als er zum ersten Mal die repräsentative Eingangshalle des Instituts betrat und diese Treppe hinaufging, war er von der Gravität der Marmorsäulen, die von der Galerie bis zur Decke reichten, beeindruckt gewesen. Es war, als ginge er in diesem prächtigen Gebäude automatisch aufrechter, mit erhobenem Kopf und gestreckter Wirbelsäule. Inzwischen nahm Marty zwei Stufen auf einmal und bemerkte an dem Gebäude höchstens noch die Dimensionen, die weiten Wege, die zu vielen Stufen und die Hitze, die sich im Sommer durch das Oberlicht und die großen Fenster in den Räumen staute.
Theresas Büro befand sich neben der Bibliothek in einem Zimmer der ehemaligen Direktorenwohnung. Sie war eben erst in das Büro eingezogen. Beim Eingang standen noch nicht ausgeräumte Kisten mit Büchern und Dokumentenordnern. Sie saß mit dem Rücken zum Fenster an ihrem Computer. An der Wand neben ihrem Schreibtisch hingen Zettel, Einladungen und eine impressionistische Ansichtskarte von Monet. Er kannte das Bild von einer Ausstellung, zu der Marlene ihn mitgenommen hatte. Eine rote Sonne im Nebel, deren Licht auf der Wasseroberfläche reflektiert. Wenn er die Augen zusammenkniff, schien sich das Wasser zu bewegen.
Theresa bemerkte ihn nicht. Versunken blickte sie auf ihren Bildschirm: die Ansicht des Sternenembryos HBC 722 im Nordamerikanebel. Auf HBC 722 war er besonders stolz – war es doch sein Team, das den seltenen Ausbruch dieses Sterns erstmals beobachten konnte. Sogenannte FU-Orionis-Ausbrüche, gigantische Masseströme, die sich bei der Geburt eines Sterns entwickeln, und Materiestürze, die lawinenartig auf den jungen Himmelskörper einbrechen. Die spektakulären Bilder von HBC 722, eintausendfünfhundert Lichtjahre von der Erde entfernt, hatten es sogar in die Tageszeitungen geschafft.
Marty räusperte sich und trat ins Zimmer.
Theresa schob ihren Sessel zurück und drehte sich ihm zu.
»Sie arbeiten so viel, dass Sie gar keine Zeit haben, Ihr Büro einzuräumen?«, sagte Marty mit Blick auf die Kisten.
Theresa lachte verlegen und wollte schon aufstehen, aber Marty machte ihr mit einer Handbewegung ein Zeichen, sitzen zu bleiben.
»Ich habe über die Beiträge des Instituts bei unserem Wiener Kongress nachgedacht. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie bei diesem Anlass einen Vortrag über unser Projekt halten.« Er deutete auf den Bildschirm.
»Aber natürlich«, sagte Theresa ohne zu zögern. Marty kam einen Schritt näher, senkte den Kopf und blickte auf das Formular in seiner Hand.
»Da gibt es nur ein Problem. Chile hat mich kontaktiert, sie haben unvorhergesehene Wartungsarbeiten, Ihre Beobachtungszeit in La Silla musste verschoben werden und fällt jetzt genau auf das Datum unseres Kongresses.«
Theresa sank unvermittelt in den Sessel zurück. Den Antrag auf Beobachtungszeit von der ESO hatte sie kurz vor ihrer Festanstellung bestätigt bekommen. Über ein Jahr musste sie auf die Zusage warten. Marty hatte ihr damals versprochen, ihr eigenes Forschungsprojekt über die Untersuchung eines Planetenembryos zu Ende führen zu können. Doch nach einer kurzen Pause richtete Theresa sich wieder auf.
»Ich kann eine der Studentinnen nach Chile schicken. Amy, sie kann die Beobachtungen für mich machen und mir die Daten bringen.«
Erleichtert ging er zurück in sein Büro. Auf Theresa war Verlass. Es war kein Fehler gewesen, ihr den Posten anzubieten. Sie hatte stets das große Ganze im Blick, eine unverzichtbare Fähigkeit in ihrer Position. Natürlich wusste sie um ihr Glück. Denn längst waren die Zeiten vorbei, wo jeder Physiker nach seiner Promotion eine Festanstellung bekam. Ein regelrechter Kampf um die Jobs war entbrannt.
Er kam am Sekretariat vorbei und an der Hauptkuppel, in dem sich der Refraktor befand, ein vor der Jahrhundertwende errichtetes Linsenfernrohr, das heute eine der Hauptattraktionen für die Besucher war. Immerhin gehörte es seinerzeit zu den größten der Welt. Ja, in diesem Institut zu arbeiten war eine Ehre, aber Theresa würde, wie alle anderen hier auch, den Rest ihres beruflichen Daseins in ihrem Büro verbringen und wenn überhaupt, nur noch durch das Teleskop des Instituts den Himmel betrachten.
Marty blickte auf die Uhr. Marlene und Stella müssten schon von zu Hause weggefahren sein. Als er in sein Büro zurückging, kamen ihm zwei Männer vom Catering mit Getränkekisten entgegen. Ein Student, der für den Aufbau der Cocktailbar zuständig war, erklärte ihnen den Weg über die Treppe auf die Westterrasse, wo sie den Grill und das Buffet aufstellen konnten. Einmal im Jahr kamen die Mitarbeiter mit ihren Ehepartnern und Kindern zum Sommerfest; ein Anlass, den Marty eigentlich gerne ausgelassen hätte. Aber für die Mitarbeiter war das Sommerfest eine Möglichkeit, einmal in ungezwungener Atmosphäre zusammenzukommen – seine Anwesenheit wurde erwartet.
In seinem Schrank hingen immer ein paar frische Hemden bereit, falls er im Anschluss an die Arbeit zu einer Veranstaltung oder einem Abendessen gehen musste. Er nahm das erste Hemd, das ihm in die Hand kam, ein blaues mit kurzen Ärmeln. Sein Büro war geräumig, mit einer Sitzgruppe, wo er Gäste empfangen konnte. Auf dem Schreibtisch ein Foto von Stella und Marlene in die Kamera lachend, im Hintergrund der Krater des Vesuvs.
Während er das Hemd zuknöpfte, stand er vor der Vitrine mit der Sammlung diverser Meteoriten und Fossilien. Seine letzte Anschaffung war ein Ammonit aus der Sahara, aufgeschnitten und poliert auf einem Sockel. Marty betrachtete das offengelegte Kammersystem. Vor hundert Millionen Jahren lebte in der äußeren Kammer dieses Fossils ein Kopffüßer mit einem schlagenden Kiemenherzen, der im Meer herumschwamm, und nun lagen die Überreste hier präpariert in seiner Vitrine, neben Meteoriten und Mondgestein. Die Nautilusspirale war eines seiner schönsten Exemplare, aber mehr noch faszinierten ihn die Meteoriten mit ihren kreisrunden Strukturen von kondensiertem Urstaub, deren Form durch den Sturz durch die Atmosphäre und je nach Aufschlagswinkel in die Erde bestimmt war. An einigen konnte man die Flugorientierung erkennen, dort, wo der Wind die Kanten abgerundet und die Oberfläche abgeflacht hatte. Fließlinien, Vertiefungen, Schmelzspuren, die durch die Hitze beim Eintritt in die Erdatmosphäre entstanden und aussahen wie Fingerabdrücke in Knetmasse. Marty nahm einen Eisenmeteorit aus der Vitrine und wog sein Gewicht in der Hand. Ein verglühter Rest Urmaterie. Das abgesprengte Bruchstück eines Asteroiden, der Milliarden Jahre seiner Bahn folgte, bis er kollidierte, um dann sekundenschnell durch die Atmosphäre auf die Erde zu stürzen. Was er in der Hand hielt, war so alt wie das Sonnensystem selbst. Er hatte sich über die Jahrzehnte eine ausgewählte Sammlung fossiler Schätze und Himmelskörper angelegt und er betrachtete sie eingehend mit heimlicher Freude, wenn er allein war und ihn niemand störte.
Jähes Kinderlachen und laute Stimmen ließen Marty aufhorchen; da er kein Fenster mehr hatte, hörte er schon von Weitem die ersten Gäste durch den Park kommen, als würden sie quer durch sein Büro marschieren. Schnell legte er den Eisenmeteorit in die Vitrine zurück und schloss sie ab.
Er zupfte sein Hemd zurecht und ging zur Westterrasse. Es roch nach Grill. Marty war flau im Magen, er merkte erst jetzt, wie hungrig er war. Zu Mittag hatte er im Institut vor dem Computer ein Sandwich gegessen und ansonsten den ganzen Tag nur Kaffee getrunken. Einige Studenten waren an der Cocktailbar zugange. Er hatte ihnen die Erlaubnis gegeben, eine eigene Bar aufzustellen. Die Klagen einiger älterer Mitarbeiter, die sich darüber aufregten, weil das Sommerfest ihrer Ansicht nach in erster Linie für sie da war und keine Studentenveranstaltung, überhörte er, erstaunt über die Kleinlichkeit, die auch Menschen zu eigen war, die sich beruflich mit den Weiten des Universums beschäftigten.
Die Julisonne hatte das Mauerwerk erhitzt, es war warm auf der Terrasse, nur eine leichte Brise wehte von den Bäumen des Parks her. Ein Student half den kleineren Kindern auf einen Schemel, damit sie durch das eigens für sie aufgestellte Teleskop die Venus beobachten konnten. Vierzig Millionen Kilometer entfernt und dennoch bei Taghimmel sogar mit bloßem Auge erkennbar.
»Man kann ja nicht früh genug beginnen, den Himmel zu betrachten«, sagte Steve mit Blick auf seinen Sohn, der mit beiden Händen das Okular umklammerte und durch die Linse spähte.
Steve war gut gelaunt. Erst am Tag zuvor war er vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana zurückgekehrt, wo er den Start eines Weltraumteleskops mit der russischen Sojus-Rakete beobachtete. Steve hatte dafür die Flugsoftware mitentwickelt. Ein prestigeträchtiges Projekt für das Institut. Solche Launch Events waren für jeden Mitarbeiter ein Highlight und gleichzeitig eine Erleichterung. Ein Start konnte auch schiefgehen, die Trägerrakete explodieren und die Arbeit von Jahrzehnten mit einem Schlag vernichten. Steve gab ihm ein Glas in die Hand, um anzustoßen. »Hoffen wir, dass unser Teleskop in den nächsten dreieinhalb Jahren einen erdähnlichen Planeten findet.«
»Mit Aliens«, sagte sein Sohn.
»Moleküle würden uns schon genügen.«
In diesem Moment betrat Marlene die Terrasse. Hinter ihr Stella. Stella trug enge Hosen und ein schwarzes T-Shirt, irgendwie anders als sonst, burschikos. Hatte sie nicht letztes Jahr zum Sommerfest noch ein hübsches Kleid getragen? In den letzten Monaten war Stella in die Höhe geschossen, ein letzter intensiver Wachstumsschub, der sie dünn, hüft- und brustlos machte, was vielleicht aber auch daran lag, dass sie sich seit einiger Zeit nur noch vegan ernährte. Ein wiederkehrender Gegenstand von Streitigkeiten, da Marlene sich weigerte, auf diese pubertäre Laune ihrer Tochter einzugehen und entsprechend zu kochen. Seither war der Esstisch zur Kampfzone geworden. Marty hielt sich da wohlweislich raus, still hoffend, Stellas vegane Phase würde bald vorbeigehen. Während er seinen Arm um ihre Schulter legte und sie Steve vorstellte, spürte er, wie sie sich unter seiner Berührung versteifte und zurückwich, als wäre ihr die Nähe unangenehm.
Steve fragte sie nach ihren Zukunftsplänen.
Stella zuckte mit den Schultern.
»Ich weiß, ich werde nicht Physik studieren.«
»Das hat dir dein Vater wohl gründlich ausgetrieben.«
»Ich wusste in dem Alter auch noch nicht, was ich machen sollte«, warf Marlene ein, wie um ihre Tochter zu schützen, »aber heute sollte man ja schon mit fünf Jahren wissen, was man später werden will.«
»Man nennt das Frühförderung«, sagte Steve lachend und blickte auf seinen Sohn.
»Die heutigen Kinder sind Omnivore, Allesfresser. Sie spielen gleichzeitig mit dem iPad, Kieselsteinen, Handy, Lego und sprechenden Büchern. Bald wird es nicht mehr die Frage sein, ob sie Italienisch oder Französisch können, sondern ob sie Programmiersprachen wie Python beherrschen. Gerade habe ich Maurus für seinen ersten Robotikkurs angemeldet.«
»Einen Robotikkurs habe ich auch gemacht«, warf Stella ein. »Langweilig.«
Marty erinnerte sich daran. Er hatte die Rechnung für den Kurs bezahlt. Wie auch für den Klavierunterricht, den Gitarrenkurs und den Theater-Workshop, von dem Stella weinend nach Hause gekommen war, weil sie nicht die gewünschte Rolle erhalten hatte.
»Von mir aus könnten in den Geschäften nur noch Roboter arbeiten, die immer hilfreich und freundlich sind.« Stella schoss ihre Bemerkung wie einen Pfeil in die Runde.
Marlene nickte. »Eigentlich ist mir ein Roboter auch lieber als schlecht gelauntes Personal.«
»Es wird früher oder später so kommen, ob man diese Entwicklung nun begrüßt oder nicht. Wenn man sich vor Augen führt, wie wichtig die Robotik allein in der Raumfahrt ist, man denke nur an die Mars-Rover!« Steve hatte ein kleines Spielzeugmodell des Mars-Rovers in seinem Büro, an dem er sich freute wie ein Kind. Marty wünschte, etwas von Steves Begeisterung würde auf Stella überspringen, auf sie einwirken, einen Keim der Neugierde in ihr wecken, aber sie schaute wie abwesend auf ihr Handy. Nicht ohne Wehmut dachte er daran, wie er mit ihr in vergangenen Sommern die Leoniden beobachtet hatte und wie vergnügt sie gewesen war, wenn eine Lichtspur den Nachthimmel durchkreuzte. Inzwischen interessierte sie sich ausschließlich für das, was sich in ihrer unmittelbaren Nähe abspielte.
»Wir bauen immer mehr Beziehungen zu seelenlosen Wesen auf. Es gibt ja mittlerweile Leute, die ihrem Rasenmäher einen Namen geben«, warf Marlene ein.
»Das kann ich bestätigen. Maurus’ Roboterhund heißt Bello, und er ist mir ehrlich gesagt lieber als ein echter Hund, bedenkt man die Arbeit und den ganzen Dreck, den so ein Tier macht.«
Stella war ans Buffet gegangen, und Marty sah, wie ihr ein Student hinter dem Grill Würstchen anbot und Stella das Gesicht verzog und etwas von Massentierhaltung murmelte.
Die Terrasse war inzwischen voll. Theresa war zu ihnen gestoßen und wollte von Steve alles über den Start des Teleskops wissen. Auch Thomas, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, hörte zu. Er war erst seit ein paar Wochen im Institut, organisierte die Führungen und hielt Vorträge über Lichtverschmutzung; Vorträge, die zu Martys Erstaunen immer ausverkauft waren und viele junge Menschen ins Institut lockten. »Unser Kämpfer für die Dunkelheit«, so stellte er Thomas Marlene vor. Thomas verpasste keine Gelegenheit, um über sein Buchprojekt zu reden, über das Ende der Dunkelheit und die verheerenden Folgen für Natur und Forschung. »Es sollte ein Menschenrecht sein, den Nachthimmel mit seinen Sternen zu sehen.« Marlene zuckte mit den Achseln und bekam diesen rastlosen Blick, der bedeutet, sie wolle gehen.
Über den Kiesweg gingen sie zu dritt zum Ausgang. Die Luft war schwer vom süßlichen Duft der Akazien. Stella redete leise auf Marlene ein, die verständnisvoll nickte, wie beiläufig mit der Hand eine der weißen Rispenblüten berührte, die sich unter ihrem Gewicht zu Boden neigten. Marty ging ein paar Meter hinter ihnen. Und wie er Mutter und Tochter so zusammen sah, eine Einheit, die sich umkreiste wie eine Art Doppelsternsystem, gebunden an Anziehungskräfte, von denen er ausgeschlossen war, kam es ihm vor, als ob sie ein Geheimnis teilten, von dem er nichts wissen sollte.
Eigentlich hatte er geplant, mit den beiden essen zu gehen, gemeinsam als Familie, doch Stella lehnte ab. Sie wollte sich mit Freundinnen treffen. Zum Abschied winkte Stella mit der Hand. Sie konnten gerade noch zusehen, wie sie an der Straßenecke abbog und aus ihrem Blickfeld verschwand.
»Wir können dankbar sein, dass Stella überhaupt mitgekommen ist. Warum sollte auch eine Siebzehnjährige den Freitagabend mit ihren Eltern verbringen.«
Der Tesla in Deep Blue metallic, den er erst vor wenigen Wochen geleast hatte, roch nach Ledersitzen. Der Tesla war Marlenes Idee gewesen. Er wäre noch lange den Volvo gefahren, doch Marlene hielt den alten Wagen nicht mehr für angemessen. Er wäre jetzt lieber gleich nach Hause gefahren, aber Marlene wollte in ihr Lieblingslokal in die Innere Stadt. Hastig tippte sie etwas in ihr iPhone.
Auf der Höhe der Universität wurde der Abendverkehr sofort dichter und ein paar Meter weiter kamen sie zum Stehen. Nichts bewegte sich mehr, obwohl die Ampeln weiter vorne auf Grün standen. Marty öffnete das Fenster und streckte den Kopf hinaus. In der Ferne hörte man Polizeisirenen, die schnell näher kamen.
»Wahrscheinlich eine Demonstration.«
Marlene stöhnte auf.