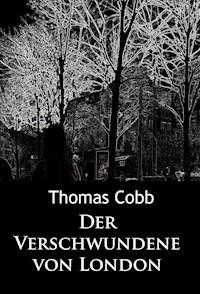
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie war von Kopf bis zu Fuß in Schwarz gekleidet und außergewöhnlich groß, um mehrere Zoll höher als der Mann, welcher zuerst vorübergegangen. Mit langen, schwebenden Schritten wandelte sie einher; ihr Gesicht war durch einen dichten, dunklen Schleier vollkommen verhüllt, während die große, weiße Hand unbehandschuht zur Seite niederhing. Starr vor sich hinblickend, folgte diese unheimliche Erscheinung des Mannes Fußstapfen, als wären beide losgelöste Schatten eines mitternächtigen Geisterzuges ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1
Der Verschwundene von London
Thomas Cobb
idb
ISBN 9783961505210
1. Kapitel.
Was Joseph Bodger sah.
Ein rauher Märzwind strich über den Forst von Rookfield. Die Sonne war etwa seit einer Stunde untergegangen, als Joseph Bodger am Rande des nachtstillen Waldpfades auftauchte. Obwohl schlank von Gestalt und kaum mehr als 26 Jahre zählend, hatte er ein verwelktes, alt aussehendes Gesicht, mit kleinen, schmalen Augen, welche die natürliche Neigung verrieten, in schräger Linie über die lange, spitzige Nase hinwegzuschauen. Ein verblichenes, blaues Tuch war in losem Knoten um den dünnen Hals geschlungen, und wenige Schillinge hätten genügt, ihm den Anzug abzukaufen, der nachlässig auf seinem abgemagerten Leibe hing.
Als er die Grenze des Waldes erreicht hatte, verließ er den ausgetretenen Weg, kreuzte ein Stück freier Wiese, setzte sich am Rande des Grabens nieder und tastete nach seiner Pfeife. Nachdem er diese gestopft und angezündet, streckte er sich ins Gras, zog die Beine herauf und entschlummerte friedlich wie ein neugeborenes Kind.
Mehrere Stunden lag er in tiefem Schlafe. Sein erster Gedanke nach dem Erwachen galt der mittlerweile ins feuchte Gras gefallenen Pfeife – er hob sie auf, zündete sie frisch an, schüttelte sich gleich einem nassen Hunde, und zur Straße zurückschlendernd, verfolgte er sie bis zum Ende des Waldes, den Hügel hinan, auf dessen Höhe das Dorf Rookfield malerisch hingebettet lag.
Der Himmel war trübe, mit Wolken umzogen; die kleinen Häuser und Kaufläden lagen in tiefer Dunkelheit, die wenigen Straßenlaternen brannten spärlich und düster. Joseph beschleunigte seine Schritte, ließ den Kreuzungspunkt von vier zusammenlaufenden Straßen, welcher das Herz des Dorfes bildete, hinter sich und erreichte bald eine zur Rechten gelegene Mauer.
Hier führte ein Gitterthor nach dem westlichen Eingange der Kirche von Rookfield, einem massiven Steinbau, dessen östlicher Flügel kürzlich neu hergestellt worden war, während der schlanke Turm aus dem Mittelalter stammte und weder zu dem ehrwürdigen Hauptschiff, noch zu dem modernen Chor paßte. Vermutlich enthielt derselbe auch eine Uhr – die herrschende Dunkelheit gestattete keine nähere Unterscheidung – denn als Joseph durch das Gitterthor den die Kirche umgebenden Friedhof betreten hatte, hörte er zwei aufeinanderfolgende Schläge.
Welche halbe Stunde kündigten sie an? Es konnte halb zwölf, halb eins, auch halb zwei sein; darüber Gewißheit zu erlangen, war unmöglich, bevor er nicht die Stunde schlagen hörte.
Grabsteine umringten ihn – gebrochene Säulen, ein paar stattliche Denkmäler, eiserne und hölzerne Kreuze, Gräber, die wie kleine wohlgepflegte Gärtchen prangten, andere in Wildheit verkommend, Ruhestätten mit einem schmucklosen Stein und dann wieder Hügel, auf denen nur Gras wucherte. In geringer Entfernung von dem mittleren Kirchhofwege stand ein hohler Eibenbaum von ungewöhnlichem Umfange; dicht verwachsene Gebüsche umrankten den Stamm, so daß Baum und Busch eine natürliche Wand gegen die Straße bildeten. Joseph ließ sich den Vorteil dieser Deckung nicht entgehen.
»Oho!« flüsterte er »das sieht nach einem frischen Grabe aus!«
Die Turmuhr schlug dreiviertel.
Dem sich aufmerksam umschauenden Manne fiel der Glanz weißer Seidenbänder in die Augen, daneben Kreuze, aus Blumen geformt, Gewinde mannigfacher Art, zudem unterschied er deutlich den fauligen Geruch verwelkter Veilchen und Maiblumen.
Er trat näher, sein Fuß stieß gegen einige starke, verstaubte Bretter, die von Kränzen bedeckt, über ein noch offen stehendes Gruftgewölbe gelegt waren.
Die Turmuhr verkündete Mitternacht. Hastig verließ Joseph den Kirchhof, schlug den Weg zur Rechten ein, ging an einigen Kaufläden und Landhäusern vorbei und blieb endlich vor einem Gitter, dem letzten in der Dorfstraße, stehen.
Vorsichtig, jedes Geräusch beim Aufklinken des Tores vermeidend, öffnete er und flüchtete mit raschem Sprunge in das nächste, stark verwachsene Gebüsch; dort kauerte er auf dem nassen Boden nieder, zog die Stiefel aus und kroch leise längs der Hecke des Gartens hin, bis er das große, im regelrechten Vierecke gebaute Haus erreichte.
Sein ohnehin blasses Antlitz hatte jede Farbe verloren; dicke Schweißtropfen hingen ihm an der Stirne, mehr noch aus Furcht vor Hunden als vor Menschen. An die Büsche gedrückt, in Angst erschauernd, schlich er vorwärts dem Hause zu; erst als er sich diesem gegenüber befand, wagte er sich ins Freie, um die Hinterfenster zu untersuchen. Ein Messer durch einen der Fensterrahmen keilen, den Riegel ausheben, hineinspringen, die steingepflasterte Vorratskammer durchschreiten und deren Innentür mit einer kurzen Brechstange öffnen war das Werk weniger Minuten; es blieb ihm nur übrig, leise zum Speisezimmer zu schleichen, dessen Tür aufzuschließen und einzutreten.
Dort angelangt gebrauchte Joseph zuerst die Vorsicht, den Riegel von innen vorzuschieben und gleichzeitig ein Fenster zu öffnen, um sich für den Fall unwillkommener Überraschung die Mittel zur Flucht zu sichern. So geräuschlos wie möglich brannte er ein Streichhölzchen an, entzündete die Lampe, die auf dem Tische vor ihm stand, und steckte so viel von dem dort aufgestellten, mit dem Löwenwappen verzierten Silbergeräte zu sich, als der Leinensack, den er zu diesem Zwecke unter seiner Weste verborgen trug, zu fassen im stande war.
Als die Uhr auf dem Kaminsimse von Oberst Askews Landhaus die erste Stunde nach Mitternacht schlug, dünkte es Joseph hohe Zeit, den Rückzug anzutreten, da noch ein weiter Weg vor ihm lag. Er schnürte den Sack fest zu, warf ihn über die Achsel, blies die Lampe aus, schwang sich auf die Brüstung des Fensters und sprang leicht und geschickt in ein unter demselben befindliches Blumenbeet.
Der Horizont hatte sich aufgehellt, blauer Aether schimmerte zwischen den weißen Lämmerwölkchen hindurch, und während Joseph im Gebüsche die Stiefel anzog, verfluchte er zwar leise, doch recht herzhaft den Mond, der goldig über seinem Haupte glänzte.
In gebückter Stellung, gedeckt durch das Gesträuch, faßte er den Sack und wollte eben nach dem Gitterthor zurück, als er Fußtritte vernahm und besorgt stille stand.
Die Ruhe der Natur, die leichten, segelnden Wolken schienen die tiefe Stille um ihn und neben ihm noch fühlbarer zu machen; nur die Schatten des wandernden Gewölkes glitten geisterhaft über den mondbeleuchteten Kiesweg. Als die Schritte näher kamen, kroch Joseph bis an die Gartenmauer, zog die Tuchmütze tief über sein kurz geschnittenes Haar und lugte vorsichtig hinüber ins Freie.
Der Schatten einer Gestalt schwankte über die Straße, verlängerte sich zu riesenhafter Größe und erwies sich als Vorläufer eines mittelgroßen, stark gebauten Mannes, welcher, rasch vorübergehend, die Richtung nach dem Kirchhofe einschlug. Sein Bart ragte aus dem aufgeschlagenen Rockkragen hervor, die Augen waren zu Boden gesenkt. Joseph hielt den Atem an, bis der nächtliche Wanderer außer Sehweite war.
Nun galt es, keine Zeit mehr zu verlieren; er drückte den Sack fest an sich und wollte endlich seinen Schlupfwinkel verlassen, als der Schall erneuter Fußtritte an sein lauschendes Ohr schlug.
»Merkwürdige Stunde für Spaziergänger – ganz merkwürdig gewählte Zeit!« brummte er vor sich hin. Nochmals mußte Joseph den Schutz der hohen Lorbeerstauden suchen, wobei er nur ab und zu einen Blick über die Gartenmauer zu werfen wagte. »Der Henker soll mich holen, wenn es diesmal nicht ein Weib ist!« stammelte er im nächsten Augenblicke.
Sie war von Kopf bis zu Fuß in Schwarz gekleidet und außergewöhnlich groß, um mehrere Zoll höher als der Mann, welcher zuerst vorübergegangen. Mit langen, schwebenden Schritten wandelte sie einher; ihr Gesicht war durch einen dichten, dunklen Schleier vollkommen verhüllt, während die große, weiße Hand unbehandschuht zur Seite niederhing. Starr vor sich hinblickend, folgte diese unheimliche Erscheinung des Mannes Fußstapfen, als wären beide losgelöste Schatten eines mitternächtigen Geisterzuges.
Josephs Hände zitterten derart, daß der Inhalt seines Sackes zu klirren begann; er legte ihn auf den Boden und wartete, bis auch die Frau den Gesichtskreis von Oberst Askews Haus verlassen hatte; dann schlich er, ohne noch eine Minute zu verlieren, in entgegengesetzter Richtung davon.
Zur Linken war die Straße häuserfrei, doch wenige Meter entfernt zur Rechten zitterte ein trübes Licht zwischen den blätterlosen Zweigen einer Reihe von Lindenbäumen hindurch. Hinter diesen Linden und einem Garten von beträchtlicher Ausdehnung stand das unter dem Namen ›Waldaussicht‹ bekannte Landhaus.
Von hier aus lief eine Hecke längs der Straße weiter, bis jenseits derselben in geringer Entfernung ein zweites Haus, ›das Krähennest‹ auftauchte. Es war das letzte im Dorfe, und als Joseph auch dieses im Rücken hatte, setzte er seinen Weg mit erleichtertem Herzen rüstig fort.
2. Kapitel. Was Joseph Bodger las.
Die Weststraße Londons grenzt zwar an einen wohlhabenden Stadtteil, gehört aber selbst keineswegs zu dieser vornehmen Nachbarschaft. Während die Kirchenglocken zum Früh-Gottesdienst rufen, zieht die Musikbande der Heilsarmee mit klingendem Spiele vorüber; verwahrlost aussehende Kinder tragen Milchkrüge über die Gassen und nur wenige Läden sind geöffnet.
Aus dem schmalen, dunklen Hauseingang einer der zahllosen Mietskasernen, kam an diesem Morgen, wohl frühzeitig durch das Glockengeläute geweckt, Joseph Bodger zum Vorschein, und schlug den Weg nach der unweit der Straßenecke gelegenen Barbierstube ein. Der untere Teil der Ladenfenster war weiß übertüncht, um den unbefugten Einblick in das Innere zu verhindern, an der Tür hing ein Schild mit folgender Inschrift:
Vertrau' dein Haar Jones' Sorgfalt an Denn besser kann's kein andrer Mann!
Dieser vertrauenerweckenden Einladung folgend, trat Joseph ein, setzte sich auf einen leeren Stuhl, legte den Kopf zurück, und sein sachliches Kinn wurde alsbald mit warmem Seifenschaume bearbeitet.
»Gut' Morgen, Joseph!« sagte Herr Jones, dem sein eigenes glänzendschwarzes Haar und der gekräuselte Bart als bestes Aushängeschild dienten. »Ein rechter Stoppelbart«, fuhr er geringschätzig fort, während er das Messer, vor Beginn der Arbeit, in gefährlicher Nähe von Josephs Nase abzog. »Um Sie, mein Freund, zu rasieren, bedarf es einer kräftigen Hand. Nun, wie ist's jetzt?« schloß er nach vollendetem Geschäfte, sich vertraulich vornüber lehnend, – »hab' ich's recht gemacht?«
Joseph stand, äußerlich ein verwandelter Mann, vom Sessel auf. So nützlich wird ein Penny selten angewendet – er gab sogar noch einen zweiten aus, kaufte sich die Sonntag-Morgenzeitung und schlenderte mit dieser in der Tasche nach dem Hyde-Park. Dort streckte er sich in der Nähe des Marmorbogens ins Gras und begann den Polizeibericht zu lesen. Kaum hatte er das Blatt geöffnet, so war auch seine ganze Aufmerksamkeit durch folgenden Artikel gefesselt:
Ein spurlos verschwundener Dichter.
»Herr Derwent, der wohlbekannte Verfasser zahlreicher, reizender Dichtungen und volkstümlicher Erzählungen für die Kinderwelt, ist kürzlich unter höchst geheimnisvollen Umständen aus seinem Hause verschwunden. Des Dichters Gattin, an der er mit inniger, ja leidenschaftlicher Liebe hing, war nach langer, schmerzhafter Krankheit gestorben und wurde am 4. dieses Monats, Dienstag Nachmittag, zu ihrer letzten Ruhestätte gebracht.
Herr Derwent, der mit seiner einzigen Tochter den herben Verlust beweinte, folgte dem Sarge nach dem Gottesacker, sah die teuere Leiche in die Gruft senken und kehrte hierauf nach seinem Heim zurück, dem am Rande des freundlichen Dorfes Rookfield gelegenen, von ihm selbst ›das Krähennest‹ benannten Landhause.
Wiewohl schwer gebeugt und in traurigster Gemütsstimmung, ob des erlittenen Schicksalsschlages, schien Herr Derwent sowohl geistig als körperlich vollkommen gesund. Nachdem er gespeist und mit seiner Tochter den Abend verbracht hatte, wobei nichts in seinem Benehmen den leisesten Verdacht irgend einer geheimen Absicht aufkommen ließ, zog er sich zur Nachtruhe in sein eigenes Zimmer zurück.
Mittwoch morgens fand eine Dienerin die Tür der Eingangshalle unverriegelt, ein Umstand, der keinerlei Befremden hervorrief, da Herr Derwent vor dem Frühstück häufig spazieren zu gehen pflegte.
Die Frühstücksstunde kam, doch nicht der Hausherr. Sein Bett war unberührt, und er ist seither nicht wieder gesehen worden. Der hochgeschätzte Schriftsteller, der nicht nur von allen geliebt wurde, die ihn kannten, sondern auch wegen seiner gemütvollen, geistreichen Werke, die Gunst des großen Publikums im hohen Maße genoß, blieb für die Seinen und die um ihn trauernden Freunde spurlos verschwunden.
Das sonst so stille, friedliche Dorf war überdies während der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in welcher der unglückliche Dichter einem dunkeln Schicksal zum Opfer fiel, der Schauplatz einer zweiten Missethat. In dem von Oberst Askew bewohnten Herrenhause, das einige hundert Meter vom Krähenneste entfernt liegt, wurde zur selben Zeit ein Einbruchsdiebstahl verübt und eine beträchtliche Menge Silbergeräte entwendet.
Von dem Wunsche beseelt, unseren Lesern die genauesten Einzelheiten des ebenso traurigen als geheimnisvollen Vorganges zu bieten, sandten wir gestern einen besonderen Berichterstatter nach Rookfield. Fräulein Derwent wollte ihm zuerst keine Unterredung gewähren, als man ihr jedoch bedeutete, daß die Veröffentlichung aller Nebenumstände durch ein soviel gelesenes Blatt, wie das unsere, zweifellos die Entdeckung erleichtern würde, willigte sie endlich ein, unseren Berichterstatter zu empfangen.
Die Unterredung unseres Berichterstatters mit der Tochter des vermißten Dichters.
Das ›Krähennest‹ kann ohne Übertreibung als ein ideales Dichterheim bezeichnet werden. Am Ausgang eines malerisch gelegenen Dorfes erbaut, anderthalb Meilen von der nächsten Eisenbahnstation entfernt, bietet es den genußreichsten Fernblick über den sanftgewellten Forst von Rookfield.
Das Haus ist nicht hoch, doch geräumig, von einem ausgedehnten Garten umgeben, in dem der gelbe Frühlingssaffran bereits die saftigen Knospen sprengt. Schlingpflanzen umranken die Fenster und auf den frisch hergerichteten Blumenbeeten, die das Haus von der wenig befahrenen Landstraße trennen, wird bald der purpurne Rhododendron in Blüte prangen.
Fräulein Derwent empfing unseren Berichterstatter in einem entzückenden, altertümlichen Gemache, dessen Wände unten mit Eichenholz getäfelt, oben durch engbestellte Bücher-Regale gänzlich verdeckt sind.
Fräulein Florence Derwent ist eine reizende, junge Dame von 19 Jahren, groß, vornehm und schön, in tiefe Trauer gekleidet. Trotz ihrer offenbaren Selbstbeherrschung genügte ein zufälliges Wort, eine flüchtige Anspielung, um ihre sanfte Stimme zu erschüttern, ihre grauen Augen mit einem Tränenflore zu verschleiern.
›Dies war also des Dichters Zimmer,‹ begann unser Reporter. ›Die Geburtsstätte edler Gedanken, die von hier aus die Welt durchwanderten.‹
›Es war meines Vaters Studierzimmer,‹ bestätigte Fräulein Derwent. ›Jeden Morgen, soweit meine Erinnerung zurückgreift, saß er an diesem Tische – unfaßbar scheint es mir, ihn nie mehr hier zu sehen!‹
›Sollte dies wirklich außer jeder Möglichkeit liegen, verehrtes Fräulein?‹
›Die Hoffnung ist gering!‹ rief sie erregt. ›Wenn er noch lebt, warum kehrt er nicht zurück? Dienstag Abend sah ich ihn zum letztenmal – heute haben wir Samstag und kein Wort, kein Zeichen von ihm hat uns erreicht. Er hatte keinen Feind auf Erden – alle liebten und schätzten ihn – wer konnte diesem Mann ein Unrecht zufügen?‹
›Man stellt die Vermutung auf, er habe möglicherweise sich selbst ein Leid angetan.‹
›Diese Erklärung ist für jeden, der seinen Charakter und seine Lebensweise kennt, ausgeschlossen,‹ antwortete sie lebhaft, ›selbst Inspektor Holt glaubt nicht an seinen Tod; wie aber könnte er leben und mich in dieser Ungewißheit lassen!‹
›Inspektor Holt scheint demnach die Annahme nicht zu verwerfen, Herr Derwent sei in die Hände von Räubern gefallen?‹ warf unser Berichterstatter ein.
›Was hätte einen Dieb oder Räuber an meinem Vater verlocken sollen? Er trug niemals Wertsachen bei sich, nur eine Uhr, die ohne Kette in seiner Tasche steckte. Wenn er, wie ich annehmen muß, nach dem Kirchhofe ging, um der Mutter Grab zu besuchen, so verfolgte er die gewohnte Straße, die in geringen Zwischenräumen mit Häusern besetzt ist; auch war er ein starker Mann – er hätte kräftigen Widerstand geleistet und durch seinen Hilferuf die Nachbarschaft aus dem Schlafe geweckt.‹
›Wenn Sie, mein Fräulein, eine Sie vielleicht peinlich berührende Frage entschuldigen wollen – bemerkten Sie Dienstag Abend nichts Außergewöhnliches in Ihres Vaters Benehmen?‹
›Nicht das geringste,‹ lautete die entschiedene Antwort. ›Dr. Viret, der ihn nach Hause begleitete, als das Begräbnis vorüber war, kann bezeugen, daß niemand zurechnungsfähiger sein konnte, als der arme Vermißte.‹
›Dr. Viret? meinen Sie den berühmten Pathologen?‹
›Denselben – er übt keine Praxis, da aber unser Hausarzt in dem fünf Meilen entfernten Wisborough wohnt, und die Krankheit meiner Mutter oft schleunige Hilfe, selbst bei Nacht, erheischte, so nahm sich Dr. Viret auf die Bitte seines Berufsgenossen ausnahmsweise dieses Falles an.‹
›Darf ich fragen, welcher Art die Krankheit Ihrer Mutter gewesen?‹
›Ihr Tod wurde durch ein Zusammentreffen mannigfacher Leiden herbeigeführt – ursprünglich jedoch litt sie am Wangenkrebs.‹
›Ich glaube, Dr. Viret ist Spezialist für Krebsleiden?‹
›Er zeigte in der Tat wissenschaftliches Interesse für meiner Mutter Krankheit – besondere Erscheinungen, die ich nicht imstande bin, Ihnen näher zu erklären, begleiteten den Verlauf des Leidens. Schließlich übernahm Dr. Viret, der in unserer nächsten Nähe wohnt, die alleinige Behandlung – Dr. Brown sprach nur gelegentlich vor – und ich konnte seither seine Güte und Sorgfalt für unsere teuere Kranke nicht dankbar genug anerkennen.‹
Nach einem weiteren, höchst anregenden Gespräche über des Dichters letzte Arbeiten, bat unser Gewährsmann um die Erlaubnis, das Zimmer sehen zu dürfen, in dem Herr Derwent sich zuletzt aufgehalten. Erst nach sichtlichem Zögern geleitete ihn Fräulein Derwent die Treppe zum ersten Stockwerke hinauf nach einem kleinen einfachen Schlafgemach. Einige ausgewählte Kupferstiche schmückten die Wände, auf dem Ankleidetische lag eine vielgelesene Bibel, und neben dem altertümlichen Ofen stand ein mit Kattun überzogener Lehnstuhl.
›Ich sagte meinem Vater unten in seiner Studierstube gute Nacht,‹ erzählte Fräulein Derwent; ›kaum war ich nach meinem hier oben gelegenen Zimmer gegangen, als ich seine Stimme hörte. O, wie erschütternd ist es, Zeuge des tiefsten Seelenschmerzens eines starken Mannes zu sein! Mein Vater stand am Fuße der Stiege, blickte aufwärts und rief in thränenerstickten, herzzerreißenden Tönen den Namen meiner Mutter: ›Alice! Alice!‹ Wir hatten sie erst am Nachmittag zu Grabe getragen. Ich eilte hinab, nahm zärtlich seine Hand und führte ihn hieher in sein Schlafzimmer, wo ich ihn nochmals küßte, um ihn nach einiger Zeit, scheinbar beruhigt, zu verlassen. Als ich ihn zum letzten Mal sah, saß er in diesem Lehnstuhl – kurz darauf schlug es 11 Uhr – seither ist jede Spur von ihm verschwunden.‹«
»Doch nicht so ganz«, flüsterte Joseph Bodger, seine Lektüre unterbrechend. »Einer hat ihn noch später gesehen – und das bin ich! Schwören möchte ich, daß er es war, als ob ich es hier schwarz auf weiß gelesen hätte.«
Das Zeitungsblatt zusammenfaltend, überblickte Joseph die erste Seite und fand gleich obenan die folgende Anzeige:
» 1000 Pfund Belohnung!
Roderich Derwent ist in der Nacht vom 4. auf den 5. März aus seinem Hause verschwunden. Der Vermißte ist 55 Jahre alt, 5 Fuß 4½ Zoll groß, breitschulterig gebaut, hat lichtbraune, gekrauste, etwas mit grau gemischte Haare, dünnen Schnurr- und Backenbart, breites blühendes Gesicht, war mit schwarzem Überrock und Filzhut bekleidet, wurde zuletzt im ›Krähennest,‹ Rookfield, Sussex, gesehen.
Die obengenannte Belohnung wird demjenigen ausbezahlt, welcher imstande ist Angaben zu machen, die entweder zur Auffindung des Vermißten, oder, falls sein Tod sich bestätigt, zur Entdeckung des Mörders führen.
Nähere Auskunft bei Edwards Sohn und Mathews, Rechtsanwälte, No. –, Old Jewry, E. C.«
»Ich wette, das paßt in meinen Kram«, murmelte Joseph, sich aus dem Grase erhebend. Hatte er den hier beschriebenen Mann doch später als alle andern zu Gesicht bekommen, und obendrein ein Weib, das ihm unmittelbar folgte! »Da gibt's Geld zu verdienen«, dachte er weiter, indem er seinen Platz beim Marmorbogen verließ, »diese 1000 Pfund sollen mein werden.«
Bei näherer Überlegung erschien ihm Inspektor Holts Teilnahme an der Sache als ein seine Pläne erschwerender Umstand. Joseph kannte den Inspektor und wußte, daß dieser auch ihn nicht vergessen hatte; sie hegten gegenseitige Achtung für einander, wie sie dem Sachverständigen in seinem Beruf gebührt. Leider konnte Joseph nicht geradeswegs zum Inspektor gehen und von ihm, auf Grund seiner Angaben, die ausgeschriebene Belohnung fordern. Das war ein Unglück, doch, wenn er zwischen zwei Übeln zu wählen hatte, so wollte er lieber die Zwecke der Gerechtigkeit vereiteln, als der ihm feindlich gesinnten Macht zu einem Erfolge verhelfen.
»Auf jeden Fall«, wiederholte er nochmals »gibt's Geld zu verdienen, und ich will nicht säumen mir meinen Anteil zu holen.«
Er war nicht nur der Letzte, der Herrn Derwent gesehen, er war auch der Einzige, der von dem Dasein der geheimnisvollen Frau Kenntnis hatte; folglich durfte er keine Zeit verlieren, um vor allem die nähere Spur dieser für ihn hochwichtigen Person zu entdecken.
3. Kapitel. Florence Derwent.
»Ist Fräulein Derwent zu Hause?«
»Ich werde nachsehen, mein Herr.«
Das stämmige, rothaarige, ländliche Hausmädchen wies Inspektor Holt den Weg nach dem Empfangszimmer und ging, das Fräulein von seinem Besuche zu benachrichtigen.
Der Beamte mochte vierzig Jahre zählen, war mittelgroß, sorgfältig gekleidet, glatt rasiert, und hatte ein kurzes, entschiedenes Wesen. Weder mit übernatürlichem Scharfsinn noch der Kraft der Weissagung begabt, besaß er doch einen klaren kritischen Verstand. Seit er die Lösung verwickelter Kriminalfälle zur Hauptaufgabe seines Lebens gemacht, war es ihm gelungen, manches scheinbar unergründliche Geheimnis aufzuhellen. Auch bei dem vorliegenden, rätselhaften Ereignisse hatte er nicht nur Herrn Derwents Haus und Nachbarschaft der gründlichsten Durchsuchung unterzogen, sondern eingehende Unterredungen mit dem Verleger des vermißten Mannes sowie mit dessen Bankier gepflogen – kurz, alles getan, was in seiner Macht lag, um irgend einen bisher ungekannten dunkeln Hintergrund des anscheinend so friedlichen Lebens im ›Krähenneste‹ zu entdecken. Er mochte jedoch forschen wie er wollte, es lauerte kein Gespenst in der ungetrübten Atmosphäre des stillen Dichterheims. Herr Derwent hatte kein Weib geliebt, außer seine eigene Frau; er hinterließ keine Schulden, sein Vermögensstand wies sogar einen Überschuß auf; man hätte seinen ganzen Lebenslauf vor aller Welt enthüllen können, ohne etwas Ehrenrühriges zu finden, worüber seine Tochter zu erröten brauchte.
Schon nach einigen Minuten, gerade als die Uhr auf dem Kaminsimse die zwölfte Stunde, Montag Mittag, verkündete, kam Lisa zurück und führte den Inspektor nach Herrn Derwents Studierzimmer.
Der Berichterstatter hatte nicht übertrieben, als er Florencens Schönheit rühmte; auch den seltenen Vorzügen ihres Geistes und Gemütes, die bei jedem der anspruchslosen, klugen Worte, die sie sprach, den Hörer für sie einnehmen mußten, hatte er nur Gerechtigkeit widerfahren lassen. Die leuchtenden, grauen Augen gaben ihrem Antlitz großen Reiz, und die reine, etwas blasse Gesichtsfarbe stimmte vortrefflich zu dem reichen, goldglänzenden Haare. Der anziehendste Zauber ihrer Persönlichkeit lag außerdem in der stattlichen, edlen Gestalt. Gleich ihrer Mutter war sie größer als Herr Derwent, und jede Bewegung ihres jugendkräftigen Körpers zeugte von vollendeter Anmut.
Noch schien es ihr unmöglich, an das Unglück zu glauben, das erst seit wenigen Tagen auf ihr lastete. Bis zum Beginn der langwierigen Krankheit ihrer Mutter war Florencens Leben in heiterer Ruhe dahingeflossen, und als die Sorge um die Kranke sich in Schmerz über ihren Verlust verwandelte, hatte sich zu ihrer Trauer noch das Entsetzen über des Vaters rätselhaftes Verschwinden gesellt. Wie teuer auch die Mutter dem Mädchen gewesen, der Vater war ihr noch unendlich mehr – geistige Verwandtschaft verband die hochbegabte Tochter mit dem ihr in zärtlicher Liebe ergebenen Manne, so daß außer natürlicher Neigung auch noch der Stolz gegenseitigen Besitzes die beiden seltenen Menschen innig verknüpfte.
Mit vor Erregung geröteten Wangen stand Florence bei Inspektor Holts Eintritt von dem Sessel an ihres Vaters Schreibtische auf.
»Sie haben mir etwas zu sagen«, rief sie ihm entgegen.
»In unserem Falle, mein Fräulein, ist keine Nachricht gute Nachricht.«
»O, dürfte ich Ihnen glauben!« stammelte sie inbrünstig.
»Warum sollten Sie nicht«, antwortete der Beamte tröstend – »Sie fragen mich, wodurch sich diese Zuversicht rechtfertigen läßt? Nun, wir haben Haus und Garten und jeden Zollbreit Erde der Nachbarschaft abgesucht, jeden Wassertümpel durchforscht, in allen umliegenden Scheunen Umschau gehalten, und nirgends eine Spur des Vermißten entdeckt.«
»Gelang es Ihnen, den Mann zu finden, der bei Oberst Askew eingebrochen ist?« fragte Florence.
»Ich wollte, wir hätten ihn! Beiläufig bemerkt, Fräulein Derwent, ich rannte beinahe Ihren Nachbar um, als ich den Garten betrat.«
Rasch schlug Florence die Augen auf. »Herrn Fairford?« fragte sie hastig.
»Er ist wohl ein alter Freund Ihres Hauses?«
»Kein alter Freund«, erwiderte sie, »er lebt erst seit zwei Monaten in unserer Gegend. Mein Vater lernte ihn an demselben Tage kennen, als er das uns zunächst gelegene Haus bezog, das heißt, als er im Begriffe war, es einzurichten.«
»Hat Herr Fairford Familie?« forschte der Inspektor weiter.
»Er lebt allein mit seiner Dienerschaft.«
»Also noch ein junger Mann«, fuhr Holt sinnend fort – »er scheint kaum dreißig Jahre zu zählen. Haben Sie ihn vor seiner Ankunft hier nicht gekannt?«
»Nein. Ich sah ihn vor zwei Monaten zum erstenmal, als er an unserem Garten vorüberging. Gleichzeitig mit der Nachricht, das leerstehende Haus bekäme einen neuen Mieter, trafen Handwerksleute aus London ein, um es wohnlich herzurichten. Wenige Tage später, an einem Mittwoch, begegnete mein Vater Herrn Fairford, brachte ihn zu uns zum Frühstück und seitdem war er oft des Abends unser Gast. Mein Vater behauptete, er sei der einzige Mensch in Rookfield, dessen Verkehr Genuß und Anregung biete.«
»Fragte Herr Derwent seinen neuen Freund niemals nach dessen früherem Aufenthaltsort?«
»Nur einmal, dann nie mehr – es kam uns vor als rufe der Gedanke an die Vergangenheit unwillkommene Erinnerungen in ihm wach.«
»Sie wissen also nichts von seinem Leben, ehe er ihr Nachbar wurde?«
»Durchaus nichts! Warum stellen Sie diese Fragen an mich, Herr Inspektor?« rief Florence betroffen, »sollten Sie glauben, Herr Fairford könnte Schuld an meines Vaters Unglück tragen?«
»Ich fürchte, die Neugier ist eine meiner bösesten Gewohnheiten«, antwortete der Beamte ausweichend. »Halten Sie fest daran, liebes Fräulein, daß ich überhaupt nicht an ein Herrn Derwent zugefügtes Leid glaube – wäre er tot, wo ist sein Leichnam?«
»Ebenso frage ich: wenn er lebte, warum kehrt er nicht zurück?«
»Für uns steht nur die eine Tatsache fest, daß Ihr Vater bisher nicht zurückgekommen ist. Dies kann aus zweierlei Ursachen geschehen sein. Entweder wurde er ohne erklärbaren Grund ermordet, und sein Körper nach einem sicheren, uns unzugänglichen Versteck gebracht, oder er verließ das Haus aus eigenem Antriebe. Es gibt nur eine Person, welcher aus seinem Tode Gewinn erwächst.«
»Sie meinen den Vetter Arnold!« rief Florence entrüstet.
»Der Vetter Arnold«, fiel der Inspektor ihr rasch in die Rede »war zur Zeit, als das Unglück geschah, gar nicht in England – ist auch jetzt, so viel ich weiß, noch im Ausland. Es ließen sich eine Menge Fälle aufzählen, daß Leute scheinbar ohne allen Grund verschwunden sind, z. B. der folgende: Ein Geistlicher, ein gewöhnlicher, ruhig dahinlebender Mann, verließ eines Tages seinen Wohnort, reiste nach einer viele Meilen entfernten Stadt und eröffnete dort einen Buchladen. Nach zwei Monaten erst kam er wieder zum Bewußtsein seiner Handlungen, ohne sich des dazwischen liegenden Zeitraums im geringsten entsinnen zu können. Der Fall ist in den Annalen der Polizei wohlbekannt.«
»Hier war ohne Zweifel Krankheit oder Wahnsinn im Spiele«, gab Florence zur Antwort.
»Es handelte sich um einen lang andauernden, epileptischen Anfall.«
»Kein Mensch könnte daran denken, den Vater für epileptisch zu halten, er war gesund an Körper und an Geist!«
»Es wäre ganz unstatthaft, Bestimmtes behaupten zu wollen, verehrtes Fräulein«, beendete Inspektor Holt die Unterredung. »Wir haben im Polizeiamte eingehend über diese Angelegenheit verhandelt und sind zu der Überzeugung gelangt, daß kein Verbrechen vorliegt. Sollte eine neue Wendung sich ergeben, so bitte ich, mich sofort zu benachrichtigen. Ich hoffe zuversichtlich, Herr Derwent wird in kürzester Zeit, gerettet und wohlauf, seine geliebte Tochter in die Arme schließen.«
4. Kapitel. Owen Fairford.
Obwohl Florence Derwent manchen Freund älteren Datums besaß, so stand ihr doch, Vetter Arnold ausgenommen, keiner vertraulich näher, als Owen Fairford. Sie wußte nichts von seinem Vorleben oder seinen Verhältnissen, nichts von seiner Familie, auch nicht, warum er allein in Rookfield lebte, und dennoch dünkte ihr alles an dem einsamen Manne wohlbekannt und verständlich.
Er maß nahezu 6 Fuß und war mit seinen breiten Schultern und dem hübschen von der Sonne gebräunten Antlitz ein echter Sohn Englands, wie man deren viele auf den Schulen von Oxford und Cambridge sieht. Er mochte 34 Jahre zählen, schien aber bedeutend jünger, wohl wegen des blühenden, bartlosen Gesichtes.
Nach Florencens Meinung lag jedoch etwas in Owens Äußerem, was ihn vorteilhaft von anderen jungen Männern ihrer Bekanntschaft unterschied. Worin das Besondere bestand, konnte sie sich nie recht klar machen. Er hatte fast schwarzes Haar und dunkelblaue Augen, mit meist recht traurigem Ausdrucke. Vielleicht war es dieser sinnende Blick im Verein mit seiner ungewöhnlichen Lebensweise, was sie auf die Vermutung führte, daß ihn ein geheimer Kummer bedrücke und zugleich die wärmste Teilnahme in ihrem Herzen weckte.
Montag Nachmittag stattete Fairford den ersten Besuch seit dem Tode von Florencens Mutter im ›Krähenneste‹ ab.
»Ich wollte nicht früher kommen«, sagte er, nachdem er das Mädchen begrüßt – »selbst heute tat ich es nur zagend; – weiß ich doch kaum, was ich Ihnen sagen soll. Man möchte trösten, dem tief empfundenen Anteil Worte leihen, und weckt doch nur qualvolle Erinnerungen. Wollen Sie alles, was ich fühle, als gesprochen betrachten und uns weitere Pein ersparen?«
»Ich freue mich, daß Sie gekommen sind«, antwortete sie einfach.
»Der Polizeibeamte war diesen Morgen bei Ihnen«, nahm Fairford das beiden zunächst liegende Thema auf. »Brachte er irgend eine Nachricht? Der Wunsch, das Ergebnis seiner Bemühungen zu erfahren, flößte mir die Kühnheit ein, Sie schon heute aufzusuchen.«
»Nichts – keine Spur, Herr Fairford! Meines Vaters Rechtsanwalt sandte den Inspektor am verflossenen Donnerstage zum erstenmal zu mir. Er durchsuchte das ganze Haus, verhörte die Dienerschaft, mit Ausnahme Annens.«
»Warum wurde bei Anna eine Ausnahme gemacht?«
»Sie lag krank zu Bette – er konnte ihr Zimmer nicht betreten; im übrigen beharrt Inspektor Holt bei seiner Meinung, der Vater habe aus eigenem Antriebe das Haus verlassen, und damit müssen wir uns vorläufig zufrieden geben.«
»Sie halten dennoch die Ausschreibung der Belohnung aufrecht?« fragte Owen.
»Dr. Viret tut das, dem Rate unseres Anwaltes Edwards folgend. Ach, wie entsetzlich ist diese Ungewißheit! Wüßte man auch das Schrecklichste – es ließe sich leichter ertragen.«
Owen lehnte sich in seinem Sessel vor, und beide Arme auf die Knie stützend, faltete er die großen, kräftigen Hände in stummem Mitgefühl. »Man darf doch die Hoffnung nicht aufgeben«, tröstete er eindringlich. »Wir wissen ja gar nichts von den Nebenumständen dieses unbegreiflichen Falles.«
»Werde ich sie jemals erfahren? Kaum wage ich aufzuatmen, so erstickt der nächste Augenblick den leisen Hoffnungsschimmer in meiner gequälten Seele. Keine Minute vergeht, ohne daß ich des Vaters Gestalt leibhaftig vor mir sehe; jetzt, während ich hier sitze, ist's mir, als müsse die Tür aufgehen und er, nach alter Gewohnheit, mir entgegeneilen.«
»Ich glaube, Fräulein Derwent, es wäre das Beste, Sie entschlössen sich, dieses Haus zu verlassen; so lange Sie hier sind, verstärkt alles in Ihrer Umgebung nur von neuem Ihre Trauer.«
»Das würde ich nur tun, wenn die Notwendigkeit mich dazu zwänge. Wohin sollte ich auch gehen?« fuhr sie trostlos fort. »Ich habe nur einen Verwandten in der weiten Welt, meinen Vetter Arnold, und selbst dieser ist nicht in England. Er soll sich im Kaplande aufhalten; da jedoch auch Herr Edwards seine bestimmte Adresse nicht kennt, ist es sehr wahrscheinlich, daß der Brief mit der Nachricht von dem Tode der Mutter und dem Verschwinden des Vaters ihn gar nicht erreicht hat.«
»Ich erinnere mich nicht, daß Ihr Vater jemals von Arnold gesprochen hätte«, bemerkte Owen.
»Wir erwähnten ihn nicht gern. Früher lebte er bei uns, und wir waren uns herzlich gut, wie Bruder und Schwester. Als er nach London ging, um Medizin zu studieren, führte er einen etwas lockeren Lebenswandel, und fiel bei mehreren Prüfungen durch. Nachdem er auch das Doktorexamen nicht bestanden, verlor mein Vater die Geduld und entzog Arnold seine Hilfe. Er reiste nach dem Kapland, um dort bei der berittenen Polizei einzutreten; seitdem haben wir nie mehr von ihm gehört.«
»Glauben Sie, daß er auf die Nachricht des hier Geschehenen zurückkehren wird?«
»Er ist der Erbe«, antwortete Florence. »Des Großvaters Vermögen geht, da ich kein Knabe bin, vom Vater auf Arnold über – sobald mein Vater für tot erklärt wird, tritt Arnold in den Besitz des Hauses, sowie unseres gesamten Eigentums.«
Owen schien zu zögern. »Dies dürfte wohl nicht wörtlich zu nehmen sein«, warf er nachdenklich ein. »Herrn Derwents Werke sind überall verbreitet, seine Autoren-Rechte müssen einen beträchtlichen Gewinn abwerfen.«
»Gewiß, Herr Fairford, aber die Sachen sind meist in den Besitz des Verlegers übergegangen. Wie oft nannte die Mutter scherzend die Poesie meines Vaters erste Liebe – jedenfalls war er in Betreff der Ausstattung seiner Bücher äußerst verschwenderisch – Sie wissen selbst, in wie kostbarem Gewande sie prangen. Der Gewinn des neuen Werkes wurde daher stets durch das Erscheinen des nächsten verschlungen.«
»Verzeihen Sie meine Kühnheit, Fräulein – selbst wenn wir Herrn Derwents Tod als erwiesen annehmen müßten, – habe ich falsch verstanden oder sind Sie dann in der Tat gänzlich von Ihrem Vetter Arnold abhängig?«
»Nein, nein!« rief sie lebhaft, »nicht von ihm, nur von mir selbst. Ich fürchte die Zukunft nicht im geringsten«, fuhr sie tapfer fort. »Was andere Frauen getan haben, kann ich ebenso gut leisten. Im Vergleiche zu dem Schmerz um meinen Vater ist jeder andere Verlust für mich völlig unwesentlich.«
»Immerhin«, wagte er anzudeuten, »müßte man doch an die Mittel und Wege denken – –«
»Dank der Güte Doktor Virets habe ich hiefür noch keine Sorge empfunden. Ich kann es kaum in Worte fassen, wie liebevoll er sich meiner annimmt. Ich hatte keine Vollmacht, Geld auf der Bank zu erheben; Doktor Viret hinterlegte daher eine Summe auf meinen Namen, damit ich die laufenden Ausgaben bestreiten kann; auch verpflichtete er sich, die Zahlung der ausgeschriebenen Belohnung zu leisten. Er ist ein treuer Freund; ich wollte, Sie lernten ihn kennen!«
Fairford stand auf und nahm seine Mütze vom Tische. »Das Einzige, was ich vorläufig ersehne«, sagte er, sich verabschiedend, »wäre, Ihnen, teures Fräulein, dienen zu dürfen; doch, wahrem Leide gegenüber fühlen wir unsere Machtlosigkeit am empfindlichsten. Es gibt nichts Traurigeres, als Zeuge des Kummers der Menschen zu sein, die wir am höchsten schätzen, und doch nicht ihre Tränen trocknen zu können.«
Während er so sprach, nahm er Florencens Hand; ihre Augen begegneten sich – die seinen schienen dem Mädchen sehnsüchtiger, düsterer denn je.
»Sie verstehen mich am besten«, flüsterte sie, von der Erregung des Moments fortgerissen – »ist's mir doch, als laste auch auf Ihrer Seele ein tiefer, geheimer Schmerz.«
Fairford glaubte, es habe noch kein Weib mit mehr zartfühlender Teilnahme zu ihm aufgeblickt. Er fand keine Antwort, sein starker Körper bebte, ein Schleier legte sich ihm über die Augen. Tief Atem holend, um seiner Bewegung Meister zu bleiben, drückte er die Hand, die noch immer in der seinen lag, und verließ Florence, ohne ein weiteres Wort zu sagen.
5. Kapitel. Cherchez la femme.
Als Joseph Bodger am Montag Abend aus dem letzten in der Station Rookfield einlaufenden Zuge stieg, hätte ihn selbst Inspektor Holt nicht erkannt, so verändert sah er in dem neuen glänzenden Spitzhute und dem schwarzen Rocke aus, der, bei einem Kleiderhändler aus zweiter Hand gekauft, für seinen mageren Körper viel zu weit war und in reichlichen Falten an ihm niederhing. Hierzu trug er glatte, graue Beinkleider, den hohen Kragen von einem Halstuche umschlungen, in der Hand einen leichten Spazierstock.





























