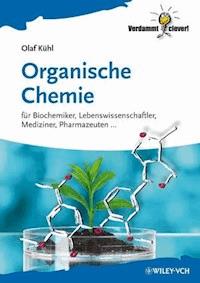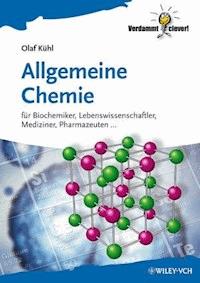10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zunächst ist es für Krynitzki ein ganz normaler Auftrag: Er soll eine verschwundene Luxuslimousine ausfindig machen und von Kiew nach Deutschland zurückbringen. Mit solchen Missionen verdient der Enddreißiger seinen Lebensunterhalt, Versicherungen bezahlen ihn, und auch in diesem Fall scheint der Betrug auf der Hand zu liegen. Halb unbewusst vor seiner Familie und seiner zerrütteten Beziehung aus Berlin flüchtend, fährt Krynitzki nach Kiew – und stellt fest, dass der dortige Halter des Fahrzeugs ein hoher Beamter war, der vor wenigen Monaten gestorben ist. Krynitzki lernt die rätselhafte, eigentümlich anziehende Witwe Svetlana kennen – und ihren Sohn Arkadij, ein hochbegabter Geist, der in einer psychiatrischen Anstalt lebt und sich obsessiv mit der gewaltreichen ukrainischen Geschichte sowie mit dem Schicksal seiner vor Jahrzehnten verschwundenen Kinderfrau Olga befasst. Krynitzki erkennt, dass die Spuren zu der unauffindbar bleibenden Limousine wie zu Olga im Dunkel der Familiengeschichte zusammenlaufen, merkt aber nicht, dass er längst in einen gefährlichen Strudel geraten ist. Denn er wird selbst verfolgt … Olaf Kühls großartig gezeichnete Figuren lavieren zwischen Sehnsucht und den Schatten der Vergangenheit, Betrug und Selbstbetrug. Ein hochliterarischer Roman über die schmerzhafte Suche nach der Wahrheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Olaf Kühl
Der wahre Sohn
Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Zunächst ist es für Krynitzki ein ganz normaler Auftrag: Er soll eine verschwundene Luxuslimousine ausfindig machen und von Kiew nach Deutschland zurückbringen. Mit solchen Missionen verdient der Enddreißiger seinen Lebensunterhalt, Versicherungen bezahlen ihn, und auch in diesem Fall scheint der Betrug auf der Hand zu liegen. Halb unbewusst vor seiner Familie und seiner zerrütteten Beziehung aus Berlin flüchtend, fährt Krynitzki nach Kiew – und stellt fest, dass der dortige Halter des Fahrzeugs ein hoher Beamter war, der vor wenigen Monaten gestorben ist. Krynitzki lernt die rätselhafte, eigentümlich anziehende Witwe Svetlana kennen – und ihren Sohn Arkadij, ein hochbegabter Geist, der in einer psychiatrischen Anstalt lebt und sich obsessiv mit der gewaltreichen ukrainischen Geschichte sowie mit dem Schicksal seiner vor Jahrzehnten verschwundenen Kinderfrau Olga befasst. Krynitzki erkennt, dass die Spuren zu der unauffindbar bleibenden Limousine wie zu Olga im Dunkel der Familiengeschichte zusammenlaufen, merkt aber nicht, dass er längst in einen gefährlichen Strudel geraten ist. Denn er wird selbst verfolgt …
Olaf Kühls großartig gezeichnete Figuren lavieren zwischen Sehnsucht und den Schatten der Vergangenheit, Betrug und Selbstbetrug. Ein hochliterarischer Roman über die schmerzhafte Suche nach der Wahrheit.
Über Olaf Kühl
Olaf Kühl, 1955 geboren, studierte Slawistik, Osteuropäische Geschichte und Zeitgeschichte an der Freien Universität Berlin und ist vor allem als Übersetzer aus dem Polnischen und Russischen bekannt. 2005 wurde er mit dem Karl-Dedecius-Preis für sein polnisch-deutsches Übersetzungswerk ausgezeichnet. Seit 1996 ist er Russlandreferent des Regierenden Bürgermeisters von Berlin. 2011 erschien Olaf Kühls Debütroman «Tote Tiere».
Inhaltsübersicht
Sometimes I think she’s just in my imagination
The Rolling Stones,
Anybody seen my baby
Ach, du warst in abgelebten Zeiten
meine Schwester oder meine Frau.
Johann Wolfgang von Goethe,
An Charlotte von Stein
Eins
Ganz früh am Morgen aufstehen, wenn im ersten Tageslicht die Spatzen loslegen. Die Vögel singen heller, wenn alles ruhig ist. Nach der gepackten Reisetasche greifen, nicht richtig ausgeschlafen und doch wach und ein bisschen wie verkatert, obwohl man nicht viel getrunken hat am Abend, die Wohnungstür zuschlagen und die Treppen hinuntergehen, durch diesen Geruch von Bohnerwachs und undefinierbarem Eintopf, die Tasche auf den Rücksitz des Wagens werfen, einen letzten Blick hoch zu den Fenstern im dritten Stock des Mietshauses, in denen sich das rosigblasse Blau des frühen Wolkenhimmels spiegelt, sodass fast nichts dahinter zu erkennen ist, kaum das Grün der Zimmerpflanzen, zwei große Gummibaumblätter an der Scheibe, dann hinters Lenkrad steigen, den Zündschlüssel nach rechts drehen, über diesen kleinen Widerstand hinaus, und gespannt zusehen, wie der Benzinzeiger die Skala hochklettert. Den Motor anlassen und eine Weile dem gleichmäßigen, tiefen, fast: gesunden Geräusch der Zylinder lauschen, die ihr Gas in die Straßen blasen. Die Kraft von Generationen steckt in dieser Maschine, dieser beeindruckenden Frucht der Arbeitsteilung. Die schützende Scheibe herunterkurbeln und kühle Morgenluft hereinlassen. Wissen, dass es kein Zurück gibt. Onkel Wolfgang konnte schon tot sein.
Es ist noch nicht Marlenes Zeit. Sie schläft noch. Erst später am Vormittag wird sie aufstehen und die Zeitung aus dem Briefkasten holen. Bei dem Gedanken daran, wie oft er sie aus der Wohnung hat treten sehen, senkt sich sein Fuß zwei Zentimeter tiefer aufs Gaspedal. Er sieht sie die Treppe hinuntergehen, so wie sie sie tausendmal hinuntergegangen ist, sie hält den Morgenmantel mit der Hand zusammen, der Gürtel ist verloren, vor Jahren bei einem Skiurlaub in Österreich. Dabei trägt sie Hausschuhe. Als würde ihr bloßes Erinnerungsbild die Macht haben, ihn aufzuhalten, als könnte diese Gedankenfigur ihn zurückziehen wie eine wortlos ausgestreckte Hand, zurück in die Stadt, in diese Wohnung, und er würde sich von der weißen Haut des Bauches zwischen den auseinanderwehenden Bademantelschößen zum tausendsten Mal verführen, dann überreden lassen. Dann würden die Gespräche von neuem beginnen, die endlosen Diskussionen der letzten Wochen und Monate. Über ihre Beziehung. Dass da jede Entwicklung fehlte. Dass sich nichts mehr tat …
Spricht eine Frau von Entwicklung, dann ist es schon zu spät. Dann geht es bald zu Ende. «Zwischen uns entwickelt sich nichts mehr.» Er lauschte dem gleichmäßigen Summen des Motors und dachte: Was soll sich, verflucht, entwickeln, wenn doch alles gut läuft? Die Erinnerung an solche Gespräche brachte ihn in Wut. Und als sich einmal wirklich bei ihr etwas entwickelte, im Bauch, hat sie es weggemacht. Ihre krakelige Unterschrift unter der Einwilligungserklärung hat er noch in der Schublade.
Mit fast neunzig durchrauscht er die Frankfurter Allee Richtung Osten, in der bitteren Genugtuung, ihr jetzt zumindest schon fast entkommen zu sein, wieder einmal. In Lichtenberg erwacht die ehemals herrschende Klasse der DDR. Solange er in Berlin ist, ist er noch nicht ganz gerettet. Er hat im Laufe der Jahre verschiedene Fluchten gewagt. Er wollte sich auf die Kehrseite des Lebens verdrücken. Hat lange als Nachtwächter gearbeitet. Ist für ein paar Wochen zu Günter gezogen, nach Prenzlauer Berg, tief in den Osten, hat sich dort versteckt. Es half alles nicht.
Er musste endlich richtig weg. Muschters Anruf kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Marlene wird nicht gleich zusammenbrechen. Sie wird nicht denken, dass es für immer ist, er verlässt sie ja nicht zum ersten Mal. Sie wird heute dasselbe tun wie an jedem Tag. Noch bevor sie mit der Zeitung wieder in ihrer Wohnung ist, wird der Wasserkessel auf dem Gasherd pfeifen. Dieses gedämpfte, aber unüberhörbare Zischen, so beruhigend wie das Läuten von Kirchenglocken. Sie wird mit einem Becher löslichen Kaffees zurück ins Bett steigen, sanft und weißhäutig und in Gedanken versunken, mütterlich und verständnisvoll, wahrscheinlich fühlt sie sich gut, vielleicht sogar moralisch überlegen, sie wird Konrads Flucht hinnehmen wie einen tollen Jungenstreich und vielleicht in sich hinein lächeln, sie wird Verständnis für ihn zeigen wie für das trotzige Kind, das sie nie hatte. Weil sie zu wissen glaubt, dass er am Ende wieder zurückkommen wird. Sie wird die taz lesen, wird sich wohlfühlen und sich ein paar Gedanken machen. Praktische Gedanken müssen das nicht sein, sie braucht nur das Gefühl, kritisch eingestellt zu sein, diese fortschrittliche Art von Lebensgefühl.
Dachte Konrad, wobei sein Fuß sich unmerklich vom Gaspedal hob.
Damals bei der Demo vor dem Amerika-Haus hatte sie in der vordersten Reihe gestanden und Pflastersteine geworfen. Ihre mit hellem Flaum bewachsenen, von den Sommermonaten auf Kreta braungebrannten Unterarme ragten aus den abgeschnittenen Ärmeln des Parkas. Damals kämpfte sie. Und er glaubte, sie würden etwas ändern können.
Heute Nachmittag hat sie Yoga um die Ecke, in einem Ladengeschäft, in dem so eine Frau ähnlich wie sie selbst Kurse anbietet. Dass überhaupt eine Frau ihr ähnlich sein kann, sagt schon alles. Früher wäre das unmöglich gewesen. Ihre Lebensmittel kauft sie im Bioladen. Kaffee aus Guatemala. Sie hat eingesehen, dass der frontale Kampf gegen das System keine Chance hat. Deshalb konzentriert sie sich nun auf die bescheidenen Dinge, die Graswurzelarbeit, den Widerstand im Kleinen, von dem sie gern erzählt. Gegen das Große da draußen unternimmt sie nichts mehr, diese Bewegung ist über sie hinweggegangen, sie hat sich damit abgefunden. Früher hat sie gern fotografiert, der ganze Flur hängt voll mit ihren Schwarzweißfotos, heute besitzt sie einen kleinen Laden für Fotozubehör und verdient damit, immer schlechter, ihr Geld. Sie reibt sich nicht mehr auf im Kampf. Stattdessen genießt sie ihr Leben bewusst, mag gutes Essen.
Im Osten geht tatsächlich die Sonne auf. Als er in Schönefeld den Berliner Ring verlässt und die immer geradeaus führende Fahrbahn nimmt, steht der goldrote, funkelnd warme Ball dicht über dem Horizont.
Die Autobahn Richtung Frankfurt/Oder ist leer.
Aus der Gegenrichtung, Grenze und Fürstenwalde, kommen ihm Pkws entgegen, die nach Berlin wollen, zur Arbeit. Ihn bringen höchstens ein paar Lkws zum Überholen. Deutschlands östliche Länder liegen wüst und leer. Die weiten Äcker und Felder der ehemaligen LPGs, die grauen Wirtschaftsgebäude aus Beton und Eternit wirken verlassen. Ab und zu huscht im Augenwinkel eine Siedlung vorüber, ein Dorf, Schemen von Scheunen oder Lagerhallen. Er kennt diese adretten, aufgeräumten Orte.
Er freut sich auf Polen. Polen durchdringt auch die geschlossenen Fenster, man braucht nicht einmal die Autotür zu öffnen. Im Winter der Rauch der Braunkohle aus den Schornsteinen, das Holz in den Dörfern. In Słubice ist dieser Geruch noch schwach, Słubice ist verdorbenes Slawentum, ein aufgegebenes deutsches Dorf, das noch zu keiner neuen Identität gefunden hat.
Er hat ihr nie gesagt, was er genau tut. Recherchieren, das klingt gut. Für wen, für eine Zeitung? Nein, für ein großes Unternehmen in Westdeutschland. Das erzählt er auch Freunden, das leuchtet am ehesten ein. Wenn er ehrlich ist, hat es weniger mit Diskretion zu tun als mit Scham. Denn gestohlene Autos zu suchen, dieser Job ist ihm peinlich, wenn er an die Pläne und Visionen der Studentenzeit denkt.
Die Sonne steht jetzt schon sehr hoch, sie blendet. Er klappt den Sonnenschutz herunter. Einmal hat er einen Sportwagen gesehen, der unter einen Lkw gerutscht war, auf der Autobahn nach Memel. Es roch verbrannt.
Jetzt wittert er diesem Geruch nach, erinnert sich aber nur an den heißen, widerlichen Plastikgestank, wenn er in den Sommerferien am Rastplatz wieder ins Auto stieg, das von der Sonne aufgeheizt war. In der kurzen grauen Lederhose mit den geschnitzten weißen Enzianknöpfen und der fettig dunkel gescheuerten Hinterseite verbrannte er sich regelmäßig die Schenkel auf den Kunststoffsitzbezügen. Aus der Motorhaube stanken Ölwanne und heiße Gummischläuche. Nach der Rast öffnete sein Vater die Türen und ließ kurz Luft hindurchwehen, dann gab er einen Wink und drückte seine Zigarette auf dem Boden aus. Das empfand er wie eine Drohung, was mit ihm geschehen würde, wenn er nicht sofort einstiege. Der Vater stand da, die rechte Hand an der Tür, glänzend spannte der graue Anzugstoff um seinen breiten Gorillarücken. Was sollte Konrad tun? Gegen den Vater kam er nicht an. Die Mutter sieht er nicht in der Erinnerung. Als wäre sie schon damals verschwunden gewesen. Mag sein, dass sie schon immer zu leichtgewichtig gewesen war, zu flüchtig, zu hell, zu wenig eindrücklich, wie durchscheinend. Manchmal kommt es ihm vor, als sei sie nichts weiter gewesen als eine Luftverquirlung, ein Flimmern der aufgeheizten Sommerluft, das sich Jahrzehnte in Bewegung gehalten hat, wie eine Fee, aber dann rasch verschwunden ist, aufgelöst in der durchsichtigen Weite, aus der sie eines Tages hervorgegangen war. Dieses Etwas musste ja immerhin geatmet haben, sagte er sich, unzählige Male die Luft ein- und wieder ausgeatmet haben. Schon kurz nach ihrer eigenen Geburt, dann in der Umarmung eines Mannes, vielleicht seines Vaters, hat sie heftig und laut geatmet, hat geschrien, die Luft ausgestoßen, dann wieder bei seiner Geburt, später ist ihr Atem flacher geworden, gleichmäßig und ruhiger, in so vielen Nächten, in denen er sie nicht mehr kannte … Die Luft über dem Kontinent war eine große Halle, in der sie lebte und atmete.
Und ihr Körper? Er wusste nicht, wo er jetzt war. Der Körper der Mutter ist wie die Atemluft, du brauchst sie, aber sie gehört dir nicht, du beachtest sie nicht einmal.
Die helle Autobahn in seiner Erinnerung ist damals viel leerer als die heutigen. Endlose sandgraue Betonstreifen durchzogen die Landschaft, einige Brücken waren zerbombt, der Schutt lag an den Straßenrändern. Es ging zu bewundernswerten deutschen Schlössern, Burgen, Museen, Sehenswürdigkeiten. Hermannsdenkmal. Residenz Würzburg. Insel Mainau. Das war wenige Jahre nach dem Krieg, und seine Eltern legten Wert darauf, dass Konrad ein Patriot wurde und deutsche Kultur lieben lernte. Seine Mutter – da ist sie jetzt auf einmal doch – verhedderte sich mit den Landkarten, sie konnte sie nie richtig falten, das Kartengebilde plusterte sich auf ihrem Schoß und irritierte den Vater, der irgendwann anhalten musste, um es ordentlich zusammenzulegen. Mit so einer Unordnung an seiner Seite konnte er sich nicht auf die Straße konzentrieren. Mutter war im Allgemeinen nicht gut als Beifahrerin, sie bekam dafür oft Schimpfe. Später fragte Konrad sich, warum das alles so gekommen war. Er erinnerte sich an den feinen Geruch, wenn sie ihren Kopf zu ihm oder von ihm weg drehte, wie ein Hauch von Odol oder One Drop Only vom Regal im Bad. So erklärte er sich das, als er noch nicht wusste, was es bedeutete. Der Vater entschied alles, auch, wo angehalten wurde. Wenn die Mutter es irgendwo schön fand, zählte das nicht, er fuhr weiter, und sie verstummte für längere Zeit. Konrad erinnerte sich sehr genau an die Stimmung, die dann im Auto herrschte. Und er konnte ja nicht weg. Er alberte auf der Rückbank herum, machte Witze, um seiner Mutter zu helfen, auch aus ihrer Sprachlosigkeit heraus. Er wollte sie aufheitern. Ihr Bewegungsfreiheit verschaffen. Er wollte seine Mutter beweglich haben und stark. Aber der Rücken des Vaters im Anzugsstoff presste sich massig gegen den Sitz und machte alles schwer. Durch den Spalt unter der Kopflehne sah er den rasierten Nacken. Wenn die Mutter nicht lachte, und das tat sie oft nicht aus Angst, den Vater zu verärgern, dann war das die schlimmste Art von Versagen in seiner Kindheit. Nicht einmal seine Witze taugten etwas. Er konnte dann auch nicht weglaufen vor Scham. Er musste das ertragen. Er war gefangen in dieser kleinen Familie, gefangen in diesem Auto.
Vater rauchte Zigaretten. Die heiße Sommerluft aus dem Fensterspalt wehte auch den Rauch zu ihm nach hinten. Später kamen andere Automodelle, nach dem ersten Kadett ein Opel Diplomat. Sonst änderte sich nichts. Es war das gleiche Gefängnis, die gleiche Familie. Die Befreiung kam erst, als sie nach Berlin gingen. Aber da war dann auch die Mutter weg, sie blieb in Westdeutschland. Konrad war acht. Der Vater kaufte ihm zum Trost einen Spielkameraden, einen Terrier namens Artur. Wo war Artur geblieben? War er irgendwann weggelaufen? Konrad wusste es nicht mehr.
An all das hatte er ewig nicht gedacht. Es war ihm eigentlich auch schon lange egal. Nur weil sein Onkel vor zwei Tagen über seine Mutter gesprochen hatte, fiel es ihm wieder ein, jetzt bei dieser monotonen Fahrt über die Autobahn.
Sein eigenes Auto war alt, er hatte sich bewusst ein unansehnliches, gebrauchtes Modell zugelegt, immer noch im reflexhaften Widerstand gegen das Establishment und gegen bürgerliche Statussymbole. Außerdem sollte es im Grenzland oder in Polen nicht gleich gestohlen werden. Weil es alt war, roch es kaum oder gut, zum Beispiel nach den Äpfeln, die er öfter vom Bauernhof der Freunde in Brandenburg mitbrachte.
Mit einem knurrenden Satz war der Schäferhund bei ihm, und genauso schnell hatte er ihn erkannt und umtänzelte ihn nun mit eingeklemmtem Schwanz. Jacek hatte ihn aus der Berliner Werkstatt auf diesen Hinterhof in Słubice mitgenommen. Konrad spürte die Rippen des mageren Tieres an seinen Knien.
Das Herrchen war besser genährt.
Es saß unten in der Reparaturgrube und dachte gar nicht daran, sofort zu ihm herauszuklettern. Jacek klopfte die Radaufhängungen und Querlenker eines alten Opel ab. Vor der Stoßstange schwankte eine nackte Glühbirne im Gitterkäfig. Konrad kannte den von Öl verschmierten, untersetzten und doch behänden Mann aus Berlin, wo Konrad seine immer alten und billigen Autos bei ihm hatte reparieren lassen.
Jacek konnte in der Hinsicht fast alles; vor allem half er Konrad aber bei der Suche nach gestohlenen Autos. Auch damit erschöpften sich seine Begabungen nicht. Er vermochte ewig über die große Politik zu dozieren und tat das mit derart rhetorischer Selbstsicherheit, dass man sich fragte, weshalb er sich hier immer noch mit Autokarosserien dreckig machte. Konrad kam sich mit dem formlos angehäuften Wissen seines abgebrochenen Studiums im Vergleich dazu ganz weich vor. Keinen einzigen Satz brachte er so überzeugend wie Jacek hervor. Einmal hatte Jacek rücklings unter einem Auto gelegen, für einen Augenblick den Schlüssel sinken lassen und gesagt:
«Wir leben in einer Übergangszeit.»
Konrad kam mit einer Tasse aus dem Kabuff zurück, das als Büro diente, rührte im Nescafé und war beeindruckt.
Jacek zog die Mutter fest.
«Wir brauchen neue Vordenker», erklärte er. Neben der kleinen Werkstatt betrieb Jacek einen Abschleppdienst, die Grenzen zwischen den Gewerben sind fließend. Jacek schleppte auch Autos ab, die ihm nicht gehörten und von denen bald niemand mehr wusste, wem sie je gehört hatten. Das interessierte Konrad aber nicht. Er brauchte Jaceks Tipps, der fast immer wusste, welches Auto wann über die Grenze gebracht worden war.
Jetzt kletterte er endlich aus der Grube, wischte sich die Maulwurfspranken, viel zu groß für den gedrungenen Körper, an einem groben Tuch ab und schob ihm die Hand hin, in der Konrad seine eigene immer gern ein paar Sekunden ruhen ließ. Die Furchen waren schwarz von Motoröl.
«Gut durch die Zone gekommen?», lachte der Pole.
«Gibt’s ja nicht mehr», winkte Konrad ab.
«Kein Wunder, die wollten ja gar nicht frei sein, haben sich sofort dem nächsten großen Bruder an den Hals geschmissen», dozierte Jacek schon.
«Ja, ja.»
Heute hatte Konrad keine Zeit und keine Lust auf diese Diskussionen. Früher war das anders gewesen, an endlos langen Nachmittagen auf dem dunklen Werkstatthof in Schöneberg, als er sein ganzes Leben noch vor sich wähnte und mit den Fragen seiner Magisterarbeit auch gleich die Probleme der Menschheit zu lösen glaubte. Als Marlene noch nicht aufgegeben hatte, als sie noch eine Sparringspartnerin war, mit der man sich nach überstandenem Kampf vereinigen konnte. Heute war da nichts mehr, heute musste er nur schnell weg, das Auto suchen, weiter im Osten. Wen hätte er auch vor Jacek in Schutz nehmen sollen? Die unrasierten Männer, denen er morgens im Supermarkt in Hellersdorf begegnete, nach der Nachtschicht in Hoppegarten zwei S-Bahn-Stationen weiter westlich? Es zog ihn unwiderstehlich in die großen, leeren Einkaufshallen, die nach der Wende entstanden waren. Real. Netto. Ganz egal. Manchmal ging er hinein, ohne etwas zu brauchen. Nur um die Räume und die Kassiererinnen auf sich wirken zu lassen. Sie waren anders als die im alten Westen. Munter wie Fische im Wasser, als spürten sie noch den Zusammenhalt des VEB-Kollektivs. Glockenhell riefen sie sich Scherze zu, lachten über Transportbänder und wartende Kunden hinweg. Als wäre es ein Glück, hier zu arbeiten, und alles im Leben immer nur halb so schlimm. So wie damals.
Was wirklich passiert war, sah man an den Männern. Er begegnete ihnen in den Gängen, sie verrieten sich durch einen halb kindisch-beleidigten, halb lüstern-frechen Lippenausdruck. Verschlagene Blicke, Hände, rotglänzend wie die von Neugeborenen, die den Einkaufswagen schoben. Es waren Männer, deren bisheriger Lebensgang, von Lauf kann man ja schwerlich sprechen, einen schmerzhaften Dämpfer erlitten hatte. Sie fühlten sich ungerecht behandelt. Weil sie gleichzeitig ein schlechtes Gewissen hatten, ließen sie sich alles gefallen. Nur der Biervorrat musste pünktlich aufgefüllt werden. Konrad ging gern durch diese Märkte. Hier konnte er, selbst ein Nachtwächter, sich mit dem Anblick der anderen Menschen trösten. Einige von ihnen machten wahrscheinlich den gleichen Job wie er.
«Ich wollte eigentlich …»
«FuckYouHilas sind das, keine Männer», unterbrach Jacek ihn.
Sein polnisches Lachen war eine Neutronenbombe. Es ließ die deutsche Angst wie die Sorge um das mühsam angesparte Auto zu Staub zerrieseln. Jacek hatte immer Schwierigkeiten gehabt, sich in seine Opfer hineinzuversetzen. Gemäß dem polnischen Männlichkeitskult galt es als verachtenswert, die eigene Freiheit für staatliche Fürsorge hinzugeben. Polnische Männer müssen kämpfen. In diesem beinahe kindischen Stolz riskieren sie maßlos viel, aus Lust an der Geste. Die polnischen Kavalleristen, die Napoleon auf dem Weg nach Russland begleiteten, ritten vor seinen Augen in den reißenden Fluss und ertranken. Mit Argumenten darf man ihnen gar nicht kommen, sonst trumpfen sie erst richtig auf. Und alles Staatliche muss weggefegt werden, sowieso.
Jacek hatte ihm nicht nur die Verachtung für bürgerliche Sicherheit beigebracht, sondern auch ganz praktische Dinge. Worauf man bei der Fahrgestellnummer achten muss und wie man erkennt, ob sie verändert worden ist. Und wie man ein Auto knackt. Das hatten sie geduldig an den alten Karosserien auf dem Autohof in Schöneberg geübt. Konrad war handwerklich völlig unbegabt, über die leichteren älteren Modelle war er nicht hinausgekommen. Er schaffte es gerade so, eine Schnur mit Schlaufe oder einen langen Draht hinter die Fahrertür zu ziehen. Bei einigen Modellen braucht man die Verkleidung der Zündverkabelung nicht aufzubrechen, sie lassen sich mit einer polnischen Münze starten, dem Grosz, Gegenwert ein Pfennig, den man in das abgenutzte Zündschloss steckt.
«Sei vorsichtig in Kiew, mit den Russen», mahnte Jacek.
«Ukrainer», korrigierte Konrad.
«Egal, die sind alle verrückt.»
1993 hatte ein Soldat der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte seinen besten Freund erschossen, weil der ein Auto nicht rechtzeitig geliefert hatte. Seitdem konnte man mit Jacek über dieses Thema nicht mehr reden.
Das Wort «verrückt» hatte neulich auch Muschter benutzt. Kein Wort ist unschuldig. Wolfgang Muschter war auf den ersten Blick das Gegenteil von Jacek. Ein umgänglicher, schlanker Mittvierziger im meist anthrazitgrauen Anzug, Leiter der Kfz-Schadensregulierung der Versicherung, für die Konrad arbeitete. Irgendwann hatte er ihm den ersten Auftrag anvertraut – anvertraut war das richtige Wort, denn Konrad besaß nicht die geringste Erfahrung. Ein Autodiebstahl in einer Kleinstadt an der polnischen Ostsee. Er war hingefahren und hatte den Fall durch einen glücklichen Zufall nach zwei Tagen aufgeklärt, ein Betrugsfall.
«Verrückte Sache», hatte Muschter gesagt, als er ihm gestern den neuen Auftrag erteilt hatte. «Das sind keine kleinen Autodiebe mehr.»
Sie saßen in den schwarzen Sesseln einer Hotellobby in der Budapester Straße, Konrad ließ seinen Blick zur Rezeption schweifen.
«Was meinen Sie?»
«Der Fall hat einige unerklärliche Besonderheiten. Normale Auftraggeber und Diebe handeln zum Beispiel rational. Da kennen wir die Gründe, die Abläufe, es gibt wiederkehrende Muster. Irgendjemand will ein bestimmtes Modell, zahlt fünfzig bis sechzig Prozent des Zeitwertes für den Wagen und gibt eine Bestellung auf. Die Banden sind Profis. Sie kalkulieren ihr Risiko und führen den Auftrag aus. Deshalb werden sie so selten geschnappt. In diesem Fall haben wir Indizien, dass einiges anders gelaufen ist als sonst.»
«Wem wurde der Wagen gestohlen?»
«Den Namen kann ich nicht nennen.»
Muschter schob ihm die Akte über die polierte Tischplatte und ließ ihn einen kurzen Blick darauf werfen, nach wenigen Sekunden zog er sie wieder zurück.
«Vorstandsmitglied eines deutschen Konzerns. Die Sache ist deshalb delikat, weil dieser Mann sich den Wagen sehr wahrscheinlich hat stehlen lassen.»
«Warum?»
«Sie wissen doch. Der Mensch ist unersättlich. Dieser Vorstand hat auf einmal nicht mehr wie früher jedes Jahr das neueste Mercedesmodell bekommen, sondern nur noch alle zwei Jahre. Kennen Sie sich in den Typen aus? Der Mercedes 500 SE der Baureihe W140 kam 1991 auf den Markt. Zwei Tonnen schwer, mehr als fünf Meter lang, anderthalb Meter hoch, Kugelumlauflenkung, hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker und innenbelüfteten Scheibenbremsen, über zweihunderttausend Mark teuer. Den bekam er 1993. Haftpflicht und Kasko bei uns, wie bei der gesamten Fahrzeugflotte des Konzerns. Und jetzt passen Sie auf. Im März 1994 präsentiert Mercedes-Benz auf dem Genfer Salon ein geliftetes Modell, den S 500. Alles Kleinigkeiten, überarbeitete Heckpartie, vom Eindruck her breiter und niedriger, auch die Kühlerschutzgitter und Scheinwerfer etwas wuchtiger. Stoßfänger und Flankenschutzflächen durch eine umlaufende Sicke horizontal gegliedert. Wissen Sie, was eine Sicke ist?»
«Nein.»
«Sehen Sie. Kleinigkeit, der Wagen hatte sich nur äußerlich ein bisschen verändert. Und trotzdem wollte der Mann jetzt dieses neue Modell haben. Bekam es aber nicht gleich, er hätte noch ein halbes Jahr darauf warten müssen. Deshalb hat er seinen Fahrer mit dem Wagen an die polnische Grenze geschickt, und wenn der sich nicht verplappert hätte, hätten wir nie Wind von der Sache bekommen. An einer Autobahnraststätte, mit einer Zufallsbekanntschaft, einem Fernfahrer aus seiner Heimat, dem Sauerländischen. Jetzt streitet er alles ab und behauptet, er habe auf eigene Faust einen Ausflug nach Osten gemacht. Wer’s glaubt. Sein Chef wollte einfach, dass der Wagen schnell über die Grenze verschwindet.»
«Ist der Mann wichtig für mich?»
«Nein. Die Sache ist nur unangenehm für uns. Die Firma ist Großkunde. Hat Hunderte von Fahrzeugen versichert. Strafanzeige kommt nicht in Frage. Also wollen wir das Auto wiederhaben.»
Konrad nickte.
«Allerdings ist die Sache auch am anderen Ende undurchsichtig. Oder, wenn Sie wollen, verrückt.»
«Nämlich?»
«Es gibt Hinweise, dass das Fahrzeug am helllichten Tag durch die Straßen von Kiew kutschiert. Mit so einem Wagen kann man sich ja auch gar nicht verstecken. Das heißt, wenn er bis Taschkent gekommen wäre, hätten wir vielleicht nie davon erfahren. Aber Kiew liegt noch in unserem alten Einflussbereich. Dort gibt es Augenzeugen, die den Wagen auf dem Kreschtschatik gesehen haben wollen. Unser Anwalt dort konnte uns sogar den Namen des Fahrzeughalters mitteilen.»
«Wer ist es?»
«Sie werden lachen. Der Mann soll fast neunzig sein. Wir dachten erst, es wäre eine gefakte Biographie. In der ehemaligen Sowjetunion werden die Männer höchstens sechzig. Aber es scheint zu stimmen, den gibt es. Wahrscheinlich nur Strohmann. Wer es sich gönnt, mit so einer Luxuslimousine durch die postsozialistische Metropole zu kutschieren, muss gute Kontakte haben, zur Polizei, zur Politik. Das erschwert uns die Arbeit. Deshalb will ich, dass Sie mal hinfahren und sich die Sache aus der Nähe anschauen.»
«Ein Sammler vielleicht?»
«Alles möglich. Melden Sie sich dort bei Jurko Mazepa, unserem Mann vor Ort. Er hilft Ihnen bei der Suche nach dem Wagen, Sie regeln alle Formalitäten und bringen ihn zurück.»
Muschter sah Konrad mit ungewohnter Zuneigung an. «Sie sind sich bewusst, dass dieser Auftrag nicht ungefährlich ist, ja?», fragte er. «Kiew ist ein anderes Pflaster als Polen. Passen Sie auf.»
«Träumst du, Mann?» Jacek stieß ihn in die Seite.
«Was?»
«Wonach du suchst, hab ich gefragt.»
«Ist dir in letzter Zeit ein 500 SE untergekommen?», fragte Konrad.
«Klar.» Jacek grinste schief. «Meine Spezialität, weißt du doch. Stand noch ’ne Weile hier auf dem Hof rum, weil ich keinen Abnehmer für gefunden habe. Hab ihn aufpoliert. Die Nummer nachgeschmirgelt.»
Konrad nickte mäßig amüsiert.
«Zeig mal Kennzeichen und Nummer», sagte Jacek.
Konrad gab ihm den Zettel.
«Falls ich was erfahre, sage ich dir Bescheid. Aber mach dir keine Hoffnung. Wie bist du zu erreichen?»
«Hotel Dnipro in Kiew», sagte Konrad.
«Müde, wa?» Jacek rempelte ihn an. «Du glaubst doch nicht, dass so ein Auto hier unbemerkt über die Grenze kommt.»
«Ist es aber. Und jetzt kutschiert es durch Kiew. Das ist sicher.»
«Komm, ich mach dir einen Kaffee und guck deinen Wagen mal durch. Nicht dass du unterwegs liegenbleibst. Gute Tarnung für einen Ermittler übrigens. Mit der Karre willst du in die Ukraine kommen?»
«Drück mir die Daumen», sagte Konrad.
Fliegen wäre kein Problem gewesen. Das hatte er auch vor der Wende getan, als man sich noch über den Übergang Friedrichstraße zum Flughafen Schönefeld quälen musste. Aber am Anfang eines solchen Falles ist es besser, erst einmal Bodenhaftung zu behalten. Den Fluchtweg des gestohlenen Autos nachzufahren. Die Witterung der Limousine aufzunehmen. Auf einen Tag mehr oder weniger kommt es nicht an, und der Spesenvorschuss der Versicherung reicht eine Weile. Womöglich redete er sich das mit dem Fluchtweg und der Witterung nur ein und wollte sich bloß länger in der gedankenlosen Trance des Autofahrens wiegen.
Die Strecke zwischen Frankfurt/Oder und Warschau bietet Monotonie genug, um den Gedanken nachzuhängen. Um einfach zu vergessen. Bestimmt zum zehnten Mal sang Keith Richards dröge Stimme «Slipping Away», immer wieder drehte Konrad die Kassette um. Er dachte an seinen Onkel. Gestern, nein, zwei Tage war es her, als er einfach auf seinem Stuhl zusammensackte. Als Kind musste er dem Bruder seiner Mutter einmal sehr nahe gewesen sein. Aber er konnte sich nicht erinnern, und das war durchaus ein Problem für ihn. Erst bei der Beerdigung seines Vaters vor einem Jahr war er ihm wiederbegegnet. Danach hatte Konrad noch fast ein Jahr gezögert, bevor er ihn am Schlachtensee besuchte. Um ihm irgendwie zu imponieren, hatte Konrad ihm einen polnischen Roman geschenkt, über den er mal eine Uniarbeit geschrieben hatte.
«Wenn man da nachgräbt, ist es gedanklich ziemlich flach», hatte der Onkel gemeint. «Bunte Schreibkunst, erschöpft sich aber schnell nach dem ersten Glanz der Metaphern. Nimm’s mir nicht übel, wir kennen uns doch ganz gut, wenn auch erst seit kurzem wieder. Mir kommt es vor, der Schreiber lupft den Rock zur Pirouette und meint, damit hätte er die Welt schon bezirzt und bräuchte ihr nicht mehr mannhaft gegenüberzutreten, nämlich mit einem echten Gedanken. Will durch aufgeplusterte Bilder verblüffen und verführen. So wie kleine Jungs. Die sind noch wie Mädchen, reden unheimlich viel. Was meinst du, was du als Kind geplappert hast. Hast damals auch gern Röckchen getragen. Weißt du noch? Dieses grüne, mit Falten.»
Konrad konnte sich an nichts davon erinnern, und es war ihm unangenehm, dass Onkel Wolfgang mehr aus seinem Leben wusste als er selbst.
«In dem Alter ist das normal», fuhr der Onkel fort. «Aber nach der Pubertät wird so was unappetitlich. Dein Autor ist längst erwachsen, aber er will immer noch grotesk und verwirrend sein, die Köpfe verdrehen. Schöne Oberfläche und kein Gedanke dahinter. Deswegen müssen sie so viel von der ‹Seele› reden.»
«Wer?», hatte Konrad, leicht beunruhigt, gefragt.
«Die Slawen. Oder hast du schon mal was vom ‹russischen Denken› gehört? Dafür hört man ständig von der sogenannten ‹russischen Seele›. Das Gedankliche ist ihnen zweitrangig. Versteh mich nicht falsch: Rechnen, Kombinatorik, da sind sie gut. Schachspielen, Technik und so was. Staudämme bauen, Flüsse umleiten. Programmieren. Aber das wahre Denken – weißt du, was ich meine? Mit der Welt auf Augenhöhe sprechen. Von Mann zu Mann. Wenn du so willst – Liebe machen mit der Wirklichkeit.»
Der Onkel ballte seine rechte Faust.
Konrad war auf seinem Stuhl abgerückt. Onkel Wolfgang hatte ihm bei so einer Gelegenheit schon einmal die Hand auf den Oberschenkel gelegt. Russische Seele, Zweiter Weltkrieg, jedes Thema war dafür Gelegenheit genug. Ganz besonders die harten Körper der Soldaten, die im Kampf auf ihren wahren Wert gewogen wurden … Die alten Wochenschaufilme flimmerten auf dem Bildschirm im Wohnzimmer. Hysterisch klirrte die siegestaumelnde Stimme des Sprechers, und irgendwann tauchte immer Adolf Hitler auf und schritt eine Reihe von Volkssturmleuten ab. Vor einem etwa Fünfzehnjährigen blieb er stehen, strich ihm über den Kopf und stieß die Worte «Deutscher Junge!» aus.
Bei Vaters Beerdigung hatte sich ein älterer Mann im Trenchcoat aus der Menge der Trauergäste gelöst und war auf ihn zugekommen: «Also doch, Rüdigers Sohn. Der Ausdauerläufer. Erkennst du mich nicht?»
Konrad war dem Mann einige Zeit zuvor am Schlachtensee begegnet. Er hatte gerade seine Joggingschuhe festgeschnürt, da sah er über sich diesen Schatten. Ein alter Mann im schwarzen Filzmantel, der sich auf dem Weg kaum so rasch genähert haben konnte, er musste aus dem seitlichen Gebüsch getreten sein.
«Wie ist die Form?», erkundigte sich der Fremde.
«Na ja», druckste Konrad.
«Wir trieben damals auch Sport», erklärte der Mann und hielt am gegenüberliegenden Seeufer nach Umrissen seiner Vergangenheit Ausschau. Dann fügte er hinzu:
«Im Offizierslehrgang.»
«Und heute nicht mehr?», fragte Konrad, obwohl die Frage angesichts seines Alters und der ganzen Gestalt absurd war.
«Sie wissen ja, wie das damals ging. Plötzlich hieß es: Nach Osten. An die Front.»
Konrad machte einige Rumpfbeugen, bemerkte, dass er sich vor ihm verbeugte und wich zwei Schritt zurück.
«Wissen Sie, wie sich das anfühlt, auf dem Boden von Rschew zu stehen?»
«Nein. Hab auch keine Zeit», sagte Konrad und wollte weglaufen, da trat dieser Mann erstaunlich rasch heran und erwischte ihn am Ellbogenknorpel, ein äußerst unangenehmes Gefühl. Konrad riss sich los.
«Das können Sie auch gar nicht wissen», rief der Mann beinahe wütend. «Sie sind zu jung. Es fühlt sich an, als stünde man zum ersten Mal wirklich auf Festland. Gerettet vor den Küsten. Man wendet sich nach Westen und weiß noch: Irgendwo weit dort drüben ist die Reichshauptstadt.»
Er drehte sich zum schmalen Ende des Sees, wo hinter einer Landzunge der Wannsee liegen musste.
«Verstehen Sie?» Er zuckte verächtlich die Schultern. «Berlin. So weit, dass es ganz klein wird, ganz unwichtig, genau wie die Menschen, die man zurückgelassen hat. Die Frauen verlieren ihre Gewalt über dich. Der Himmel wölbt sich über dir, und du weißt: Überall ist Land, ringsum bis zum Horizont. Festland, festes Land.»
Er hatte sich in Rage geredet, was sein Gesicht auf erschreckende Weise formlos und lebendig werden ließ. Als wäre unter dieser Maske jahrelang alles zurückgehalten und verklemmt gewesen. Seine Augen tränten.
Konrad wollte etwas erwidern, doch der Mann machte eine herrische Armbewegung: «Über die zugefrorene Newa. Attackengeschrei. Rennende Leute. Fallen ringsum, sterben wie die Fliegen. Du spürst nichts mehr, du hast keine Angst, nur diese Sicherheit, dass du nicht allein bist, dass hinter dir und neben dir deine Kameraden rennen. Dein Volk. Riesengroß wirst du, wirst selbst ein ganzes Volk. Oder im Flugzeug hinter den Russen her.»
«Was Sie da von den Frauen sagten …», setzte Konrad an, ermutigt vom vertraulichen «du».
«Im Tiefflug geht es die verschneite Straße entlang, auf der sich eine schwarze Ameisenkolonne bewegt. Der Feind! Wie das auseinanderspritzt bei jeder Garbe des Bord-MG, wie das seitwärts in den Schnee hechtet und für immer liegen bleibt.»
Er setzte seinen Hut wieder auf, drehte sich wortlos um und ging.
«Frauen!» Nach wenigen Schritten blieb er noch einmal stehen und spuckte aus. «Damals wusste man, wofür man starb! Da brauchte man kein Nazi zu sein. Wer hat denn schon alles geglaubt? Aber dieses Gefühl der Befreiung … die Hoffnung. Sie haben diese Erniedrigung des deutschen Volkes nicht erlebt. Sie wissen nicht …»
Konrad wollte etwas sagen, aber der Mann hörte überhaupt nicht mehr zu, er brüllte:
«Nichts wissen Sie! Irgendwo dort, wo das Auge nicht mehr hinreichte, wo nur Schnee und Sonnenglast am Horizont war, dort lag ein Ziel. Dieses gute Gefühl, dass nicht alles vergebens und verflucht ist, die Hoffnung, dass dort wenigstens irgendetwas ist …»
Jetzt drehte Konrad sich um und lief weg, das war das Einzige, was er tun konnte. Dann, aus einiger Entfernung, hörte er die Worte:
«Deutscher Junge!»
Er wandte den Kopf im Laufen, da stand dieser Mann mit hängenden Armen mitten auf dem Weg und sprach diese idiotischen Worte aus. Konrad hätte fast gelacht über die einsame Vogelscheuche:
«Deutscher Junge!»
Das kann man sagen, so oft man will, es wird nicht besser davon. Im Gegenteil, das Wort «deutsch» klirrt nur immer leerer und leerer, am Ende klingt es wie zehnmal selbst- und noch immer unbefriedigt.
Und erst in dieser Verbindung. «Deutscher Junge!» war geschmacklos. Eigenschaftswort und Hauptwort berührten sich, rieben aneinander wie ein nass geschwitztes Nylonhemd und wundgescheuerte Haut. Ein Bedeutungsscheusal. Ein Junge ist ein Junge, aber ein deutscher? Ein blonder Junge, das wäre etwas. Oder ein schwarzer.
Am Ende hatte der Mann seinen Mantel doch aufgemacht.
Konrad rannte weg. «Nazischwein», rief er, schon aus sicherer Entfernung, und ärgerte sich, dass seine Stimme so hoch war.
Da hörte er den Mann fragen, unsicher wie ein Blinder:
«Konrad?»
Das war sein Onkel. So hatte es angefangen. Zugegeben, eine schwierige Geschichte. Onkel Wolfgang war etwas anderes als die üblichen seltsamen und schrulligen Onkel, die es in jeder Familie gibt. Er war wie ein Gift. Alle warnten Konrad davor, mit diesem Mann Kontakt aufzunehmen. Noch am Grab des Vaters zog eine Frau ihn am Ärmel und sagte: «Lassen Sie endlich den Jungen in Ruhe.» Marlene entwickelte sofort einen instinktiven Hass auf ihn. Aber Konrads Neugier war geweckt. Beim Joggen hatte er mehrere Male einen Umweg gemacht, um wenigstens an dem kleinen Haus in der Altvaterstraße vorbeizukommen, aber nie geklingelt, immer hatte er sich im letzten Moment bezwungen. Irgendwann hatte er dann doch auf den Knopf gedrückt. Schließlich war es der Bruder seiner Mutter, auch wenn diese ihn nicht mehr interessierte. Sie hatte ihn vor dreißig Jahren alleingelassen. Aber jetzt, da auch sein Vater gegangen war, fühlte er sich mutiger und unabhängiger und wollte wenigstens einmal mit dem Verrufenen reden.
«Liebe machen mit der Wirklichkeit», dachte Konrad jetzt auf der regennassen Fernstraße vor Warschau, eingekeilt zwischen schweren Lkws. In dem Moment fing der Citroën an zu stottern, wie aus Protest. Links und rechts rauschten schon länger quadratische Walmdach-Bungalows im Stil italienischer Landhäuser vorbei, einsam in die freie Flur gestreut. Der Plakat- und Schilderwald am Straßenrand wurde dichter. Konrad konnte den Wagen gerade noch an den Seitenstreifen lenken. Es war vermutlich nicht Jaceks Schuld, es lag wohl an den Franzosen, aber Jacek hätte das sofort wieder hinbekommen. Konrad, der Autojäger, hatte von Fahrzeugmechanik keinen Schimmer. Diese Panne änderte seinen Plan. Er musste um Hilfe bitten und den Wagen in eine Garage im Zentrum schleppen lassen. Am Warschauer Zentralbahnhof stieg er in den Zug, die trockene, heiße Luft des Abteils ließ ihn sofort in einen tiefen Schlaf fallen, aus dem er immer nur erwachte, wenn die Schiebetür aufgerissen wurde und die Grenzpolizisten oder Zöllner ihre fahlen Gesichter ins Licht der Deckenfunzel streckten.
Zwei
Als er neunzehn Stunden später am Hauptbahnhof von Kiew ausstieg, schlug ihm durch die geöffnete Zugtür eine noch größere Hitze entgegen. Als wäre er irrtümlich nach Rom gefahren. Massen von Reisenden strömten mit ihm auf den Bahnhofsvorplatz, viele schleppten unförmig große, rechteckige Plastiktaschen, blau-rot gestreift und mit einem Reißverschluss verschlossen. Hier quirlte das Leben. Aus Buden auf den Bürgersteigen wehte der Duft von Brathähnchen und Pommes frites, Frauen riefen private Übernachtungsmöglichkeiten aus, wollten alles Mögliche verkaufen. Muschter hatte ihn vor den Kiewer Taxifahrern gewarnt und ihm eine verlässliche Firma genannt. Konrad fand den Zettel nicht, stieg in das nächste Fahrzeug und nannte das von Muschter empfohlene Hotel. Der Schiguli tuckerte zwischen schattigen alten Mietshäusern die breite Allee der Schewtschenkostraße bergan, bog in den Kreschtschatik ein und erreichte an dessen nördlichem Ende den Europäischen Platz.
Konrad checkte ein, brachte seine Reisetasche aufs Zimmer, duschte und begab sich gleich darauf zu Fuß auf die Suche nach dem großen Wasser, dessen Geruch bis hierher drang. Er stieg die Treppen vom Wolodymyrski Projizd rechts hoch. Unter dem Rundbogen des Denkmals leuchtete der Fluss in der westlichen Nachmittagssonne.
Es war erst Mai und schon fast so warm wie im Sommer, viel wärmer als in Berlin. Schon am Kreisverkehr war ihm der Duft des Flieders in die Nase gestiegen, jetzt sah er, dass auch die Kastanienblüten sich öffneten. Er wollte nach unten ans Ufer des Dnjepr, verirrte sich aber auf den einsamen, abgesunkenen Betonwegen am Steilhang. Als weit und breit gar niemand mehr zu sehen war, kehrte er um und fand den Weg zum Wasser.
Unter der Dnjeprbrücke schienen dunkle Wirbel sich selbst zu verschlingen. Ein Schwimmer wäre in die Tiefe gerissen worden, selbst ein Ausflugsdampfer mittlerer Größe wich den unheimlichen, trägen Strudeln aus.
Am anderen Ende der Brücke erreichte er die Insel. Erste Sonnenbadende lagen schon am sandigen Strand. In kleinen Holzbuden mit umzäunten Gärtchen wurden Bier und andere Getränke verkauft, aus den Lautsprechern klagten die verminderten Septimen der postsowjetischen Popmusik. Alles so traurig, die Geliebte so fern. Vom Fluss wehte eine kühlende Brise. Sein Blick wanderte stromabwärts, nur ein paar Kilometer, und man wäre in der Steppe. Er stellte sich vor, er würde sein Floß den Strom hinab und dann ans flache Ostufer treiben lassen, und schließlich den Fuß auf das harte, kurze Rispengras setzen. Konrad atmete auf. Dieser Ort und die Weite taten ihre Wirkung. Eigentlich wurde es Zeit, ins Hotel zurückzugehen.
Er hatte für den Tag keine Pläne mehr. Morgen sollte er den Anwalt treffen, ohne seine Unterstützung konnte er nicht viel ausrichten. Die wichtigsten Anhaltspunkte waren der Name und die Adresse von Jurij Solowjow, dem Fahrzeughalter. Einem angeblich fast Neunzigjährigen. Dazu die Fahrgestellnummer und das Kennzeichen. Allein würde er nicht mehr herausbekommen, weder bei der Polizei noch auf dem Zulassungsamt, also war er ganz von diesem Anwalt abhängig.
«Bei diesen Banden gibt es eine Hierarchie», hatte Muschter erklärt. «Die Leute, die hier bei uns die Drecksarbeit erledigen, verdienen am wenigsten. Andere, die die Wagen weiter nach Osten verschieben, kriegen tausend oder fünfzehnhundert Mark auf die Hand, und das sind immer noch arme Schlucker, die ihre Hintermänner gar nicht kennen. Die verdienen richtig daran.»
Im Grunde machte auch Konrad die Drecksarbeit, nur andersherum.
Je länger er auf der Dnjeprinsel herumlief und grübelte, weshalb die Versicherung sich seinen Einsatz so viel kosten ließ, desto unruhiger wurde er. In diesem Zustand brauchte er nicht ins Hotel zu gehen, an Schlaf war nicht zu denken. Irgendwann blieb er stehen, zog den Stadtplan von Kiew heraus, breitete ihn auf einer bröckelnden Ufermauer aus und suchte nach der Adresse. Lemberger Platz, Ecke Artjomstraße. Ausgang der Vorowskij. Altstadt.
So könnte er sich doch wenigstens von weitem schon einmal ansehen, wo dieser Solowjow wohnte. Aus purer Neugier. Außerdem, man stelle sich vor, der Mercedes würde dort vor der Haustür stehen. Er hatte keinen rostigen Nagel in der Hosentasche, aber mindestens einen Finger würde er auf den Kotflügel legen, so viel war sicher. Und er wäre wieder der Held, der Fall in Rekordzeit gelöst.
Die schmalen Altstadtstraßen, die vom Kreschtschatik bergan führten, brachten ihn bald außer Atem. Er nahm bewusst nicht den kürzesten Weg. Als er sich schon in der Nähe des Hauses wusste, bog er noch einmal nach links ab und machte einen Umweg. Er genoss das Gefühl, sein ahnungsloses Ziel zu umkreisen. Er wollte den Anblick des Hauses verzögern. Die großen Torbögen der alten Mietshäuser gaben den Blick auf Hinterhöfe und Gartenhäuser frei. Er spazierte hier und dort hinein, sah sich um, entdeckte interessante Garagen und Schuppen. Falls der Wagen irgendwo versteckt war, dann vermutlich zwischen solchen verwinkelten Gebäuden.
Er fand nichts.
Als er das Haus erreichte, zeichneten sich dessen Ziegel im Dämmerlicht der Straßenlaterne in einer unerkennbaren Farbe ab. Über dem linken Dnjeprufer, in Richtung Moskau, hing blass und pockennarbig der zunehmende Mond. Das war eigentlich ein gutes Omen. Im zweiten Stock hatte jemand das Licht eingeschaltet, die anderen Fenster waren dunkel.
Neben der Haustür fand er ein Metallschild mit acht Knöpfchen, ohne Nummern und Namen. Nur diese kleinen Knöpfchen. Konrad drückte versuchsweise gegen den runden Griff, die Tür ging auf, sie war nur angelehnt.
Jetzt wurde er ein bisschen nervös. Selbst wenn dieser Jurij Solowjow schon neunzig war, die sehnige Wut des Alters kann schmerzhaft sein.
Die Anmutung dieses Treppenhauses im Zentrum von Kiew, in einem Gebäude, das noch aus vorrevolutionärer, spätestens stalinistischer Zeit stammte, war nach allem, was sich hier zugetragen haben musste, erstaunlich bürgerlich. Nichts kündete von Gefahr. Der Kokosteppich auf den hellen Steinstufen dämpfte das Geräusch seiner Schritte, kurz überkam Konrad sogar ein Gefühl, als sei er nicht fremd hier, sondern nach langer Irrfahrt zurückgekommen. Es roch anders als in der Mansteinstraße, anders als im Treppenhaus bei Marlene in Steglitz. Nicht nach Reinigungsmitteln, nicht nach Bohnerwachs oder wochentäglichem Eintopf, auch nicht nach dem Erkennungsgeruch des bürgerlichen deutschen Sonntags, dem säuerlich-bitteren, angebrannten Braten, bei dem einem sofort der schwarze Fleischrand vor Augen steht. Es war aber auch nicht allein die Summe von Roten Beten, Rindfleisch, Fett und Knoblauch. Es war noch etwas anderes, das er nicht definieren konnte. Katzenpisse vielleicht. Etwas von einem wilden Tier.
Du kommst in ein fremdes Land und glaubst plötzlich, du wärst schon einmal da gewesen. Als hättest du etwas aus deinem Leben vergessen, als wäre dir dieses Etwas – diese Heimat – vor langer Zeit ausgetrieben worden, ohne dass du dich daran erinnern könntest.
«Was wollen Sie?»
Konrad erschrak. Er war bereits im zweiten Stock, die erleuchtete Wohnung war die richtige, sein Finger hatte schon auf den Klingelknopf gedrückt. Die Stimme klang nicht sehr freundlich.
«Ich bin unten auf dem Parkplatz vorbeigefahren und habe versehentlich das Auto Ihres Mannes beschädigt.»
Die Frau musste mindestens siebzig sein, sie war nicht groß, stand aber gerade und aufrecht in ihrem straff sitzenden, schwarzen Kostüm in der Tür. An der Decke des langen Flurs hinter ihr brannte eine nackte Glühbirne. Ihr Haar war noch immer schwarz, vermutlich gefärbt, darin einzelne graue Strähnen. Ihre dunklen Augen sahen ihn klar, fast durchdringend an. Das war keine verhuschte Babuschka, obwohl sie zweifellos ein bisschen erschrocken war.
«Meines Mannes?»
«Ja. Jurij Solowjow. Er ist doch der Halter des Mercedes. Kann ich ihn sprechen?»
Sie sah Konrad vorwurfsvoll und kopfschüttelnd an.
«Was reden Sie denn. Mein Mann ist doch schon gestorben.»
Sie drückte die Tür zu. Nicht, wie man sie einem Vertreter vor der Nase zuknallt, eher, als rechnete sie noch mit einer Erklärung. Bis zuletzt blieb sie in dem Türspalt stehen.
Aber er sagte nichts mehr, den Gefallen tat er ihr nicht. Er hatte sie gesehen, das genügte, denn seiner Erfahrung nach war es so: Wenn man einmal einen Zipfel in Händen hält, darf man keinesfalls mehr loslassen. An so einem Zipfel, wie klein er auch sein mag, hängt immer die ganze Geschichte, der ganze Schlamassel. Jede Tat ist leichter getan, als ihre Spuren beseitigt sind. Irgendeine Winzigkeit bleibt immer zurück, und dann geht dort jemand vorbei und bekommt den Geruch in die Nase. Einen Geruch so fein, dass man ihn im ersten Augenblick für Einbildung hält, so hoch oben in den Nebenhöhlen, dass er fast schon Gedanke ist. Knoblauch in heißem Olivenöl oder das splitternde Holz des Faulbaums, so dezent, dass man sich wundert, dass er einem überhaupt aufgefallen ist. So einen Geruch darf man nicht übergehen. Ihm muss man seine ganze Aufmerksamkeit schenken, muss ihm nachgehen.
Deshalb schob er jetzt auch keinen Fuß in die Tür. Er war ruhig stehen geblieben, hatte ihrem Blick bis zuletzt standgehalten und sich erst umgedreht, als die Tür ins Schloss gefallen war. Er wusste, dass sie ihn durch den Spion beobachtete.
Geradezu beschwingt verließ er das Haus, die Aufregung hatte ihn belebt.
Sie hatte ihr Gesicht gezeigt. Und ohne es zu wollen, hatte sie ihm auf Anhieb eine Menge verraten. Dass sie die Frau von Jurij Solowjow war, sie hatte ja nicht widersprochen. Und dass dieser Jurij schon tot war. Zwei wichtige Dinge.
Und merkwürdig, dieses Wort, «gestorben» hatte sie gesagt, nicht «tot». Wer fuhr denn dann jetzt mit dem Mercedes durch Kiew, ein Gestorbener? Und warum «schon»? Bei einem Mann von fast neunzig Jahren?
Immerhin, und das war das Allerwichtigste, hatte sie überhaupt etwas gesagt. Gelogen oder nicht, das war erst einmal gleichgültig. Konrad hatte sich daran gewöhnt, mit Lügen zu leben. Eine Lüge ist immer noch besser als Schweigen. Alles ist besser als dieses wochenlange Schweigen, das sich irgendwann zu Monaten ausgedehnt hat und nun anfängt, schlecht zu werden, in die Jahre hineinzuwachsen, ein am Ende uferloses Schweigen, das dennoch immer noch schmerzt wie am ersten Tag. Ein Schweigen, das einem die Luft zum Atmen abschnürt. So dass man nur ganz flach atmen kann, nur noch Ersatzluft, die einem das Gefühl gibt, alles andere auf der Welt wäre nur Ersatz.
Er war ihr doch nicht zu nahegetreten.
Er hatte nur nach dem Auto ihres Mannes gefragt.
Draußen auf der Straße atmete Konrad tief durch. Touristen grölten an ihm vorbei, Amerikaner. Eine Frau aus der Gruppe konnte den Blick nicht von seinem Gesicht lösen, als hätte sie erkannt, dass er nicht hierhergehörte.
Ihm war nach Tanz zumute. Nach Gesang. Nach dieser Begegnung musste er erst einmal verschnaufen. Das war doch etwas, mit einem einzigen mutigen Schritt war er ein gutes Stück weitergekommen. Hinein in dieses andere Leben, von dem er vorher nichts kannte als die spärlichen Angaben auf dem Versicherungsformular. Solche Fragebögen enthalten immer nur die sprödesten Daten. Name, Adresse, Geburtstag. Für den geübten Blick allerdings ist schon das Geburtsjahr, diese weit entfernte, schwankende Boje im einförmig grauen Nebel des Jahrhunderts, ein vielsagendes Faktum.
Er balancierte auf den löchrigen Gehsteigen, lief über die wackligen Treppen der Unterführungen, bis er sich glücklich den Fuß umknickte, kam spät ins Hotel zurück. Gegen seine Gewohnheit ging er in die Hotelbar, aß endlich einen Happen und trank zwei Tschernigower Pils. Auf dem Zimmer schaltete er den Fernseher ein und ließ sich rückwärts auf das breite Bett fallen.
Gegen zwei, er war in seinen Sachen bei laufendem Fernseher eingeschlafen, läutete das Zimmertelefon. Er nahm ab und hörte eine angenehme Stimme auf Russisch fragen: «Вам не скучно? Хотите компанию? Молодая девушка?» – Hätten Sie nicht Lust auf ein wenig Entspannung mit einem jungen Mädchen? Er kannte diese Anrufe. Beim ersten Mal, vor Jahren in einem Moskauer Hotel, war er aus dem Schlaf hochgeschreckt, hatte nach dem Lichtschalter getastet und nicht gewusst, wo er war. Er suchte lange mit der Hand nach dem Telefonhörer und begriff, als er ihn endlich hatte, nicht, wer zu ihm sprach. Dem verwirrt hingestotterten Ja schickte er, als es schon fast zu spät war, ein Nein hinterher.
Diesmal sagte er einfach: «Да, пожалуйста.» – Ja, bitte. Und er staunte über sich selbst. Erklären brauchte und wollte er sich nichts. Das hier hatte nichts von Muschters «Man gönnt sich ja sonst nichts», wenn er von einem Taucherurlaub auf den Malediven oder anderen luxuriösen Freizeitvergnügen erzählte. Vielleicht war es die aufsässige Lust, noch tiefer in ein anderes Leben hineinzugreifen und es zur Preisgabe von Geheimnissen zu provozieren.
Als Konrad den Hörer aufgelegt hatte, fiel er wieder in einen halben Schlummer, so hätte er ohne weiteres die ganze Nacht durchschlafen können. Er hörte weder den Fahrstuhl noch die Schritte auf dem dicken Teppich im Flur. Wie aus dem Nichts pochte es an der Tür, ganz leise. Er öffnete und huschte mit einem Satz auf die Decke zurück. Das Mädchen kam herein, breitete ihre Jacke über die Sessellehne und setzte sich an den Bettrand. Sie hatte ein sympathisches, weiches Gesicht. Er legte ihr eine Hand auf den Schenkel. Der Muskel, schmal wie der eines Kindes, spannte sich und ließ wieder locker, sodass er durch die Strumpfhose die zierliche Kniescheibe ertasten konnte. Das Licht war gedämpft, nur die gelbe Nachttischlampe leuchtete. Das Mädchen duftete nach Schminke, ihr Mund schmeckte nach Zigaretten.
Im Fernseher lief eine Kaffeereklame, eine tiefe Männerstimme raunte von «nižnist smaku», von der Zärtlichkeit oder Zartheit des Geschmacks, während ihm das Mädchen mit ihrer Zunge, rau wie ein Reibeisen, über den Mund fuhr. Vielleicht kamen ihm die Wörter deshalb so merkwürdig vor, weil er gerade mit einem lebendigen Menschen verschmolz.
Nachher ging sie nicht gleich. Vielleicht nutzte sie die Gelegenheit, dem Druck ihrer Arbeit zu entkommen und sich ein paar Minuten bei ihm auszuruhen. Er zweifelte nicht an ihrer Behauptung, dass sie auf diese Weise ihr Jurastudium verdiene. Er zweifelte auch nicht an ihrem Alter, einundzwanzig Jahre, oder daran, dass sie nächstes Jahr ihr Diplom machen wollte. Sie blieb einfach neben ihm liegen, steckte sich eine Zigarette an und redete wie eine alte Bekannte.
«Und was tust du?», fragte sie irgendwann.
«Ich suche ein Auto.»
Als sie weg war, lag er fast bis zum Morgengrauen wach. Die haarigen grauen Wolldecken hatte er in den Schrank zurückgelegt. Es war so schon zu warm. Er starrte an die Zimmerdecke. Er hatte sich gewaschen, doch ein Gefühl von Klebrigkeit war geblieben. Er lauschte auf die Geräusche von draußen. Versuchte, sich abzulenken, indem er die bisherigen Informationen zusammenfügte. Er versuchte immer, seine Fälle im Kopf zu lösen. Versuchte auch diesmal, ein Bild in den vorhandenen Informationen zu erkennen, ein Muster. Sobald er dieses Bild erkannt hätte, wüsste er, nach welchen Spuren vor Ort er zu suchen hätte.
Muschter. Konrad hatte nicht die paranoische Neigung, zufälligen Namensähnlichkeiten tiefere Bedeutung beizumessen. Dabei arbeitete das Computerprogramm, das man ihm in der Zentrale in Köln vorgeführt hatte, genau nach diesem Schema. Es durchforstete die Datenbestände nach wiederkehrenden Mustern. Er ärgerte sich damals, dass man ihm ausgerechnet dieses Programm nicht näher hatte erklären wollen. Soweit er verstanden hatte, ging es dabei um das Übereinanderlegenvon Strukturen, das Erkennen von Wiederholungen. Wenn zwei Gegner einer Autokollision oder eines Unfalls öfter in den Schadensmeldungen auftauchen oder gar am selben Ort gemeldet sind, deutet das auf fingierte Zusammenstöße hin. Das waren die allereinfachsten Anhaltspunkte. Es gab gewiss andere, von denen man ihm nichts gesagt hatte, weil man nicht wollte, dass sie sich herumsprachen. Das Programm legte die Informationen der einzelnen Fälle übereinander, wie Zeichnungen auf Pauspapier. Wo sich etwas wiederholte, verstärkten sich die Umrisse und ließen Konturen eines Bildes hervortreten.
Das Programm des ukrainischen Senders lief weiter, und alle halbe Stunde, zur Kaffeereklame, glaubte er, ihr geschicktes Stöhnen zu hören, und roch ihr Parfüm und eine Spur von süßem Achselschweiß. Die Filme liefen in russischer Sprache, diese Reklame auf Ukrainisch. Er konnte die Fernbedienung nicht finden und sich nicht aufraffen, aufzustehen und den Apparat direkt auszuschalten. Irgendwann ging er doch ans Fenster, schob den Vorhang zur Seite und blickte auf die Fahrbahnen des Rondos hinab. Um diese Zeit fuhren nur einzelne Autos vorbei. Eine Weile beobachtete er den Verkehr. Vielleicht schwamm ja dort draußen im diesigen Laternenlicht plötzlich der 500 SE vorbei, wie ein Traumschiff. Vielleicht genoss der Neunzigjährige es, um vier Uhr morgens mit seinem Beutefahrzeug durch die Stadt zu gleiten. Ein ehemaliger Parteibonze, der sein Geld über die Wende gerettet hat, oder ein Geheimdienstler. Vielleicht auch der Vater eines Oligarchen, dem sein Sohn ein Geschenk zum runden Geburtstag gemacht hat. Womöglich hatte er sogar einen Chauffeur. Aber außer zwei Betrunkenen, die sich anbrüllten, konnte Konrad nichts entdecken. In diesem Moment schien es ihm ganz unwahrscheinlich, dass der Wagen tatsächlich noch in der Stadt sein sollte. Vermutlich war er längst weiter nach Moskau oder Almaty verschoben worden, und er jagte ein Phantom. Möglicherweise hatte er durch den Besuch bei Solowjows Frau alle Beteiligten aufgescheucht. Nein, das war wohl doch keine gute Idee gewesen, in dieser Hinsicht.
Er ging unter die Dusche und seifte sich noch einmal ein. Vom Bad aus sah er den Widerschein der bunten Fernsehbilder auf der Zimmerwand flackern, hörte die gedämpften Stimmen. Das Hotelzimmer war zu groß für ihn. Er brauchte kein Doppelbett.
Konrad war jetzt bald achtunddreißig, aber manchmal wunderte er sich immer noch über sich selbst.
Am anderen Morgen ärgerte er sich über seine Offenherzigkeit, er hatte viel zu viel geredet. Jetzt suchte er wie ein ängstlicher Kleinbürger das Hotelzimmer nach Spuren der Nacht ab. Dabei wusste das Hotelpersonal ohnehin Bescheid, die Rezeption hatte ihn ja aus der Gästeliste herausgesucht. Mit dieser ebenso beruhigenden wie unangenehmen Erkenntnis ging er in den Frühstückssaal, kippte einen Kaffee hinunter, ließ die heißen Eierkuchen mit Marmelade und den Grießbrei stehen und machte sich auf den Weg in die Stadt.
Mazepas kleines Büro befand sich in der Chmelnickijstraße in einem jener Neubauten, die überall aus dem Baugrund schossen. Ein blassgrünes Mietshaus aus den dreißiger Jahren, längst dem Untergang geweiht, schmiegte sich noch an die Hochhausfassade aus schwarzen Kunststeinfliesen. Eine Kamera überwachte den Haupteingang.
Jurko Mazepa wirkte so hellwach, dass Konrad sich auf der Stelle unfrisch und unausgeschlafen vorkam.
Wangen und Kinn des Brünetten waren frisch rasiert, die helle Haut glänzte vom Rasierwasser und war punktiert von schwarzen Haarstümpfen, das kräftige Haupthaar feucht nach hinten gekämmt. Der Mann wusste, wie gut er aussah. Während seinen eigenen Fingern immer noch der Geruch nach Frau anhaftete, den mehrmaliges Waschen nicht wegbekommen hatte, duftete Mazepa nach einem jener prickelnden Aftershaves, die Konrad in Berlin bisweilen zum Wechsel des S-Bahn-Waggons veranlassten. Hier nahm er diese dezente Körperverletzung in Kauf. Man erträgt Dinge leichter, wenn sie einer anderen Wirklichkeit angehören. In wenigen Tagen würde er nach Berlin zurückfahren, am Lenkrad eines Mercedes 500 SE. Dann konnte er die Szenen ausknipsen wie mit der Fernbedienung.
Ohnehin war er fasziniert von diesem Mann. Ist es nicht merkwürdig, dass nach politischen Umschwüngen die Menschen, die im alten System in guten Positionen waren, auch in dem neuen bald wieder oben schwimmen? Während viele von denen, die zuvor gelitten hatten oder sich einfach nur innerlich abwandten und in ihre Nischen zurückzogen, auch unter den neuen Verhältnissen nicht aus dem Halbdunkel herausfinden, sich nicht neu einrichten können in der gewandelten Gesellschaft? So als wären sie unentrinnbar in ihren alten Verletzungen gefangen, abhängig davon, als bräuchten sie die ewige Zurücksetzung, um sich lebendig zu fühlen.
«Freut mich, Sie kennenzulernen. Wie war Ihre Fahrt? Möchten Sie einen Kaffee?»
«Ja, bitte.»
«Sind Sie mit Ihrem Hotel zufrieden?»
«Sehr, danke.»
«Dann lassen Sie uns gleich zur Sache kommen. Sie haben gewiss auch wenig Zeit. Zwei Dinge habe ich herausgefunden, die für Sie von Interesse sein könnten.»
«Nämlich?»
«Erstens – das wissen Sie bereits, aber wir haben es noch mal überprüft–, der gesuchte Wagen ist tatsächlich auf den Namen Jurij Solowjow zugelassen. Die von Ihnen genannte Fahrgestellnummer wurde auch bei der Anmeldung angegeben, dürfte also auch am Fahrzeug selbst nicht manipuliert worden sein. Man hegt demnach keine großen Befürchtungen, dass der Wagen hier kontrolliert werden könnte.»
Er machte eine Kunstpause.
«Meine zweite Entdeckung ist eher geeignet, die Suche zu erschweren.»
Konrad spielte mit: «Nämlich?»
«Der Fahrzeughalter ist vor drei Monaten gestorben.»
Also doch.
«Wenn er gestorben ist, muss ja jemand den Wagen geerbt haben.»
«Langsam, langsam», lachte Mazepa. «So schnell geht das hier nicht.»
«Was wissen wir über diesen Jurij Solowoj? Wer war er?»
«Militär im Ruhestand, Mitglied der KPdSU, bis zum Zerfall der Sowjetunion. Kein wirklich hohes Tier, aber immerhin Bezirkschef oder so was Ähnliches. Veteran des Großen Vaterländischen Krieges. Bei der Demobilisierung im Range eines Obersten. Viel mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen.»
«Woran ist er gestorben?»
«Halten Sie das für wichtig? Ich finde keine Hinweise auf einen unnatürlichen Tod. Vermutlich Krebs, oder Herz, Kreislauf, wenn er Glück hatte. Altersschwäche. Mit neunundachtzig.»
«Aber ist es nicht umso merkwürdiger, dass jemand in dem Alter ein Auto anmeldet und kurz darauf stirbt?»
«Ein Indiz dafür, dass er nur Strohmann war.»
«Trotzdem würde ich gern mehr über ihn wissen.»
Mazepa sah Konrad zum ersten Mal verwundert an. «Wozu? Er ist tot.»
Konrad mochte es nicht, wenn man seine Methoden in Frage stellte. «Das kann ich Ihnen später erklären. Erst einmal muss ich möglichst viel über ihn in Erfahrung bringen. Alles, was Sie herausbekommen können. Den Totenschein zum Beispiel. Wo ist er bestattet worden? Gab es eine Obduktion? Haben Sie Fotos von ihm?»
Jurko guckte erstaunt.
«Vielleicht ist es gar nicht schlecht», beschwichtigte Konrad, «wenn wir auf unterschiedliche Art ermitteln, gewissermaßen von zwei Seiten. Was werden Ihre nächsten Schritte sein?»
«Da der Halter erst vor kurzem verstorben ist, muss ich klären, auf wen das Eigentum rechtlich übergeht», sagte Mazepa. «Wer in formalem Sinn der Erbe des Fahrzeugs ist. Oder an wen es verkauft wurde. Von diesem Eigentümer können wir es dann zurückfordern. Das dauert eine Weile, sollte der Betreffende aber klagen, zieht sich die Sache hin: gutgläubiger Erwerb und so weiter. In einigen Tagen kann ich Ihnen sagen, ob es nicht sinnvoller ist, dass Sie zunächst nach Berlin zurückfahren.»
«Gut. Ich habe jedenfalls gestern Abend schon mit der Ehefrau gesprochen.»
«Ehefrau?»
«Ja, der Frau von Jurij Solowjow. Beziehungsweise seiner Witwe.»
Jurko setzte seine Kaffeetasse ab. Zum ersten Mal verriet er eine deutliche Regung, weit mehr als Erstaunen.
«Ja, wissen Sie, es war so ein schöner lauer Abend. Ich war gerade angekommen und war noch nicht müde, hatte Lust auf einen Spaziergang und bin einfach hingeschlendert, in die Altstadt. Und plötzlich stand ich vor diesem Haus. Ich wollte mir ansehen, wo der Täter wohnt. Und da habe ich eben geklingelt. Die Frau weiß angeblich nichts über den Mercedes. Damit Sie da schon mal Bescheid wissen.»
«Das meinen Sie nicht im Ernst, oder?», lachte Mazepa.
«Doch.»
Das Gesicht des Anwalts verzog sich vor Ärger. «Wenn das stimmt, ist das Auto weg. Das war absolut unprofessionell. Diese Frau hat mit der Sache wahrscheinlich gar nichts zu tun, aber Sie haben dadurch … alle Pferde scheu gemacht. Alle.»
«Ihren Mann kann sie ja nicht mehr warnen.»
«Aber die Täter.»
Konrad sah ihn an und sagte nichts.
«Das hätten Sie besser mit mir abgesprochen.»
Er hatte vermutlich recht, aber kindlicher Trotz gestattete es Konrad nicht, das zuzugeben.
Eine längere Pause entstand.
«Der Wagen ist seit einigen Tagen nicht mehr gesehen worden», sagte Mazepa, sachlich, nur um das Schweigen zu brechen.
«Wohl nicht deshalb, weil ich aufgetaucht bin», witzelte Konrad, nicht minder lustlos.
Warten? Mehrere Tage? Ein Scherz. Sollte Konrad sich so lange an den Dnjeprstrand legen und sonnen? Sich in Spielhallen vergnügen? Über Friedhöfe schlendern? Die Nächte mit der Jurastudentin verbringen und danach ausschlafen?
Er setzte sich auf eine Bank in der von weißem Baustaub bepuderten Grünanlage gegenüber dem Haus am Lemberger Platz. Nebenan wuchs ein Rohbau in die Höhe. Er blieb gern irgendwo an einer Stelle und beobachtete, stundenlang konnte er zum Beispiel auf Bahnhöfen warten. Wenn der Fahrzeughalter in diesem Haus gewohnt hatte, war es nicht unwahrscheinlich, dass sich das Auto noch irgendwo in der Nähe befand. Vielleicht konnte Solowjows Frau ihn von dort oben sogar sehen.
Nach zwei Stunden kam sie aus dem Haus. Er stand auf und folgte ihr. Er wollte wissen, wohin sie ging, mit wem sie Kontakt pflegte. Wen sie jetzt vielleicht warnte. Ein paar Seitenstraßen weiter verschwand sie in einem Hauseingang. Er war nicht schnell genug, um durch die zufallende Tür zu schlüpfen. Er notierte alle Namen von den Türschildern, unter anderem den einer Arztpraxis.