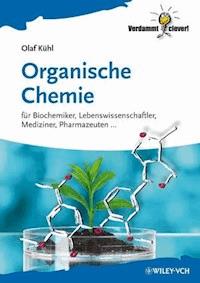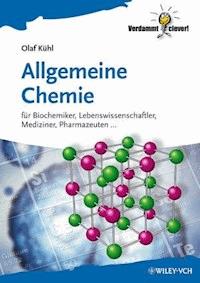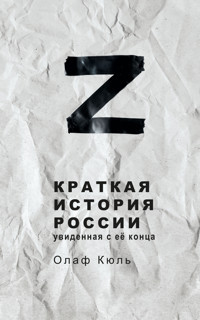Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hierax Medien
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Spätestens mit dem Angriff auf die Ukraine stellt sich die Frage, wie Russland zu dem wurde, was es heute ist. Olaf Kühl, langjähriger Osteuropareferent der Regierenden Bürgermeister von Berlin, kennt das Land wie nur wenige; er hat es über Jahrzehnte intensiv bereist, auch abseits der großen Metropolen, bis nach Sibirien und in den Fernen Osten. In seinem Buch zeigt er, wie sich Russland seit dem Zerfall der Sowjetunion entwickelt hat – wie hellere, freiere Köpfe allmählich durch regimehörige Funktionäre ersetzt wurden, bevor eine mafiöse Geheimdienstelite die Macht an sich riss. Fassbar wird all das in den Schicksalen der Menschen, von denen Kühl erzählt: darunter ein erfolgreicher Unternehmer, der, weil er sich vom Geheimdienst nicht erpressen lassen wollte, im Gefängnis gefoltert und getötet wurde; oder auch ein Separatistenführer, der 2014 an der Annexion der Krim beteiligt war und mittlerweile auf Konfrontation zu Putin geht. Eines lässt sich schon jetzt erkennen: Die völkisch-nationalistische Außenpolitik wird zu heftigen, gewaltsamen inneren Umbrüchen führen, bis hin zum Zerfall des Landes – mit gefährlichen Konsequenzen auch für Europa. Ein ebenso fesselndes wie weitsichtiges Russland-Porträt.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Olaf Kühl
Z
Kurze Geschichte Russlands, von seinem Ende her gesehen
Über dieses Buch
Spätestens mit dem Angriff auf die Ukraine stellt sich die Frage, wie Russland zu dem wurde, was es heute ist. Olaf Kühl, langjähriger Osteuropareferent der Regierenden Bürgermeister von Berlin, kennt das Land wie nur wenige; er hat es über Jahrzehnte intensiv bereist, auch abseits der großen Metropolen, bis nach Sibirien und in den Fernen Osten. In seinem Buch zeigt er, wie sich Russland seit dem Zerfall der Sowjetunion entwickelt hat – wie hellere, freiere Köpfe allmählich durch regimehörige Funktionäre ersetzt wurden, bevor eine mafiöse Geheimdienstelite die Macht an sich riss. Fassbar wird all das in den Schicksalen der Menschen, von denen Kühl erzählt: darunter ein erfolgreicher Unternehmer, der, weil er sich vom Geheimdienst nicht erpressen lassen wollte, im Gefängnis gefoltert und getötet wurde; oder auch ein Separatistenführer, der 2014 an der Annexion der Krim beteiligt war und mittlerweile auf Konfrontation zu Putin geht. Eines lässt sich schon jetzt erkennen: Die völkisch-nationalistische Außenpolitik wird zu heftigen, gewaltsamen inneren Umbrüchen führen, bis hin zum Zerfall des Landes – mit gefährlichen Konsequenzen auch für Europa. Ein ebenso fesselndes wie weitsichtiges Russland-Porträt.
Vita
Olaf Kühl, 1955 geboren, studierte Slawistik, Osteuropäische Geschichte und Zeitgeschichte und arbeitete von 1995 bis 2021 als Osteuropareferent für die Regierenden Bürgermeister von Berlin. Er ist ein exzellenter Kenner Russlands und der Region. Kühl, der als Schriftsteller mehrere Romane vorlegte – «Der wahre Sohn» war für den Deutschen Buchpreis nominiert –, zählt zudem zu den wichtigsten Übersetzern aus dem Polnischen und Russischen und wurde unter anderem mit dem Karl-Dedecius-Preis und dem Brücke-Berlin-Preis ausgezeichnet.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-01648-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
Der Zauber des Anfangs
Metaphysik des Krieges
Mord
Gier
Lüge
Der Traum von alter Größe
Der totale Sieg
Die exakten Esoteriker
Lenins Leiche
Die Vasallen fallen
Der KGB und das Geld
Kulissenkämpfe
Ein Regime bringt sich in Stellung
Die Wiederkehr des Terrors
Der FSB sprengt Russland
Rjasan – eine Kriminalgeschichte
Das gesunkene U-Boot
Die Ermöglichung der Lüge
Charakterselektion
Das Netz der Propaganda
Die große Gier
Uhrenfetischismus
Das Verführerische des Lasters
Paläste statt Hochtechnologie
Go Russia!
Erpressung und Enteignung
Die Unersättlichkeit des Staates
Nebelbildungen im Gehirn
Die Bekehrung
Patriotische Gesänge
Himmelhoch strebend
Wider die Ketzer
Krieg und Spiele
Minderwertigkeitskomplexe
Ersatzhandlungen
Sehnsucht nach Helden
Kleine, siegreiche Kriege
Geliebte Feindin Ukraine
Putin – ein Epitaph
Der Krieg
Krieg und Verbrechen
Phantasma des verlorenen Lebensraums
Geister der Geschichte
Risse im Gewaltmonopol
Das Ende
Der Realitätsschock
Verlust Russland
Literatur
Dank
Vorwort
Was war das für ein Russland, das damals in das Leben des neunzehnjährigen Studenten hereinbrach? Vor allem anderen die Sprache – die einfachen Sätze, die die Leningrader Dozentin an der TU Berlin uns nachsprechen ließ. Dieser Klang muss es gewesen sein, rau und melodiös. Er riss mich weg von der Psychologie, hin zur Slawistik: zu einem exotischen Fach an einem Westberliner Institut, an dem angeblich CIA und KGB um Einfluss rangen.
Durch die Nabelschnur der Sprache folgte alles andere, was der heute besudelte Begriff der «russischen Welt» abdecken könnte. Im Literaturseminar Tolstoi, Gogol, Tjutschews Lyrik; im historischen Seminar Krimkrieg und russische Wirtschaft, innenpolitische Entwicklungen in der Sowjetunion seit Chruschtschows Sturz. Privatlektüre war Wladimir Lenin – mich lockte die quasireligiöse Askese der Tat, die ich in der erschlafften bundesrepublikanischen Gesellschaft jener Jahre, die sich am Terrorismus der RAF müde gearbeitet hatte, vermisste. Bei uns Rückzug ins Private, dort der Anspruch, denkend die ganze Welt zu verändern. Das gängigste aller Russlandstereotype, die Weite des Landes, schien zugleich die Universalität russischen Denkens zu verbürgen. Am geöffneten Fenster des Studentenheims Eichkamp stand ich mit meinem griechischen Kommilitonen und schmetterte die sowjetische Hymne in Richtung S-Bahn-Gleise; in der Gemeinschaftsküche hing goldgerahmt Wladimir Iljitsch. Die Sowjetunion war die Erlösung aus der Banalität des eigenen Alltags.
Biographische Berührungspunkte gab es nicht am Anfang dieser langen Geschichte. Doch wer zehn Jahre nach dem letzten großen Krieg geboren ist, der war auf unsichtbare Weise gezeichnet von ihm – die Eltern sprachen nicht viel von ihrer Verblendung im Dritten Reich, sie vermittelten eine wortlose und schwer fassbare Ent-Täuschung, die vom Wirtschaftsaufschwung überkleistert wurde; der Onkel erzählte in einem endlosen Mantra, wie er an der Front eine gefangene sowjetische Kundschafterin laufen ließ und vor Leningrad einen Arm verlor. Dieser zeitliche Bogen verbindet die Tragödie des Zweiten Weltkriegs mit der blutigen russischen Wiederaufführung gegen die eigenen Waffengefährten von damals.
Im Polen der Vorwendezeit bekam das romantische Bild der Sowjetunion erste Risse. Bedrückend traurige Gestalt hatten die hehren Ideen des Sozialismus dort angenommen. Und hinter grauen Fassaden waren mutige Menschen am Werk, vom Komitee zur Verteidigung der Arbeiter, später von der Solidarność, die das sowjetkoloniale System bekämpften und am Fundament des Imperiums sägten. In Polen damals etwas auf Russisch zu bestellen, hieß, lange aufs Essen zu warten, wenn nicht gar vergeblich. Und welch eine Erleuchtung die Speisekarte: slawische Wörter, in lateinischen Buchstaben geschrieben! So traten Polen und seine Literatur in mein Leben.
Weitere Desillusionierungen folgten. Der KGB-Resident in Berlin-West entsprach nicht den literarischen Vorbildern des sowjetischen Kundschafters. Er rauchte Kette und wirkte viel zu nervös. Ich gab ihm eine Kopie meiner Seminararbeit über «Entstehung und Entfaltung des sowjetisch-chinesischen Konflikts» (verfasst bei dem ukrainischen Historiker Bohdan Osadczuk-Korab). Unsere Treffen flogen auf, als meine schriftliche Ablehnung der Kollaboration in falsche Hände geriet.
Trotz dieser blauen Flecken, die das Ideal beim Zusammenstoß mit der Realität bekommen hatte, war Russland immer noch attraktiv genug. Die ersten zehn Jahre als Länderreferent des Regierenden Bürgermeisters von Berlin waren eine Zeit des offenen Austausches, noch ohne revisionistische Verstimmungen und Komplexe. Ob es junge Manager waren, die zur Weiterbildung nach Berlin kamen, ob der Journalist Jegor Jakowlew, beeindruckender Weggefährte Michail Gorbatschows, der Berliner Ehrenbürger Gorbatschow selbst, die selbstbewussten Gouverneure der russischen Regionen oder – von der Gegenseite – der geistreiche Orientalist Jewgeni Primakow, langjähriger Chef der Auslandsaufklärung – all diese hellen, unabhängigen Köpfe der Perestroika-Zeit zeigten, was Russland sein könnte, wenn es sich befreien, wenn es zu sich selbst kommen würde.
Dann, irgendwann am Anfang des 21. Jahrhunderts, sah man neue Gesichter, ja, man meinte förmlich zu wittern, dass da etwas faul wurde im Staate. So wie Michail Gorbatschow durch die Freiheit seines Denkens und Redens bezaubert hatte, so mischte ein neuer Präsident jetzt trügerischen Charme mit Drohungen zwischen verspannten Kinnladen. Nicht persönlicher Statur verdankte er die Macht, sondern einzig der Tatsache, dass der Geheimdienst, überlebender Alien der zusammengebrochenen Sowjetunion, ihn installiert hatte. Vielleicht, dachte man, muss er den harten Burschen geben, um den unter Jelzin durcheinandergeratenen Laden wieder unter Kontrolle zu bekommen. Aber alles, was an Taten folgte, strafte Putins Worte Lügen. Diese neue «Elite» hatte keinerlei Wertvorstellungen, sie wiegte den Westen mit Demokratierhetorik in Sicherheit, während sie sich selbst bereicherte und kritischen Journalisten, demokratischen Kräften der Reihe nach den Garaus machte. Mit doppelter Härte setzte sie den Jelzin’schen Krieg in Tschetschenien fort, zettelte neue «siegreiche Kleinkriege» an und beweihräucherte das alles. Je aggressiver es wurde, desto mehr Phrasen von Frieden, nationaler Größe, vom Sieg im Großen Vaterländischen Krieg.
Die meisten inneren Umwälzungen in Russland folgten auf verlorene Kriege – den Krimkrieg 1853 bis 1856, die krachende Niederlage gegen Japan 1905, den Ersten Weltkrieg 1917 und den Afghanistan-Feldzug 1979 bis 1989. Mit seinem wahnwitzigen Überfall auf das – von den Russen selbst so bezeichnete – «Brudervolk» der Ukraine hat Putin ein Fenster der Hoffnung darauf geöffnet, dass es diesmal ähnlich kommen wird. Das Staatsgefüge zeigt erste Risse. Söldnertrupps und Kleinarmeen gefährden das Gewaltmonopol. Der Krieg steigert die Brutalisierung des Machtkampfes auch jenseits des Schlachtfelds. Im Vergleich zu dem, was kommt, wird der Untergang der Sowjetunion ein friedvoller Spaziergang gewesen sein.
Im 19. Jahrhundert lebte in Russland ein Nihilist namens Sergei Netschajew, dessen Zerstörungswut und Durchtriebenheit sogar dem Anarchisten Bakunin Angst machte. Dostojewski hat die historische Figur zur Vorlage seines Pjotr Werchowenski im Roman «Die Dämonen» genommen. Netschajews Mittel waren Lüge, Betrug und Mord. Die erschreckendste Erkenntnis nach allem, was ich hier beschreibe, ist die Tatsache, dass von Netschajew über die Bolschewiken eine direkte Linie zu denen führt, die Russland heute beherrschen. So paradox das klingt – für dieses Russland ist es die einzige Rettung, endgültig besiegt zu werden.
Berlin, im März 2023
Der Zauber des Anfangs
1990 bis 2023 – dreiunddreißig Jahre sind aus der historischen Vogelperspektive eine überschaubare Zeitspanne. Eine neue Menschengeneration wächst in dieser Zeit heran. Vierunddreißig Jahre trennen uns vom Mauerfall. Die meisten erinnern sich daran, wo sie an jenem Abend waren, was sie getan haben, als wäre es gestern gewesen.
Für Russland mit seiner tausendjährigen Geschichte sind die letzten dreiunddreißig Jahre nur ein Zeitschnipsel, winzig in seinen Dimensionen wie die Krim oder ein anderes (für den Westen bedeutungsloses) Anhängsel am Rande dieses Imperiums, das einst ein Sechstel der Erde bedeckte. Und doch ist der hier behandelte letzte Abschnitt der russischen Geschichte nicht weniger mit Bedeutung aufgeladen als einige dieser geographischen Zipfel an den westlichen Grenzen des Reiches. Es ist die Verletzlichkeit des eigenen Größenverständnisses, auch die Angst vor eigener Angreifbarkeit, die in diese Gebiete hineinprojiziert wird, ohne dass sie nachvollziehbare geopolitische Gründe hätte.
Russische Geschichte bemaß sich immer nach ganz anderen Zeitläuften. Langsam zu treiben, sich der eigenen Zukunft gewiss zu sein und warten zu können, in solchen und ähnlichen Bildern fand sie sich beschrieben. Russland, sagt Nietzsche in der «Götzen-Dämmerung», sei «die einzige Macht, die heute Dauer im Leibe hat, die warten kann, die etwas noch versprechen kann». In ganz ähnlichen Worten Oswald Spengler: «So hätte das weite Land mit seinem schweifenden Volkstum noch Jahrhunderte dauern und auf seine Zukunft warten können», und er meint damit die Zeit bis zum Epochenbruch durch Peter den Großen. Marquis Astolphe de Custine attestierte in seinem berühmten Buch «La Russie en 1839» Russland «Geschichtslosigkeit», im Sinne des Denkers Pjotr Tschaadajew, der das in seinem «Ersten philosophischen Brief» kritischer formulierte: «Geschichtliche Erfahrung kennen wir nicht, Zeitalter und Menschenalter sind fruchtlos für uns vorübergegangen. (…) Einsam stehen wir da in der Welt, haben ihr nichts gegeben, haben sie nichts gelehrt; wir haben keine einzige Idee zur Gesamtheit der menschlichen Ideen beigetragen.»
Was wären dreiunddreißig Jahre auf einem jener weiten Zeitplateaus gewesen, zwischen den großen Zuspitzungen der russischen Geschichte – der sogenannten Zeit der «Smuta», der Wirren, den Reformen Peters des Großen, der Oktoberrevolution? Von Fliegengesumm erfüllte Sommer, die sich so gleichförmig und endlos hinziehen wie die Ferien in der Kindheit. Dem großen Regisseur Andrei Tarkowski ist es gelungen, diese scheinbar leeren Zeiten in seinen Filmen einzufangen. Wie wohltuend träge vergehen in dem Film über den Ikonenmaler Andrei Rubljow die Jahre, wie gewaltsam und grausam brechen aber, wenn sie denn einmal kommen, die Veränderungen von außen herein – etwa wenn die Krieger der Goldenen Horde, denen das Großfürstentum Moskau noch immer tributpflichtig ist, in den Kreml von Wladimir eindringen, morden und foltern, das Gold von der Kuppel der Kirche reißen. Wir schreiben das Jahr 1408.
Eine der jüngsten dieser Krisen war die Russische Revolution des Oktober 1917, in Wirklichkeit ein Putsch der Bolschewiki. Von ihren Gegnern wurde sie schon damals – und heute erst recht – als «Zusammenbruch» des Russischen Reiches verstanden. Putin hat den 7. November als Revolutionsfeiertag abgeschafft und damit auch den kommunistischen Gründungsmythos beerdigt. Stattdessen wird am 4. November der Vertreibung fremder Heere aus Moskau gedacht, die besser in das Feindbild passen: 1612 zwang ein Volksaufgebot das polnisch-litauische Heer zur Kapitulation und beendete die Zeit der Wirren. Die Ikone der Gottesmutter von Kasan begleitete diesen Heereszug als religiöses Symbol. Im Februar 1613 wurde in der befreiten Hauptstadt ein neuer Zar gewählt: Michail Romanow. 1649 führte Zar Alexei I. den Feiertag «Tag der Gottesmutter-von-Kasan-Ikone» ein.
Ähnlich wie nach dem ersten Niedergang vor gut einem Jahrhundert in der Folge von Weltkrieg und Revolution beschleunigten sich die Ereignisse nach der Wahl Michail Gorbatschows zum Generalsekretär des ZK der KPdSU im Jahre 1985. Wenige hatten den Zerfall des Sowjetimperiums vorausgesehen, auch Gorbatschow nicht; wenige den Fall der Mauer und die deutsche Wiedervereinigung. Manche hatten sie auch gar nicht gewünscht. Anders als nach 1917 gab es nun in Russland nicht nur eine Gruppierung, die ihre ideologischen Vorstellungen – wie damals im Bürgerkrieg – mit Gewalt durchsetzte. Perestroika und Glasnost waren von Gorbatschow als Modernisierungsmaßnahme des bestehenden Systems gedacht gewesen. Dass ihm dabei die Union unter der Hand zerfiel, ist auch Boris Jelzin zu verdanken, der den Auflösungsvertrag gegen Gorbatschows Willen unterschrieb.
Am Ende hat Russland einen Bogen geschlagen, der es tiefer in die Vergangenheit zurückführte, als man je für möglich gehalten hätte. Wenn Putin in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag am 25. September 2001 zu wissen behauptete, «dass niemand Russland jemals wieder in die Vergangenheit zurückführen kann», dann log er. Und frohlockte.
So viel wäre möglich gewesen! Da stand dieses Land, noch immer aufrecht und äußerlich unangetastet inmitten der Überreste des Sowjetimperiums, dessen Teile von ihm abgefallen waren. Die Russische Föderation hätte die Möglichkeit gehabt, alle Potenziale von Perestroika und Glasnost für seine Entwicklung zu nutzen. Sie hätte ihr riesiges Territorium, ihre Bodenschätze, die Ressourcen ihrer damals in der Sowjetunion noch gut ausgebildeten Fachleute, die innovative Kraft und Begeisterung junger Menschen, die sich von den Reformen eine Zukunft erhofften und erstmals Freiheitsluft atmen durften, dazu verwenden können, eine innerlich gefestigte und nach außen angesehene große Macht zu werden.
Russland hat es nicht nur geschafft, all diese Möglichkeiten ungenutzt zu lassen, sondern auch sich in einer mentalen Festung zu verschanzen. Es hat sich in Umzingelungsängsten eingemauert, sich in Phantomschmerzen über verlorenes Territorium hineingesteigert und steht infolge dieser an Spaltungsirresein grenzenden Weltsicht endgültig einen Schritt vor dem Abgrund.
Wer noch einen Zauber in diesem Anfang nach dem Ende der Sowjetunion sehen wollte – spätestens seit dem Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ist das letzte Fünkchen davon verflogen. Der Krieg hat endgültig sichtbar gemacht, was sich an innerer Stagnation, Fäulnis und Gewaltpotenzial in Russland angesammelt hat. Es sind alles Dinge, die wir seit über zwanzig Jahren schon wissen konnten, wir haben sie nur nicht sehen wollen oder sie unter irgendwelchen Vorwänden und Rationalisierungen verdrängt.
Der russische Überfall auf die Ukraine – ich benutze dieses Wort bewusst in Parallele zum deutschen und sowjetischen Überfall auf Polen 1939 und zum deutschen auf die Sowjetunion 1941 – erzwingt einen klaren Blick. Der Krieg zeichnet die Konturen scharf. Das russische Vexierspiel vernebelt weiter den öffentlichen Raum, es wird sogar aggressiver und bösartiger, aber es vermag nichts mehr gegen die homerische Helligkeit, in die der Krieg das Gesicht des Landes taucht. Vielsagend ist, dass einige der sogenannten Meinungsagenten, die sich zuvor in den deutschen Medien tummelten, nach dem Überfall auf einen Schlag verstummt sind.
Wer die Begriffe Perestroika und Glasnost im heutigen Russland mit der Aufbruchsfreude der Gorbatschow’schen Frühzeit verwendet, wer überhaupt nur das Wort «Freiheit» im emphatischen Sinne gebraucht, muss des höhnischen Gelächters der «Wissenden» gewärtig sein, all jener Libertären, Illiberalen, Antidemokraten, deren Zahl wächst. Je weniger Denkanstrengung ihre Glaubensdogmen erfordern, desto größeren Zulauf finden diese «Eingeweihten». Auch in bestimmten Kreisen Polens oder Ungarns hört man sie. «Meinungsfreiheit? Sei doch nicht naiv!» Das sagen Gebildete, die gleichzeitig gern die Vorteile in Anspruch nehmen, die ihr Land aus der EU-Mitgliedschaft zieht. Russland fördert solche obskuren Stimmen im Westen nach Kräften sowohl medial als auch finanziell in der Hoffnung, Europa dadurch zu spalten.
Metaphysik des Krieges
In Russland sind Wertbegriffe wie «Demokratie» und «Menschenrechte» nach den Erfahrungen der neunziger Jahre derart negativ besetzt, dass sie an der Firewall seines Selbstverständnisses abprallen. Das offizielle Russland hüllt sich heute in die Sprache der Religion. Die orthodoxe Kirche ist zu einem Transmissionsriemen für Propaganda und Ideologie geworden, die den Krieg gegen die Ukraine jahrelang vorbereitet haben. Das Oberhaupt dieser Kirche, Patriarch Kyrill I., bezeichnet den Krieg als einen «metaphysischen Konflikt». «Alles Gesagte zeugt davon», sagte Kyrill in einer Predigt am 6. März 2022 in der Moskauer Christi-Erlöser-Kathedrale, «dass wir in einen Kampf eingetreten sind, der keine physische, sondern eine metaphysische Bedeutung hat.» Ausgerechnet bei der Rechtfertigung des Tötens und des Krieges beruft er sich auf die Gebote der Bibel: «Auf der Seite des Lichts stehen, auf der Seite der Göttlichen Wahrheit, auf der Seite der Göttlichen Gebote, auf der Seite dessen, was das Licht Christi uns eröffnet, sein Wort.» Er ruft die jungen Männer auf, ihr Leben hinzugeben, so wie Jesus Christus das seine gegeben habe: «Christus ist auferstanden, und wir alle werden mit ihm auferstehen. Und das Leben ist ewig, deshalb ziehet mutig hin und erfüllet eure Kriegerpflicht.»
Dieser Ton verschärfte sich seit dem Herbst 2022, als die militärischen Niederlagen nur noch schwer zu leugnen waren. Bald waren es nicht nur die Nato und der Westen an sich, in denen Russland seine Gegner erkannte, die Sakralisierung des Krieges führte dazu, dass der offizielle Vertreter des Sicherheitsrates der Russischen Föderation von einer notwendigen «Ent-Satanisierung» der Ukraine sprach. Gewissens- und Glaubensfreiheit hätten, so Alexei Pawlow, die Ukraine in eine «Hypersekte» verwandelt. Als Beispiele für die «Satanisierung» wurden die ukrainischen Oligarchen Igor Kolomoiski und Wiktor Pintschuk genannt, die der «ultraorthodoxen Sekte der Chassiden» angehörten. Die jüdische Gemeinde Russlands protestierte prompt. Oberrabbiner Berl Lasar sprach von einer Beleidigung für Millionen Gläubige. Die Chassiden seien keine Sekte, sondern eine legitime Schule des Judaismus. Es war nicht der erste antisemitische Tiefschlag, den das offizielle Russland sich erlaubte. Nach seiner Behauptung, die Ukraine sei von «Nazis» kontrolliert, hatte Außenminister Sergei Lawrow im Mai Wolodymyr Selenskyjs Argument, er sei ja selbst Jude, dadurch zu entkräften versucht, auch Adolf Hitler habe «jüdisches Blut» gehabt und die schlimmsten Antisemiten seien in der Regel die Juden selbst.
Die religiöse Überhöhung des Machtkonflikts erinnert an das Wort vom «Reich des Bösen» (evil empire), mit dem Ronald Reagan im März 1983 die Sowjetunion stigmatisierte. Damals musste die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Europa, gegen den Widerstand der «Friedensbewegung», ideologisch flankiert werden. Neununddreißig Jahre später reproduziert die russisch-orthodoxe Kirche diese dichotomische Weltsicht und beruft sich auf ähnliche «moralische Anliegen» wie seinerzeit der amerikanische Präsident und die ihn unterstützenden Evangelikalen in den USA – vor allem den Kampf gegen Homosexualität, Abtreibung und Pornographie sowie den Schutz der traditionellen Familie.
Interessant ist, wie die katholische Kirche auf die Kriegshetze der Orthodoxie reagiert. Als nehme er direkt Bezug auf Kyrill, wiederholte Papst Franziskus im Mai 2022 seinen schon zuvor gegenüber der italienischen Zeitung «Corriere della sera» geäußerten Standpunkt, beim russischen Krieg gegen die Ukraine gebe es «keine metaphysisch Guten und Bösen auf abstrakte Art und Weise». Was zunächst wie eine Widerrede gegen Kyrill klingt, erweist sich bei genauerem Hinsehen als Relativierung des Konflikts. Der Papst laviert nicht nur bei diesen Begriffen. Statt der klaren Teilung in Täter und Opfer wollte er «etwas Globales» erkennen, «mit Elementen, die stark miteinander verwoben sind». Franziskus spielt dem russischen Narrativ in die Hände, wenn er vom «Gebell» der Nato «an den Toren Russlands» spricht. Und völlig disqualifiziert hat er sich, als er im August 2022 die fanatische Propagandistin Darja Dugina, Tochter von Alexander Dugin, nach dem tödlichen Anschlag auf sie als «unschuldiges Opfer» bezeichnete.
Sucht man einen argumentativen Zugang zu der orthodox-ideologischen Aufrüstung, hilft es nicht, die von ihr verbal vertretenen Werte (traditionelle Familie und dergleichen) infrage zu stellen; das blockiert den Dialog von vornherein. Wirkungsvoller ist es, die Kirche an ihren eigenen Maßstäben zu messen. Im Grunde bräuchte man hier gar nicht auf religiöse Kategorien zurückzugreifen. Wie Hannah Arendt sagt, ist in einer Welt, in der man mit Tatsachen nach Belieben umspringt, die einfache Tatsachenfeststellung bereits eine Gefährdung der Machthaber. Wie steht es also im heutigen Russland um die Einhaltung solcher Gebote wie «Du sollst nicht töten», «Du sollst nicht stehlen» und auch «Du sollst nicht lügen»?
Mord
Die korrekte Übersetzung aus dem Hebräischen, «Du sollst nicht morden», bezeichnet treffender, was in Russland gängige staatliche Praxis ist: die heimtückische Tötung wehrloser Opfer. Von den staatlichen Morden und Mordversuchen, die Christopher Nehring in seinem Buch «Geheimdienstmorde» behandelt, werden ein gutes Viertel sowjetischen beziehungsweise russischen Geheimdiensten zugerechnet, mit rapide steigender Tendenz ab 2004.
Seit der Ermordung Alexander Litwinenkos mit Polonium im November 2006 und der versuchten Tötung Alexei Nawalnys mit dem Chemiewaffengift Nowitschok im August 2020 denkt man dabei vor allem an diese Methode – die Vergiftung. In beiden Fällen gilt Putins unmittelbare Beteiligung beziehungsweise Zustimmung als sicher. Dabei will der Giftmord so gar nicht passen zu dem von ihm gepflegten Männlichkeitskult. Der stolze Reiter mit entblößtem Oberkörper – sollte er nicht wie der heilige Georg die Lanze in den Drachen bohren, statt klammheimlich die Ermordung seiner Gegner anzustiften und Gift in Unterhosen streuen zu lassen?
Tatsächlich aber ist diese Methode keine Erfindung des jetzigen Präsidenten. Sie reicht in die Anfangsjahre der Sowjetunion und viel weiter in Russlands Geschichte zurück. Unter Iwan dem Schrecklichen (1530 bis 1584) häuften sich Verdachtsfälle auf Giftmord in der eigenen Familie und im näheren Umfeld. Pawel Bulanow, Sekretär des sowjetischen Geheimdienstchefs Genrich Jagoda (1891 bis 1938), beschrieb einen besonderen Giftschrank, aus dem Jagoda die «kostbaren Phiolen entnahm, um sie mit entsprechenden Instruktionen seinen Agenten anzuvertrauen». Als früherer Apotheker interessierte sich das Oberhaupt der GPU, der sowjetischen Geheimpolizei, für Gifte ganz besonders; er hatte mehrere Toxikologen in seinen Diensten, für die er ein eigenes Laboratorium eingerichtet hatte und die unkontrolliert über unbegrenzte Mittel verfügten. Bulanows Aussagen sind nicht unbedingt in jedem Detail für bare Münze zu nehmen, aber es gibt genug andere Hinweise auf Giftmorde in der Frühzeit der sowjetischen Geheimdienste. Seit 1971 wurde Jagodas «Apotheke» institutionalisiert, die Entwicklung neuer chemischer Kampfstoffe in staatliche Hände gelegt. Dabei entstand der Vorläufer des heutigen Nowitschok («Neuling»). Bei den bilateralen Verhandlungen zum Chemiewaffenübereinkommen zwischen den USA und Russland wurden dem Westen diese Forschungen verheimlicht. Der russische Chemiker Wil Mirsajanow machte das Programm Anfang der 1990er Jahre bekannt. Der BND war allerdings schon vorher durch einen russischen Agenten an eine Probe des Kampfstoffes gelangt.
Am 23. Oktober 2002 wurden die tschetschenischen Terroristen im Moskauer Dubrowka-Theater mit einem in den Zuschauerraum eingelassenen Giftgas betäubt. Leider starben dadurch hundertfünfundzwanzig der Geiseln, die eigentlich gerettet werden sollten. Da die Behörden die Art des Gifts nicht verraten wollten, waren die Rettungsärzte hilflos. Erst später teilte der russische Geheimdienst FSB mit, es habe sich um eine Spezialrezeptur auf der Basis des künstlichen Opioids Fenatyl gehandelt. Alle Terroristen, auch die schon bewusstlosen, wurden erschossen. Der Chemiker, der für den Gaseinsatz verantwortlich war, bekam den Titel «Held Russlands».
Ob mit Gift oder auf andere Art – die Liquidierung in Ungnade gefallener Personen oder angeblicher «Verräter» ist in Russland seit Langem Usus. Staatliche Auftragskiller werden belohnt. Stalins größter Widersacher Leo Trotzki wurde im August 1940 in Mexiko von dem spanischen Kommunisten Ramón Mercader, Agent des sowjetischen Innenministeriums NKWD, mit einem Eispickel erschlagen. Den Mordauftrag bekam er vom Direktor der NKWD-Auslandsabteilung, Pawel Sudoplatow, der von Stalin persönlich mit der Durchführung betraut worden war. Mercader erhielt den Leninorden und nach Verbüßung seiner zwanzigjährigen Haft auch den Titel «Held der Sowjetunion».
Andrei Lugowoi, einer der beiden Mörder von Alexander Litwinenko, wurde für die Tat mit einem Mandat im Staatsparlament, der Duma, belohnt und genoss dadurch strafrechtliche Immunität. Den großartigen Investigativjournalisten von Bellingcat gelang es nach dem Giftmordversuch an Alexei Nawalny, viele der beteiligten FSB-Mitarbeiter zu identifizieren und ihre Reiserouten zu rekonstruieren. Nawalny persönlich hat einen der Beteiligten angerufen, sich als Offizier des FSB ausgegeben und ihn dazu animieren können, Einzelheiten der Aktion zu verraten.
Im Krieg gehört das Töten zum Handwerk. Allerdings hat Russland schon in Tschetschenien bei der Flächenbombardierung der Hauptstadt Grosny und anderen Angriffen auf Zivilisten gezeigt, dass es sich an keine Art von Kriegs- oder internationalem Recht gebunden fühlt. In Syrien zerbombte die russische Luftwaffe gezielt Krankenhäuser, obwohl – oder weil – ihr die Vereinten Nationen deren Koordinaten mitgeteilt hatten. Gegen die Zivilbevölkerung setzte sie thermobarische Waffen ein.
Seit dem 24. Februar 2022 ist das Morden zu einer Massenbeschäftigung russländischer Soldaten in der Ukraine geworden. Dieses unschöne, in der Wissenschaft gängige Adjektiv unterscheidet die Staatsangehörigen der Russischen Föderation von den ethnischen Russen. Denn natürlich sind es nicht ausschließlich diese, die Verbrechen begehen. In der Ukraine kämpfen, wie schon 2014, viele Burjaten, Tuwinen, Dagestaner. Völker aus den ehemals kolonisierten Randgebieten der Föderation werden bevorzugt eingezogen oder melden sich aus Armut freiwillig. Ich werde in diesem Buch aus ästhetischen Gründen «russisch» auch für «russländisch» sagen, es sei denn, die explizite Unterscheidung wird wichtig. In Butscha, Irpin, Mariupol schossen die Soldaten Zivilisten vom Rad, folterten in Kellern, töteten wahllos. Im Donbass war Ähnliches schon seit 2014 üblich. Nach der Befreiung von Isjum durch die ukrainische Armee wurden neue Gräber mit Hunderten ziviler Opfer entdeckt. Ein Buch wie dieses kann der grausamen Realität nur hinterherhinken. Die Täter von Butscha erhielten Orden von Putin. Kriegsgefangene aus Mariupol, die nach dem Dritten Genfer Abkommen besonderen Schutz genießen, wurden durch gezielten Granatbeschuss getötet.
Und schließlich die historisch neue, perverse Verschmelzung beider Arten des Tötens – der kriminellen und militärischen: Seit Juli 2022 darf der Gründer der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, verurteilte Kriminelle, die in Lagern und Gefängnissen sitzen, für den Kampfeinsatz in der Ukraine anwerben. Ihnen wird außer dem Sold auch die Amnestierung nach einem halben Jahr versprochen. Der wegen Diebstahls und Raubs vorbestrafte Privatunternehmer, nach seiner Catering-Firma «Putins Koch» genannt, darf mit Genehmigung der staatlichen Strafvollzugsverwaltung Totschläger, Vergewaltiger, ja sogar Serienmörder (darunter ein Kannibale) für einen Krieg einziehen, der vom Staat geführt wird. Wie soll man diese Rekruten nennen – «soldatische Verbrecher»? Das wäre so, als sagte man «ärztlicher Vergifter» zu jenen ausgebildeten Medizinern des FSB, die an den Auftragsmorden an Nawalny und anderen mitgewirkt haben. Tatsächlich findet sich das schaurige Oxymoron in einschlägigen investigativen Untersuchungen. An den Eid des Hippokrates fühlen diese Spezialisten sich nicht gebunden, denn der besagt auch: «Ich werde niemandem, auch nicht auf seine Bitte hin, ein tödliches Gift verabreichen.»
Gier
Viele machen die Selbstbereicherung der Oligarchen in Russland für die fatale Entwicklung verantwortlich, die das Land genommen hat. Wenn vierundsiebzig Jahre nach der gewaltsamen Verstaatlichung des Privateigentums («Nationalisierung»), nach einer unsäglich brutalen Entkulakisierung, der Vernichtung und Enteignung wohlhabender Bauern, die abrupte Umkehr dieser Entwicklung zunächst einmal in eine wilde «ursprüngliche Akkumulation» ausartet, dann wundert das nicht. Zutreffend ist auch, dass es bei der Privatisierung keine Chancengleichheit gab. Insider des alten Systems, Mitglieder der kommunistischen Jugendorganisation Komsomol, der Partei und Geheimdienste, besaßen die nötigen Informationen, um an die Filetstücke der staatlichen Wirtschaft zu gelangen. Man kann Jelzin und seinen Beratern durchaus diese Art der Privatisierung vorwerfen. Wie Sergei Stepaschin als Präsident des Rechnungshofes in seinem Bericht von 2004 feststellte, erfolgte sie von 1993 bis 2003 nach dem «schlechtesten Szenario aller europäischen Länder». Zugleich aber sei sie rechtlich nach den damals geltenden Gesetzen abgelaufen.
Entscheidend war am Ende, was die Besitzer aus ihrem Unternehmen gemacht haben. Gewiss, Michail Chodorkowski bekam 78 Prozent der Anteile an dem Erdölkonzern Yukos für 310 Millionen US-Dollar, bei einem Marktwert, der kurz darauf fünf Milliarden betrug. Aber Chodorkowski war Unternehmer genug, um den Konzern zu entwickeln, in die Ölförderung und -verarbeitung zu investieren und in den letzten Jahren vor seiner Verhaftung auch die Steuerzahlungen zu steigern.
Das wahre Problem der Wirtschaft im heutigen Russland ist ein anderes. Es besteht darin, dass das Recht auf Eigentum, ganz gleich von wem und auf welche Weise erworben, staatlich nicht geschützt ist. Die Oligarchen sind heute nichts als Spielmasse in der Hand des Regimes, ihr Vermögen hängt an der Gunst des Autokraten. Deshalb ist auch ihr Einfluss auf die Politik gering im Vergleich zu dem, den sie in den neunziger Jahren noch hatten. Eigentum ist ein geliehenes Gut, ein Lehen der Herrschenden. Man spricht häufig von einem «Feudalsystem» in Politik und Wirtschaft. Der Eigentumstitel ist völlig abhängig von der Loyalität des Eigentümers gegenüber der Regierung. Der russische Politiker und Bürgerrechtler Leonid Wolkow bezeichnet die Oligarchen als Putins «wandelnde Portemonnaies». Als Chodorkowski der Politik ins Gehege kam, als er Putin auf einer öffentlichen Versammlung Korruption bis in höchste Kreise vorwarf, als er unbedachterweise darüber spekulierte, ob er Teile von Yukos an den US-Konzern ExxonMobil verkaufen sollte, schützte ihn auch sein Eigentum nicht mehr. Bis heute gilt, dass Unternehmer sich der von ihnen aufgebauten Firmen niemals sicher sein können. Waren es in den neunziger Jahren die organisierte Kriminalität und mafiöse Banden, die Privatunternehmern ihre Firma mit Gewalt raubten, so geht die Gefahr heute von staatlichen Organen aus, die sich mit Vertretern des organisierten Verbrechens verbünden.
Die Situation in Russland macht bewusst, warum der staatliche Schutz des Privateigentums eine Grundfeste der persönlichen Freiheit ist. Eigentum ist unmittelbar mit Verantwortung verknüpft. Die fehlende Verantwortung des Einzelnen für sein Schicksal ist eines der wesenhaften Merkmale sowjetischer Mentalität. Der Kampf der Bolschewiki gegen die besitzende Schicht der Bauernschaft, die sogenannten Kulaken, verfolgte den Zweck, eine auf ökonomischer Unabhängigkeit basierende politische Gegenkraft zu eliminieren. Heute sind es die weitgehende Ausschaltung einer unabhängigen Richterschaft und Staatsanwaltschaft und die Komplizenschaft von Polizei und Geheimdienst mit dem organisierten Verbrechen, die den Schutz des Eigentums in Russland außer Kraft setzen.
Der Student und Blogger Jegor Schukow, verurteilt für die Protestdemonstration gegen die Wahlfälschungen von 2019, nannte in seinem Schlusswort vor Gericht die Verantwortung als einen zentralen Begriff der christlichen Ethik. Er tat dies ganz bewusst, weil auch der russische Staat sich als letzte Bastion bei der Verteidigung der traditionellen Werte und des Christentums verstehe. Das Christentum aber sei die Geschichte eines Mannes, der das Leid der ganzen Menschheit auf sich lud – und damit Verantwortung übernahm. Schukow wurde für seine Teilnahme an den Protesten und seinen Blog zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt.