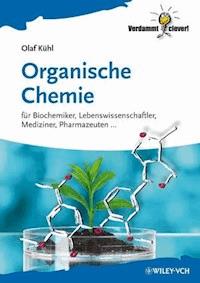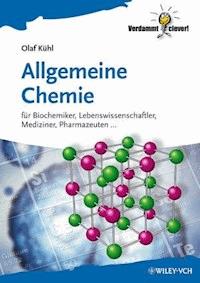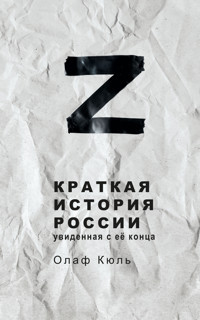9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwei Freunde fassen einen irrwitzigen Plan – sie wollen den berühmtesten Gefangenen der Welt befreien. Ein außergewöhnlicher Reise- und Abenteuerroman. «Wir fahren also hin und holen Chodorkowskij raus?», fragte ich. «Klar», sagte er. Mehr nicht. Ich konnte noch nicht glauben, dass Andrzej es ernst meinte. Dass ihm die Tragweite des Unternehmens bewusst war. Deshalb sagte ich: «Wir fahren ohne die Frauen.» – «Sicher», erwiderte er. Und fügte nach einer Weile hinzu: «Ist zu gefährlich.» In dem Moment war mir klar, dass er verstanden hatte. «Was sagen wir ihnen?», fragte ich. «Dass wir auch mal was allein machen wollen. Sibirien ist zu gefährlich für sie.» Wir sagten das so und hatten zu diesem Zeitpunkt doch keine Ahnung, was uns erwartete.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Olaf Kühl
Tote Tiere
Roman
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Die Frauen waren zu Hause geblieben. Es war ihnen zu unheimlich gewesen, an diesem Nachmittag, unter immer dichteren Wolken, noch loszuziehen. Das Risiko lockte sie nicht. Vielleicht saßen sie einfach lieber in der Küche und redeten.
So gingen wir allein. Andrzej wollte uns die Berge zeigen, einen Marsch durch die Gegend machen. Der Schnee lag knöchelhoch, die Tannen trugen schwere weiße Hauben. Im Dorf war die Straße noch ein Kinderspiel, doch dann querten die ersten Bäche den Weg, später Flüsse, zugefroren und mit Puderschnee bedeckt. Als wir das Dorf schon weit hinter uns gelassen hatten, stapften wir lange am steilen Ufer eines vereisten Flusses entlang und kamen allmählich höher ins Gebirge.
Seit Stunden waren wir unterwegs, viel länger als geplant. Keiner von uns wusste noch, wo wir waren. An einer Stelle hatte Andrzej gesagt: «Kommt, eine Abkürzung», und war im Unterholz verschwunden. Es wurde schon dunkel, und wir schlugen uns durch einen Wald, der immer düsterer wurde. Ständig mussten wir stehen bleiben und warten, wenn einer in den tiefen Fußstapfen der anderen nicht schnell genug vorwärtskam.
Anfangs hatten wir viel geredet, nicht Andrzej, er redet nie viel, aber Bogdan hatte von seinen Erfahrungen als Berater der Weltbank in Rumänien und Moldau gesprochen, was Andrzej sehr interessierte, später, als wir müde an einem Hochsitz Rast machten, auch von seiner Scheidung, was nur noch mit einem Brummen quittiert wurde. Darüber war die Zeit vergangen. Ich hatte mich ganz auf Andrzej verlassen, der dieses Gelände wie seine Westentasche kannte.
Doch irgendwann blieb ich stehen. «Ist ja wie im ‹Weißen Raben›», sagte ich.
«Ja, aber die Altersheim-Version», erwiderte Andrzej trocken. Er atmete schwer. Ich sah, wie er einen jungen Buchenstamm umklammerte. Das war nicht nur körperliche Erschöpfung.
Von den Zweigen rieselte uns der weiße Staub in die Kragen, pappig schob sich der Schnee in die Hosenbeine. Meine Lederstiefel waren durchnässt. Obwohl es dunkel wurde und kalt war, hatte ich noch keine Angst, im Gegenteil. Alles sah allmählich nach einem Abenteuer aus, wie im echten Männerleben, aber das täuschte. In Wirklichkeit war es nicht besonders gefährlich. Wir konnten höchstens ein, zwei Stunden Fußweg von Wołowiec entfernt sein. Nicht ausgeschlossen, dass wir im Kreis gegangen waren, dann befanden wir uns vielleicht ganz in der Nähe des Dorfes. Die Zivilisation war um die Ecke. Es wäre nicht einmal eine Gefahr, unbeabsichtigt auf das Gebiet der Slowakei zu geraten – es gab ja keine Grenzen mehr, keine Wachposten und keine bewaffneten Patrouillen.
Ich kannte diese Kälte, und ich kannte diesen Schnee. Nicht von den endlosen, hartgefrorenen Ebenen vor Stalingrad, über die der Wind feines Pulver fegte, schneidend wie die Kante eines Blatts Papier. Eher aus einer späteren Zeit. Damals lief ich Schlittschuh auf dem Teich im Stadtpark. Die Dunkelheit brach langsam herein, so wie jetzt. Fast alle anderen Kinder waren schon nach Hause gegangen. Der Frost betäubte das Gesicht. In der geheizten Wohnung würden meine Finger höllisch brennen, wenn sie wieder auftauten, aber das war nicht der Grund, weshalb ich nicht nach Hause wollte. Wenn ich noch ein bisschen länger bliebe, glaubte ich, würde etwas Besonderes geschehen, für das ich nicht einmal Worte hatte. In Wirklichkeit habe ich dann immer gekniffen; nie habe ich diese Kälte, diese grausame Klarheit der Welt bis zu Ende ausgehalten. Sie rief und lockte, doch ich schreckte jedes Mal vor ihr zurück. Ich fügte mich, ging heim, zog Handschuhe, Mütze und Pullover aus, wusch mir mit kaltem Wasser die Hände und setzte mich ins überheizte Wohnzimmer, wo mein Vater Schuberts «Winterreise» auf dem Klavier spielte, wenn nicht schon die Tagesschau lief. Später kam Amerika ins Haus, Miami, Fury, Flipper und Bonanza. Eine ganz andere, viel hellere Welt, in der man jede Einzelheit sonnenklar zu erkennen glaubte. Bei uns war alles dämmrig, warm und gemütlich, aber genau das war die Quelle einer unbestimmten Angst. Ich wusste, das Zuhause bot keine Sicherheit. Es war im Grunde so schwach wie mein Vater selbst mit seinen gar nicht lang zurückliegenden Erlebnissen, über die er nie mit uns sprechen wollte. Nachts stürzte diese Fassade ein, in meinen Träumen, wenn böse Männer in unsere Wohnung einbrachen und alles auf den Kopf stellten. Notdürftig versteckten wir uns hinter der Wohnzimmergarnitur, in jedem freien Winkel, den wir fanden. Wenn es hell wurde, hörte ich nur noch, wie ihre Schritte sich über die langen Gänge entfernten. Die Türen waren bereits zugeschlagen, bevor ich erwachte, die leeren Fensterhöhlen der ausgebrannten Häuser, die ich vom Klettergerüst auf dem Spielplatz sah, waren zugemauert.
Je größer ich wurde und je mehr ich verstand, desto stärker fühlte ich mich bevormundet. Später hatte ich bisweilen den Eindruck, ich sei mein ganzes Leben mit einer scheinbaren Zeit abgespeist worden, mit aufgeplusterten Jahren, die in sich zusammenfallen würden wie Zuckerwatte und deren einzige Aufgabe es war, mir die schmerzliche Vergangenheit vom Leibe zu halten.
Doch die Wahrheit verging nicht – dafür bin ich ihr dankbar. Sie welkte nicht, sie wartete auf mich wie eine treue Geliebte. Wir beide waren anspruchslos. Es genügte mir, wenn ich ab und zu einen Wink bekam, der das geheime Einverständnis zwischen uns am Leben hielt.
Kürzlich stieß ich beim Umsteigen am Potsdamer Platz auf einen Durchgang zwischen zwei ockergelb gestrichenen Stützmauern unter einer Treppe. Er war für heutige Verhältnisse viel zu schmal und beängstigend niedrig. Man musste sich fast bücken, um dort hindurchzugehen. Vielleicht ist er für die Körpergröße der zwanziger Jahre ausgelegt, vielleicht war er nie als Durchgang gedacht und ließ sich bei der Modernisierung des Bahnhofs einfach nicht beseitigen. Aus statischen Gründen, könnte man sagen. Gründe zu finden ist nie das Problem. Durch diesen Tunnel waren einst Versprengte aus der Reichskanzlei gekommen. Sie hatten den Anschluss an den Haupttrupp verloren, der sich in Richtung Norden durch die U-Bahn aus der Stadt schleichen wollte. Dicht nebeneinander auf den Bahnsteigen lagen Verwundete, Mütter mit Kindern, und suchten Schutz vor den Kämpfen, die oben in der Stadt tobten.
Mich zog an diesem Silvesterabend in den Beskiden nichts zurück an den flackernden Kamin im Holzhaus, wo die Freunde aus Warschau und Krakau zusammensaßen und sich in Feierlaune tranken. An der steilen, verschlammten Zufahrt zu Andrzejs Grundstück parkte die gehobene Mittelklasse, teure Geländewagen. Ausgesprochen sympathische Leute, erfolgreich im neuen Polen, als Verleger, Anwälte oder Finanzberater, viele von ihnen jünger als ich. Aber in diesem Augenblick spürte ich kein Bedürfnis nach ihrer Gesellschaft. Sie waren mir zu wenig fremd.
Dann waren da diese Knochen. Andrzej hockte schon unten in der Mulde. Was er gefunden hatte, konnte ich erst nicht erkennen. Ich hielt mich beim Abstieg an einem Ast fest, rutschte ab und landete im Schnee. Dabei verstauchte ich mir den Fuß.
Knochen. Kein Skelett, sondern Knochen, überall verteilt. Ein Stück von der Halswirbelsäule mit dem Schädel. Einem Teil des Schädels – der Unterkiefer fehlte. Weil er abgerissen war, sah das Ganze aus wie ein schmaler, länglicher Vogelkopf. Schneekristalle glitzerten auf den Zähnen.
«Eine Hirschkuh», flüsterte Andrzej.
«Warum Kuh?»
«Siehst du ein Geweih?»
Fast reglos kniete er da und betrachtete eine Keule, an der nur noch ein paar blassrote Strähnen hafteten. Ungeduldig warteten die Krähen in den Bäumen, dass wir sie wieder an ihren Fraß ließen. Manche hüpften frech um uns auf dem Boden herum.
Andrzej blieb in der Hocke und starrte das Gerippe an, ich stand schweigend neben ihm. Zu Hause warteten die Gäste, doch wir hatten es nicht eilig. «Was wäre, wenn wir uns jetzt verlaufen?»
Mein Handy piepte. Ein slowakisches Netz. Wir konnten nicht weit von der Grenze sein. Ich kam nur noch humpelnd voran, der umgeknickte Fuß tat höllisch weh.
Am Bahnhof Klosterstraße in Berlin stieg ich aus der U-Bahn. Eine Frauenstimme vom Band wies umständlich auf das Rauchverbot hin. «Verehrte Fahrgäste, zur Verbesserung der Sauberkeit und aus Rücksichtnahme auf Nichtraucher …» Lebendes Personal suchte man hier schon lange vergeblich. Das Zugabfertigerhäuschen auf der Mitte des Bahnsteigs, in dem sich früher Uniformierte am Mikrophon mit raschen Seitenblicken vergewisserten, ob niemand im letzten Augenblick die Tür aufriss, war verlassen, die Scheiben waren mit Spiegelfolie verklebt. Nur die toten Augen der Überwachungskameras hatten noch alles im Visier. Unscharf zeichnete sich auf einem kleinen Bildschirm die Silhouette eines Mannes ab, der die gewölbte Hand zum Gesicht hob. Als ich den Blick an der Kamera vorbei in die Wirklichkeit richtete, sah ich ihn. Tatsächlich – am anderen Ende des Bahnsteigs zündete sich der Mann im Trenchcoat in aller Ruhe eine Zigarette an.
Auf der Treppe schlug mir der eisige Wind so heftig den Schneestaub ins Gesicht, als hätte mein Vordermann einen Tannenzweig zurückschnellen lassen. Ich wollte nicht zu früh kommen und spazierte in aller Ruhe über den Alexanderplatz zum Bus. In einigen Fenstern des Roten Rathauses brannte noch Licht.
Über einem Lüftungsschacht der U-Bahn erwischte mich wieder der beunruhigende Hauch der Vergangenheit, diese Luft wie aus einem verbrauchten Staubsaugerfilter, die Mischung aus verschwitzter Kleidung, Tunnelmief, dem Eisen der Schienen und dem Asbest der Bremsen.
Im Vergleich zu den Schneemassen in Polen waren das hier armselige Reste, längst der Übermacht des nassen schwarzen Asphalts ergeben. Die Stadtreinigung hatte noch nicht alle Luftschlangen und Knallkörper weggefegt. An der Haltestelle Unter den Linden stieg ich aus dem Bus und ging über die Straße.
Der russische Botschafter in Berlin feierte eines seiner potemkinschen Feste. Mehr oder weniger prominente Gäste strömten in den gewaltigen, von einem hohen Eisenzaun abgeriegelten Bau, um sich unter der byzantinischen Kuppel mit dem roten Stern ablichten zu lassen und anderntags die Seiten der Boulevardzeitungen zu schmücken. Eine Handvoll Anhänger von Amnesty International protestierte vor dem Gebäude. Wieder einmal war eine Journalistin in Russland ermordet worden – man hatte sich fast schon daran gewöhnt. Der Botschafter hatte im letzten Augenblick versucht, die Kundgebung verbieten zu lassen.
Ich tastete nach meiner Einladungskarte, war im Begriff, durch das schmiedeeiserne Tor zu gehen, sah schon den Metalldetektor dahinter und den Botschaftsmitarbeiter, der die Pässe kontrollierte, und setzte einen Fuß nach vorn, da geschah etwas Merkwürdiges. Mir wurde bewusst, dass der Knöchel, den ich mir in Wołowiec verstaucht hatte, nicht mehr wehtat. Man merkt ja normalerweise nicht, wenn etwas nicht wehtut. Man merkt den Schmerz. Und ein leichter Schmerz ist hilfreich, er bewahrt vor der Euphorie. Beim Waldlauf knickte ich meist dann um, wenn ich meinen Tagträumen allzu narzisstisch ihren Lauf ließ. Die Katastrophe kam, wenn ich mich zu sicher fühlte.
Bis heute sah ich die anthrazitglänzende Karosserie des BMW-Cabrios vor mir, das wie schwerelos im strahlenden Sonnenlicht die Volodymyrska-Straße hinunterglitt, von der St.-Andreas-Kirche bergab Richtung Stadtzentrum, damals nach der ersten Nacht mit Kateryna in Kiew, als wir vom rauschhaften Glück der neuen Liebe erfüllt waren. Ich jubelte: Wie wunderbar ist das Leben, wie schön kann es sein nach so langer dunkler Zeit, und fast im selben Augenblick, ich hatte eine Sekunde nicht hingesehen, war da der gespaltene Schädel auf dem Asphalt, das Hirn und das Blut und das verbeulte Blech des Trolleybusses.
Ich erschrak über meine eigene Empfindungslosigkeit. Ich spürte keinen Schmerz mehr. Manchmal hatte ich einen Kater, ja. Kopfschmerzen. Oder schnitt mich am Deckel einer Fischkonserve, die ich ungeschickt mit dem Messer zu öffnen versuchte.
Mein Freund und Nachbar starb eines Morgens ein Stockwerk unter mir. Ich hörte die Sirenen der Feuerwehr, das Knattern der Hubschrauber, aber ich kam im Halbschlaf überhaupt nicht auf die Idee, sie könnten etwas mit ihm zu tun haben. Erst Stunden später, im ICE nach Düsseldorf, erreichte mich die Nachricht auf dem Handy.
Die Schmerzlosigkeit sollte mich warnen. Das wurde mir hier am Eingang der russischen Botschaft bewusst. Leichten Fußes, als hätte ich nie die Absicht gehabt, dieses Gebäude zu betreten, machte ich im letzten Moment kehrt. Es war mir gleichgültig, ob jemand mich erkannt hatte. Ich drehte um und ging in Richtung Brandenburger Tor. Am Pariser Platz tauchte ich wieder in das Labyrinth unter der Stadt ein.
Andrzej Karymsiuk hätte über solche Probleme vermutlich nur geschmunzelt. Ihm ging es gut. Er schwamm auf einer Welle des Erfolgs. Mit seinem Namen, der halb arabisch, halb ukrainisch klang, zählte er längst zu den Großen der polnischen Literatur. Aber auch wenn er auf seinen Lesungen den hemdsärmligen Polen gab, wenn er die Deutschen provozierte, unbefangen und doch sehr gezielt ihre wunden Punkte berührte – indem er die Vorschlaghämmer Zweiter Weltkrieg und Auschwitz auf sie niedersausen ließ –, um sie dann gleich wieder mit überbordender Liebe in seine Arme zu schließen und ängstlich kichern zu lassen, war Andrzej viel zu feinfühlig, um nicht zu merken, dass gerade die Art seines Erfolges in Deutschland ein Warnsignal war. Ein Gespräch fand nicht mehr statt – Karymsiuk, das war inzwischen nicht nur eine Marke, sondern auch eine Maske.
Man brauchte ihn deshalb gar nicht erst von der Notwendigkeit zu überzeugen, etwas zu tun. Das Problem war, dass er nicht nach Russland wollte. Er weigerte sich hartnäckig, auch nur einen Fuß in dieses Land zu setzen. Tatjana, seine Übersetzerin, war traurig, sogar empört – nie gab es Lesungen in ihrer Heimat. Karymsiuk hatte ihr erzählt, wie eine Gruppe polnischer Ethnologen, die vor Ort russisches Liedgut studieren wollten, von der Miliz von einem Tag auf den anderen aus einem russischen Dorf vertrieben worden war, ohne Begründung. Und sie hatte erstaunt gefragt: «Ja, macht denn die polnische Polizei so etwas nicht?» Diese Episode erzählte Andrzej immer, wenn man ihn nach Russland fragte.
Nach Deutschland fuhr er auch nicht gern. Besonders die Herbstmonate waren ihm zu schade zum Reisen – wenn das Laub der Buchenwälder im tiefsten Rot leuchtete, sich kaum noch Besucher in sein abgelegenes Dorf verirrten und er dort seine Ruhe hatte, dann kamen ihm die besten Ideen. Aber in Deutschland konnte man wenigstens Geld verdienen. Deutschland war ein großer Teddybär – den durfte man knuffen und puffen, und er nahm gleichmütig jede Kritik hin. Doch dieses Land brauchte dringend Kritik, um nicht an seinem Wohlbefinden zu ersticken. Abarbeiten konnte man sich an ihm nicht, denn es war zu schlaff, unerreichbar in seiner Arroganz wie ein Mensch im eigenen Fett. Jeder Schlag traf ins Weiche. Es war schon etwas Besonderes, wenn einmal ein älterer Mann während der Lesung aufstand und aus Protest den Raum verließ. Karymsiuks Auftritte folgten einer eingespielten Choreographie. «Catch as catch can.»
Die Lesereisen waren ermüdend, aber sie waren für ihn keine Herausforderung. Er genoss es, das Publikum zu dressieren, doch um diesen Zirkus länger als zwei, drei Tage auszuhalten, musste er sich betäuben. Nach so einem Abend stand er dann im Hotelzimmer, um vier, halb fünf Uhr morgens, und lauschte den Zügen, die in der Ferne vorbeifuhren, oder den Reifen der Laster auf dem Asphalt.
Ich wollte nicht, dass er an fehlender Härte zugrunde ging. Ich wollte Andrzej ins Feuer werfen, um zu sehen, dass er nicht verbrennt.
Schon im März war ich wieder bei Karymsiuk in Wołowiec.
«Vielleicht hast du einfach Angst, nach Russland zu fahren?», provozierte ich ihn.
«Quatsch. Ich will nur nicht.»
«Du hast Angst, diese Erfahrung könnte dich umhauen.»
Er schwieg.
«Du könntest dir das wenigstens mal ansehen. Sonst redest du über ein Land, das du nicht kennst.»
«Aber was soll ich da? Ich kann mir vorstellen, wie es dort aussieht. Die Menschen sind eingeschüchtert und dumpf, sonst würden sie so ein Regime nicht dulden. Das geht schon seit Jahrhunderten so. Obrigkeitsdenken. Sie fürchten sich. Daran hat sich nichts geändert.»
«Dann fahren wir eben hin und tun etwas.»
«Zum Beispiel?»
«Irgendwas. Chodorkowskij befreien.»
Das war mir so rausgerutscht.
«Diesen Oligarchen?»
«Ja.»
«Warum denn das?»
«Weil das ein feiner Kerl ist, der völlig zu Unrecht sitzt.»
«Das sagst du.» Karymsiuk machte seinen Schmollmund. Er schürzte die Lippen und klemmte sich die rechte Wange zwischen die Backenzähne. «Irgendwas wird an den Vorwürfen schon dran sein.»
«Du redest wie alle, ohne nachzudenken.»
So begannen unsere Diskussionen. Beiläufig, fast spielerisch.
«Wo sitzt er?», fragte Andrzej.
«In Sibirien.»
«Sibirien, okay, das klingt schon besser. Meinetwegen. Nach Moskau oder Petersburg fahre ich jedenfalls nicht.»
Sibirien. Bei diesem Stichwort fielen mir die Gulags ein, die Straflager. Die verbannten Dekabristen im neunzehnten Jahrhundert. Zecken, Mücken und Schnaken.
«Abgemacht», sagte ich.
Die russischen Freunde in Berlin waren entsetzt. Von Chodorkowskij sagten wir gar nichts, ihnen genügte schon, dass wir nach Sibirien wollten. Sie rieten uns ab, ohne unsere wahren Pläne zu kennen.
«Auf keinen Fall mit dem Auto. Wenn ihr mit dem Auto fahrt, wird von euch keine Spur bleiben», sagte Elena, eine kluge Frau.
Und die andere Elena sagte: «Ihr seid verrückt. Dort leben nur Burjaten und ehemalige Häftlinge der Straflager, die nach ihrer Entlassung geblieben sind und Frauen geheiratet haben, die auch im Lager saßen oder zum Wachpersonal gehörten. Sadistisches, tumbes Volk. Täter wie Opfer. Und deren Nachfahren. Du kannst dir vorstellen, was das für ein genetisches Material ist. Sobald sie euch als Touristen aus dem Westen erkennen, werden sie euch überfallen und ausrauben. Die bringen euch um. Außerdem: Im Sommer ist es dort unerträglich. Ich weiß noch, wie ich einmal in einem Ferienlager am Baikal war. Mein ganzer Körper war voller Fliegen. Ekelhaft. Ich musste meinen Vater anrufen, damit er mich nach Hause holt.»
Die Dekabristen hatte sie vergessen.
Chodorkowskij war damals freiwillig von einer Reise in die USA nach Moskau zurückgekehrt, obwohl sein Geschäftspartner Platon Lebedjew gerade verhaftet worden war. Mag sein, dass er dieses Warnsignal nicht ernst genommen hatte. Oder er wollte seine Kollegen nicht im Stich lassen, wollte den Konflikt ausfechten. Vielleicht hat er auch die Skrupellosigkeit und Feigheit derer, die ihn fürchteten und ihn ausschalten wollten, einfach unterschätzt. So klang er jedenfalls, als ich ihn das erste Mal gesehen hatte.
Es war vor ein paar Jahren im Hotel Adlon am Pariser Platz. Chodorkowskij hielt einen Vortrag im Festsaal des Hotels, der bis auf den letzten Stuhl besetzt war. Ich sah sein schmales, glattrasiertes Gesicht aus der Ferne, denn als ich kam, saß und stand die Menge bereits dichtgedrängt vor dem Podium. Im Rückblick kommt mir dieser Abend fast unheimlich vor. Chodorkowskij beantwortete auch Fragen nach seinem Verhältnis zum russischen Präsidenten. «Haben Sie keine Angst vor Putin?», fragte eine Frau aus dem Publikum. «Nein», antwortete er mit ruhiger Stimme, die angeblich auch ganz laut werden konnte. Es hieß, dass er Mitarbeiter seiner Firma vor versammelter Mannschaft zusammenstauchte, wenn er mit ihrer Leistung nicht zufrieden war. «Und Putin braucht auch vor mir keine Angst zu haben», fügte er ebenso leise hinzu. «Ich plane keinen Umsturz in Russland.»
Das war zu optimistisch. Wenige Wochen später wurde er bei einer Zwischenlandung in Nowosibirsk aus dem Flugzeug heraus verhaftet. Als einer von mehreren Oligarchen, die in den Kreml geladen waren, hatte Chodorkowskij zuvor auf die Korruption bis in höchste Kreise hingewiesen. Dazu gehörte Mut. Augenzeugen berichten, dass er blass war, dass seine Stimme gezittert habe.
Nach dem Vortrag in Berlin gab ich Chodorkowskij die Hand. Neben mir stand ein grauhaariger älterer Mann mit wachem Blick, den ich im Stillen Nosferatu nannte. Er war vor Jahrzehnten Redakteur einer moskautreuen Zeitung gewesen. Ich fragte mich, wie er sich hier unter den Vorzeigekapitalisten Russlands fühlte. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wusste niemand mehr, was er denken sollte oder was die anderen dachten. Alle früheren Trennlinien waren über den Haufen geworfen. Dennoch mochte ich Nosferatu. Er war alt und unschädlich, wie eine Bombe mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum, er spielte seine Rolle als Graue Eminenz weiter – und er besaß Witz. Chodorkowskij betrachtete er durch eine rosa Brille: Kapitalist zwar, aber wenigstens Russe – und dadurch schon von Natur aus Revolutionär.
Gemeinsam gingen wir die paar Schritte vom Hotel zum Eingang der S-Bahn Unter den Linden. Was wir eben erlebt hatten, schien ihn nur gestreift zu haben – er war schon wieder von seiner Vergangenheit eingeholt. Daran merkte man am deutlichsten, dass er alt wurde. Irgendeine Erinnerung, eine Anekdote aus der DDR, eine konspirative Begegnung mit Konrad Wolf, hatte er ausgegraben und redete und redete …
An jenem Tag in Berlin begann ich, Chodorkowskij zu mögen. Das war nicht nur eine Frage der Politik. Es war seine Person, er selbst. Sein Gesicht verriet eine Sensibilität, die selten geworden war bei den öffentlich auftretenden Russen. Die neuen Funktionäre wirkten zynisch und diszipliniert wie die alten Kommunisten, aber sie glaubten an nichts mehr. Das Ende der Jelzin-Ära hatte eine schlappe Art von mutierten Scientologen emporgespült. Sie wollten auf der Seite der Überlebenden sein, wollten siegen lernen, aber ob von der Sowjetunion oder anderen, das war ihnen egal. Im Vergleich zu ihnen besaßen viele der alten Sowjets eine geradezu subtile Reife, sie hatten sich im Laufe der schnell verflogenen siebzig Jahre von gierigen Revolutionären zu milden, gesättigten Staatsmännern entwickelt. Gromyko, Falin, das waren Aristokraten im Vergleich zu diesen unbeherrschten Jungs.
Man muss, um das zu erkennen, vielleicht die berühmten Zehntelsekunden des Gesichtsausdrucks gesehen haben, die man nicht bewusst wahrnimmt und die dennoch entscheidende Signale aussenden. Im Studio eines Freundes in Berlin Mitte fand ich Gelegenheit dazu. Die Zeitlupe am Computer machte die verräterischen Sekundenbruchteile sichtbar. Eingefrorene Kinnpartien. Schmollende Lippen. Am eindruckvollsten waren die Mundwinkel, die auf beiden Seiten hochzuckten, wie bei zähnefletschenden Raubtieren.
Das Kunststück war, diese Männer zusammenzubringen. Mit Argumenten kam ich bei Andrzej nicht weit. Ich erzählte ihm bei jeder Gelegenheit von Chodorkowskij, ich versuchte, ihn mit meiner Sympathie anzustecken. Aber seine Begeisterung hielt sich in Grenzen. «Für mich hat der Mann kein Charisma», sagte er.
Das wollte noch nichts heißen. Denn auf einer beinahe wortlosen Ebene verstanden wir uns sofort: Befreiung, das war auch für ihn ein geradezu heiliger Begriff. Er selbst hatte, seit er laufen konnte, immer das Weite gesucht. Kreuz und quer durch Polen, in ziellosen Fahrten mit der Bahn, per Anhalter, auf der Ladefläche von Lastwagen. Reisen als Rausch, Flucht vor quälenden Fragen, unerklärlicher Unruhe. Während des Wehrdienstes war er einmal nicht zu seiner Einheit zurückgekehrt und hatte dafür im polnischen Knast in Stargard Szczeciński gesessen. Anderthalb Jahre wegen Fahnenflucht. Von dieser Zeit zeugten die Narben an seinen Unterarmen und am Oberkörper.
Heute schien das nur noch Literatur zu sein, der alte Fluchtinstinkt längst gezähmt. Die wilden Jugendjahre, die sich in Schriftstellerbiographien so gut machen. Raue Kanten, von der Zeit abgeschliffen, so wie Andrzej als Person heute glatt und eloquent auftrat.
Doch das hatte seinen Preis. Etwas in diesem Mann, den ich für sein poetisches Feuer bewunderte, war eingeklemmt. Womöglich war das sogar die treibende Kraft in ihm, ein ständiger Schmerz. Womöglich war es riesengroß, aber man sah es immer nur für Sekunden durch einen feinen Riss, wie den rotglühenden Stahl durch die angelehnte Tür des Hochofens. Manchmal wirkte er in seiner äußerlichen Ruhe auf mich, als hätte er eine Betäubungsspritze bekommen, stünde auf zittrigen Beinen da wie ein benommenes Tier, das erst allmählich zu sich kommt.
Deshalb war es unvorhersehbar, wie er sich in Russland bewegen, wie er auf dieses Land reagieren würde. Auf einen Osten, der noch mehr Osten war als sein eigener. Keine Frage – wenn es hart auf hart käme, würde ich mich absolut auf ihn verlassen können. Wenn wir den Gefangenen-Konvoi und die Soldaten mit Waffen in Schach halten, Chodorkowskij aus dem Fahrzeug holen, ihn in unseren Geländewagen setzen und ihm die Handschellen abnehmen müssten, würde er niemals kneifen. Aber in der langen Zeit davor, auf dieser Reise bis ans äußerste Ende Sibiriens, war es gut möglich, dass eine Stimmung ihn entmutigen, zur Umkehr bewegen, ihn aufgeben lassen würde. Das Risiko musste ich in Kauf nehmen, denn ich konnte mir diese Aktion nicht ohne ihn vorstellen. Nur ein Pole ist zu einer derart aussichtslosen Tat fähig.
Trotzdem war ich überrascht, als er am Ende zusagte.
«Wir fahren also hin und holen Chodorkowskij raus?», fragte ich.
«Klar», sagte er. Mehr nicht.
Ich konnte noch nicht glauben, dass Andrzej es ernst meinte. Dass ihm die Tragweite des Unternehmens bewusst war. Vielleicht fasste er meine Frage als Scherz auf und glaubte, es würde eine unserer üblichen Touren durch Südost- und Osteuropa werden. Deshalb sagte ich: «Wir fahren ohne die Frauen.»
«Sicher», erwiderte er. Und fügte nach einer Weile hinzu: «Ist zu gefährlich.»
In dem Moment war mir klar, dass er verstanden hatte. «Was sagen wir ihnen?», fragte ich.
«Dass wir auch mal was allein machen wollen.»
«Okay.»
«Sibirien ist zu gefährlich für sie.»
Wir sagten das so und hatten zu diesem Zeitpunkt doch keine Ahnung, was uns erwartete.
Andrzej stieg die Holztreppe hoch zu seinem Zimmer. Ich hörte, wie er die Tür aufschloss. Vor Jahren hatte er die Außenklinke abgeschraubt, sodass niemand mehr hereinkonnte, wenn er nicht von innen öffnete.
Ich hörte ihn Schubladen aufziehen und darin wühlen, dann kam er zurück und legte eine Pistole vor mir auf den Küchentisch.
«Was hältst du davon?», fragte er und schob mir die ölig glänzende Waffe hin. «Eine Beretta. Italienisches Fabrikat. Kaliber 9 mm …»
Ich nahm sie in die Hand und war überrascht, wie schwer sie war. Ich streckte den Arm aus, versuchte ihn ruhig zu halten und zielte auf das Wandgemälde über dem offenen Kamin. Ein Engel mit goldenem Heiligenschein breitete darauf seine Arme aus, in Schulterhöhe flatterten zwei kleine Putten in mönchsbraunen Gewändern. Ein wunderlicher Nachbar, der hier in Wołowiec vor Jahren seine schöpferische Ader entdeckt hatte, hatte die Wand mit warmen Erdtönen bemalt.
Andrzej legte seine Hand auf den Lauf. «Keine gute Idee.»
«Ich hätte ja nicht abgedrückt», beschwichtigte ich.
«Auf Engel schießt man nicht.»
Waffengewalt schwebte mir bei dem damals noch nebelhaften Befreiungsplan als Allerletztes vor. Wir mussten den amerikanischen Fehler vermeiden, jeden noch so fein geschnürten Knoten am Ende einfach mit militärischer Brutalität zu zersprengen. Als gäbe es keine raffinierteren Mittel. Abgesehen davon wäre Gewalt in unserem Fall gleichbedeutend mit Selbstmord gewesen. Wir hatten keine Chance gegen die Besatzung eines strengbewachten Lagers oder Gefängnisses, schon gar nicht gegen eventuell alarmierte militärische Unterstützung, die Kräfte der OMON-Milizen und des Innenministeriums, deren Schlagkraft nicht erst seit den Tschetschenien-Kriegen bekannt ist.
Denkbar war natürlich die technisch aufwendige Variante. Wir besorgen uns einen Hubschrauber und den Piloten gleich dazu. Das bekommt man nur bei der Armee – gegen ein gehöriges Bestechungsgeld oder von einem privaten oder korrupten halbstaatlichen Unternehmen. So etwas war in Russland leicht zu finden, aber wir hatten weder die Kontakte noch die nötigen Mittel dafür. Ob es private Flugzeug-Leihfirmen gab, wussten wir auch nicht. Wie schnell wäre die russische Luftwaffe einsatzbereit, wenn wir auf dem Gefängnisdach landen würden? Würde der Zeitvorsprung ausreichen, um über die chinesische Grenze zu gelangen? Der Stab des Sibirischen Militärbezirks war mitten im Zentrum von Tschita untergebracht, in einem klassizistischen Gebäude zwischen dem Bahnhof Tschita II und dem Leninplatz. Wenn ein solcher Plan gelingen sollte, musste er generalstabsmäßig ablaufen.
«Nicht zu schaffen», winkte Andrzej ab.
«Aber denk mal an den elften September. Da hat eine Handvoll Leute es geschafft, die Twin Towers in sich zusammenstürzen zu lassen.»
«Aber das waren Fanatiker. Moslems. Sie hatten einen Glauben.»
«Ja, und? Wir glauben an die Freiheit.»
«Du vielleicht. Sei doch nicht naiv. Was hat den Menschen hier in meinem Dorf die Freiheit schon gebracht? Die meisten haben ihre Arbeit verloren. Sie können mit der schönen neuen Welt nichts anfangen. Zum Verreisen haben sie kein Geld.»
Du Staubsaugervertreter, dachte ich, du selbstzufriedener Handelsreisender mit deinem Köfferchen östlichen Verfalls. Gehst hausieren mit der Melancholie eines in der Abendsonne lungernden, rauchenden Zigeuners.
Ganz die Unschuld, zog er die Brauen hoch.
«Ja, und?», sagte ich. «Das sollen wir uns zum Vorbild nehmen? Diese Menschen haben sich in ihrer Rückständigkeit eingerichtet, sie scheuen jede Veränderung. Da muss man mit harter Faust hineinfahren.»
«Mit der Faust? In mein Dorf?»
«Ach, hör auf.»
Doch er fuhr unbeirrt fort, auch genüsslich, weil er merkte, dass er mich erfolgreich auf die Palme gebracht hatte: «Außerdem habe ich den Verdacht, der elfte September war sowieso nur eine Simulation im Fernsehen. Virtual reality. Verstehst du? Es gibt Indizien.»
«Das ist nicht dein Ernst, oder?»
Er zuckte mit den Schultern. «Glaubst du alles, was in der Zeitung steht?»
Realistischer war tatsächlich die David-Variante – mit List und einer gehörigen Portion Intelligenz. Etwas anderes hatte Chodorkowskij auch nicht verdient. Wir mussten mit seinen Mitteln arbeiten. Er war so gewitzt, dass Putin nichts übriggeblieben war, als ihn mit plumper Gewalt festzunehmen und wegzusperren.
«Wir müssen uns wehren können», überlegte ich. «Als letzte Option. Wenn wir in einen Hinterhalt geraten, wenn uns jemand festhalten will, zum Beispiel. Ich hab noch nie so ein Ding benutzt.» Ich schaute auf die Beretta in meiner Hand. «So eine besorgen wir uns in Russland. Das ist kein Problem. Ich weiß, wo man die kriegt. Können wir bei dir irgendwo damit üben?»
«Klar», sagte Andrzej.
«Hast du Munition?»
«Klar.»
«Woher?»
«Frag nicht. Ist besser für dich.»
Der Schnee war getaut, im Hügelland oberhalb des Dorfes duftete es nach Nadelblättern und feuchter Erde. Der Waldboden federte, dennoch lief es sich leichter als noch vor wenigen Wochen im tiefen Schnee.
Jeden Tag streiften wir durch die Berge. Wenn wir Stunden später zurückkamen, mussten wir uns erst einmal aufwärmen. Die nassen Stiefel blieben draußen auf der Veranda. Wir machten Feuer im Kamin und brutzelten ein paar Spiegeleier. Am Nachmittag war hier noch wenig los. Erst gegen Abend, wenn die ersten Familienmitglieder eintrudelten und Besucher kamen, zogen wir uns in das Blockhaus zurück, das Andrzej sich vor einiger Zeit am Hang über dem Haus gebaut hatte. Ein schmaler Steg führte über ein Rinnsal zu der Hütte. Dort roch es nach Harz, Terpentin und frischgesägtem Fichtenholz. Der Fußboden war glatt und hell, mit einer Schicht ganz feinen Sägemehls, wenn man mit der Hand darüberstrich. Die spartanische Einrichtung verhinderte jede Ablenkung. Die einsame kleine Stereoanlage auf dem Fußboden blieb meist stumm. An einer Wand waren Fotos und Karten mit Reißzwecken befestigt.
Wie kommt man am schnellsten nach Tschita oder Krasnokamensk, ohne sich schon beim Kauf des Flugtickets mit seinem Reiseziel zu verraten? Wir breiteten Landkarten von Russland und Sibirien auf dem großen Holztisch aus. Von Moskau nach Krasnokamensk waren es sechstausend Kilometer. Es gab zwar drei Fluglinien, die Direktflüge von Moskau nach Tschita anboten – AVIAROST, Tschita Avija und VIM AVIJA –, aber der Kauf eines solchen Tickets, glaubten wir, wäre zu auffällig. Wir mussten in angemessener Entfernung landen, am besten an einem von Touristen gern besuchten Ort, und uns dann gemächlich, wie Touristen, auf unser eigentliches Ziel zubewegen. Für die Transsibirische Eisenbahn von Moskau war die Zeit zu knapp. Am Ende einigten wir uns auf Irkutsk. Das war der beste Ausgangspunkt. Wenn wir Mitte Juli dort landeten, hätten wir drei Wochen bis zum achten August, um ohne auffällige Eile nach Krasnokamensk zu kommen.
An diesem Tag sollten in Peking die Olympischen Sommerspiele eröffnet werden. Am achten August 2008 um acht Uhr morgens. Die Acht ist bei den Chinesen eine Glückszahl. Sie steht für Reichtum. Es konnte nicht schaden, wenn auch wir uns ihre Symbolkraft für unseren Plan zunutze machten. Deshalb entschieden wir, dass an diesem Tag die Befreiung stattfinden sollte – ändern ließ sich das Datum immer noch. Wichtig war der Zielkorridor, der unserer Aktion einen zeitlichen Rahmen gab. Es war nicht tragisch, wenn wir ihn um ein, zwei Tage verfehlten.
Möglichst bald mussten die Visa beantragt, die Flugtickets gekauft werden. Pro forma buchten wir einen Rückflug für den zehnten August aus Irkutsk. Niemand außer uns wusste, dass wir diese Maschine nie besteigen würden.
Früh am Morgen packten wir ein paar Dosen Bier ein und verdrückten uns in die Berge. Um diese Zeit weckten wir sogar die Hunde auf, die hündisch ergeben und schwanzwedelnd aus ihren Hütten auf die Veranda gekrochen kamen, wenn wir dort auf der Holzbank saßen und uns die Stiefel anzogen. Der Nebel hing noch bis oben in die Wälder und zerstreute sich erst mit der aufgehenden Sonne langsam im Tal.
Die Schießübungen waren mehr ein Vorwand. Wir rechneten nicht damit, tatsächlich einmal die Waffe zu gebrauchen. Eher übten wir die gemeinsame Bewegung im Raum. Eine Art Generalprobe. Der Erfolg der Aktion in Sibirien hing auch davon ab, wie gut wir uns aufeinander verlassen, ob wir uns gegenseitig einschätzen konnten. Es würde eine Menge Situationen geben, die sich nicht im Voraus planen ließen.
«Ein Revolver ist sicherer als eine Pistole», erklärte Andrzej. «Er bekommt seltener eine Ladehemmung, auch wenn man meist das Gegenteil denkt, weil man meint, die Drehtrommel wäre ein komplizierter Mechanismus. Ein weiterer Vorteil ist, dass du den Revolver auch nachladen kannst, wenn du angeschossen bist. Für eine Pistole brauchst du beide Hände.»
Er erläuterte mir den Umgang mit der Waffe. Wie man sie entsichert. Wie man das Magazin wechselt. Wie man die Pistole auseinandernimmt, sie reinigt und wieder zusammensetzt. So viel hatte er bei der polnischen Armee gelernt.
In den Wäldern über dem Dorf und hinter den nächsten Hügelketten begegnete uns fast kein Mensch. Bis Wołowiec waren die Schüsse vermutlich gar nicht zu hören. Für den Fall, dass uns doch jemand überraschte, nahmen wir ein Kleinkalibergewehr mit, für das Andrzej eine Genehmigung hatte. So konnten wir immer behaupten, wir hätten mit dem Gewehr geschossen. Nicht viele Menschen sind in der Lage, den Schuss einer Pistole von dem eines Kleinkalibers zu unterscheiden. Die Pistole war nicht registriert und hätte uns Ärger eingebracht.
Wenn eine Bierdose geleert war, stellten wir sie in vierzig bis fünfzig Meter Entfernung auf einen Baumstumpf oder in eine Astgabel. Ich traf am Anfang nur selten.
«Du warst nicht bei der Bundeswehr, oder?», fragte Karymsiuk. Er mochte dieses deutsche Wort und benutzte es in der weiblichen Form – bundeswera.
«West-Berliner mussten nicht.»
Andrzej stellte seinen Rucksack ab und zog eine neue Dose heraus. Von hier aus öffnete sich der Blick über das ganze langgezogene Tal mit den Resten des Lemkendorfes und den neuen Häusern, die sich an der Straße entlang ausbreiteten. Immer mehr Städter ließen sich hier nieder. Sie bauten meist etwas höher am Berghang, protziger und größer als die Einheimischen.
An diesem Tag hatten wir bis zum späten Nachmittag in den Bergen Schießübungen gemacht. Wir kamen aus dem Wald und gingen müde den Hang hinunter.
«Verdammt», fluchte Andrzej. Ich dachte, er wäre gestolpert, so abrupt stürzte er den Hang hinab. Unten im Tal konnte ich aus der Ferne nur eine Herde auseinanderlaufender schmutzig weißer Punkte erkennen, eine Schafherde, und einen Hütehund, der auf sie zulief und immer wieder zurücksetzte, wie im Spiel. Aber nein, das war kein Hütehund. Der Hund hetzte die Schafe.
«Dojczland, hierher!», schrie Karymsiuk.
Als wir endlich ankamen, hatte die Schäferhundmischung ein Lamm im Genick gepackt und schüttelte es mit aller Kraft hin und her. Wie ein schlaffes Kissen hing das Tier im Gebiss des Hundes. Es war zu spät. Zwischen den weißen Löckchen blitzte rohes Fleisch auf. Als wir es endlich befreit hatten, lag das kleine Wesen mit starren Läufen da und zitterte am ganzen Leib. Andrzej setzte ihm die Pistole auf die krause Stirn und drückte ab.
Ich sah die Wirkung dieser Waffe zum ersten Mal aus der Nähe. Dojczland hielt sich in respektvoller Entfernung und fiepte vor Erregung. Andrzej trat mit dem Fuß in seine Richtung. Ich wusste, wie sehr er diesen Hund liebte. Dojczland zog den Schwanz ein und suchte das Weite. Andrzej fluchte ihm hinterher. «So etwas passiert dauernd», sagte er hilflos. «Wir haben den Zaun bei uns schon höher gesetzt. Aber die Hunde schaffen es doch immer rüberzuspringen.»
«Kriegt ihr keinen Ärger mit den Nachbarn?»
«Klar. Entweder die Tiere verenden sofort, oder sie müssen notgeschlachtet werden. Es passiert leider immer öfter.»
Das Besserungslager IK-10 (früher Jag 14–10) in Krasnokamensk, Ostsibirien, in das Chodorkowskij nach seiner Verurteilung 2005 gebracht worden war, ist umgeben von ödem Steppenland. Ursprünglich war es gegründet worden, um Arbeitskräfte für den Uranabbau zu konzentrieren. Man findet in der Nähe noch die alten Gruben und Fabriken. Als Folge des Uranbergbaus weist die Gegend eine signifikant erhöhte Radioaktivität auf. Von Zabajkalsk an der chinesischen Grenze fährt man etwa fünfundsiebzig Kilometer durch eine sanft gewellte Landschaft, die von jedem auch nur leicht erhöhten Standpunkt schon aus der Ferne einzusehen ist. Hier fällt die kleinste Bewegung auf. Der Vorteil von Krasnokamensk war, dass es nahe an der chinesischen Grenze lag und damit einen einfachen, direkten Fluchtweg ins Ausland bot. In der Luftlinie beträgt die Entfernung zur Grenze etwa fünfundvierzig Kilometer. Mit dem Auto konnte man diese Strecke in einer guten halben Stunde zurücklegen. Allerdings brauchten wir dafür einen Vorsprung, denn wenn die Flucht vorzeitig aufflog, würde man uns vom Hubschrauber aus abknallen können wie die Hasen. Das war der Nachteil. Schlupflöcher gab es in dieser kargen Gegend nirgends. Mehrere Jahre hintereinander war das Land von Dürre heimgesucht worden. Die ohnehin spärliche Vegetation war ganz vertrocknet, von Wäldern und Hainen waren nur noch kahl aufragende Stämme geblieben. Die laublosen Birken boten einen trostlosen Anblick.
Auf den uns zur Verfügung stehenden Fotos konnte man trotz der mangelhaften Auflösung erkennen, wie verrostet die Zäune und Wachtürme des Lagers waren. Das ganze Ensemble machte einen sehr heruntergekommen Eindruck, so als lebte dort keine Menschenseele mehr. Nach diesen Aufnahmen zu urteilen, musste es relativ einfach sein, dort jemanden einzuschleusen und Chodorkowskij herauszuholen.
Er war in diesem Lager in einem von dreizehn kasernenähnlichen Gebäuden untergebracht und hatte einen Schlafplatz in einem zweistöckigen Bett. Wir wussten nicht genau, in welchem Gebäude er sich befand. Wir wussten auch nicht, ob sich das änderte oder ob er ständig in einem Haus blieb. In jedem dieser Blöcke waren ein- bis zweihundert Gefangene untergebracht. Chodorkowskij trug einen dunkelblauen Häftlingsanzug mit seinem Namen auf der Brust. Als politischer Gefangener war er hier eine Ausnahme. Bei den Insassen handelte es sich in der Mehrzahl um jugendliche Diebe und Gewaltverbrecher.
Sogar ein ziemlich detaillierter Tagesablauf aus dem Lager in Krasnokamensk war uns zugespielt worden. Das Leben der Häftlinge schien geradezu fürsorglich geregelt zu sein. Um 6.00 Uhr werden sie durch einen Lautsprecher geweckt. Um 6.30 Uhr gibt es Frühstück (Weizengrieß und schwarzen Tee) in der gemeinsamen Kantine. Nach dem ersten Appell übernimmt um 9.00 Uhr jeder Häftling die ihm aufgetragenen Funktionen – Zimmer putzen, Brot backen, Geschirr spülen, Reparaturen. Ab 11.00 Uhr Kartoffeln schälen und kochen, um 12.00 Uhr Mittag. Nach dem zweiten Appell ab 15.00 Uhr Arbeit oder Unterricht. 18.00 Uhr Abendessen. Nach 20.00 Uhr dürfen sie fernsehen, jedoch nicht mehr als zwei Stunden am Tag. In jedem der dreizehn Barackenblöcke steht ein Fernsehapparat. Aus dem Programm der staatlichen Sender erfahren die Häftlinge nicht viel über die wahre Situation im Land. Um 22.00 Uhr ist Nachtruhe, dann wird das Licht gelöscht.
Dieser Tagesablauf ließ zwei mögliche Zeitfenster für die Befreiung erkennen – jeweils nach den beiden Appellen. Der erste beginnt um 7.00 Uhr, der zweite um 13.00 Uhr. Die Appelle können bis zu zwei Stunden dauern. Ihr Zweck ist die Überprüfung der Vollzähligkeit der Häftlinge. Die Flucht musste sofort nach dem Ende einer solchen Zählung erfolgen, wenn sie so lange wie möglich unentdeckt bleiben sollte. Nachts oder am frühen Morgen wäre es schwierig, sich überhaupt unauffällig im Lager zu bewegen. Wenn alle schliefen, fiel jeder auf.
Das Wichtigste war, erst einmal Kontakt zu Chodorkowskij aufzunehmen. Ein bestimmter Personenkreis hatte regelmäßig Zugang zum Lager. Waren und Lebensmittel mussten von außen geliefert werden. Zwar gab es eine Viehzucht, Gärten und eine Bäckerei; Fleisch, Brot und Kartoffeln, die Standardverpflegung zum Mittag- und Abendessen, stammten aus eigener Produktion. Aber schon der schwarze Tee musste geliefert werden, ganz zu schweigen von Obst und Meeresprodukten, die auf den Tisch kamen, wenn sich eine Lagerinspektion aus Moskau ankündigte. In dem Gefängnisladen, in dem die Häftlinge während ihrer einstündigen Freizeit nach 16.00 Uhr einkaufen dürfen, gibt es Seife, Zigaretten und andere Bedarfsartikel. Zeitungen gelangen meist drei Tage nach dem Erscheinungsdatum ins Lager. Auch in einer Zeitung konnte man Nachrichten schmuggeln. Welche Möglichkeit am besten geeignet war, mussten wir vor Ort feststellen.
Wir mussten aber auch mit der Möglichkeit rechnen, dass Chodorkowskij gar nicht mehr dort war. Nach offiziellen Informationen war er nämlich Ende 2006 in das Untersuchungsgefängnis in Tschita, den Sledstvennyj izoljatorIZ-75/1, verlegt worden. Anwälte und Menschenrechtsorganisationen bestätigten diese Information. In der Presse fand ich aber später und sogar wenige Wochen vor unserer Reise noch widersprüchliche Nachrichten, denen zufolge Chodorkowskij nach wie vor in Krasnokamensk saß. Wir mussten für beide Möglichkeiten gewappnet sein. Tschita hatte den Vorteil, dass es leichter und unauffälliger zu erreichen ist. Dort würden wir Chodorkowskij nach der Befreiung auch erst einmal irgendwo unterbringen, in einem Keller verstecken können. Vom Gefängnis in Tschita bot sich die Flucht in die Mongolei an. Von dort bis zur chinesischen Grenze in Zabajkalsk waren es immerhin 460 Kilometer.
«Was, wenn er gar nicht befreit werden will?», keuchte Andrzej beim Anstieg zu einer Berghöhe südlich vom Tal. Die Kletterei machte ihm sichtlich Spaß. Die Luft war so feucht vom Nebel, dass man auch glauben konnte, es niesele.
Die Frage überraschte mich. Plötzlich wurde er konkret. Am Abend zuvor hatte er mir noch vorgeworfen, dass ich beschränkt an den Tatsachen klebe. So bodenständig deutsch sei. Krzysztof Varga saß mit uns am Küchentisch, als wir über eine Stelle aus Andrzej Stasiuks «Dojczland» diskutierten: «Feuchte Dunkelheit legte sich über Bayern. Dann aber, als wir schon hoch, ganz hoch waren, öffnete sich im Westen eine lange, horizontale, gleißend helle Spalte. Wir flogen an ihr entlang. Hier war es dunkel, dort aber, in diesem Riss, der so fein war wie ein Haar, wie eine Wunde von der allerschärfsten Klinge, loderte goldenes Feuer, pulsierte purpurnes Blut.»
Schon möglich, dass ich sticheln wollte. Aber mich interessierte tatsächlich, was der Autor sich unter dieser Transzendenz vorstellte, wie nah er sich an das Religiöse heranwagte. Und ich fragte absichtlich plump: «Was meint er mit dieser Klinge, was für Blut soll das sein?»
«Weiß nicht, Konrad … Eine Metapher.» Hilfesuchend blickte Karymsiuk zu Varga hinüber, um sich des ungaroslawischen Bundes gegen meine deutsche Beschränktheit zu vergewissern.
Kann man jemanden befreien, der gar nicht darauf vorbereitet ist? Wenn er uns, zwei Wildfremde, vor sich sah, musste Chodorkowskij davon ausgehen, dass das eine Falle sei. Dass man ihn auf der Flucht erschießen wollte. Er würde in dem Moment nicht bedenken, dass man das viel einfacher hätte haben können – wie mit Litwinenko in London, der vergiftet worden ist. Er hätte nicht viel Zeit zum Nachdenken in so einem Moment. Wenn wir uns nicht irgendetwas einfallen ließen, würde sein Selbsterhaltungsinstinkt vermutlich über das Verlangen nach Freiheit obsiegen.
Es gibt ein schönes russisches Wort für diese Art der Entführung: выкрасть – «herausstehlen». So nannte das eine Zeitung, als sie die Entführung des serbischen Kriegsverbrechers Karadžić aus Den Haag empfahl. Stehlen kann man einen Sack Kartoffeln, aber keinen lebendigen Menschen. Das Wie der Befreiung war nur die eine Frage – und eine eher handwerkliche. Wir konnten Chodorkowskij nicht vorher um Erlaubnis bitten. Es gab keine hundertprozentig zuverlässige Organisation, keinen Kontaktmann, dem man uneingeschränkt vertrauen konnte. Selbst seine Anwälte im Westen, seine PR-Agenturen konnten unterwandert sein und waren es zum Teil auch. Wir mussten also die Befreiung vorbereiten, ohne zu wissen, ob er sie wollte. Das war das Risiko. Es ließ sich nicht vermeiden.
Andrzej bohrte nicht weiter nach. «Gut», sagte er. «Lassen wir diese Frage mal offen. Was dann?»