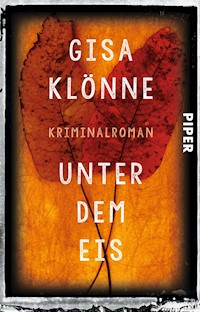8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wald, stoischer, stummer Wald ist der Schauplatz, an dem Kommissarin Judith Krieger ermitteln muss. Wald, der Tatort eines Mordes ist. Wald, der das Geheimnis um ein Mädchen birgt. Der Fall konfrontiert Judith mit der Trauer um einen Freund. Außerdem muss sie ausgerechnet gemeinsam mit dem ungeliebten Kollegen Manni Korzilius ermitteln. Doch sie hat keine Wahl, sie muss diesen Fall lösen, denn es geht um ihren Job und bald auch um ihre Identität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Michael
ISBN 978-3-492-97401-1
September 2016
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016
Erstausgabe: Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2009/Ullstein Verlag
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Covergestaltung: Mediabureau di Stefano, Berlin
Covermotiv: Mark Fearon/Arcangel (Feder und Untergrund); kjohansen/Getty Images (Rahmen)
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Sahar International Airport Mumbay, 8. Mai
Der kleine Mann trug staubige, abgetretene Gummilatschen, Adidas-Shorts und ein Hemd, das verblichen war. Er passte nicht zu den anderen in den gebügelten Fantasieuniformen, die mit ihren polierten Metallschildern neben ihm auf Urlauber warteten. »Darshan Klein« stand auf dem Stück Pappe, das sich der kleine Mann über den Kopf hielt. Die Glastüren vor den Gepäckbändern spuckten lärmende Menschen aus. Irgendwo plärrte ein Baby. Immer wenn jemand am anderen Ende des Flughafengebäudes die Türen öffnete, waberte ein Schwall feuchtwarme, abgasgetränkte Luft in die klimatisierte Halle. Sandra Hughes saß am British-Airways-Ticketschalter und beobachtete den kleinen unpassenden Mann mit dem Pappschild, weil sie sonst nichts zu tun hatte. Jetzt rannten ihn zwei Geschäftsreisende beinahe über den Haufen. Sie entschuldigten sich nicht, hasteten weiter zum Info-Counter, wo sie ihre Pilotenkoffer auf den hellen Steinboden knallten. Die Hostessen hinter der Theke pflegten ihr neutrales Lächeln.
Heute Nachmittag wollte offenbar überhaupt niemand ein Ticket kaufen, die Schicht zog sich in die Länge. Sie dachte an ihren Freund, der morgen aus Sydney zurückkommen würde. Diese Jenny arbeitete schon wieder auf demselben Flug wie er und das gefiel ihr nicht. Vielleicht sollte sie Anns Rat befolgen und die Sache beenden. Sie könnte sich wieder nach England versetzen lassen, aber der Gedanke an den ewigen Nieselregen war nicht gerade ermutigend. Vielleicht sollte sie einfach die Pille absetzen. Jetzt war auch American Airlines gelandet. Eine Traube weißhäutiger, schwitzender Touristen in bunt gemusterter Freizeitkleidung quoll in die Halle. Sie zerrten ihre riesigen Hartschalenkoffer hinter sich her und wurden sofort von den Männern in den Fantasieuniformen zum Seitenausgang eskortiert. Nur der kleine Mann mit den Gummilatschen blieb übrig. Er hielt sein Pappschild noch etwas höher und ließ die Glastüren nicht aus den Augen.
Zwei Stunden später, als der glutheiße Nachmittag draußen sich zu einer weiteren Nacht verdunkelt hatte, die keine Abkühlung bringen würde, kam der kleine Mann mit zögernden Schritten auf ihren Ticketschalter zu. Das Pappschild hatte er jetzt unter den Arm geklemmt und seine gekrümmten Schultern gaben seinem Gang etwas Geducktes, Resigniertes. Was zum Teufel …, dachte Sandra, aber dann stand er schon vor ihr und sie konnte sehen, wie sehnig und hager er war und dass sein Hemd am Kragen Löcher hatte. Er roch nach Curry und frischem Koriander. »Darshan Klein«, sagte er, und ein goldener Backenzahn blitzte auf. Einer seiner Schneidezähne fehlte. Er legte einen zerknitterten Zettel auf den Tresen. »BA 756, 5:05 pm, Darshan Maria Klein.«
»Die Maschine aus Frankfurt ist pünktlich gelandet und alle Passagiere sind längst durch.« Sie war nicht sicher, ob er verstand. »It landed at five«, wiederholte sie. »No more passengers here.«
»Darshan Klein.« Es lag etwas Drängendes in seinen Worten.
Seine dunklen Augen hielten ihren Blick fest. Er deutete auf ihren Computer. Eigentlich war er gar nicht so unsympathisch.
Sandra seufzte. »Okay, ich werde nachsehen.« Sie tippte die Flugnummer und den seltsamen Namen ein. Die Maschine war pünktlich gelandet, wie sie es gesagt hatte, aber eine Person namens Darshan Maria Klein war nicht an Bord gewesen.
»I’m sorry«, wiederholte sie. »Darshan was not on this flight.«
Der Mann schien nicht zu verstehen.
»Darshan not come«, radebrechte sie.
Der Mann nickte, machte aber keine Anstalten zu gehen. »Darshan?«, wiederholte er, zeigte erneut auf den Computer und dann auf die Uhr über dem Infoschalter.
»Oh, Sie meinen, ob es noch einen späteren British-Airways-Flug gibt? Nein, das war der letzte für heute.«
Nebenan am Air-India-Counter machten die Ticketverkäuferinnen Feierabend. Irgendwie musste sie diesen hartnäckigen Kunden loswerden. Sie rief das Buchungssystem auf und gab den Namen erneut ein. Bingo. Darshan Maria Klein war tatsächlich auf die Fünfuhrmaschine aus Frankfurt gebucht worden. Scheiß auf die Datensicherheit, dachte sie, drehte den Bildschirm ein Stück herum und winkte den Mann heran. Aufmerksam folgte er ihrem Zeigefinger.
»Darshan war tatsächlich auf die Maschine BA 756 gebucht.« Sie zeigte ihm den Namen im Buchungsmenü, wechselte dann zur Passagierliste. »Aber sie hat nicht eingecheckt, sehen Sie? In Frankfurt? Darshan not come.«
»Darshan not come«, wiederholte der Mann. Es klang traurig.
Sandra schenkte ihm ein professionelles Lächeln.
»Darshan not come. I’m sorry.«
»Tomorrow?«
Aufseufzend tippte sie auch diese Option in die Tasten.
»No. I’m sorry.« Sie stand auf und begann, die Prospekte vom Tresen einzusammeln.
Der Mann nickte zögernd und ging endlich zum Ausgang. Ein kleiner, gebeugter Schatten, der durch die Glastür glitt und mit der Nacht verschmolz, zielstrebig und lautlos wie eine Katze.
1. Teil
Das Vergehen
Sonntag, 26. Oktober
Sie sehen die Frau, sobald sie die Lichtung erreichen. Sie kniet und erbricht sich. Die Wiese ist sumpfig, Grashöcker ragen daraus hervor wie strohige Perücken. Egbert Wiehl drückt seiner Frau das Pilzkörbchen in die Hand und versucht, so schnell wie möglich zu der Fremden zu gelangen, ohne nasse Füße zu bekommen. Ein sinnloses Unterfangen, es hat tagelang geregnet. Die Frau ist noch jung und hat einen blonden Pferdeschwanz. Sie schreit leise auf, als sie Egbert Wiehl wahrnimmt, und plötzlich weiß er nicht mehr, was er sagen soll. Ist Ihnen nicht gut? Brauchen Sie Hilfe? Beides ist offensichtlich, denn es ist ein kalter Morgen und trotzdem kauert die Frau mitten in einer schlammigen Pfütze. Eine Sportlerin. Er zwingt sich, nicht auf ihre langen, muskulösen Beine zu starren, die in einer engen schwarzen Trikothose stecken.
Die Frau versucht, etwas zu sagen, aber ihre Zähne klappern zu heftig. Es stinkt nach Erbrochenem. Die Frau hat sehr runde, grasgrüne Augen. Von ihrem Kinn hängt ein Spuckefaden, den sie offenbar nicht bemerkt. Jedenfalls macht sie keine Anstalten, ihn wegzuwischen. Egbert Wiehl hat das Gefühl, dass sie sich vor ihm fürchtet, und geht in die Hocke.
»Haben Sie etwas Falsches gegessen? Pilze vielleicht? Sind Sie gestürzt?« Er streckt die Hand nach ihr aus und sie zuckt zurück. Im selben Moment wird ihm bewusst, dass er das Fahrtenmesser noch in der Hand hält.
»Entschuldigen Sie, das Messer – wir sammeln Pilze, Helga und ich. Es war ja keine sehr gute Pilzsaison, zu kalt, und jetzt ist es schon spät im Jahr, aber …« Er klingt wie ein Idiot. Hastig schiebt er das Messer in den Schaft an seinem Gürtel und lächelt.
»Kommen Sie.« Er streckt ihr wieder die Hand entgegen. »Können Sie aufstehen? Sie können doch hier nicht in der Pfütze knien. Sie holen sich ja den Tod.«
Statt einer Antwort beginnt die Frau erneut zu würgen, blass und hässlich sieht ihr Gesicht dabei aus, eine verzerrte Maske.
»Meine Frau ist dort drüben, wir wollen Ihnen helfen. Ich bin Arzt, wenn auch neuerdings pensioniert.«
Hört sie ihn überhaupt?
»Kommen Sie«, drängt er einmal mehr.
Jetzt setzt die Frau sich mühsam auf. Sie zittert immer noch, hebt aber den rechten Arm und zeigt auf einen Hochsitz, der am Südrand der Lichtung im Schatten der Bäume steht.
»D-d-da.«
Egbert Wiehl folgt der Linie, die ihr Zeigefinger beschreibt, mit den Augen. Ist sie dort runtergestürzt? Unwahrscheinlich, denn sie konnte laufen, ihre Fußspuren sind gut sichtbar ins nasse Gras gedrückt. Sie führen direkt vom Hochsitz zu der Stelle, wo sie kniet.
»Egbert! Ist alles in Ordnung?« Helgas Stimme scheint von weit her zu kommen, mit einer unwirschen Handbewegung lässt er sie verstummen. Er späht zu dem Hochsitz hinüber. Krähen flattern um den hölzernen Ausguck am Ende der Leiter, drängen sich durch die seitlichen Schießscharten, ja, es sieht aus, als ob sie sogar durch das Dach tauchen und sofort wieder herauskatapultiert werden, ein taumelndes, rastloses Auf und Ab. Irgend etwas stimmt nicht.
»Warten Sie hier.« Egbert Wiehl steht schwerfällig auf. Hitchcocks Vögel fallen ihm ein, er drängt die Filmbilder beiseite, fixiert den Hochsitz. Kein Grund, sich zu fürchten, sagt er sich. Die Frau macht eine Bewegung, als wolle sie weglaufen. Er tätschelt ihre Schulter. »Bleiben Sie hier, ich sehe nach.« Keine Antwort, nur ihr fliegender Atem. Er stapft auf den Hochsitz zu. Der Himmel ist pastellblau und wolkenlos, und die Sonne klettert soeben hoch genug, um die Baumwipfel im Tal rot und gelb aufleuchten zu lassen. Vor zwei Stunden hat Helga Kaffee, Mineralwasser, belegte Brote, Äpfel, eine Tafel Nussschokolade und die Picknickdecke in den Rucksack gesteckt, den er auf dem Rücken trägt. Der Wetterbericht hat einen strahlenden Altweibersonntag versprochen. Die letzte Chance des Jahres, ein paar Reizker zu finden und die Aussicht vom Bärenberg zu genießen.
Egbert Wiehl erreicht den Fuß der Leiter und späht nach oben. Die Krähen haben überhaupt keinen Respekt vor ihm. Es sind viele, bestimmt 20 Stück.
»Schschsch«, macht Egbert Wiehl, »Schsch.«
Er stellt den Rucksack ins Gras und dreht sich um. Beide, Helga und die blonde Sportlerin, stehen nun nebeneinander und beobachten ihn. Es sieht aus, als ob Helga die Fremde festhält. Im selben Moment bemerkt er den Gestank. Süßlich. Faulig. Kranke und Sterbende riechen manchmal schlecht, aber doch nicht so. Verwesung, signalisiert sein Hirn. Vor 40 Jahren hat er das zuletzt ähnlich intensiv gerochen, als sie im Keller des Universitätsklinikums Leichen sezieren mussten. Es gab keine Klimaanlage und man konnte nie sicher sein, was einen erwartete, wenn man die Toten aus ihren Formalinbädern hob. Egbert Wiehl späht ins Unterholz, kann aber nichts Ungewöhnliches erkennen. Er versucht, möglichst flach zu atmen.
Der Gestank wird schlimmer, je höher er klettert. Die schwarzen Vögel stürzen krächzend aus dem Himmel und taumeln wieder empor. »Schsch«, macht er erneut, aber erst als er ganz oben angekommen ist, fliegen sie weg. Das Blut rauscht in seinen Ohren. Sein Mund ist trocken, die Zunge ein pelziges Tier. Das, was die Krähen zurückgelassen haben, liegt auf der hölzernen Sitzbank. Es stinkt gotterbärmlich. Es ist nackt und zerfressen. Schutzlos. Im Dach des Hochsitzes fehlen Bretter. Egbert Wiehl schluckt angestrengt. Nur das Haar der Leiche sieht noch menschlich aus. Es ist seidig und blond, wie das der Sportlerin.
***
Kriminalhauptkommissarin Judith Krieger reitet wieder. Sie galoppiert durch einen Sommerwald, in weiten Sprüngen, die sie wiegen, bis sie vergisst, dass sie und das Pferd zwei Wesen sind. Ein Schimmel. Er spricht zu ihr in einer Sprache, die sie intuitiv versteht. Eine dunkle Stimme, tief in ihr drin. Es tut weh, weil es so nah ist. Irgendein Ich von ihr weiß die ganze Zeit, dass sie nur träumt, und registriert das Telefon, aber sie hört trotzdem nicht auf, den Pferdehals zu liebkosen. Nicht aufwachen müssen. Niemals mehr. Geborgen sein, gewiegt werden wie ein Kind. Das Klingeln verstummt und wieder gibt es nur den weißen Rücken unter ihr, die Ahnung von Glück. Licht fällt durch die Baumkronen auf das Pferd und tanzt im Takt seiner Muskeln. Irgendwo tief in ihrer Brust lauert der Schmerz.
Als sie den Waldrand erreichen, will sie umkehren, aber das Pferd gehorcht ihr nicht mehr. Ich will das nicht, denkt ihr waches Ich. Will diesen Traum nicht, jedenfalls nicht dieses Ende, nicht wieder dieses Ende. Weit entfernt hinter den Feldern duckt sich ein Gehöft ins Tal. Plastikverschweißte Heuballen gleißen daneben, der Landschaft seltsam entrückt, wie eine Installation von Christo und Jeanne-Claude. Der Schmerz in Judiths Brust wird stärker, Panik mischt sich darunter, trocknet ihre Kehle aus. Du träumst, sagt ihre Vernunft. »Du musst suchen«, flüstert der Schimmel. Was denn, will sie fragen, aber da trägt er sie auf einmal vorwärts – so ist es jedes Mal –, schneller und immer schneller und es gibt keine Zügel, nur die Mähne, an die sie sich klammert, den Geruch nach Erde und Pferd und den Wind, der ihr die Tränen in die Augen treibt. Die Angst. Sie beginnt zu fallen. Halt an, ich will nicht zu diesem Hof, versucht sie zu rufen, aber die Einigkeit mit dem Schimmel ist jäh verschwunden und sie findet ihre Stimme nicht mehr, nur verzweifelte Sehnsucht und das überwältigende Gefühl von Verlust.
Im nächsten Moment ist sie allein, im Inneren des Gehöfts. Eine steile Treppe, Dunkelheit, die sie umfängt. Der Geruch ranzigen Drecks. Eine fleckige Matratze. Schmuddelige Tapeten. Irgendwo ist das Opfer. Fleisch und Knochen. Haare. Vergänglich. Zu vergänglich. Dann keine Tür mehr, keine Treppe, kein Entkommen, nur noch ein Raum mit zu niedriger Decke. Wo sind ihre Kollegen? Ein Geräusch vor dem Haus. Galoppierende Hufe. Panik. Das Pferd lässt sie allein. Sie ist allein. Sie hat es nicht geschafft. Wo verdammt noch mal ist die Tür? »Warum bist du nicht gekommen?« Patricks Stimme. Warum kann sie nicht antworten? Warum wäscht diese Panik durch ihren Körper, in jede ihrer Poren? »Ich hab es einfach nicht geschafft.« Ein heiseres Flüstern. Ist das wirklich ihre Stimme? Ihre Lippen sind steif. Sie kann Patricks Antwort nicht hören, weiß nur, dass er da ist, irgendwo hier in diesem muffigen, dunkelbraunen Raum. Die Luft wird knapp und sie kauert auf dem Boden, wittert wie ein wildes Tier. »Patrick?«, flüstert sie. So viel Hoffnung in ihrer Stimme, so viel Sehnsucht. Sie muss Hilfe holen. Nach einer endlosen Zeit entdeckt sie ihr Handy. Es liegt auf einer Fensterbank, hinter der nicht mehr die Wiese mit den Heuballen ist, nicht mehr ihr Pferd. Sie rappelt sich auf und stolpert auf das Handy zu. Aber ihre Finger sind steif und nassgeschwitzt und gehorchen ihr nicht mehr. Katapultieren das Handy mitten in eine bodenlose Schwärze und sie weiß, dass sie verloren hat.
Auf dem Anrufbeantworter im Wohnzimmer tutet das Besetztzeichen. Offenbar hat der Anrufer aufgelegt, ohne eine Nachricht aufs Band zu sprechen. Judith Krieger liegt reglos und versucht, ihren Atem zu zähmen. Sie weiß nicht, was schlimmer ist, der Moment im Traum, wenn das Pferd mit ihr durchgeht, die nicht enden wollende Einsamkeit in dem dunkelbraunen Raum oder das Aufwachen. Sie versteht diesen Traum nicht, der sie seit Monaten wieder und wieder heimsucht. Versteht nicht die Sehnsucht und die Intensität. Versteht nicht, was das Pferd bedeuten soll. Von einer kurzen, unerfreulichen Phase in ihrer Pubertät abgesehen, ist sie nie geritten.
Sie braucht Kaffee und eine Zigarette. Musik gegen schwarze Gedanken an weiße Pferde und gegen die Stille in ihrer Wohnung, die Martin in der Nacht zurückgelassen hat. Sie setzt Espresso auf und geht zur Toilette. Aus dem Flur dringen die gedämpften Anfangsakkorde von Queens Spread your Wings. Sie findet ihr Handy in der Tasche ihres Ledermantels.
»Krieger.«
»Du bist da. Gut.« Axel Millstätt. Ihr Chef.
»Es ist Sonntagmorgen.«
»Du musst ins Präsidium kommen, sofort.«
Irgendjemand hat ihr neulich erzählt, die Abhängigkeit von Zigaretten sei ähnlich stark wie die von Heroin. Sie fischt ein Blättchen und einen Filter aus ihrem Tabakpäckchen.
»Im Bergischen Land haben sie eine Leiche gefunden. Ziemlich unappetitliche Geschichte. Identität nicht feststellbar. Wolfgang hat Angina. Die anderen sind mit dem Jennifer-Fall vollauf ausgelastet. Ich möchte, dass du ins Bergische fährst und dir das ansiehst.«
Sie zündet die fertig gedrehte Zigarette an und nimmt die gurgelnde Espressokanne vom Herd. »Heißt das, dass ich die Ermittlungen leiten soll?«
»So würde ich das nicht ausdrücken.«
Pause.
»Du weißt doch selbst, die letzte Zeit …«
Judith trinkt einen Schluck Espresso, verbrennt sich, kippt den Rest in ein Glas und schüttet kalte Milch dazu. Red nicht darüber.
»Ja, ich weiß.«
»Mein Gott, Judith, das geht nicht, beim besten Willen nicht. Wir wissen doch alle, was du durchgemacht hast. Ich will ganz ehrlich sein mit dir. Du warst eine exzellente Ermittlerin, du weißt, dass ich von Anfang an auf deiner Seite war. Aber dann passierte diese unselige Geschichte – nein, lass mich jetzt ausreden. Diese unselige Geschichte mit Patrick also, und verdammt, jeder hatte Verständnis, dass du Zeit brauchtest.«
Red nicht davon.
»Aber jetzt sind zwei Jahre vergangen und dir fehlt immer noch der nötige Biss. Diese Sache im Bergischen ist eine Chance für dich.«
Nikotin und Koffein pulsieren in ihrem Kopf. Eine heiße Welle. Judith inhaliert tief, ist sich nicht sicher, ob sie eine Chance haben möchte. Ob sie sich einer Chance gewachsen fühlt.
»Manni. Du und Manni, ihr werdet das Kind schon schaukeln. Ihr berichtet an mich.«
»Manni?«
»Manni.«
Sie hört auch das, was er nicht sagt, nicht sagen muss: Friss oder stirb, dies ist deine Chance. Deine letzte Chance. Sie kann ihm das nicht einmal verdenken.
»In einer halben Stunde in meinem Büro?«
Judith bläst Rauch Richtung Decke.
»Okay.«
Axel Millstätt hat Spanielaugen. Bitterschokoladenbraune Spanielaugen, die niemals zu zwinkern scheinen. Starren ihr Gegenüber einfach so lange an, bis es sich fühlt wie ein Schmetterling, auf den die Nadel eines Insektenforschers niedersaust. Früher hat Kriminalhauptkommissarin Judith Krieger den Ehrgeiz besessen, diesem Schokoladenblick etwas entgegenzusetzen. Wie Ikarus hat sie ihre Flügel gespreizt und versucht in die Sonne zu fliegen und Millstätt hat das durchaus zu würdigen gewusst. Jetzt senkt sie den Kopf, weiß nicht, wo sie hinsehen soll. Manni stürmt ins Büro, eifrig wie ein überdimensioniertes Füllen. Seine knochigen Beine stecken in modischen Cargo-Jeans, sein Blondhaar ist auf dem Kopf zu kleinen Stacheln hochgegelt. Erwartungsvoll rutscht er auf seinem Stuhl hin und her und zerbeißt Pfefferminzbonbons, während Millstätt die wenigen Fakten herunterbetet, die ihm bekannt sind. Judith kennt Manni nicht gut, sie mustert sein Profil verstohlen von der Seite. Wie konnte es so weit kommen, dass mir so ein grünes Kerlchen gleichberechtigt an die Seite gestellt wird, fragt sie sich. Manni ist erst seit einem Jahr im KK 11, arbeitet normalerweise in einem anderen Team als sie. Judith weiß, dass er die Wochenenden in Rheindorf verbringt, dem Kaff, in dem er aufgewachsen ist, in dem er eine unübersehbare Anzahl von Kumpels hat, was wiederum die Folge des vielschichtigen Vereinslebens ist, dem er sich mit Enthusiasmus hingibt. Schützenverein, Fußballverein, Junggesellenverein. Wenn er davon erzählt, bekommt er rote Backen. Vermutlich bringt er seiner Mutter auch noch seine Wäsche und lässt sich von ihr bekochen.
Sie ist froh, dass Manni sich dazu berufen fühlt, im Präsidium zunächst die Vermisstenmeldungen zu checken sowie Spurensicherung und Rechtsmedizin zu verständigen.
»Fahr ruhig schon vor«, sagt er zu Judith. Es klingt milde, als sei er ihr Vorgesetzter und sie eine Praktikantin, die man möglichst schnell loswerden will. Judith zwingt sich, ruhig zu bleiben. Die Aussicht, den Tatort als Erste und allein zu inspizieren, ist allzu reizvoll.
Wenig später lenkt sie einen nagelneuen Ford Focus auf die Autobahn. Das absolute Filetstück des Fuhrparks der Mordkommission, das sie allein deshalb erwischt hat, weil Sonntag ist. Der Styroporbecher Kaffee, der zwischen ihren Beinen klemmt, bessert ihre Laune noch mehr. Kurz vor Lindlar sieht sie neben der Autobahn die ersten Fachwerkhäuschen mit den für das Bergische Land typischen grünen Fensterläden. Aber es gibt keine Landidylle mehr, an den Ortsrändern wuchern die unvermeidlichen Tempel der Neuzeit: Gewerbehallen, Autohäuser und Einkaufszentren. Ein paar Kühe fressen unmittelbar neben der A4 ihr Gras, vermutlich sind sie im Laufe der Zeit taub geworden oder sediert von den Abgasen. Ein Silo und in weiße Folie verschweißte Heuballen erinnern Judith wieder an ihren Traum. Sie schaltet das Radio an. Bei Bielstein verlässt sie die Autobahn und fährt über zunehmend schlechter ausgebaute Landstraßen, bis sie nach vielen Kurven und sehr viel gelbem Wald das Dorf Unterbach erreicht. Von hier sollen es noch etwa drei Kilometer bis zum Fundort der Leiche sein. Sie findet den Schotterweg, der einen Kilometer hinter dem Dorf rechts abzweigt, und das Holzschild, das ein Kollege aus dem Bergischen beschrieben hat. »Sonnenhof« steht in verschnörkelter Schrift darauf. »ZUM ASCHRAM« hat jemand mit violetter Farbe auf den Baumstamm gesprüht, an dem das Schild befestigt ist.
Der Schotterweg führt in Serpentinen ins Tal, hohe Nadelbäume verschlucken das Licht. Judith wirft einen Blick auf das Display ihres Handys – kein Netz mehr. Das Tal erscheint unwirklich, als stamme es aus einem dieser Bauernhof-Sets für Kinder. Es gibt Schafkoppeln und Wiesen mit alten Obstbäumen, zwei zottelige Esel und einen Bach. Hof, Scheune und Nebengebäude stehen unorthodox durcheinander, als hätte der kindliche Bauherr diese letzten Bauklötzchen willkürlich in die Mitte der Wiese gestreut. Dies ist nicht die Landschaft aus ihrem Traum, kein weißes Pferd ist zu sehen und doch erscheint die Erinnerung daran auf einmal wie ein böses Omen. »Sonnenhof – Welcome«, das Schild ist an einen Pfosten neben einem matschigen Parkplatz genagelt. Ein Mann lehnt am Zaun und sieht ihr entgegen. Er trägt weiße Baumwollhosen und ein orangefarbenes T-Shirt, das überhaupt nicht zu seinem roten Pferdeschwanz passt. Seine nackten Füße stecken in Badelatschen aus Plastik. Judith lässt das Fenster herunter.
»Hallo, ich will zum Erlengrund. Irgendwo muss ein Weg dorthin abzweigen. Können Sie mir sagen, wo?«
Er lächelt, was sein Gesicht wie eine Kreuzung von Boris Becker und Kermit dem Frosch aussehen lässt.
»Presse?«
»Kennen Sie den Weg?«
»Klar.« Er beugt sich zu ihr herunter. »Aber da ist alles abgesperrt. Die Bullen werden dich nicht ranlassen – und wenn du sie noch so nett anlächelst.«
Sie sieht ihm direkt in die hellblauen Augen. Wartet. Er gibt nach.
»Den Weg entlang, über die Brücke und vor den Teichen rechts. Ist ziemlich matschig dort. Sag nachher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.«
»Danke. Wissen Sie, was passiert ist?«
Er mustert sie. »Jemand ist tot. Keiner vom Sonnenhof.«
»Sind Sie sicher?«
»Hier fehlt niemand.« Er sieht jetzt überhaupt nicht mehr freundlich aus. Verschränkt die blassen Arme vor der Brust und tritt einen Schritt zurück.
»Warum tragen Sie eigentlich keine Socken? Ihre Füße sind ja schon ganz blau.«
Zu ihrer Überraschung scheint ihn diese Frage zu amüsieren. Er zwinkert ihr zu.
»Ciao, Presselady. Komm mal auf eine Yogastunde vorbei, wenn du noch mehr Fragen hast.«
»Ciao, ciao.« Judith gibt Gas. Yoga. Vielleicht wird sie Kermit beim Wort nehmen. Sie ist ziemlich sicher, dass ihm das nicht gefallen würde.
Am Ende des Tals entdeckt sie den Holzsteg und lenkt den Ford im Schritttempo darüber. Unmittelbar dahinter liegen die Teiche, starr und glitzernd, wie aus flaschengrünem Glas. Rechts davon führt ein Weg in den Wald, der in der Tat äußerst matschig ist. Judith hält ihren Wagen exakt in der Spur, die andere Fahrzeuge vor ihr gegraben haben. Die Absperrung, die sie nach etwa fünf Minuten erreicht, besteht aus zwei jungen Beamten von der Schutzpolizei, die von einem Bein auf das andere treten und Judiths Dienstausweis sorgfältig kontrollieren. Der Erlengrund ist eine sumpfige Lichtung von etwa 100 Meter Durchmesser. Mehrere Polizeiautos und ein grün-weißer Bus stehen auf dem Waldweg am Rand. Judith parkt hinter einem Kombi und steigt aus.
Obwohl die Sonne direkt über der Lichtung steht, ist es kalt. Es riecht nach Pilzen und nach vermoderndem Laub. Aus den Polizeiautos dringt das gedämpfte Gezische und Gepiepse des Funkverkehrs. Ein grauhaariger Mann läuft auf sie zu.
»Hans Edling. Sind Sie vom KK 11?«
»KHK Judith Krieger, ja.«
Sie geben sich die Hand.
»Am besten schauen Sie erst mal selbst. Sieht ziemlich übel aus, der Knabe. Ich hab sofort bei euch in Köln angerufen.«
Er dreht sich abrupt um und springt über einen Graben auf die Lichtung.
»Sehen Sie den Hochsitz dort drüben? Da liegt er. Spaziergänger haben ihn gefunden. Die sitzen jetzt hier im Bus. Ein Kollege ist auf dem Hochsitz und passt auf. Soll ich mit rübergehen?«
»Danke, nicht nötig. Je weniger Spuren … «
»Ja.« Er springt zurück auf den Weg. »Wir sehen uns dann gleich.«
Erlengrund, überlegt Judith, während sie durch das nasse Gras läuft. Vermutlich gibt es hier Erlen, aber wie sehen die eigentlich aus? Das Gedicht vom Erlkönig fällt ihr ein, die Deutschlehrerin mit den nervösen Haselmausaugen, die hinter ihrer Schildpattbrille hin und her flitzten. Sie hatte eine wunderschöne Stimme, ganz weich und melodisch, aber in der neunten Klasse hat ihr niemand mehr zuhören wollen und Judith hat sich nicht getraut, sich der Meinung ihrer Klassenkameraden zu widersetzen. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, rezitiert Fräulein Meinert in Judiths Kopf. Verdammt, schon wieder reiten. Ein Kind hat Angst und stirbt, darum geht es in dem Gedicht. Der Erlkönig bringt den Tod. Erlkönig, Erlengrund. Jetzt reiß dich bloß zusammen, Judith.
Sie sieht sich mit neuer Aufmerksamkeit um. Fußspuren führen aus verschiedenen Richtungen zum Hochsitz, einen befestigten Weg über die Lichtung gibt es nicht. Sie werden klären müssen, von wem welche Spur stammt. Die Sonne steht hoch. Mit den bunten Herbstbäumen und den glitzernden Pfützen wäre die Lichtung ohne weiteres ein lohnendes Motiv für Landschaftsfotografen. Nichts deutet darauf hin, dass hier eine Gewalttat geschehen ist. Die Welt ist schön und die Menschen tun alles, um einander das Leben zur Hölle zu machen, denkt Judith. Der Hochsitz steht halb versteckt zwischen lichten Bäumen. Als sie ihn erreicht hat, klettert ein Polizist die Leiter herunter. Er hat einen Schal über Mund und Nase gebunden, den er mit einer schnellen Bewegung abstreift.
»Hallo, Kollegin, an den Geruch gewöhnt man sich nie.«
»Warum warten Sie nicht hier unten?«
Er deutet mit dem Daumen zu einem Baum, in dessen kahler Krone große schwarze Vögel sitzen.
»Geht leider nicht, wegen der Aasgeier.«
Er steckt sich eine Marlboro an und inhaliert gierig. Judith betrachtet den Hochsitz. Ihre Füße sind nass. Es riecht nach Tod. Das einzige Geräusch ist das heisere Geschrei der schwarzen Vögel. Sie zieht sich Latexhandschuhe und Schuhüberzieher an. Man stellt es sich jedes Mal schlimm vor, aber immer noch ist es doch anders, denkt sie, als sie oben angekommen ist. Dann zwingt sie sich, ganz genau hinzusehen.
***
Er findet sie in der Scheune, wo sie das Futter für die Jungtiere mischt. Er nimmt sie in die Arme und hebt sie auf das Regal, in dem die Utensilien für die Schur liegen. Wie weich sie ist, wie fest ihr Körper sich trotzdem anfühlt. Warm und lebendig. Sie schlingt die Arme um ihn, dann die Beine. Ihre Körper wiegen sich sanft, atmen im Gleichtakt. Wie gut sie riecht. Ein bisschen nach Sandelholz, ein bisschen nach Patchouli, ein winziges bisschen nach Schweiß. Er zieht sie noch dichter an sich und schiebt seine Hand unter ihre Fleecejacke. Sie hat Muskeln bekommen, seit sie auf dem Sonnenhof lebt. Sanfte Wölbungen links und rechts des Rückgrats, dieser Lebenssäule, die so viel trägt und so zerbrechlich ist. Parawati, denkt er. Göttliche Gefährtin. Sie jetzt und hier nehmen, sich in ihr vergraben, wieder, schon wieder, immer und immer wieder.
»Warte hier, warte einen Moment.« Er küsst ihren Hals, löst sich von ihr und geht zur Tür. Er späht hinaus, sieht niemanden und schiebt den Riegel vor. Nimmt eine Sperrholzplatte und stellt sie in das Fenster über dem Regal. Sie passt in die Öffnung, als wäre sie eigens dafür gemacht. Der Geruch nach Heu, das Dämmerlicht und das Wissen, was sie gleich tun werden, erregen ihn noch mehr. Im Vorraum des Stalls gibt es ein Elektroöfchen. Er klemmt es unter den Arm, reißt eine Decke aus dem Schrank und geht zurück zu dem Regal, auf dem seine Göttin sitzt und ihn beobachtet.
»Ich will dich.« Jeder seiner Schritte ist jetzt ein Schleichen, ein Lauern, das die Spannung ins beinahe Unerträgliche steigert.
»Du meinst hier, jetzt gleich? Aber …«
»Psst. Nicht sprechen.« Er stellt das Heizöfchen auf den Boden, findet eine Steckdose, schaltet es an. »Zieh dich aus.«
»Du meinst …?«
Er nickt. Geht zu ihr und schiebt seine Hände wieder unter ihr Fleece. Findet ihre Brüste. Sieht, wie die Angst, entdeckt zu werden, und die Lust in ihrem Gesicht miteinander kämpfen, bis das Verbotene ein Reiz wird, dem sie nicht widerstehen kann.
»Du bist unmöglich!« Es klingt überhaupt nicht wie eine Rüge. Mit einer entschlossenen Bewegung zieht sie Fleece und T-Shirt über den Kopf und wirft sie auf den Boden.
Beeil dich, will er drängen, aber jetzt ist es an ihr, das Tempo zu bestimmen. Sie genießt seine Ungeduld, springt auf den Boden, dreht ein paar spielerische Pirouetten. Immer noch ist er erstaunt, dass sie, die sonst so spröde und unnahbar ist, so vollkommen ohne Scham und Verklemmtheit Liebe machen kann. Weil es so sein muss, weil sie die Richtige ist. Er zerrt sich die Kleider vom Leib, lässt sie dabei nicht aus den Augen. Sie lacht, als sie seine Erektion sieht. Kein böses Lachen, sondern ein fröhliches.
»Zieh dich aus«, wiederholt er.
Unendlich langsam zieht sie den Reißverschluss ihrer Cordjeans herunter, unendlich langsam streift sie die Hose von den Hüften, den Slip. Er breitet die Decke über die staubige Holzoberfläche des Regals, sie dreht noch eine Pirouette und lacht ihn an. Aber jetzt hält er das Warten nicht mehr aus, er geht mit drei schnellen Schritten zu ihr, packt sie, hält sie fest, hebt sie auf die Decke.
»Leg dich hin.« Er ist ihr so dankbar, dass sie sofort aufhört, mit ihm zu spielen, dass sie sein Verlangen begreift oder zumindest geschehen lässt. Dass sie seinem heiseren Flüstern gehorcht, sich hinlegt, stillhält, sich bewegt, so, wie er es will. Dass sie all das, was er mit ihr tut, genießt und ihm das zeigt.
Als sie fertig sind, setzt er sich neben sie und hält sie im Arm. Sie teilen sich eine Zigarette. Dann noch eine. Auch das ist längst eine Gewohnheit geworden, eine Sucht, ebenso verboten wie ihre Liebe.
»Wir müssen uns anziehen.« Ihre Finger kraulen seinen Nacken, seinen Hals, seine Brust. »Wir haben sowieso Glück, dass niemand gekommen ist.«
»Am liebsten würde ich gleich nochmal.«
»Jetzt ist erst mal Schluss, ich muss mich um die Schafe kümmern.« Sie setzt sich auf und sieht ihm gerade in die Augen. Zieht die Augenbrauen hoch und kneift die Lippen zusammen wie eine mieslaunige Gouvernante.
»Ts, ts, ts. Sie kennen überhaupt keine Scham, mein Herr. Man muss seine Begierde beherrschen lernen!«
Sie springt auf den Boden und angelt nach ihrer Unterhose. So unverschämt jung und unverschämt sexy. Die Begierde beherrschen lernen, denkt er. Du hast ja überhaupt keine Ahnung, wie schwer das ist.
***
Der Leichnam hat leere Augenhöhlen und keine Lippen. Keine Nase. Sein ganzes Gesicht ist nur eine rohe, verdorbene Fleischmasse. Rund um die Augenhöhlen schimmern die Schädelknochen. Die Brust ist Blut. Aus der Bauchhöhle quellen bräunliche Gedärme, es sieht so aus, als wären sie Stück für Stück aus dem Unterleib gezerrt worden. Blonde Haare. Der Tote lehnt in der Ecke auf der hölzernen Sitzbank, einen Ellbogen beinahe lässig in die Schießscharte geklemmt, die andere Hand locker neben sich auf der Bank, die Beine weit ausgestreckt. Die Todesursache ist nicht zu erkennen. Kopf und Rumpf sind mit Wunden übersät. Aasgeier, hat der Polizist gesagt. Judith hat noch nie darüber nachgedacht, was Krähen fressen und dass das Sprichwort von den Krähen, die einander nicht die Augen aushacken, einen sehr realen Ursprung haben könnte. Sie schätzt die Körpergröße des Toten auf über 1,80 Meter. Sie geht in die Hocke und schiebt die Gedärme ein Stück aus der Lendengegend. Eindeutig ein Mann. Er muss mindestens seit einer Woche tot sein, wahrscheinlich länger.
Hat die Leiche eigentlich keine Kleider? Sie bückt sich noch tiefer und späht unter die Sitzbank. Dunkelverkrustete Flecken, etwa unter dem Körper des Toten. Ein paar ins Holz gedrückte Zigarettenkippen. Selbstgedrehte Zigaretten, sehr dünn, ohne Filter. Ganz hinten in einer Ritze liegt noch etwas. Ein Stück durchsichtiges Hartplastik. Sie pult es heraus, hält es ans Licht. Ein Splitter, etwa drei Zentimeter lang mit geriffelter Kante, vielleicht ein Stück Griffmulde von einer Kassette oder CD-Hülle.
»Frau Krieger, Ihr Chef aus Köln will Sie sprechen.« Hans Edlings Stimme schallt über die Lichtung.
»Ich rufe ihn gleich an!« Alles, was sie braucht, ist ein Moment der Ruhe. Zeit, ein Gefühl für diesen Ort zu bekommen, ein Gefühl, das sie später leiten wird, so war es jedenfalls früher immer. Es ist kalt. Sie schiebt die Hände in die Taschen ihres Ledermantels. Gleich wird Manni ankommen, die Spurensicherer und dann ist es zu spät für ungestörte Beobachtungen. Komm schon, Judith, beeil dich. Ihre Blicke fliegen.
Der Tote hat keine Kleidung, keine Schuhe, keine Papiere, keine Waffe. Das Dach des Hochsitzes hat ein großes Loch. Judith stellt sich auf die Zehenspitzen und lässt die Finger über die Kante der Öffnung gleiten. Vermutlich sind einmal Balken draufgenagelt gewesen, oder Teerpappe. Wo sind diese Balken jetzt? Sie schaut nach unten, sieht aber nur Gebüsch und den Polizeibeamten, der sich gerade eine weitere Zigarette anzündet. Eine Fernsehreportage fällt ihr ein, die sie vor einigen Wochen nachts gesehen hat, als sie mal wieder nicht schlafen konnte. Das Volk, um das es ging, bettet seine Toten auf Tragegestellen in Bäumen zur letzten Ruhe, bietet sie ungeschützt dem Licht und den Vögeln dar. Es hat etwas mit Ehrerbietung und den Wünschen der Götter zu tun, aber Judith hat nicht bis zum Ende zugeschaut, sondern weitergezappt. Überall klebt getrocknetes Blut in grotesken Spritzmustern. »L & A« hat jemand mit schwarzem Filzstift in ein großes Herz an die Rückwand des Hochsitzes geschrieben. Auch eine Sarah und ein Mick haben sich in einem Herz verewigt, allerdings ist dieses mit einem Messer ins Holz geritzt. »Tom, du geile Sau«, steht daneben und etwas weiter links »Meli was here«. Diverse Initialen und Daten – aller Wahrscheinlichkeit nach ohne Zusammenhang mit dem Mord. Sitzen Liebende aus der Umgebung in diesem Hochsitz, schmiegen sich aneinander auf der Holzbank, unsichtbar für die Welt zu ihren Füßen, den Blick durch die Schießscharten in die Baumkronen gerichtet? Vorsichtig bückt Judith sich so weit hinunter, dass ihr Kopf auf der Höhe des Toten ist. Was war das Letzte, was er gesehen hat? War es Tag oder Nacht, als er starb? Sie ist plötzlich sicher, dass es Nacht war, dass er allein war mit seinem Mörder. Kein Wanderer weit und breit, der ihn hätte retten können. Nur Wald, stoischer, stummer Wald und Dunkelheit. Judith steht ganz still. Wenn sie die Augen schließt, glaubt sie die Angst des Toten noch zu fühlen, ein rasendes, irrlichterndes Aufbegehren.
Sie klettert die Leiter hinunter. Dreht sich eine Zigarette. Der Polizist lässt ein silbernes Benzinfeuerzug aufschnappen und gibt ihr Feuer.
»Das mit dem Anrufen kannst du vergessen.«
»Wie bitte?«
»Vergiss es einfach, Empfang gibt’s hier nur auf dem Hochsitz. Wenn du Glück hast.«
Judith fischt ihr Handy aus der Manteltasche und betrachtet das Display. »Netzsuche.« Er hat Recht.
»Ich werd dann mal wieder.« Er tritt seine Zigarette aus und schiebt die Kippe in die Zellophanhülle seiner Marlboro-Packung.
»Scheißjob. Ich hoffe, die Kollegen aus Köln beeilen sich.«
Er nickt ihr zu, zieht sich den Schal wieder vors Gesicht.
Judith stapft zurück über die Wiese. Ihr rechter Fuß sinkt in eine Pfütze, kaltes Wasser kriecht ihr den Stiefelschaft hoch. Dann ist auf einmal das Gefühl aus dem Traum wieder da. Die Unwirklichkeit. Die Sehnsucht, die sich nie erfüllen wird. Bedrohung in Zeitlupe. Als liefe sie für immer durch flüssiges Glas. Sie rammt die Fäuste in die Manteltaschen und beschleunigt ihre Schritte. Wenn sie Glück hat, kann ihr irgendein Kollege Gummistiefel leihen.
***
Die Luft in dem Polizeibus ist unerträglich stickig. Diana Westermann sitzt am Fenster, eingeklemmt zwischen der rosigen Frau mit dem leeren Pilzkörbchen und einem Klapptisch, der mit schauderhaftem Teakholz-Imitat aus PVC beklebt ist. Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Sie kann die Beine nicht richtig ausstrecken. Sie friert immer noch, obwohl die Heizung weit aufgedreht ist, kein Wunder, ihre Hosen und Schuhe sind klatschnass. Sie schiebt die Hände unter die Wolldecke, die ihr ein Polizist gegeben hat. Sie will heim, weg von hier. Es riecht nach Schweiß, Kaffee und Salamibroten, lauter Gerüche, die sie nicht mag. Immerhin besser als dieser süßliche Gestank. Sie schluckt. Sie will sich nicht daran erinnern.
»Sie haben einen Schock, Sie müssen etwas essen und trinken.« Der Mann in der Kniebundhose, der sie auf der Lichtung gefunden und sich inzwischen als Egbert Wiehl vorgestellt hat, verhält sich wie ihr Adjutant. Warum musste er sie auch auf der Lichtung überraschen? Was hatte er dort zu suchen, frühmorgens, in ihrem Revier? Ohne ihn säße ich jetzt nicht hier, denkt Diana. Ich hätte mich gefangen, aufgerappelt, ich hätte einfach weiterlaufen können. Der Adjutant tupft sich die Stirn mit einem hellblauen Stofftaschentuch ab, lässt zwei Stück Würfelzucker in einen dampfenden Becher fallen und schiebt ihn zu Diana hinüber.
»Nehmen Sie ein Brot«, echot seine Frau zum wiederholten Mal. »Oder wenigstens ein Stück Schokolade.«
Nur damit sie endlich Ruhe geben, nimmt sie den Becher und trinkt. Der Kaffee schmeckt karamellig süß, aber sie kann fühlen, dass ihr Zittern nachlässt. Sie trinkt in durstigen Schlucken, das Ehepaar lächelt sich an. Sollen sie doch. Auf einmal hat sie sogar Hunger. Sie isst ein Salamibrot und trinkt noch einen Becher Kaffee.
»Danke. Ich wusste gar nicht, wie hungrig ich bin.«
Der Mann will den Becher nochmals füllen, aber sie schiebt ihn energisch von sich weg.
»Zwei Becher sind wirklich genug. Ich trinke sonst nie Kaffee.«
Sie sitzen wieder stumm und lenken die Blicke aneinander vorbei. Wie in einem Aufzug, denkt Diana. Man guckt sich nicht in die Augen, nie. Vor dem Fenster des Kleinbusses wuchern Weißdornsträucher und Schlehen, die Lichtung ist nicht zu sehen.
»Das schöne Wetter.« Die Stimme der Frau klingt nörgelig.
Ich will hier weg, denkt Diana Westermann. Es war ein guter Morgen, bis ich mich entschieden habe, zum Erlengrund zu joggen. Die Wildgänse sind geflogen. Der Wald war so still. Ich hätte nicht auf den Hochsitz steigen sollen. Nicht wieder, nicht heute. Ich hätte einfach weiterjoggen sollen. Warum mussten mich diese Pilzsammler finden?
»Das schöne Wetter.« Dies ist offenbar ein uraltes Klageritual, das keiner Verben und keiner näheren Erklärung bedarf.
Die Frau nervt. Die ganze Situation ist durch und durch unerfreulich und da tut es überhaupt nichts zur Sache, dass das Wetter wirklich schön ist. Herbst eben. Ein Bilderbuchtag. Das Laub so bunt, dass man ganz vergessen kann, dass dies ein millionenfaches Sterben ist, ausgelöst durch den temperaturbedingten Mangel an Chlorophyll. Der Himmel so durchsichtig, dass er etwas zu versprechen scheint. Natürlich weiß man es besser, aber man kann sich doch nicht entziehen. Läuft über die Wiesen, läuft durch die rotgelbe Farbenpracht, starrt in das hohe Blau und erwischt sich unwillkürlich dabei, dass man singen will. Und vielleicht ist das ja der eigentliche Grund, dass ich nach Deutschland zurückgekommen bin, überlegt Diana. Dass ich endlich wieder einen Herbst erleben wollte. Jahreszeiten. Und jetzt sitze ich hier auch in der Scheiße und muss einen Weg finden, wie ich wieder rauskomme.
Die Minuten schleppen sich dahin, quälend langsam. Die Luft wird immer stickiger. Es ist nicht fair, denkt Diana. Die Leute haben keinen Respekt vor dem Wald. Sie schmeißen ihren Müll ins Unterholz. Sie trampeln alles nieder. Sie schlagen sich ins Gestrüpp, wenn sie lebensmüde sind, weil sie glauben, dass es im Wald einsam ist. Sie hängen sich auf, erschießen sich oder fressen ihre Tabletten und kümmern sich einen Dreck darum, dass es Förster gibt, Jäger, Spaziergänger, die sie früher oder später finden müssen. Theoretisch wusste ich das immer. Die Toten im Wald sind gewissermaßen ein Berufsrisiko für mich. Aber ich habe das nicht ernst genommen, bis vor kurzem habe ich das einfach nicht ernst genommen. Ihr Herz rast und sie beginnt zu schwitzen. Ihre Zunge klebt am Gaumen wie Sandpapier. Das Koffein, denkt sie. Ich vertrage es nicht. Ich hätte den Kaffee nicht trinken sollen. Sie räuspert sich.
»Entschuldigen Sie, haben Sie zufällig noch etwas anderes zu trinken als Kaffee?« Ihre Stimme klingt heiser.
Der Adjutant fördert eine Büchse Mineralwasser aus seinem Rucksack hervor, die er zu Diana herüberschiebt.
»Danke.« Sie öffnet die Dose. Wasser schießt zischend aus der Öffnung. Achtlos wischt sie es mit dem Ärmel von der Tischplatte und trinkt, bis die Büchse leer ist. Es tut gut, aber ihre Gedanken jagen immer noch im Kreis. Ich will einfach meine Ruhe. Ich hätte nicht auf diesen Hochsitz klettern sollen. Scheiße, jetzt ist auch noch mein Ärmel nass. Ich will heim.
»Die Leiche hatte genau so blonde Haare wie Sie.« Die Stimme des Mannes klingt überrascht, als wäre ihm dies eben erst aufgefallen.
Halt den Mund, das geht dich überhaupt nichts an, will sie sagen, beherrscht sich aber.
»Viele Leute haben blonde Haare.«
Der Adjutant scheint nicht wirklich überzeugt zu sein, sagt aber nichts mehr. Seine Frau seufzt. Wieder schleicht die Zeit dahin wie eine Schnecke. Wie lange will die Polizei sie noch in diesem stickigen Bus warten lassen?
Das Ehepaar beginnt jetzt ebenfalls zu picknicken. Der Mann zieht sein Fahrtenmesser aus dem Gürtel und zerteilt seine Brote in kleine Häppchen, die er auf der Messerspitze in den Mund balanciert. Die Frau schmatzt leise. Ich will hier raus, denkt Diana. Ich sollte längst Ronja abgeholt haben. Ich will …
Eine Frau öffnet die Schiebetür des VW-Busses. Sie trägt einen schwarzen Ledermantel, der augenscheinlich nicht sehr neu ist, und verwaschene Jeans. Ihr Gesicht ist fleckig, über und über mit riesigen Sommersprossen übersät. Ihr Haar ist schulterlang und struppig, ein undefinierbares Hellbraun.
»Sie haben den Toten gefunden?« Sie sieht Diana auf eine Art an, die verrät, dass sie die Antwort schon kennt. Ihre Augen sind grau mit einem merkwürdig türkisfarbenen Rand um die Iris.
Diana nickt.
»Krieger, Kripo Köln.« Die Gefleckte lächelt ein Lächeln, das ihre seltsamen Augen nicht erreicht. »Ich weiß, es ist unangenehm, dass Sie warten mussten. Leider lässt sich das nicht vermeiden.« Sie hustet. »Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten. Einzeln.« Sie zieht die Schiebetür ganz auf. »Ich schlage vor, wir beginnen mit Ihnen.« Sie wendet sich an das Ehepaar. »Wenn Sie bei meinem Kollegen warten würden?«
Ein uniformierter Polizist führt die beiden weg. Die Gefleckte klettert in den Bus und setzt sich Diana gegenüber. Der grauhaarige Beamte, der sich vorhin als Edling vorgestellt hat, schiebt sich neben Diana auf die Sitzbank.
»Sie heißen Diana Westermann? Wohnhaft im alten Forsthaus in Unterbach?«
»Warum wohnen Sie in dem Forsthaus?« Edling beäugt Diana misstrauisch. »Vermietet der alte Hesse jetzt Zimmer?«
»Ich wohne dort, weil ich das Revier leite. Alfred Hesse ist seit Februar pensioniert.«
»Sie sind Försterin?« Die sommersprossige Kommissarin hat den Wortwechsel mit schnellen Blicken beobachtet. Nun scheint sie entschlossen zu sein, das Gespräch wieder an sich zu reißen. »Dann kennen Sie das Gelände hier sicher gut?«
»Mein Revier ist über 1500 Hektar groß. Ich arbeite hier erst ein halbes Jahr.«
»Heißt das ja oder nein?«
»Das Schnellbachtal kenne ich einigermaßen.«
»Gut.« Ein sparsames Lächeln.
»Da ist der alte Hesse also auch pensioniert.« Der Grauhaarige ist offenbar nicht so schnell bereit, das Thema zu wechseln. Die Kommissarin hüstelt und zieht die Kappe von einem teuer wirkenden, dunkelblau marmorierten Füllfederhalter.
»Ich denke, es ist am besten, wenn Sie der Reihe nach erzählen, was heute morgen passiert ist. Lassen Sie sich Zeit. Jedes Detail kann für uns hilfreich sein.«
»Ich war joggen.«
»Wann genau sind Sie losgelaufen?«
»8.30 Uhr, ich war spät dran.« Das klingt beinahe entschuldigend. »Normalerweise laufe ich früher, aber gestern Abend war ich in Köln auf einer Party. Ich war spät dran und Ronja war nicht da, da habe ich verschlafen.«
»Ronja?«
»Mein Hund. Sie ist noch jung. Ich lasse sie im Sonnenhof, wenn ich in die Stadt muss.«
»Okay, Sie sind also um halb neun losgelaufen.«
»Ich hab mich für den Weg durchs Tal entschieden, weil ich Ronja unterwegs abholen wollte. Ich laufe die Strecke öfter, also hab ich nicht besonders auf den Weg geachtet.« Diana denkt an die Wildgänse und wie ihre Rufe geklungen haben, an den transparenten Himmel. Das wird die Polizei wohl kaum interessieren. »Am Erlengrund hab ich dann die Krähen gesehen.«
Sie beginnt wieder zu frieren.
»Was genau haben Sie dann gemacht?« Die Kommissarin lässt Diana nicht aus den Augen.
»Ich hab nicht wirklich nachgedacht. Bin einfach losgelaufen, um nach dem Rechten zu sehen. Es ist schließlich mein Hochsitz.«
Es ist ein Fehler, dass sie das gesagt hat, merkt sie sofort. »Ich meine, er ist eine forstliche Einrichtung und ich benutze ihn oft.«
Der Blick der Kommissarin fliegt für einen kurzen Moment zu ihrem Kollegen.
»Sie jagen also?«, fragt der, als hätte er ein Stichwort bekommen. Es klingt, als würde er fragen: ›Sie morden also öfter‹?.
»Es gehört zu meinem Job, mein Revier zu bejagen.« Diana verschränkt die Arme vor der Brust. »Das ist doch kein Verbrechen, oder?«
»Nun regen Sie sich nicht gleich so auf, mein Kollege hat Ihnen doch nur eine Frage gestellt.«
Vorhin haben dir die Fragen deines Kollegen doch selbst nicht gefallen, denkt Diana. Sie setzt sich ein wenig aufrechter hin.
»Ich will endlich heim.«
»Das kann ich verstehen. Aber leider sind die Umstände so, dass Sie zuerst unsere Fragen beantworten müssen. Und je eher Sie das tun, desto eher können Sie gehen.«
»Ich bin also zu dem Hochsitz rübergelaufen. Ich hab gar nicht nachgedacht, bin einfach hingelaufen, die Leiter hoch, und dann lag er da. Es war auf einmal wie ein Horrorfilm. Ich hab immer noch nicht nachgedacht. Bin einfach wieder runter und weggerannt, und dann ist mir schlecht geworden und ich hab mich übergeben. Das Nächste, was ich mitbekommen habe, war, dass dieser Mann, dieser Herr Wiehl, vor mir stand und auf mich einredete.«
Draußen erklingt Motorengeräusch, eine Autotür wird zugeschlagen. Ein Hund kläfft.
»Einen Moment bitte.« Die Kommissarin schiebt die Kappe auf ihren Füller, steckt ihn in die Manteltasche und springt aus dem Kleinbus. Diana versucht unauffällig zu entziffern, was sie bislang notiert hat, gibt aber schnell wieder auf. Die Schrift ist eckig und krakelig, absolut unleserlich. Der Polizeibeamte macht Habichtaugen.
»Warum lassen Sie Ihren Hund im Sonnenhof?«
»Ich kenne den Schreiner, ich liefere ihm manchmal ein paar Stämme Buchenholz. Laura, ein junges Mädchen, das ihm in der Werkstatt hilft, passt gern auf Ronja auf.«
»Holz, mhm, mhm.«
Aus dem Mund des grauhaarigen Beamten klingt das wie etwas Obszönes. Diana Westermann verschränkt die Arme vor der Brust und starrt konzentriert auf das Teakholz-Imitat.
***
Hinter dem Polizeibus stehen Manni und die beiden Ks von der Spurensicherung. Sie treten von einem Fuß auf den anderen und sehen unternehmungslustig aus, wie Grundschüler vor einer Klassenfahrt. Manni wirkt mehr denn je wie ein Riesenfohlen. Judith kommt sich auf einmal uralt und ausgelaugt vor. Karin und Klaus, die beiden Ks, sind auch noch ziemlich jung, harmonieren aber so perfekt wie eine alte Streifenwagen-Besatzung, die jahrzehntelang Dienstwagen und Stadtteil geteilt hat, ohne das je in Frage zu stellen. Es gibt nur noch wenige solcher Teams, denn eine sich täglich wiederholende Tätigkeit passt nicht in eine Gesellschaft, die ständig den Kick sucht und darüber völlig verlernt hat, sich mit etwas zu bescheiden. Außerdem werden die Arbeitsbedingungen für Polizisten durch den ewigen Sparkurs nicht gerade besser. Einige Kollegen geben auf, weil sie die Überstunden satt haben. Andere wollen sich nicht länger von all denen anpöbeln lassen, für die keine Regeln gelten, weil sie nichts mehr zu verlieren haben. Erst letzte Woche hat wieder eine Kollegin von der Streife gekündigt, eine nette Rothaarige, die Judith für ziemlich fähig gehalten hat. Es ändert sich ja doch nichts, hat sie Judith im Fahrstuhl zugeflüstert und ist mit festen Schritten und einem Lächeln auf den Lippen in ein neues Leben geeilt. Judith hat sich dabei ertappt, dass sie sie beneidete.
»Also, wo ist der Kandidat, der uns den Sonntag gestaltet?« Karin pult eine Packung Juicy-Fruit-Kaugummis aus der Jackentasche und bietet sie an. Judith schüttelt den Kopf und dreht sich eine Zigarette, Manni schiebt sich eines seiner unvermeidlichen Pfefferminzbonbons zwischen die Zähne, die beiden Ks beginnen rhythmisch zu kauen. Beide haben einen blassen Teint, den die kalte Luft rosig färbt.
»Ich bring euch hin.«
Kurze Zeit später ist auch der Rechtsmediziner da. Karl-Heinz Müller, ein brathähnchenbrauner Mitvierziger mit Dreitagebart, der eine Wolke herben Aftershaves hinter sich herzieht, als er behände die Leiter zum Hochsitz erklimmt.
»Ihr wartet hier unten.« Müller liebt komplizierte Fälle und verfügt über ein äußerst stabiles Selbstbewusstsein. Er pfeift einen Boney-M-Schlager, während er den Leichnam in Augenschein nimmt.
»Wie lange ist er schon tot?«, ruft Judith nach einer Weile.
»Ihr ändert euch nie, oder?« Müllers Gesicht taucht einen Moment über der Leiter auf.
»Ungefähr zumindest?«
»Vorgestern hab ich mir noch am Nassau Beach frische Kokosnüsse aufschlagen lassen und wahrhaftig ganz und gar vergessen, wie lästig ihr sein könnt.«
Müller nimmt seine musikalische Darbietung wieder auf. Daddy Cool. Judith denkt an die Försterin im Bus. Etwas stimmt nicht mit ihr. Sie würde gern über dieses Gefühl sprechen, weiß aber nicht, wie sie mit Manni reden soll. Bei Patrick hätte sie es gewusst. Stumm stehen sie nebeneinander im nassen Gras an der Stelle, die Karin und Klaus ihnen zugewiesen haben. Ich bringe es einfach nicht mehr, denkt Judith. Der Tag ist noch nicht einmal halb vorbei und schon habe ich das Gefühl, dass mir die Ermittlungen entgleiten. Eine Chance, hat Millstätt gesagt. Aber ich tauge nicht zu einer Chance. Ich habe keine Chance verdient.
Sie sieht sich um. Von irgendwoher müssen Täter und Opfer gekommen sein. Wenn sie es nicht mit einem Selbstmörder zu tun haben. Aber auch der wird nicht splitterfasernackt durch den Wald gerannt sein. Irgendwo muss er eine Spur hinterlassen haben. Kleider. Eine Waffe. Ein Fahrzeug. Und wo, verdammt nochmal, sind die Bretter aus dem Dach des Hochsitzes?
»Kommt mal hoch, ihr zwei.« Müller winkt.
Es ist zu eng für drei Personen auf dem Hochsitz, Manni bleibt auf der Leiter, Judith presst sich an die Wand. Der Gestank des Todes senkt sich über sie wie eine Glocke. Ungerührt beugt Karl-Heinz Müller sich dicht über die zerstörten Überreste des Gesichts des Toten und drückt mit dem Ende einer Plastikpinzette vorsichtig in die rechte Augenhöhle. Etwas ist dort, ein Metallkügelchen. Müller richtet sich auf und deutet mit der Pinzette auf die Rückwand des Hochsitzes, wo mehrere dunkle Löcher erkennbar sind.
»Schrot!« Judith spricht lauter, als es nötig ist.
»Schrot.«
»Also ist die Tatwaffe ein Jagdgewehr.«
»Eine Flinte. Wenn der Schrot die Todesursache ist, ja.«
»Du meinst, jemand kann mit einer Ladung Schrotkugeln im Kopf auf einen Hochsitz klettern?«
»Das nicht, aber er könnte ja schon tot gewesen sein, als auf ihn geschossen wurde. Oder hier hochgetragen worden sein. Obwohl er ein ziemlich stattlicher Bursche ist.«
Müller beugt sich über die zerfressene Brust des Toten und macht sich auch dort mit der Pinzette zu schaffen. Nach kurzer Zeit sichert er ein weiteres Metallkügelchen.
»Da hat jemand nicht nur einmal abgedrückt.«
Hass, denkt Judith. Eifersucht. Leidenschaft. Wut. Die ganze unerfreuliche Palette. Aber wo sind die Kleider des Toten? Und wer hat das Loch ins Hochsitzdach gesägt? Das war keine Tat im Affekt. Jedenfalls war der Täter kaltblütig genug, dafür zu sorgen, dass wir sein Opfer nicht so leicht identifizieren können.
»Schrot«, sagt Manni. »Wer außer Jägern schießt mit Schrot?«
Müller hebt die kompakten Schultern und dreht die blutigen Handflächen zum Himmel.
»Braucht ihr noch lange?« Klaus’ Stimme. Die beiden Ks haben ihre Gerätschaften aufgebaut und wollen anfangen.
»Wie lange ist er schon tot?«, fragt Judith.
Müller legt den Kopf schief.
»Etwa zehn Tage – aber nagel mich bloß nicht fest darauf. Diese Krähen haben ein verdammtes Chaos angerichtet.«
»Es besteht wohl keine Chance, dass man rekonstruieren kann, wie er mal aussah?«
»Vergiss es. Wir sind hier nicht in Amerika.« Müller kramt in seinem Instrumentenkoffer und beginnt wieder zu pfeifen. Yesterday von den Beatles.
***
Juliane Wengert stellt ihren Koffer in die Diele und einen Moment lang wird ihr schwindelig. Die Tür zum Wohnzimmer steht offen. Die Luft, die ihr von dort entgegenschlägt, ist kalt und abgestanden. Unbewohnt, denkt sie und wundert sich, dass sie das wirklich und wahrhaftig riechen kann. Mein Haus ist unbewohnt. Sie ist eine Woche auf einem Kongress in Rom gewesen und hat sich ausschließlich aufs Dolmetschen konzentriert. Jetzt braucht sie dringend ein Schaumbad, ein leichtes warmes Essen, eine Flasche Wein. Vielleicht ein Klavierkonzert von Mozart und ein Feuer im Kamin. Jemanden, der ihre schmerzenden Schultern massiert. Sie fühlt sich leergeredet und zugleich bis an die Grenze des Erträglichen mit Worten und Stimmen angefüllt, die nicht ihre eigenen sind, wie immer nach mehrtägigen Kongressen.
Erst während des Rückflugs hat sie sich gestattet, wieder an Andreas zu denken. Sie behält den Kaschmirmantel an und tritt ins Wohnzimmer. Alles ist so, wie sie es verlassen hat, nur die Lilien in der hohen Vase vor dem Kamin haben ihre Blüten fallen lassen. Weiße Lilien, ihre Lieblingsblumen. Besiegt vom Zahn der Zeit. Sie trägt die Vase in die Küche und schüttet das faulige Wasser in den Abfluss, geht zurück ins Wohnzimmer und dreht die Heizung auf. Sie fegt die Blütenblätter vom Couchtisch in ihre Hand, sie sind transparent wie Seidenpapier. Etwas reißt in ihr, etwas, dem sie nicht nachgeben will, dem sie schon lange nicht nachgeben will, weil es nicht ins Leben der glücklich verheirateten Top-Dolmetscherin Juliane Wengert passt. Sie strafft den Rücken. Dieses Etwas will sie aufs Sofa ziehen und dazu bringen, dass sie weint und schreit und mit den Fäusten auf die Polster trommelt, aber sie wird sich nicht unterkriegen lassen, sie ist stärker als Es.
Das Obergeschoss ist kalt und leer. Im Badezimmerspiegel entdeckt sie eine neue Falte zwischen ihren Augenbrauen. Erst jetzt bemerkt sie, dass sie die Lilienblätter immer noch in der Hand hält. Sie öffnet den Toilettendeckel und lässt sie ins Becken rieseln. Die feinen Risse und Adern erinnern sie an welkende Frauenhaut. Wo ist ihr Leben geblieben? Was hat sie eigentlich erreicht? Bis vor Kurzem hat sie geglaubt, dass sie immer noch jung ist und deshalb die Macht hat, jederzeit zu wählen. Für wen sie dolmetscht, in welchem Restaurant sie essen will, welchen Mann sie nimmt, ja sogar ob sie ein Kind bekommt. Lange ist es immer nur aufwärts gegangen in ihrem Leben. Geld war in ihrer Familie immer reichlich vorhanden, sie konnte sich während ihres Studiums ausgedehnte Aufenthalte in Italien und Frankreich leisten und hat sich aufgrund dessen nach dem Diplom als Dolmetscherin schnell einen guten Ruf erarbeitet. Mit 31 hat sie die Jugendstilvilla ihrer Großmutter geerbt, ihre Burg, ihre sichere Basis, von der aus sie operieren kann. Und jetzt ist ihre Basis kalt und leer.
Juliane Wengert setzt sich auf den Rand ihrer Badewanne. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie weiß nicht, wie sie die Kraft aufbringen soll, ihren Mantel auszuziehen, den Koffer auszupacken, die schmutzigen Kleider in den Wäschekorb zu stopfen und das Bad zu nehmen, auf das sie sich so gefreut hat. Sie starrt auf die Lilienblätter, die sich allmählich in der Toilettenschüssel verteilen. Wo ist der Sinn? Zum ersten Mal in ihrem Leben sehnt sie sich nach einem Kind. Das Kind, das sie niemals haben wird, weil sie zu lange gewartet hat. Ein Teil von Andreas, den sie behalten kann. Der noch da wäre. Der sie trösten könnte, in einem Moment wie diesem. Ein Teil von ihr selbst, auf die Zukunft gerichtet, weil er sie, Juliane, überleben wird. Zweimal hat sie eine Schwangerschaft abbrechen lassen, weil die dazugehörigen Erzeuger keinerlei väterliche Ambitionen zeigten. Außerdem liebt sie ihren Beruf. Ich habe ja noch Zeit, hat sie sich nach den Eingriffen getröstet, als dieses Loch in ihrem Bauch ins Bodenlose wütete. Und dann hat sie der Alltag wieder in Besitz genommen, mit seinen Terminen und Geschäftigkeiten, die ihr immer so wichtig erschienen sind. Diese maßlose Arroganz, das eigene Leben lenken zu können, ja unter Kontrolle zu haben, wenn man sich nur ein bisschen anstrengt – in dieser Hinsicht hatte Andreas perfekt zu ihr gepasst. Andreas, der Charmeur. Der ewige Spieler, den sie an ihrem 38. Geburtstag aus einer Laune heraus in einer Kitschkapelle in Las Vegas geheiratet hat. Sie haben sich nie um Verhütung gekümmert und als sich kein Nachwuchs einstellte, hat Juliane ihr Unbehagen immer wieder verdrängt. Partys, Urlaube, Theater- und Konzertabonnements, Übersetzungen für die UNO, rund um den Globus. Sie hat das Leben auf der Überholspur genommen und nicht wahrhaben wollen, dass jede Straße irgendwo endet.
Wo ist die Zeit geblieben, fragt sie sich jetzt. In ein paar Wochen wird sie 43 und ihr Mann wird nicht wieder heimkommen, dessen ist sie sich sicher. Heute nicht und auch nächste Woche nicht, wenn die Herbstferien vorbei sind. Und spätestens dann kann sie das nicht mehr verheimlichen. Die Direktorin wird bei ihr anrufen und fragen, wo Andreas ist, und was soll sie dann sagen? Sie drückt auf die Klospülung, aber ein paar der Lilienblätter wollen einfach nicht untergehen. Sie muss zur Polizei gehen und ihren Mann als vermisst melden. Tut sie das nicht, wird sie sich verdächtig machen. Sie drückt noch einmal auf die Klospülung, länger diesmal, aber ein paar Blütenblätter sind immer noch da. Juliane Wengert lässt sich auf den Badezimmerteppich sinken. Zu ihrem Entsetzen beginnt sie zu weinen.
***
Diana Westermann denkt an Tansania, die Ebenen mit den staubigen roten Böden, das Hochland mit seinem überbordenden Grün, das auf eine Weise leuchtet, die weiter nördlich des Äquators niemals möglich wäre. Als ob die unbarmherzig grelle Sonne in Afrika alles so lange verbrennt, bis das, was übrig bleibt, eine Essenz ist, hat sie oft überlegt, während sie ihren Jeep durch den Busch lenkte, auf der Suche nach einem Dorf, einer Wasserstelle, irgendeinem Anzeichen von menschlichem Leben. Eine Essenz, so pur, wie sie in Deutschland niemals entstehen könnte. Werden und Vergehen, Maßlosigkeit und Hunger, Hitze und Kälte – all das ist in Afrika ein ständiges Wechselspiel, das nicht durch etwas so Allmähliches gemindert wird wie einen deutschen Herbst. Und ich brauche auch keinen deutschen Herbst, brauche die Überschaubarkeit eines seit Jahrhunderten bewirtschafteten Forsts nicht, in dem nichts einem Wanderer nach dem Leben trachtet, hat sie in Afrika gedacht. Wie sehr sie sich geirrt hat. Die Welt hatte sie verändern wollen, wenn sie frühmorgens das Moskitonetz über ihrer Hängematte zurückschlug und vor ihre Hütte trat. Dem Raubbau etwas entgegensetzen, mit ihrer ganzen Kraft, ihrer ganzen Energie. Es hat nicht funktioniert, war vielleicht von Anfang an nur eine Illusion. Und jetzt droht dieses kleine, überschaubare, deutsche Leben, für das sie sich entschieden hat, auch noch aus den Fugen zu geraten. Diana Westermann zieht die Decke enger um sich und starrt auf das Teakholz-Imitat. Ich will hier raus.
Die Schiebetür wird wieder aufgezogen und die Gefleckte klettert zurück in den Bus. Sie stinkt nach Zigarettenrauch. Der grauhaarige Polizist, der Diana stumm bewacht hat, macht plötzlich wieder Habichtaugen. Zu dritt ist es viel zu eng im Bus. Zu nah. Diana versucht, sich aufrecht hinzusetzen. Ihre Beine fühlen sich taub an. Die Plastiksitzbank ist scheußlich unbequem.
»Wann kann ich endlich heim? Ich warte hier und warte. Ich habe weiß Gott noch andere Dinge zu tun. Okay, ich habe eine Leiche gefunden. Aber das ist ja wohl kein Verbrechen. Ich will jetzt heim, auf der Stelle. Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen.«
Die Kommissarin setzt sich Diana gegenüber und lässt sie reden. Es sieht so aus, als ob sie die Zähne zusammenbisse, um eventuelle Kommentare zurückzuhalten. Aber als sie schließlich zu sprechen beginnt, klingt ihre Stimme erstaunlich weich und freundlich.
»Ich bedaure, dass wir Ihnen solche Unannehmlichkeiten bereiten. Aber sehen Sie, wir können Sie nicht einfach heimschicken, bevor Sie eine Aussage gemacht haben. Wir müssen einen Mord aufklären.«
»Mord? Er ist also …?« Diana fühlt, wie ihr Herz zu rasen beginnt. Ihre Stirn wird feucht, sie wischt darüber, reibt die Hand an der Decke trocken. Fühlt, wie sich neue Schweißtröpfchen bilden.
Die Gefleckte blättert in ihrem Notizblock und kramt mit der Rechten ihren Füller aus der Manteltasche. Sogar auf dem Handrücken hat sie Sommersprossen. Sie lächelt Diana an.
»Haben Sie auf dem Hochsitz irgendetwas angefasst, irgendetwas weggenommen oder verändert?«
Diana schüttelt den Kopf.
»Sicher?«
»Sicher.«
»Gut.« Die linke Hand blättert in dem Notizblock. Wieder lächelt die Kommissarin dieses Lächeln, das ihre türkis geränderten Augen nicht erreicht.
»Sie haben gesagt, Sie benutzen diesen Hochsitz zum Jagen. Wann waren Sie denn zum letzten Mal dort, von heute einmal abgesehen?«
»Ich kann mich nicht erinnern. Ist schon eine Weile her.«
»Ungefähr?«
»Weiß ich wirklich nicht mehr. Vor ein paar Wochen.«
»Aber Sie joggen regelmäßig dort vorbei?«
»Nicht regelmäßig, nein.«
»Vorhin haben Sie aber gesagt«, die Kommissarin kneift die Augen zusammen, offenbar bemüht, ihre eigene Schrift zu entziffern, »dass Sie nicht auf den Weg geachtet haben, weil Sie die Strecke gut kennen, weil Sie sie öfter benutzen.«
»Das stimmt ja auch, aber in letzter Zeit nicht.«
»Warum?«
»Warum?«
»Warum haben Sie die Strecke zum Erlengrund in letzter Zeit nicht benutzt?«
»Ich mag es nun mal, die Route zu wechseln. Außerdem war ich in letzter Zeit von morgens bis abends im Kürtener Forst, wegen der Holzernte.«
»Und das ist der einzige Grund?«
Das Blut in Dianas Ohren beginnt wieder zu rauschen. Sie sieht der Kommissarin direkt in die Augen.
»Ja, das ist der einzige Grund.«