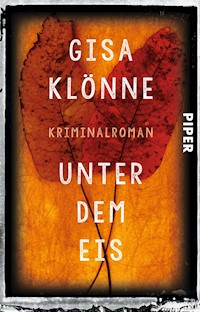8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Priestermord in Köln und ein junges Mädchen in Lebensgefahr: Hauptkommissarin Judith Krieger und ihr Kollege Manni Korzilius ermitteln in einem Verbrechen, hinter dem sich ein dunkles Geheimnis verbirgt. Niemand ist dabei frei von Schuld – auch nicht sie selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-96811-9
September 2016
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016
Erstausgabe: Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2009/Ullstein Verlag
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Covergestaltung: Mediabureau di Stefano, Berlin
Covermotiv: Maria Heyens/Arcangel (Nägel und blauer Untergrund); kjohansen /Getty Images (Rahmen)
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
1. Teil
»Nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter,
und nackt kehre ich dorthin zurück.
Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen,
der Name des Herrn sei gepriesen!«
Hiob 1, 21
Heute Abend werden sie sich sehen. Heute Abend wird sie ihm ihre Neuigkeit erzählen. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Sie kann nicht aufhören, das zu denken, sie kann nicht stillsitzen deswegen, sich auf nichts konzentrieren. Wenn er sie ansieht, weiß sie endlich, wie es ist, erkannt zu werden. Wenn er nur ihre Hand berührt, wird alles um sie still und belanglos und es gibt nur noch dieses Kribbeln: eine warme Welle bis in ihre Zehenspitzen. Sie liebt seine Stimme und die Art, wie sie miteinander reden. Sie liebt seine Hände, die kurzgeschnittenen Nägel, die Härchen auf seinen Fingern, wie dunkler Flaum. Seine Lippen sind weich und sein Körper ist überraschend muskulös, und doch kommt er ihr sehr verletzlich vor. Sie haben beide geweint, als sie es zum ersten Mal taten. Weil es so schön war, so richtig, so süß, das Ende der Sehnsucht, der Anfang von allem. Weil sie so lange versucht hatten zu widerstehen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Sie tritt vor den Spiegel, entscheidet sich für Jeans und Pullover. Noch zwei Stunden mindestens, bis er kommt, vielleicht auch länger. Aber dann wird er da sein und sie wird ihm ihre Neuigkeit erzählen und er wird sie in die Arme nehmen, ganz fest, für immer. Sie ist sehr sicher, dass es so sein wird. Es muss so sein. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Mittwoch, 22. Februar
Die Luft ist kühler im Park und es ist dunkel hier, wohltuend dunkel, die Silhouetten der Bäume sind kaum zu sehen. Er läuft auf die Kirche zu, sie leuchtet gelblich im Scheinwerferlicht. Ist er allein hier? Ja, natürlich, um diese Zeit. Das Summen in seinen Ohren lässt nach, sein Atem wird freier. Keine Musik mehr, kein Gegröle. Er hört das leise Knirschen seiner Schuhsohlen auf dem Pflaster, unwirklich beinahe, als habe es gar nichts mit seinen Schritten zu tun. Zu viel, denkt er, es war einfach zu viel. Ich hätte das letzte Bier nicht mehr trinken sollen, ich hätte an morgen denken müssen. Morgen, übermorgen, all die Termine.
Trommelschläge, dumpf und langgezogen, dröhnen jetzt von der Südstadt herüber, leiten das Ende des Karnevals ein. Die Stunde nach Mitternacht, die Stunde der Abrechnung, wenn das närrische Volk auf die Straße zieht, die Strohpuppen von den Fassaden der Kneipen reißt, sie anklagt für alle Sünden der tollen Tage, um sie dann zu verbrennen. Ein uraltes Ritual, das er niemals lustig fand, sondern ungerecht und barbarisch.
Er bleibt trotzdem stehen und lauscht den Trommeln, glaubt auch ein Echo seiner eigenen Schritte zu hören. Ein Echo, das schneller wird, lauter, ein Echo, das näher kommt, nah, viel zu nah.
Schmerz ist das nächste Gefühl. Überwältigend. Gleißend. Zwingt ihn in die Knie, raubt ihm alle Kraft. Er fällt, taumelt, unfähig, etwas dagegen zu tun. Sein Kopf schlägt aufs Pflaster, Knochen auf Stein, es hämmert und dröhnt. Er will schreien, sich wehren, und kann es nicht.
Atmen, er muss atmen. Er versucht es, rasselnd. Seine Zunge ist taub und schmeckt nach Blut. Was ist geschehen? Etwas ist da, jemand ist da, beugt sich über ihn. Kein Mensch, kein Gesicht, nur ein Schemen, und immer noch dieser wahnsinnige Schmerz.
Bitte, ich will nicht … Er kann nicht sprechen, kann sich nicht bewegen, schafft nur mit sehr großer Mühe ein Stöhnen.
Zeit vergeht, rast, gefriert. Sekunden? Minuten? Er weiß es nicht. Schräg über sich erkennt er die Kirche, unscharf, hell. Er blinzelt, erinnert sich plötzlich an die Ritterburg, mit der er als Junge so gerne spielte. Eine Festung mit Zugbrücke und Graben und zwei runden Türmen, fast so wie die, unter denen er liegt.
Jetzt ebbt der Schmerz ab und der, der ihn bringt, steht über ihm. Ein riesiger Schatten. Hebt etwas in den Himmel. Blitzend. Spitz.
Bitte … Immer noch kann er sich nicht bewegen. Immer noch sind da die Bilder aus seinem Elternhaus, und er schmeckt wieder den Kakao, den seine Mutter brachte, wenn er mit seinen Freunden Ritter spielte. Fühlt ihre weiche Hand in seinem Haar.
Er will diese Hand ergreifen, er will sich hineinschmiegen in ihren Duft, sich in ihm verlieren, aber jetzt dröhnen wieder die Trommeln und sie dringen in seine Brust und schlagen dort weiter. Dunkel. Schwer. Das ist nicht wahr, denkt er, das geschieht mir nicht wirklich. Aber der Schmerz hält ihn fest, und die Trommeln verstummen nicht, und der Schatten scheint einen Moment lang regelrecht vor der Kirche zu fliegen. Dann jagt er in irrsinnigem Tempo auf ihn herab, und der Schmerz explodiert.
Gott, denkt er. Mama. Nein. Ich will doch leben.
***
Ein letzter Blick über die Schulter. Ein Sprung. Geschafft. Bat hebt ihren Rucksack auf, setzt sich in Bewegung. Anfangs hat sie ein bisschen Schiss gehabt, Jana nachts allein zu besuchen. Schiss, dass jemand sieht, wie sie über die Mauer klettert. Schiss, dass irgendein Nachtwächter oder Bulle hier patrouilliert und Stress macht. Inzwischen ist sie cool, fühlt sich hier sicher, ja sogar geborgen. Allein mit den Toten und deren Energie, die tagsüber, wenn all die anderen Besucher über den Melatenfriedhof trampeln, kaum zu spüren ist. Die Wege zwischen den Gräbern sind unbeleuchtet, graue Kiespfade, die sich im Schwarz verlieren, auf einigen Gräbern flackern rote Lichter. Steinerne Engel bewachen sie – Boten aus einer anderen Welt. Bat lächelt. Bald wird es Frühling, und die Fledermäuse werden den Engeln wieder Gesellschaft leisten, außerdem ist es dann nicht mehr so kalt.
Da ist schon die Kapelle, wo der Hauptweg kreuzt, hier muss sie an der Trauerweide vorbei zu den neueren Gräbern. Der Weg ist ihr in den letzten zwei Jahren vertraut geworden, wahrscheinlich könnte sie ihn inzwischen mit verbundenen Augen finden. Die Flaschen in ihrem Rucksack klimpern leise, sündhaft teure Bacardi Breezer hat sie gekauft und noch einiges mehr, weil gleich ein besonderer Tag beginnt: Der 22. Februar, Janas 18. Geburtstag. Bat hat ihrer Freundin geschworen, dass sie eine Party feiern werden, und sie hat vor, dieses Versprechen zu halten.
Zuerst muss sie aufräumen, wie immer. Die Krokusse und Schneeglöckchen sind verblüht und diese spießigen Usambaraveilchen haben hier nichts zu suchen. Bat wirft sie auf den Kompost und holt eine Bodenvase mit frischem Wasser. 18 Grablichter hat sie für Jana gekauft. Sie arrangiert sie in Herzform, drückt die Vase in die Mitte, löst die dunkelroten Rosen von ihrem Rucksack und steckt sie hinein. Janas Engel thront über ihr, im rötlichen Licht der Kerzen erwachen seine Marmorgesichtszüge zum Leben. Zuerst hätte Bat ihn am liebsten weggesprengt. Unerträglich fand sie die sanfte, mädchenhafte Anmut, das Unschuldsweiß, die stille Traurigkeit. So war Jana nicht, hätte sie Janas Eltern am liebsten angeschrien, das könnt ihr nicht machen! Doch andererseits ist es auch nicht möglich, den Engel zu hassen, dazu sieht er Jana viel zu ähnlich. Also hat sie sich mit seiner Anwesenheit arrangiert.
Bat holt Janas Lederkappe aus dem Rucksack und drückt sie dem Engel aufs Haupt. Vor zwei Wochen hat sie ihm ein Tattoo auf die Rückseite seines rechten Flügels gesprüht, zwei Sterne und eine Fledermaus, sie sind noch da, bislang hat keiner was bemerkt. Ein Nietenhalsband, mehrere Ketten und ein Umhang aus schwarzem Satin und blutrotem Tüll vervollständigen das Partyoutfit des steinernen Gastes. Exakt pünktlich zur Mitternacht ist er fertig ausstaffiert. Weit entfernt sind nun die Trommeln von den Karnevalsfeiern zu hören.
Bat lässt sich auf ihre Isomatte fallen und öffnet zwei Breezer.
»Prost, Jana, let’s roll, auf dich!«
Sie leert eine Flasche in schnellen Zügen, schüttet den Inhalt der anderen auf Janas Grab. Noch eine Flasche, nicht mehr ganz so schnell. Und eine Zigarette. Und Musik. Normalerweise reicht Bat ihr MP3-Player, stundenlang liegt sie oft so da, einen Kopfhörer im Ohr, den anderen auf Janas Grab und schaut in den Himmel. Was natürlich albern ist und trotzdem tröstlich und wer weiß schon wirklich, was die Toten mitkriegen? Heute Nacht aber genügt der MP3-Player nicht, heute wird sie tanzen, für Jana, mit Jana, auch wenn ihr beim Anblick des Grabsteins überhaupt nicht danach zumute ist.
Sie beginnt soft, mit der Band Love Is Colder Than Death. Sphärisch und unheimlich klingt die hier auf dem Friedhof, ganz anders als in einem geschlossenen Raum. Der tragbare CD-Player von ihrer Mutter hat ordentlich Power, sie sollte ihn öfter mal ausleihen. Noch ein Breezer und noch einer für Jana, die beste Freundin, die es je gab. Sie wollten zusammen abhauen, wenn sie endlich 18 würden. Die Schule schmeißen, sich eine Wohnung nehmen, die sie zunächst mit irgendwelchen blöden Jobs finanzieren wollten und später mit dem Geld, das Jana als Sängerin verdienen würde und Bat als ihre Managerin, wenn sie die passende Band für Jana gefunden hätten. Sie hatten sich geschworen, sich nie zu verraten.
Noch ein Breezer. Und jetzt Sisters of Mercy, First and Last and Always. Alt zwar, aber dennoch für immer eines der besten Alben. Endlos haben sie das zusammen gehört und darüber philosophiert, dass es mehr geben muss als dieses öde Einerlei aus Schule und Angepasstsein und ›Denkt doch an später‹, das die Erwachsenen tagtäglich runterbeten, obwohl doch sonnenklar ist, dass die Welt vor die Hunde geht. Black Planet, singt der Mercy-Sänger. Bury me Deep, und auch wenn Bat jetzt die Tränen übers Gesicht laufen und bestimmt ihre ganze Schminke verschmieren, mit der sie sich so viel Mühe gegeben hat, hält sie ihr Versprechen und beginnt zu tanzen. Sie rammt die Absätze ihrer Doc-Martens-Stiefel in den Kies, dreht sich, springt, heult, grölt die Texte mit. Sie raucht dabei, trinkt schnelle Schlucke Bacardi und prostet dem Engel zu.
Sie haben behauptet, dass Jana vor den Zug gesprungen ist. Sie haben behauptet, dass Bat und die anderen aus dem Club daran schuld seien, dass sie Jana verrückt gemacht hätten. Gruftis seien sie, fehlgeleitete Jugendliche, die den Tod verklärten. Es war total sinnlos, ihnen zu widersprechen. Außerdem fehlte Bat dazu die Kraft. Jana hat sich umgebracht. Es war wie ein Schlag, der alles andere auslöschte. Wenn sie dran denkt, sieht sie vor allem die zitternde Unterlippe ihrer Mutter vor sich. Ihre Mutter hatte noch mehr gesagt, drängte sich in Bats Zimmer, stammelte rum, wollte sie in den Arm nehmen, doch das kriegte Bat nur noch undeutlich mit. Jana hat sich umgebracht. Immer und immer wieder hörte sie nur diesen einen Satz. Vier grausame Worte, die sich um Bats Herz krampften, es in eine Stahlzange nahmen und zudrückten, bis es sich roh und blutig anfühlte.
Erst als der Anfangsschock vorüber war, begann Bat zu begreifen, dass es eine Lüge war. Jana wollte nicht sterben. Und selbst wenn: Niemals hätte sie Bat ohne Abschied verlassen. Doch wenn Jana nicht freiwillig vor den Zug gesprungen war, musste jemand sie gestoßen haben. Jemand, der bislang damit durchgekommen ist, weil niemand außer Bat von ihm weiß, nicht einmal Fabian. Doch das wird sich ändern, bald, denn nach zwei Jahren Sucherei hat sie nun endlich eine Spur.
Long Train singen die Sisters of Mercy. Heyheyhey. Und Bat springt und dreht sich und schreit und keucht und ihre Tränen vermischen sich mit Schweiß, aber sie lässt sich erst auf die Isomatte fallen, als sie bei Some Kind of Stranger angekommen sind, dem letzten Song auf der CD, sie hält durch, bis es wirklich nicht mehr geht, genauso wie Jana es früher tat.
Der Engel sieht auf Bat herunter, sein Umhang flattert im Wind, als tanze er. Bat öffnet den letzten Breezer, gibt Jana einen Schluck, trinkt dann selbst. Lars heißt der Mann, von dem niemand weiß. Einmal hatte Jana ihn Bat von weitem gezeigt. Musiker sei er, Produzent, hatte sie geschwärmt und Bat schwören lassen, vorerst niemandem von ihm zu erzählen. Und plötzlich war Jana tot, und Bat konnte diesen Lars nicht mehr finden, sosehr sie auch suchte. Sie hatte sogar in Musikstudios rumgefragt, doch niemand schien einen Lars zu kennen, fast hatte sie schon zu glauben begonnen, dass es ihn gar nicht gab. Und dann stand er vor ein paar Tagen einfach an der Bar im Lunaclub und trank ein Bier. Es war voll und verraucht im Club, und Bat war schon ziemlich betrunken, es dauerte ewig, bis sie die Bar erreichte, und als sie dort ankam, war Lars verschwunden. Aber sie hatte ihn gesehen, ganz ohne Zweifel, und jetzt wird sie erst recht nicht aufgeben. Sie wird ihn wiederfinden, im Lunaclub oder woanders, bald, sehr bald. Sie wird ihn finden und dafür sorgen, dass Jana endlich Gerechtigkeit widerfährt. Bat hebt die Flasche und sieht dem Engel in die steinernen Augen.
»Ich finde ihn. Ich finde ihn ganz bestimmt«, schwört sie. »Verlass dich auf mich.«
***
Das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge zuckt über die Kirchenfassade, rechts leuchtet ein Scheinwerfer der Spurensicherung auf. Emsig wie Ameisen bewegen sich die Kriminaltechniker hinter der Polizeiabsperrung hin und her, einer stummen Choreographie gehorchend, die sich als bruchstückhaftes Schattenspiel auf der Fassade der Kirche wiederholt. Jenseits der Scheinwerfer liegt der Kirchenpark im Dunkeln und ist noch dazu durch eine übermannshohe Steinmauer vor Blicken von der Straße geschützt. Ein Ort der Ruhe, trotz seiner Innenstadtlage. Wie geschaffen für einen Mord.
»Es gibt einen Zeugen!« Der frisch zum Oberkommissar beförderte Ralf Meuser hastet auf Manni zu.
»Wo?« Manni sieht sich um.
»Im Rettungswagen.«
»Ist er verletzt?«
»Wohl nicht lebensgefährlich.«
»Kann er was sagen?«
»Schon, aber …«
Sie erreichen die Sanitäter und wedeln mit ihren Dienstausweisen. Der Zeuge, Erwin Bloch, ist ein rotnasiger Rentner mit Schnapsfahne und Matrosenmütze. Auf seine rechte Wange hat jemand einen Anker gemalt.
»Ich bin Kriminaloberkommissar Korzilius.« Manni beugt sich zu ihm herunter. »Sie haben etwas gesehen?«
Bloch glotzt ihn an, hat ganz offenbar Mühe, die Frage zu verstehen.
»Der war plötzlich da«, brabbelt er.
»Wer?«
»Der Ritter.«
»Der Ritter?«
»Der hatte ein Schwert!«
»Ein Ritter mit Schwert. Okay. Was ist dann passiert?«
»Weiß nicht.« Bloch stöhnt. »Ich bin gefallen. Alles war schwarz. Mein Bein tut weh.«
»Klär du die Details«, sagt Manni zu Meuser und sprintet los, auf die Kirche zu, den Protest des Kollegen ignorierend.
»Ein Priester!« Die Kriminaltechnikerin Karin Munzinger bremst seinen Lauf und versorgt ihn mit Handschuhen und Schuhüberziehern. Manni streift sie über, das Latex spannt über seinen Knöcheln. Matrose, Ritter und nun auch noch ein Priester. Wahrscheinlich ist auch der nur ein Karnevalist. Manni folgt der Spurensicherin zum Seitenportal der Kirche, sieht aus den Augenwinkeln, wie sein eigener Schatten auf die Sandsteinfassade springt. Sankt Pantaleon ist eine der vielen romanischen Kirchen Kölns und wird von denen, die so etwas interessiert, bestimmt auch für irgendetwas gerühmt. Heiligenbilder, Schätze oder morsche Gebeine in goldenen Schreinen. Manni schickt einen schnellen Blick zu den Kirchtürmen hinauf. Vor ein paar Jahren wurde im angrenzenden öffentlichen Park eine junge Frau so brutal vergewaltigt, dass sie fast gestorben wäre. Den Täter haben sie nie gekriegt.
Schattenkampf – Kata. Auf einmal muss er an diese Karatedisziplin denken, in der man gegen einen unsichtbaren Gegner kämpft. Wenn nicht ein Wunder geschieht, wird es mit seinem Training in nächster Zeit wohl wieder einmal nichts werden. Er duckt sich unter dem Absperrband durch, konzentriert sich auf das Szenario vor ihm. Ein weiterer Scheinwerfer strahlt auf und taucht den Toten in gleißendes Licht. Er trägt eine schwarze Soutane und liegt auf dem Pflaster, direkt vor den Stufen des Seitenportals. Ein Mann um die fünfzig, grauhaarig, gepflegt. Seine weit aufgerissenen Augen blicken starr in den Himmel. Seine Arme sind ausgestreckt, als wolle er sie zu einem letzten Segen erheben oder denjenigen, der ihn ins Jenseits befördert hat, umarmen.
Manni geht in die Hocke. Der Tote hat Blut verloren, viel Blut, seine Soutane ist voll davon und auch das Pflaster. Eine Wunde im Brustbereich scheint die Quelle zu sein, von einer Tatwaffe ist nichts zu sehen.
»Shit«, sagt Manni, denn wer auch immer für diesen Mord verantwortlich ist, hat ihnen auf den Kirchentreppen eine Botschaft hinterlassen. Die Schrift ist rot, glänzend. Manni beugt sich noch tiefer und schnuppert. Farbe, kein Blut, was die Sache nur unwesentlich besser macht.
»MÖRDER«, buchstabiert Karin Munzinger hinter ihm. »Aber das kann doch nicht … du glaubst doch nicht, dass das wirklich ihm hier gilt?«
Manni zuckt die Schultern, richtet sich auf.
»Sieht jedenfalls nicht nach einer Zufallsbegegnung aus.«
»Vielleicht hat es ein Verrückter auf die katholische Kirche abgesehen.« Ralf Meuser steht plötzlich neben Manni und wirkt im grellen Licht der Strahler noch blasser und dünner als sonst.
»Langsam, Ralf, noch wissen wir ja nicht einmal, ob unser Kandidat ein echter Priester ist.«
Meuser befühlt den Stoff der Soutane. »Die wirkt nicht wie ein Karnevalskostüm. Auch sein Birett erscheint mir echt.«
»Sein was?«
»Sein Priesterhut.« Meuser zeigt auf einen schwarzen Stoffklumpen am anderen Ende der Stufen, dessen Form Manni entfernt an den Teekannenwärmer erinnert, den seine Oma früher benutzte.
»Kleidung kann man kaufen.«
»Soweit ich weiß, muss man sich für den Erwerb von Priesterkleidung als Priester ausweisen.«
Ausweis, ein gutes Stichwort. Manni beginnt, die Hosentaschen des Toten zu untersuchen. Geldscheine, Münzen, Rosenkranz und Schlüssel. Keine Papiere. Wäre ja auch zu schön gewesen. Er nimmt den Schlüssel und probiert ihn am Seitenportal der Kirche. Er passt nicht. Klar.
Die Lichtstimmung im Park verändert sich jäh, der Rettungswagen hat gewendet und rollt nun mit rotierendem Blaulicht zur Straße. Wie eine Erscheinung schreitet die Rechtsmedizinerin Ekaterina Petrowa aus dem Lichtergewirr auf sie zu. Sie wirkt noch winziger als sonst, weil sie ausnahmsweise mal keine Absätze trägt. Ihr silberner Lidschatten funkelt wie Eis, ihre kohlschwarzen Augen scannen den Tatort und saugen sich dann an dem Toten fest. Die Lebenden müssen sich mit einem knappen Nicken begnügen. Der Rettungswagen erreicht die Straße, sein Martinshorn heult auf.
»Du weißt, wo die hinfahren, Ralf?«, fragt Manni.
Meuser nickt.
»Hat Bloch diesen Ritter noch näher beschrieben?«
»Er war grau, sagt er. Wie ein Schatten.«
Anfänger, denkt Manni böse und wünscht einen Augenblick lang, Judith Krieger wäre hier, weil die wenigstens anständige Vernehmungen führt. Aber die Kollegin Hauptkommissar ist nach ihrer letzten, fast tödlichen Eskapade bis auf weiteres out of order, und im Präsidium sind ihre Karten alles andere als gut.
»Der Zeuge stand unter Schock. Sein Bein ist gebrochen und wir haben seine Personalien …« Meuser plappert, bemüht, seinen Ruf zu retten.
Die Petrowa bekreuzigt sich und kniet sich neben den Toten. Beinahe zärtlich lässt sie ihre Hände über seinen Körper gleiten.
»Er wurde erstochen«, verkündet sie nach einer Weile. »Mit großer Wucht und einer langen Klinge.«
»Die Tatwaffe ist ein Schwert!« Meuser klingt regelrecht enthusiastisch. »Also hat der Zeuge vielleicht recht, wir suchen einen Ritter …«
»Wie lange ist er schon tot?«, fragt Manni, auch wenn er wenig Hoffnung hat, dass diese immergleiche Frage zufriedenstellend beantwortet wird. Doch hin und wieder, obwohl man sich natürlich keineswegs darauf verlassen kann, geschehen noch Wunder.
»Etwa vier Stunden«, erwidert die Rechtsmedizinerin nach einem Blick auf ihr Thermometer.
»Die Stunde der Abrechnung«, sagt Meuser leise.
»Wie bitte?«
»Mitternacht, der Übergang zum Aschermittwoch. Man klagt Strohpuppen an und verbrennt sie, lässt sie für alle Sünden büßen.«
»Der hier wurde aber nicht verbrannt«, widerspricht Manni und gestattet sich einen Blitzgedanken an Sonja, die sich jetzt gerade irgendwo in einem blaugrün schillernden Nixenfummel ohne ihn amüsiert, sicher zur Freude sämtlicher Kerle, die auf eine schnelle Nummer aus sind.
»Er wurde nicht verbrannt, aber er wurde exakt zum Ende der Karnevalszeit ermordet. Und dann diese Haltung: Wie Jesus am Kreuz …«
Ekaterina Petrowa hebt den Schädel des Toten an und begutachtet eine Platzwunde am Hinterkopf.
»Er ist niedergeschlagen worden«, folgert Manni.
»Oder die Schädelverletzung stammt vom Sturz. In jedem Fall ist sie frisch.« Sanft lässt die Russin den Kopf zurück aufs Pflaster gleiten, untersucht die Hände des Toten, betastet die Ärmel der Soutane. »Keine Abwehrverletzungen, soweit ich das vor der Obduktion erkennen kann.«
»Der Mörder war schnell.« Manni versucht sich den Tathergang vorzustellen. »Er überrascht sein Opfer, rammt ihm Schwert oder Messer in die Brust …«
»Der Priester lag auf dem Rücken, als der Täter zustach«, widerspricht Ekaterina Petrowa. »So wie das Blut ausgelaufen ist, vermute ich, dass es so war.«
»Er fällt also und verliert das Bewusstsein.«
Die Rechtsmedizinerin wiegt den Kopf hin und her. »Nicht unbedingt.«
»Er muss bewusstlos gewesen sein. Verteidigung ist ein Reflex. Selbst ein Priester liegt doch nicht einfach da und lässt sich töten.«
»Seine Augen sind offen«, sagt Ralf Meuser leise. »Als sehe er seinen Mörder an.«
»Warum hat er sich dann nicht gewehrt?«
»Vielleicht war er zu geschockt. Vielleicht kannte er seinen Mörder.«
MÖRDER. Wieder starrt Manni die Botschaft an. Es wird Ärger geben, denkt er. Druck, Hysterie, Komplikationen, vor allem, wenn dieser Mann hier tatsächlich ein katholischer Priester ist. Er checkt seine Armbanduhr, es ist schon bald fünf, auch wenn vom Tageslicht noch nichts zu sehen ist.
An der Polizeiabsperrung entsteht Unruhe, jemand ruft. Manni fährt herum, braucht einen Moment, um zu begreifen, dass das, was er dort sieht, keine optische Täuschung ist. Eine Prozession Nonnen, dunkel gewandet mit weißen Hauben, ist aufmarschiert und sieht zum Tatort hinüber. Stumm und würdevoll, als seien sie gekommen, um zu kondolieren.
***
Das letzte Frühstück mit zu dünnem Kaffee und zu weichem Brot. Der letzte Weg zurück ins Krankenzimmer, durch den verglasten Flur, dann mit dem Aufzug zwei Stockwerke hoch. Draußen wird es gerade erst dämmrig. Auf dem Rhein fährt ein Schiff, auf der Straße daneben Autos. Aus der Distanz der Rehaklinik betrachtet, sind sie nicht mehr als Lichtpunkte vor den Konturen des Siebengebirges, Signale von Menschen mit einem Ziel: Den Arbeitsplatz, den Kinderhort, ein Einkaufszentrum – Alltagsorte, deren Besuch sich im Laufe eines Tages zu Leben addiert. Judith geht zum Waschbecken, putzt sich die Zähne, steckt ihren Kulturbeutel in die Reisetasche, die sie bereits am Vorabend gepackt hat. Das Zimmer wirkt nun wieder leer, unpersönlich, bereit für den nächsten Patienten. Sie holt das T-Shirt aus der Tasche, das Manni ihr im Namen der Kollegen überreichte. Vor ein paar Wochen schon, als sie noch in einem Nebel von Medikamenten dahinschwebte. Als sie noch Blumen brachten und ihr versicherten, dass sie richtig gehandelt habe, keine Alternative gehabt hätte, dass niemand ihr einen Vorwurf mache.
Doch sobald die Ärzte sie einigermaßen zusammengeflickt hatten, begannen die Fragen. Warum sind Sie allein in dieses Haus gegangen, KHK Krieger? Warum haben Sie keine Verstärkung angefordert? Warum haben Sie sich den Anweisungen Ihres Vorgesetzten widersetzt? Fragen, Fragen, Fragen, immer wieder dieselben Fragen der ermittelnden Polizeibeamten. Judiths Antworten genügten ihnen nicht, verwandelten sich, noch während Judith sprach, in Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen. Jetzt sind die Akten bei der Staatsanwaltschaft, vielleicht wird es gegen sie ein offizielles Strafverfahren wegen Totschlags geben, einen Gerichtstermin, ein Urteil. Das Volk gegen Kriminalhauptkommissarin Judith Krieger. Vielleicht erhält sie zusätzlich noch eine Disziplinarstrafe, weil sie sich durch ein Verbot ihres Chefs nicht beirren ließ, einen Mörder zu überführen.
Sie war schon zu Hause gewesen, den linken Arm noch im Gips, als sie mit ihren Fragen kamen. Und dann nahmen die Schmerzen in ihrem Handgelenk wieder zu, wurden unerträglich, brachten sie zurück in die Klinik. Untersuchungen folgten, noch mehr Untersuchungen, Morbus Sudeck lautete die Diagnose schließlich. Eine akute Entzündung des verletzten Gelenks, die einen weiteren Krankenhausaufenthalt erforderlich machte. Die Ärzte haben ihr sogar angeboten, noch eine Woche zu bleiben, doch der Gips ist ab, die Entzündung zurückgegangen, die Schmerzen erträglich und sie will heim.
Judith streift Mannis T-Shirt über den Kopf. Das geht jetzt wieder, einigermaßen jedenfalls, sie kann wieder allein für sich sorgen. Sie zieht den Kragen der Bluse, die sie unter dem T-Shirt trägt, aus dem V-Ausschnitt, betrachtet das Ergebnis im Spiegel über dem Handwaschbecken. Das T-Shirt wirkt so wie ein schwarzer Pullunder, im Brustbereich steht in knallroten Großbuchstaben STAYING ALIVE, darunter reißt die Silhouette eines John Travolta den Arm hoch. Judith beugt sich näher zum Spiegel. Sie hat abgenommen, was nicht weiter tragisch ist. Neben ihren Mundwinkeln und unter den Augen entdeckt sie neue Fältchen, womöglich sind sie aber auch schon länger da. Sie sieht eigentlich ganz normal aus. Nicht so, als ob sie beinahe gestorben wäre. Nicht so, als habe sie einen Menschen getötet, um ihr eigenes Leben zu retten.
»Sie sind also noch immer entschlossen, uns zu verlassen.« Die Stationsärztin betritt das Zimmer, lächelt, als sie die Botschaft auf Judiths Brust bemerkt.
»Es ist gut, wieder heimzukommen.« Judith lehnt sich ans Waschbecken. »Ich werde brav sein. Die Übungen machen.«
»Übernehmen Sie sich nicht. Besorgen Sie sich Hilfe.«
»Ich habe schon einen Termin bei einer Physiotherapeutin.«
»Es geht nicht nur um Ihre Hand.«
»Ja, ich weiß.« Judith erwidert den Blick der Ärztin, hält ihn aus. Es geht darum, das, was geschehen ist, zu akzeptieren und ihre Alpträume nicht länger mit Tabletten zu dämpfen. Es geht darum, weiterzuleben, wieder aufzustehen. Ein Polizist, der getötet hat, verliert seine Unschuld, hat der Polizeiseelsorger Hartmut Warnholz zu ihr gesagt, der eines Tages ganz unangemeldet an ihrem Krankenbett aufgetaucht war. Er sah gar nicht so unsympathisch aus, längst nicht so vergeistigt, wie sie es von einem katholischen Pfarrer gedacht hätte. Sie hat eine Weile mit ihm gesprochen, seine Visitenkarte akzeptiert und ihn dann doch nicht angerufen. Ich habe nichts falsch gemacht, hat sie ihm gesagt. Der Täter hat mir keine Chance gelassen. Ich war mir immer darüber im Klaren, dass zu meinem Beruf in letzter Konsequenz auch das Töten gehört.
Die Taxifahrt nach Köln dauert nur zwanzig Minuten. Der Morgen ist weiß, von Hochnebel verhangen. Auf den Feldern neben der Autobahn picken Krähen nach Saatgut. Aschermittwoch, fällt Judith ein, und auf einmal beginnt sie, sich zu freuen. Auf Köln, aufs Alleinsein und Alleinentscheiden, nach all den Wochen, in denen sie auf Hilfe angewiesen war, dem Rhythmus anderer unterworfen. Aschermittwoch – das Ende der Karnevalszeit und des Winters. Bald ist es März, Frühling, die Tage werden schon länger. Ich lebe, denkt Judith. Ich will leben. Mein Leben leben. In letzter Konsequenz habe ich doch deshalb getötet oder etwa nicht?
Der Taxifahrer will sie hineinbegleiten, als sie Judiths Wohnung erreichen, bietet ihr an, ihre Reisetasche für sie zu tragen, doch sie gibt ihm ein Trinkgeld und schickt ihn weg. Sie streicht mit der Hand über die Holzreliefs der Eingangstür, bevor sie aufschließt, schiebt mit dem Fuß die Reisetasche in den Flur des Altbaumietshauses. Aus ihrem Briefkasten quellen Werbeprospekte, im Treppenhaus riecht es nach Holzpolitur und Stein und einem Hauch von Mittagessen. Vertraute Gerüche. Judith öffnet den Briefkasten, schafft es nicht, mit der linken Hand die Klappe festzuhalten, die Werbeprospekte fallen heraus. Sie hebt sie auf, stopft sie in ihre Reisetasche, verschließt den Briefkasten wieder. Alles ist mühseliger mit nur einer wirklich brauchbaren Hand, in der Klinik hat sie das nicht so sehr bemerkt, weil es wenig zu tun gab, außer sich auf den Heilungsprozess zu konzentrieren.
Die Reisetasche wird mit jedem Schritt schwerer, die Stufen erscheinen Judith höher als früher, die Treppe selbst viel steiler. Laufen Sie, hat der Pfarrer Warnholz ihr geraten. Bewegen Sie sich. Sie haben ein Trauma erlitten. Bewegung baut Stresshormone ab. Judith beginnt zu schwitzen. Den Handlauf auf der rechten Seite der Treppe kann sie nicht benutzen, weil sie mit dieser Hand die Tasche trägt. Auf einmal hat sie das Gefühl zu schwanken, das Gleichgewicht zu verlieren und ihre Knie beginnen zu zittern. Sie lässt ihre Tasche im ersten Stock auf den Boden plumpsen, stützt sich aufs Geländer. Drei weitere Stockwerke muss sie noch schaffen. Vielleicht hätte sie doch das Angebot annehmen sollen, den Klinikaufenthalt zu verlängern. Einfach noch ein Weilchen weiter im seligen Vakuum dahindriften und Tabletten einnehmen, wenn die Erinnerungen sie quälen. Aber das wäre falsch, feige, keine Lösung auf Dauer. Sie will die Erinnerung an dieses Haus nicht so stehenlassen, sie will nicht, dass sie sich dauerhaft festsetzt. Sie will Distanz von ihr, will wieder ermitteln, ihr Leben weiterführen. Ich schaffe das schon, ermutigt Judith sich stumm. Ich krieg das schon hin.
Ihre Wohnung riecht nach kaltem Rauch, bringt das Verlangen nach einer Zigarette zurück. Auf dem Küchentisch steht ein großer Strauß roter und violetter Tulpen, daneben stapelt sich ihre Post. Cora, liebe Freundin. Sie muss gestern Abend noch hier gewesen sein, vor ihrer Dienstreise nach Amsterdam. Judith lächelt und öffnet das Küchenfenster. Zuerst war sie viel zu schwach, um auch nur ans Rauchen zu denken. Aber nach ihrer ersten Entlassung aus dem Krankenhaus hat sie wieder angefangen. Und wieder aufgehört, als sie erneut in die Klinik musste. Sie hatte gehofft, dass das Thema damit erledigt wäre, dass es ihr nun zumindest leichter fiele, nicht wieder anzufangen. Ein idiotischer Wunsch, nichts als Illusion. Sie füllt ein Glas mit Leitungswasser, drängt die Gedanken an das Tabakpäckchen in der Küchentischschublade beiseite. Setzt sich und blättert durch ihre Post. Rechnungen. Formulare und Mitteilungen von ihrer Krankenkasse. Ein Brief vom Polizeipräsidium. Sie reißt ihn auf, überfliegt ihn. Es gibt weitere Fragen an sie. Fragen, von denen sie jetzt schon weiß, dass sie sie nicht befriedigend beantworten kann.
Judith wirft den Brief auf den Krankenkassenstapel. Blättert durch die Werbeprospekte, findet dazwischen einen Briefumschlag aus sehr feinem Leinenpapier, ihre Adresse darauf ist mit Tinte in gestochener, altmodisch wirkender Handschrift geschrieben. »Dr. Volker Ludes, Rechtsanwalt«. Der Absender ist nicht gestempelt, sondern in die Rückseite des Briefumschlags geprägt. Vielleicht irgendein Wichtigtuer, der sich ihr als Strafverteidiger empfehlen will und ihre Adresse von einem wohlmeinenden Kollegen aus der Mordkommission bekommen hat.
Judith schiebt den Briefumschlag beiseite. Es war Instinkt, der sie in das Haus getrieben hat. Instinkt, Bauchgefühl, eine Ahnung – doch wie erklärt man das? Ich kann das nicht erklären, denkt sie. Und ich habe auch keine Lust dazu.
***
Manchmal hat man Glück mit Zeugen. Manchmal erzielt man Erfolge durch pure Hartnäckigkeit. Hin und wieder gibt es eine späte Überraschung, die alles verändert. Erwin Bloch jedoch, der bislang einzige Zeuge der Soko Priester, ist ihnen auch in ausgenüchtertem Zustand alles andere als eine Hilfe. Äußerst widerwillig lenkt er seine Aufmerksamkeit vom TV-Gerät über seinem Krankenhausbett auf Manni. Nur stures Nachbohren fördert ein paar Fakten zutage. Magere Fakten: Bloch wollte im Kirchenpark pinkeln. Wie aus dem Nichts tauchte dann ein Ritter mit Schwert vor ihm auf und warf Bloch zu Boden. Bloch hatte Schmerzen, konnte sich nicht mehr bewegen. Er hatte große Angst und wurde ohnmächtig. Irgendwann kam er wieder zu sich und rief in seiner Stammkneipe an, und von dort schickten sie einen Krankenwagen und die Sanitäter entdeckten den toten Priester und informierten die Polizei.
Schluss, Ende, aus. Vom Mord hatte er nichts mitbekommen. Den Ritter kann er nicht beschreiben. Wie ein dämlicher Anfänger kommt Manni sich vor, als er zurück ins Präsidium fährt. Er holt sich einen Pott Kaffee und trinkt ihn im Stehen, starrt dabei aus dem Fenster des Büros, das er sich mit Holger Kühn teilen muss. Draußen spielen ein paar fettleibige Tauben Fangen, es sieht aus, als torkelten sie. Immerhin besteht die Chance, dass der ominöse Schwertritter tatsächlich ihr Täter ist, denn im Labor haben sie einige Blutstropfen auf Blochs Jacke sichergestellt. A positiv, die Blutgruppe des Toten. Ob es jedoch definitiv von ihm stammt, wird erst ein DNA-Test ans Licht bringen.
Manni wirft seinen Computer an. Die Zeit, in der er sich mit Bloch herumgequält hat, hat Kollege Kühn dazu genutzt, die triefäugig-plattnasige Hundegalerie an der Wand hinter seinem Schreibtisch mit einem weiteren Prachtexemplar zu verzieren. Ein besonders hässlicher Köter glubscht Manni an, nichtsdestotrotz ist er mit der Goldschleife eines Zuchtwettbewerbs dekoriert. Auch Kühn selbst führt sich neuerdings auf, als trage er ein Schleifchen. Und leider hat Millstätt ihn auch noch mit der Leitung der Soko Priester betraut. Ausgerechnet Kühn, Judiths Intimfeind, der, statt zu ermitteln, lieber in der Chefetage herumlungert, weil sein Hauptanliegen neben möglichst viel Freizeit für seine Boxerzucht die Präsentation von Erfolgen ist, für die sich maßgeblich andere krummlegen dürfen.
Doch ein abwesender Chef bedeutet auch ein interessantes Maß an persönlichem Freiraum. Manni konzentriert sich wieder auf die lange Liste, die neben einigen wenigen Fakten vor allem offene Fragen und zu erledigende Aufgaben enthält. Wer ist der Ermordete, den niemand aus der Gemeinde Sankt Pantaleon kennen will? Ist er tatsächlich ein Priester? Die Nonnen und der Gemeindepfarrer, den sie schließlich aus dem Bett scheuchten, kennen ihn jedenfalls nicht. Was hat er dann um Mitternacht an der Kirche gesucht?
Vielleicht wollte er Zwiesprache mit seinem Herrn halten. Beten. Die Augen der Nonne, die wohl so etwas wie die Chefin der Karmeliterinnen war, hatten genau dieselbe Blauschattierung wie Mannis eigene, das hatte ihn maßlos irritiert.
Und was wollen Sie hier?
Sie hatte seine Ruppigkeit überhört und fein gelächelt. Wir sind Karmeliterinnen aus dem benachbarten Kloster Maria vom Frieden. Wir kommen zur Andacht hierher.
Jetzt, mitten in der Nacht?
Es ist gleich schon fünf Uhr, der Beginn der Fastenzeit. Zeit, Einkehr zu halten und Buße zu tun.
Einkehren, beten und büßen. Stillhalten und dankbar sein und den Mund halten, während ein Priester auf der Kanzel predigt, was Gott seiner Meinung nach für richtig hält. Seit Manni 18 ist, war er nicht mehr in einer Kirche. Nur letztes Weihnachten hat er sich überreden lassen, seiner Mutter zuliebe, weil es das erste Fest ohne seinen Vater war. Manni verbiegt eine Büroklammer zu einem Minischwert. Wirft es in den Papierkorb. Wenn in der Gemeinde von Sankt Pantaleon niemand den Toten kennt, ist es sehr gut möglich, dass er gar kein Priester ist. Oder? Oder nicht? Warum denkt er dauernd, dass es noch weitere Morde geben wird? Er springt auf, trägt seinen Kaffeebecher hinüber zum Kollegen Meuser.
»Sitzt ein Schwuler in der Kirche, kennst du den?«
Meuser guckt ihn an, als spreche er Mandarin. Manni pflanzt seinen Hintern auf Meusers Schreibtischkante.
»Zuerst singen und beten sie, dann geht der Priester mit dem Weihrauch rum. Weißt du, was der Schwule da sagt?«
»Nein.«
»Pst, Süßer, dein Handtäschchen brennt.«
Meuser ringt sich ein säuerliches Lächeln ab, ohne den Blick von seinem PC-Monitor zu wenden. Vielleicht ist er schwul. Oder gläubig. Oder beides. Ich weiß eigentlich überhaupt nichts von ihm, wird Manni klar. Ich weiß nur, dass Judith ziemlich dicke mit ihm ist und ihn immer verteidigt, trotz seiner altklugen, umständlichen Art.
»Was wollte unser Mann nachts an der Kirche?«, fragt Manni versöhnlicher.
»Jemanden treffen.«
»Wen?«
»Seinen Mörder.«
»Hahaha.«
Meuser verzieht keine Miene. »Er will seinen Mörder treffen, von dem er annimmt, dass der in guter Absicht kommt und einen Schlüssel zur Kirche besitzt.«
»Du meinst, weil er selbst keinen Schlüssel bei sich trug.«
»Ja.«
»Vielleicht hatte er doch einen und der Mörder hat ihm den weggenommen«, schlägt Manni vor.
»Wieso sollte er einen haben? In der Gemeinde Sankt Pantaleon kennt ihn niemand.«
»Behaupten sie.«
»Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die uns alle belügen, um einen Mörder zu decken oder gar eine kollektiv verübte Tat?«
»Vielleicht ist er ja gar kein Priester, vielleicht war das Treffen an der Kirche nur ein Karnevalsscherz.«
»Ja, vielleicht.«
»Wir müssen rausfinden, wer er ist. Die Vermisstenmeldungen im Auge behalten. Noch weitere Gemeindemitglieder befragen.«
Ralf Meuser steht auf. »Ich fahr jetzt erst mal mit ’nem Foto von unserem Kandidaten zum katholischen Stadtdekanat.«
»Frag da auch gleich, ob es in Sankt Pantaleon irgendwas Spektakuläres zu klauen gibt.« Manni trägt seinen leeren Kaffeepott wieder zu seinem eigenen Schreibtisch, tippt weitere To-dos auf seine Liste.
Woher stammt die Farbe der Spraybotschaft?Gibt es weitere Zeugen, vielleicht Anwohner?Wo hat der Tote seine Soutane gekauft?Sie müssen was an die Presse geben, die Bevölkerung zur Mithilfe animieren. Wer hat gegen Mitternacht bei Sankt Pantaleon einen grauen Ritter gesehen? Einen Ritter mit Schwert, zu einer Zeit, in der beinahe jeder verkleidet ist. Und betrunken. Es ist wirklich ein Witz.
Mörder. Die Botschaft ist wichtig, davon ist Manni überzeugt. Sie beschuldigt das Opfer, sagt aber zugleich etwas über den Täter aus. Die Botschaft ist ein Teil einer sorgfältig geplanten Inszenierung, und wenn das so ist, hat auch alles andere eine Bedeutung: Der Zeitpunkt der Tat, die Körperhaltung des Toten, der Tatort selbst. Und falls der Täter tatsächlich als Ritter verkleidet kam, ist auch dieses Kostüm im Kontext des Karnevals sicher kein Zufall, sondern der geschickt geplante Schachzug eines eiskalten Täters.
Warum hat sich das Opfer nicht gewehrt? Das ist vielleicht das beunruhigendste Detail, das die Obduktion hoffentlich klären wird. Manni zieht seine Jacke über, nimmt die Treppen ins Parterre im Laufschritt, um seine Müdigkeit zu vertreiben, und lenkt wenig später einen Dienstwagen zurück in die Südstadt. Erbschuld, Erbsünde. Als Zeichen dafür malte der Dorfpriester seinen Schäflein früher zu Aschermittwoch ein Aschekreuz auf die Stirn. Selbst die Kinder blieben davon nicht verschont, nur Manni hatte sich gewehrt, sosehr seine Mutter auch auf ihn einredete. Sein Handy fiept, meldet den Anruf seiner Mutter, als könne sie seine Gedanken lesen. Sie berichtet vom bevorstehenden Aschermittwochsfischessen im Rheindorfer Ruderverein, fragt dann wie immer, wann er sie besucht.
»Ich hab einen neuen Fall, Ma, zurzeit ist das schlecht.«
»Aber du musst doch mal wieder was Anständiges essen.«
»Mach ich ja.«
Er hört die Enttäuschung in ihrer Stimme, weicht ihren Fragen zu den Ermittlungen aus, denkt an diesen merkwürdigen Glanz in ihren Augen, wenn sie früher vom Beichtgottesdienst kam. Einmal, kurz bevor er von Zuhause auszog, hat Manni sie angeschrien: Warum sie da hinrenne, es ändere ja doch nichts. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen, hatte seine Mutter erwidert, ein paar Tränen verdrückt und den Arm um ihn gelegt. Manni beendet das Telefonat, zu schnell, zu ruppig, er hört an ihrer Stimme, dass sie verletzt ist, wahrscheinlich sogar beleidigt, aber er kann es nicht ändern, er hat nicht vor, diesen Fall mit seiner Mutter zu diskutieren. Es reicht voll und ganz, wenn sie von dem Priestermord aus der Zeitung erfährt.
Noch zwei Stunden bis zur Obduktion, sein Magen knurrt, die Müdigkeit nach der durchwachten Nacht kommt mit Macht zurück. Sogar das fahle Februarlicht beginnt ihn zu blenden. In einem Café kauft er ein paar belegte Brötchen, erreicht wenig später Sonjas Wohnung. Zum ersten Mal hat sie ihm einen Schlüssel gegeben, eigentlich wollte er ihn schon in der Nacht benutzen. Manni geht durch den schmalen Flur in die Küche, legt die Brötchen auf den Tisch. Ein blaues Paillettenkleidchen und ein Fischernetz mit allerlei Plastikmeeresgetier hängen über dem Stuhl, auf dem Boden kringelt sich eine silberne Netzstrumpfhose. Manni hebt sie auf, wirft sie zu den anderen Klamotten. Sonja hat recht, er muss aufhören, sich für seine Mutter verantwortlich zu fühlen, und von Sonja muss er ihr auch dringend erzählen.
Er schleicht über den Flur ins Schlafzimmer, bleibt abrupt stehen. Neben Sonjas rotblonden Haarschopf auf dem Hochbett ist noch ein anderer, dunklerer zu sehen. Rückzug funkt Mannis Hirn, doch genau in diesem Moment öffnet Sonja die Augen.
»Fredo – hey!«
Er dreht sich um, geht zurück in den Flur, hat plötzlich überhaupt keine Energie.
»Das da in meinem Bett ist meine Freundin Kirsten!« Kurz vor der Wohnungstür holt Sonja ihn ein. »Das letzte Kölsch hat sie umgehauen, bis Bonn hätte sie es nicht mehr geschafft.«
Sie nimmt Mannis Hand, dirigiert ihn in die Küche. »Du glaubst doch nicht ernsthaft, ich geb dir meinen Schlüssel und dann …«
»Nee, Quatsch.«
Sie sieht ihn an. Ein leichtes Lächeln spielt in ihren Mundwinkeln. »Ich koch dir Kaffee.«
»Gleich.« Er zieht sie an sich, findet ihren Mund, tastet nach ihren Brüsten unter dem T-Shirt. Ihre Haut ist weich, warm, sie riecht nach Schlaf und Schweiß und Parfum. Auf einmal ist er überhaupt nicht mehr müde.
»Ich hab nicht viel Zeit«, sagt er in ihre Haare und fühlt wie ihr Körper auf seine Erregung reagiert.
»Wir können doch nicht …« Es ist ein schwacher Versuch zu protestieren, nicht wirklich überzeugend, weil Sonja sich nur noch fester an ihn drückt.
Manni schiebt sie zur Küchentür und schließt ab.
»Wir haben es lange nicht mehr hier getrieben«, sagt er und dann gibt es keine Worte mehr, nur noch ihren Hunger, Wärme, Hitze. Hitze, die Manni eine Stunde später auf die Straße begleitet und auf der kurzen Fahrt zu Sankt Pantaleon.
Im Inneren der Kirche riecht es nach Staub und nach Weihrauch, der Altar und die mächtige Orgel sind kunstvoll verziert. Rechts neben den Kirchenbänken künden allerlei Anschlagtafeln von einem regen Gemeindeleben: Seniorennachmittag, Kommunionskindergruppe, Chorproben, Orgelkonzert.
Mannis Handy fiept. Er checkt das Display, erkennt die Nummer von Holger Kühn.
»Die Meldung ist raus. Um drei ist die Pressekonferenz. Wir brauchen Ergebnisse. Ich verlass mich auf dich, Korzilius.«
Manni hebt den Kopf zu der mit rötlichen Ornamenten bemalten Kirchendecke, dreht sich einmal um die eigene Achse und ballt unwillkürlich die Rechte zur Faust, als er die lebensgroße Skulptur auf der Empore entdeckt. Zwei marmorne Jünglinge sind in diesem Kunstwerk miteinander verbunden. Der eine hat die Gesichtszüge eines Dämons und liegt am Boden. Der andere hat goldene Flügel und steht über ihm, rammt eine Lanze in die Brust des Liegenden und lächelt. Direkt gegenüber dem Altar.
***
Die Wohnung ist ruhig und dunkel, nur durch die heruntergelassenen Jalousien sickern schmale Streifen Tageslicht. Ruth Sollner hängt ihren Blazer an die Garderobe und trägt die Einkäufe in die Küche, stutzt, als sie den achtlos über einen Stuhl geworfenen Ledermantel entdeckt.
»Bea, bist du da?«
Nichts, keine Antwort. Ruth geht ins Wohnzimmer, das leer ist und ruhig. Sie schickt ein stummes Stoßgebet zum Himmel, während sie die Rollläden hochzieht. Tausendmal hat sie ihre Tochter schon gebeten, an die Rollos zu denken, ihr erklärt, dass die Pflanzen Licht brauchen, und dass mögliche Einbrecher denken könnten, die Bewohner seien verreist, wenn die Wohnung tagsüber abgedunkelt ist. Vielleicht hat Beatrice es ja heute Morgen einfach zu eilig gehabt, wollte nicht zu spät zur Arbeit kommen, hat einen vernünftigen Anorak statt des scheußlichen Lederungetüms angezogen. Ruth holt tief Luft und klopft an die Zimmertür ihrer Tochter.
»Bea?«
Immer noch keine Antwort. Ruth öffnet die Tür, fühlt, wie die Enttäuschung sie zu übermannen droht. Das Zimmer stinkt nach Schnaps und Nikotin. Auch hier ist es dunkel, aber nicht dunkel genug, als dass Ruth die Silhouette ihrer Tochter unter einem Gewühl aus Kissen und Decken übersehen könnte.
»Es ist zwei Uhr mittags!« Ruth geht zum Fenster, vorsichtig darauf bedacht, nicht über mögliche Hindernisse zu stolpern. Sie reißt die schwarzen Gardinen beiseite und stößt das Fenster auf, dankbar für die kühle, klare Luft, die ihr von draußen entgegenströmt.
»Hau ab!« Der Deckenberg bewegt sich, eine leuchtend violette Haarsträhne verschwindet in den Kissen.
»Warum bist du nicht in der Gärtnerei?«
»Lass mich in Ruh!«
Ruth betrachtet die matschigen Schnürstiefel auf dem Teppich, sie lässt den Blick zu dem wirren Haufen aus Klamotten und Schmuck neben der Matratze schweifen, die trotz all ihrer Bitten und Mahnungen, wenigstens einen Lattenrost anzuschaffen, nach wie vor direkt auf dem Boden liegt. Die Stereoanlage am Fußende des Matratzenlagers, in dem sich ihre Tochter versteckt, ist noch eingeschaltet, CDs mit grotesk hässlichen Titelbildern sind davor verstreut. Auch Beatrices Rucksack steht hier. Ein schmuddeliges, von Sicherheitsnadeln, Stickern und Ketten durchlöchertes Stoffding, aus dem Schnapsflaschen ragen. Direkt daneben liegt die leer gegessene Papiertüte einer Fastfoodkette.
»Was ist los, Beatrice, warum arbeitest du nicht?«
Keine Antwort, keine Regung. Nur das Chamäleon in seinem Glasterrarium blinzelt. Aus dem Pappkarton mit seinem Futter – lebenden Heuschrecken – glaubt Ruth auf einmal das leise Rascheln und Schaben zu hören, mit dem die todgeweihten Insekten ihre Leiber übereinanderschieben.
»Ich koche jetzt Kaffee.« Ruth flieht in die Küche, presst dort die Stirn an die Kühlschranktür und kämpft mit den Tränen. Sie hatte sich so sehr eine Tochter gewünscht, sie hat Beatrice vom ersten Tag an so sehr geliebt und sich an ihr erfreut, selbst als Stefan sie verließ, hatte sie noch geglaubt, nichts könne die Innigkeit zwischen ihr und ihrer Tochter zerstören. Gib sie nicht auf, das ist nur eine Phase! Ruth reißt sich zusammen, räumt die Einkäufe weg und befüllt die Kaffeemaschine. Noch immer hört sie das Rascheln der Heuschrecken. Gib deine Tochter nicht auf. Denk nicht dran, dass sie, die vor lauter Weichherzigkeit jahrelang nicht einmal zulassen wollte, dass du eine Fliege erschlägst, nun seelenruhig lebende Insekten an ihr Chamäleon verfüttert. Ruth schaltet die Radionachrichten ein, trägt den Ledermantel ihrer Tochter zur Garderobe und hängt ihn auf einen Bügel.
»… an der Kirche Sankt Pantaleon ist in der vergangenen Nacht ein Mann in Priesterkleidung ermordet worden. Das Opfer ist noch nicht identifiziert. Zeugen werden gebeten …« Der Rest wird vom Blubbern der Kaffeemaschine übertönt.
Ein ermordeter Priester? Hier ganz in der Nähe? Ruth hastet zurück in die Küche, doch aus dem Radio tönt nun die Wettervorhersage und als Nächstes verliest der Moderator mit munterer Stimme die Staumeldungen, ganz so, als ob alles in Ordnung wäre. Und vielleicht ist es das ja wirklich, vielleicht hat sie sich verhört, es kann doch nicht sein, dass jemand einen Priester umbringt, und schon gar nicht hier in Köln und dann auch noch vor Sankt Pantaleon. Doch ihre Ohren sind gut, geschult, sie hat sich nicht verhört. Vielleicht ist es eine Fehlmeldung, ein Irrtum, überlegt sie, während sie einen Becher mit Kaffee hinüber zu ihrer Tochter balanciert. Wenn Beatrice sofort aufsteht, können sie wenigstens noch zusammen zu Mittag essen, das Hühnerfrikassee, das Ruth am Vorabend gekocht hat, zart und mager und fein gewürzt. In knapp einer Stunde muss sie schon zu ihrer Schwester fahren.
»Kaffee, Bea, komm, aufstehen!« Es ist nicht leicht, einen Platz auf der schwarz lackierten Holzkiste zu finden, die ihrer Tochter als Nachttisch dient. Ruth setzt den mehrarmigen Kerzenleuchter auf den Boden, platziert den Porzellanbecher an seine Stelle. Der Kaffee duftet verführerisch. Auf einmal merkt sie, wie müde sie ist. Den ganzen Morgen hat sie im Arbeitsamt zugebracht. Aber es gibt keine Hoffnung auf eine feste Stelle für sie, immer noch nicht, trotz all der Weiterbildungen, die sie im letzten Jahr absolviert hat. Trotz ihrer in der Telefonseelsorge ehrenamtlich erworbenen Qualifikationen in Gesprächsführung und Psychologie.
»Komm schon, Beatrice, gleich gibt’s Essen. Hühnerfrikassee, das magst du doch gern!«
»Bat!« Der Deckenberg bewegt sich endlich, eines der Kissen fliegt aus dem Bett, haarscharf am Kaffeebecher vorbei. »Du sollst mich Bat nennen. Das hab ich dir schon tausendmal gesagt!«
»Bat«, wiederholt Ruth gehorsam, auch wenn sie beim besten Willen nicht verstehen kann, warum ihre Tochter wie eine Fledermaus heißen will. Wie kann es sein, dass sie mir so fremd geworden ist, fragt sie sich einmal mehr, während sich Beatrice nun wenigstens in eine halbwegs sitzende Position manövriert. Sie sieht fürchterlich aus. Die schwarze Schminke ist verschmiert, die Haut aschfahl, so dass die zahlreichen Piercings in Gesicht und Ohren noch brutaler wirken. Feindselig starrt sie ihre Mutter an.
»Mach das Fenster wieder zu, Penti friert sonst.«
Penti – Penthesilea, das unselige Chamäleon. Das teuerste Geschenk, das Stefan seiner Tochter seit der Trennung von Ruth je gemacht hat. Warum musste es ausgerechnet so ein schuppiges Urvieh sein? Es ist ein Geschöpf Gottes und Beatrice hat es sich gewünscht, beschwichtigt Ruth sich stumm. Es gibt ihr Halt, einen Grund, einigermaßen regelmäßig heimzukommen, jetzt, wo sie 18 ist und ich ihr nichts mehr vorschreiben kann. Sie kommt wegen ihres Chamäleons, wenn schon nicht mehr wegen mir, weil sie genau weiß, dass ich es nicht fertigbringe, das Tier zu füttern.
»Fenster zu!« Ihre Tochter hat definitiv eine Fahne. Sie schiebt sich eine steife violette Haarsträhne aus dem Gesicht, schlürft ein paar Schluck Kaffee, zündet dann eine Zigarette an. Sag jetzt bloß nichts, warnt ihr Blick. Sonst gibt’s Stress.
»Warum bist du nicht in der Gärtnerei?« Ruth zwingt sich, ruhig und freundlich zu bleiben. »Du weißt doch, dass wir das Geld dringend brauchen.«
»Kein Bock.« Bea inhaliert Rauch, bläst den Qualm in Richtung ihrer Mutter. Sie hat schon wieder zugenommen, bemerkt Ruth frustriert, kein Wunder, wenn sie sich immer Hamburger kauft und so viel Alkohol trinkt, ich möchte mal wissen, von welchem Geld.
»Jana hat heute Geburtstag«, sagt Bea leise und sieht auf einmal ganz jung aus und sehr verletzlich. Fast so wie früher, als noch alles in Ordnung war.
»Ach, Mädchen.« Ruth beugt sich herunter und streichelt den rundlichen Arm ihrer Tochter. Sie würde sie gern umarmen, die Kluft zwischen ihnen überwinden, traut sich aber nicht, und auch Beatrice macht keinerlei Anstalten, sich an sie zu lehnen.
»Ich mach jetzt das Essen warm«, sagt Ruth schließlich und geht zurück in die Küche, wo sie Reis und Hühnerklein auf zwei Tellern verteilt und mit Erleichterung bemerkt, dass ihre Tochter ins Badezimmer schlurft. Ein Blick auf die Uhr sagt ihr, dass sie sich nun wirklich beeilen muss, denn sie hat ihrer Schwester versprochen zu helfen und am Abend steht ihr noch eine lange Schicht in der Telefonseelsorge bevor. Sie ruft nach ihrer Tochter, schiebt den ersten Teller in die Mikrowelle und füllt zwei Gläser mit Mineralwasser, gerade als sie im Radio die Nachricht über den Priester wiederholen.
»Kennst du den?« Beatrice setzt sich an den Küchentisch.
»Ich weiß es nicht, sie sagen ja seinen Namen nicht.« Ruth reicht ihrer Tochter den Teller, schiebt ihre eigene Portion in die Mikrowelle, auch wenn sie plötzlich gar keinen Appetit mehr spürt.
»Du kennst ihn bestimmt. Du kennst die doch alle!« Bea beginnt zu essen, nur mit der Gabel, den linken Ellbogen auf den Tisch gestemmt.
»Iss bitte anständig, Beatrice«, sagt Ruth automatisch.
»Bat!« Ihre Tochter leert ihr Wasserglas in einem Zug, ohne den Ellbogen vom Tisch zu nehmen, und mustert Ruth interessiert. »Vielleicht hat ja jemand deinen heiligen Hartmut gekillt!«
»Das heißt Pfarrer Warnholz! Und den lässt du bitte aus dem Spiel!«
»Was für ein Spiel?« Beatrice rülpst leise und schaufelt sich eine weitere Ladung Frikassee in den Mund, den Blick fest auf Ruth gerichtet. »Ich denk, der ist tot.«
»Nicht Pfarrer Warnholz, nein.« Ruth öffnet die Mikrowelle, langt nach ihrem Teller, verbrennt sich, das heiße Frikassee schwappt auf ihre Bluse. Tränen schießen ihr in die Augen, sie setzt den Teller hart auf den Tisch, zu hart, denn nun ist auch noch das nagelneue Platzdeckchen besudelt, dabei hatte sie sich so über das hübsche Design gefreut und nun gibt es diese Sets sicher nicht mehr im Angebot. Sie dreht sich zur Spüle, hält ihre Hand unter kaltes Wasser, reibt mit einem Lappen über ihre Bluse. Es kann nicht sein, betet sie stumm. Nicht Hartmut, nein.
»Dein Essen wird kalt, Ma.«
Ruth dreht den Wasserhahn zu und setzt sich ihrer Tochter gegenüber. Ihr Herz hämmert wild. Sie springt wieder auf, versucht mit einem feuchten Lappen das Platzdeckchen zu retten.
»Pfarrer Warnholz ist nicht für Sankt Pantaleon zuständig, Bea.«
»Bist du sicher?«
»Er arbeitet als Notfallseelsorger für die Polizei und als Supervisor für Einrichtungen wie die Telefonseelsorge, das habe ich dir doch alles erklärt.« Ruth schiebt ein paar Reiskörner und ein Stück Huhn auf ihre Gabel. Sie fühlt sich auf einmal sehr nackt unter dem Blick ihrer Tochter. Als wäre sie ein Insekt, das Beatrice studiert. Eine der armseligen Heuschrecken in dieser Pappschachtel.
Beatrice lächelt, fast so, als könne sie Ruths Gedanken lesen. Sie trinkt einen großen Schluck Mineralwasser, stößt dann ihre Gabel wieder ins Essen.
»Ich hab deinen Hartmut aber schon bei Pantaleon gesehen«, sagt sie.
»Wann?«
»Keine Ahnung.«
»Wann, Beatrice?«
»Weiß ich nicht mehr. Irgendwann neulich. Nachts.«
***
Etwas zischt, Benzin gluckert, eine Tür schlägt zu, ein Streichholz wird angerissen. Angst. Schmerz. Abgrundtiefe Schwärze. Die Gewissheit, dass sie gefesselt ist, wehrlos und gleich bei lebendigem Leibe verbrennen wird. Die Panik jagt sie hoch, ihr rasendes Herz. Judith reißt die Augen auf, erkennt ihre Wohnung. Sie wollte sich nur kurz aufs Sofa legen, muss aber eingeschlafen sein, so tief, dass die Bilder die Macht übernommen haben. Ruhig, Judith, atme, du bist in Sicherheit, alles ist gut. Sie rappelt sich auf, wischt sich den kalten Schweiß von der Stirn, füllt in der Küche ein Glas mit Leitungswasser und trägt es auf ihre Dachterrasse. Die Geräusche der Stadt empfangen sie hier, wie eine lang vermisste Vertraute: entfernter Autoverkehr und dieses konstante Summen, das entsteht, wenn sehr viele Menschen dicht beieinander leben. Das Licht hat sich verändert, inzwischen muss es Nachmittag sein. Der Himmel ist weißgrau, undefiniert. Die Luft ist kühl und schmeckt nach Nebel.
Judith geht auf und ab, kleine Schlucke von ihrem Wasser trinkend. Sie versucht zu atmen, einfach nur zu atmen, ohne an eine Zigarette zu denken, ohne an ihren schmerzenden linken Arm zu denken, ohne an irgendetwas zu denken. Sie hat kein Licht gesehen, auch keinen Tunnel, an dessen Ende sie liebende Angehörige erwarteten, in jenem Augenblick, als sie glaubte, sie würde sterben. Sie hat einfach intuitiv verstanden, dass es um etwas anderes geht. Ums Loslassen vielleicht, ums Akzeptieren.