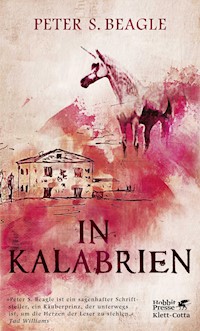15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die meisterhafte Fortsetzung des Klassikers »Das letzte Einhorn« Sooz' 17. Geburtstag steht bevor. All die Jahre hat sie nicht vergessen, was Molly Grue ihr einst aufgetragen hat: Sie muss nur eine bestimmte Melodie an ihrem Geburtstag pfeifen und dann wird sie eine bedeutsame Begegnung erleben… Aber wer ist die Frau, die ihr erscheint? Das Rätsel führt sie in ein fremdes Land. Das Land der Geträumten, das Land der Elfen und der kleinen Leute, ist gefährlich und voller Täuschung, nichts ist hier, wie es scheint. Und genau hier will Sooz ihre verschwundene Schwester Yelena finden und befreien. Wird es ihr aber auch gelingen selbst wieder heimzukehren oder ist sie für immer verloren? Die Leserinnen und Leser erwartet in diesem Band auch die dramatische Vorgeschichte »Zwei Herzen«: Das Dorf, in dem die kleine Sooz und ihre Familie leben, wird von einem gefährlichen Greifen angegriffen. Da macht sich das furchtlose Mädchen auf, um König Lír um Hilfe zu bitten. Und dann erscheint tatsächlich das letzte Einhorn! »Peter S. Beagle ist ein wunderbarer Schriftsteller, ein feiner Mensch und ein Räuberprinz, der die Herzen der Leser stehlen will.« Tad Williams
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Peter S. Beagle
Der Weg nach Hause
Aus dem Amerikanischen von Cornelia Holfelder-von der Tann
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Way Home« im Verlag Ace Books, New York
© »Two Hearts« 2005 by Peter S. Beagle
© »Sooz« 2023 by Peter S. Beagle
Für die deutsche Ausgabe
© 2008 und 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: © Birgit Gitschier, Augsburg unter Verwendung einer Illustration von © August Lamm, London
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98717-1
E-Book ISBN 978-3-608-12022-6
Inhalt
Zwei Herzen
Sooz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dank
Zwei Herzen
Mein Bruder Wilfrid findet es einfach ungerecht, dass das alles mir passiert ist. Wo ich doch ein Mädchen bin und noch ein Wickelkind und zu dumm, allein meine Sandalen zu schnüren. Aber ich finde es gerecht. Ich finde, es war alles genau richtig so. Bis auf das Traurige, und vielleicht sogar das.
Ich bin Sooz, und ich bin neun. Zehn im nächsten Monat, wenn sich wieder der Tag jährt, an dem der Greif kam. Wilfrid sagt, das war wegen mir, weil der Greif gehört hatte, dass gerade das hässlichste Kind der Welt geboren worden war, und mich fressen wollte, aber ich war zu hässlich, selbst für einen Greif. Also baute der Greif sich ein Nest im Midwood (so nennen wir den Wald, obwohl er eigentlich Midnight Wood heißt, weil es unter den Bäumen so finster ist) und blieb hier, um unsere Schafe und Ziegen zu fressen. Wie es Greife eben tun, wenn es ihnen irgendwo gefällt.
Aber Kinder fraß er nie, bis dieses Jahr.
Ich habe ihn nur einmal gesehen – ich meine, nur einmal vorher –, als er eines Abends über den Bäumen emporstieg wie ein zweiter Mond. Nur dass da kein Mond war an dem Abend. Da war gar nichts auf der ganzen weiten Welt, nur der Greif: die goldenen Federn am Löwenleib und an den Adlerschwingen lodernd, die mächtigen Vorderkrallen wie Zähne und der Monsterschnabel so riesig im Verhältnis zu seinem Kopf … Wilfrid sagt, ich hätte drei Tage lang geschrien, aber das ist gelogen, und ich habe mich auch nicht im Erdkeller versteckt, wie er behauptet, ich habe die beiden Nächte in der Scheune geschlafen, bei unserem Hund Malka. Weil ich wusste, Malka lässt nicht zu, dass mich irgendwas holt.
Sicher, meine Eltern hätten es auch nicht zugelassen, nicht, wenn sie’s hätten verhindern können. Aber Malka ist einfach der größte und beherzteste Hund im ganzen Dorf und fürchtet sich vor gar nichts. Und nachdem der Greif Jehane geholt hatte, die kleine Tochter vom Schmied, konnte man gar nicht nicht merken, wie erschrocken mein Vater war, weil er die ganze Zeit herumrannte, zu den anderen Männern, um eine Art Wache zu organisieren, damit die Leute immer Bescheid wussten, wenn der Greif kam. Ich weiß, er hatte Angst um mich und meine Mutter und tat alles, um uns zu beschützen, nur dass ich mich davon nicht sicherer fühlte, aber bei Malka wohl.
Aber es wusste ja sowieso keiner, was tun. Mein Vater nicht und auch sonst niemand. Es war ja schon schlimm genug, wenn der Greif Schafe holte, weil hier fast jeder davon lebt, dass er Wolle oder Käse oder Schaffelle verkauft. Aber dass er dann im letzten Vorfrühling Jehane holte, das änderte alles. Wir schickten Boten zum König – drei verschiedene –, und jedes Mal schickte der König jemanden mit ihnen zurück. Das erste Mal war es nur ein Ritter, einer allein. Er hieß Douros und schenkte mir einen Apfel. Er ritt singend los, in den Midwood, um Ausschau nach dem Greif zu halten, und wir haben ihn nie wiedergesehen.
Das zweite Mal – als der Greif Louli geholt hatte, den kleinen Gehilfen vom Müller – schickte der König gleich fünf Ritter. Einer von ihnen kam zwar wieder, aber er starb, bevor er irgendjemandem erzählen konnte, was passiert war.
Das dritte Mal kam eine ganze Schwadron. Das sagte jedenfalls mein Vater. Ich weiß nicht, wie viele Soldaten eine Schwadron hat, aber es waren viele, und sie waren zwei Tage im ganzen Dorf, bauten überall ihre Zelte auf, stellten ihre Pferde in jeden Stall und prahlten in der Schänke, wie sie diesen Greif für uns arme Bauern im Handumdrehen erledigen würden. Sie hatten Pfeifer und Trommler dabei, als sie in den Midwood marschierten – das weiß ich noch, und ich weiß auch noch, wie die Musik abbrach und was für Geräusche wir dann hörten.
Danach schickte das Dorf niemanden mehr zum König. Wir wollten nicht, dass noch mehr von seinen Männern starben, und außerdem waren sie uns sowieso keine Hilfe. Also wurden von da an alle Kinder schnell in die Häuser geholt, wenn die Sonne unterging und der Greif von seinem Tagesschlaf erwachte, um wieder zu jagen. Wir durften nicht mehr zusammen spielen, keine Botengänge für unsere Eltern machen, keine Herden hüten, ja nicht mal in der Nähe von offenen Fenstern schlafen, aus lauter Angst vor dem Greif. Mir blieb nichts anderes zu tun, als Bücher zu lesen, die ich schon auswendig konnte, und mich bei meinen Eltern zu beklagen, die von dem ganzen Aufpassen auf Wilfrid und mich zu müde waren, um sich mit uns zu beschäftigen. Sie passten ja auch noch auf die anderen Kinder auf, immer abwechselnd mit anderen Familien, und auf unsere Schafe und auf unsere Ziegen, deshalb waren sie immer müde, noch zu der Angst, und die meiste Zeit grollte jeder jedem. So ging es allen.
Und dann holte der Greif Felicitas.
Felicitas konnte nicht reden, aber sie war meine beste Freundin, schon seit wir klein waren. Ich verstand immer, was sie sagen wollte, und sie verstand mich besser als irgendjemand sonst, und wir spielten auf eine besondere Art, wie ich nie wieder mit jemandem spielen werde. Ihre Familie hielt sie für einen unnützen Esser, weil kein Bursche ein stummes Mädchen heiraten würde, also ließen sie sie meistens bei uns essen. Wilfrid machte sich immer über das leise Krächzen lustig, das der einzige Laut war, den sie hervorbrachte, aber ich warf einen Stein nach ihm, und da ließ er’s dann bleiben.
Ich habe es nicht gesehen, aber im Kopf sehe ich es immer noch. Sie wusste, dass sie nicht rausdurfte, aber sie freute sich immer so drauf, abends zu uns zu kommen. Und bei ihr zu Hause wäre ja keinem aufgefallen, dass sie nicht da war. Die bemerkten Felicitas sowieso nie.
Am selben Tag, an dem ich erfuhr, dass Felicitas geholt worden war, machte ich mich zum König auf.
Na ja, eigentlich war es in derselben Nacht, weil ich bei Tag nie von unserem Haus oder vom Dorf weggekommen wäre. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn nicht mein Onkel Ambrose eine Fuhre Schaffelle zum Markt in Hagsgate hätte bringen wollen – und um dort zu sein, wenn der Markt anfängt, muss man schon lange vor Sonnenaufgang los. Onkel Ambrose ist mein Lieblingsonkel, aber ich wusste, ich konnte ihn nicht bitten, mich zum König zu bringen, er wäre schnurstracks zu meiner Mutter gegangen und hätte ihr gesagt, sie solle mir Schwefel und Melasse geben und mich mit einem Senfpflaster ins Bett stecken. Er gibt sogar seinem Pferd Schwefel und Melasse.
Also ging ich an dem Abend früh ins Bett und wartete, bis alle schliefen. Ich wollte einen Brief auf meinem Kopfkissen hinterlassen, aber ich schrieb immer wieder etwas hin und zerriss es dann und warf es ins Feuer, und ich hatte Angst, dass jemand aufwachte oder dass Onkel Ambrose ohne mich losfuhr. Schließlich schrieb ich einfach nur: Bin bald wieder da. Ich nahm keine Kleider mit und auch sonst nichts außer einem Stückchen Käse, weil ich dachte, der König müsse ja wohl irgendwo in der Nähe von Hagsgate wohnen, der einzig größeren Stadt, die ich je gesehen habe. Meine Eltern schnarchten in ihrem Zimmer, aber Wilfrid war schon an der Feuerstelle eingeschlafen, und wenn er das tut, lassen sie ihn immer dort liegen. Wenn man ihn weckt, damit er in sein Bett geht, schlägt er um sich und heult. Warum, weiß ich nicht.
Ich stand eine Ewigkeit da und guckte auf ihn runter. Im Schlaf sieht Wilfrid nicht halb so gemein aus. Meine Mutter hatte die Glut mit Asche bedeckt, damit am Morgen noch Feuer zum Brotbacken da war, und die Moleskin-Hosen von meinem Vater hingen zum Trocknen da, weil er am Nachmittag in den Viehteich hatte waten müssen, um ein Lamm zu retten. Ich verschob sie ein kleines bisschen, damit sie nicht angesengt wurden. Ich zog die Uhr auf – eigentlich ist es Wilfrids Aufgabe, das abends zu machen, aber er vergisst es immer – und musste dran denken, wie sie sie am Morgen alle ticken hören würden, wenn sie nach mir suchten und vor lauter Angst das Frühstücken vergaßen, und ich machte schon kehrt, um wieder in mein Zimmer zu gehen.
Aber dann drehte ich wieder um und kletterte aus dem Küchenfenster, weil unsere Haustür so quietscht. Ich hatte Angst, dass Malka in der Scheune aufwachen und sofort wissen würde, was los war, denn Malka kann ich nie was vormachen, aber sie wachte nicht auf, und ich hielt fast den ganzen Weg die Luft an, als ich zu Onkel Ambroses Haus rannte und schnell auf seinen Wagen mit den Schaffellen kletterte. Es war eine kalte Nacht, aber unter dem Haufen Schaffelle war es heiß und stinkig, und ich konnte nichts tun, als dazuliegen und auf Onkel Ambrose zu warten. Also dachte ich vor allem an Felicitas, damit ich nicht so ein scheußlich schlechtes Gewissen hatte, weil ich einfach von zu Hause und von allen wegging. An Felicitas zu denken war schlimm genug – ich hatte noch nie jemanden, den ich gernhatte, verloren, nicht für immer –, aber es war wenigstens anders.
Wann Onkel Ambrose schließlich kam, weiß ich nicht, weil ich auf dem Wagen einschlief und erst wieder aufwachte, als da so ein Rucken und Knarren war und dieses schlabbrige Schnauben, das ein Pferd von sich gibt, wenn es geweckt wird und ihm das gar nicht passt – und schon waren wir auf dem Weg nach Hagsgate. Der Halbmond sank schon früh wieder, aber ich konnte das Dorf vorbeiholpern sehen, nicht silbrig in dem Licht, sondern unscheinbar und stumpf, keine Farbe, nirgends. Und trotzdem kamen mir fast die Tränen, weil es schon so weit weg schien, obwohl wir noch nicht mal am Viehteich vorbei waren, und ich das Gefühl hatte, ich würde es nie wiedersehen. Ich wäre auf der Stelle aus dem Wagen geklettert, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das nicht ging.
Weil der Greif immer noch wach und auf der Jagd war. Sehen konnte ich ihn natürlich nicht, unter den ganzen Schaffellen (außerdem hatte ich die Augen sowieso zu), aber seine Flügel machten ein Geräusch, als ob ganz viele Messer auf einmal geschärft würden, und manchmal stieß er einen Schrei aus, der schrecklich war, weil er so sanft und gedämpft klang und fast schon ein bisschen traurig und ängstlich, als ob der Greif den Laut nachmachte, den Felicitas von sich gegeben hatte, als er sie holte. Ich verkroch mich, so tief ich konnte, und versuchte, wieder einzuschlafen, schaffte es aber nicht.
Was auch gut war, weil ich nicht bis nach Hagsgate reinfahren wollte, wo mich Onkel Ambrose finden musste, wenn er auf dem Marktplatz seine Felle ablud. Also streckte ich, als ich den Greif nicht mehr hörte (sie jagen nie weit von ihrem Nest, wenn es nicht sein muss), den Kopf über die hintere Klappe des Wagens und sah zu, wie die Sterne einer nach dem anderen erloschen, als der Himmel immer heller wurde. Der Morgenwind setzte ein, als der Mond unterging.
Als der Wagen nicht mehr so holperte und wackelte, wusste ich, dass wir auf die Straße des Königs eingebogen sein mussten, und als ich Kühe kauen und leise miteinander reden hörte, ließ ich mich vom Wagen fallen. Ich stand erst mal nur da, wischte mir Staubflusen und Wollbüschel von den Kleidern und schaute Onkel Ambroses Wagen hinterher, der immer weiter davonrollte. Ich war noch nie allein so weit von zu Hause weg gewesen. Und noch nie so einsam. Vom Wind strich mir dürres Gras um die Knöchel, und ich hatte keine Ahnung, in welche Richtung ich gehen musste.
Ich wusste nicht mal, wie der König hieß – ich hatte nie gehört, dass ihn jemand anders nannte als »der König«. Ich wusste, er wohnte nicht in Hagsgate selbst, sondern in einem großen Schloss irgendwo in der Nähe, aber in der Nähe kann viel heißen, je nachdem, ob man mit einem Wagen fährt oder zu Fuß geht. Und ich musste immer wieder dran denken, dass meine Familie jetzt aufwachte und mich suchte, und von den Geräuschen, die die Kühe beim Weiden machten, kriegte ich Hunger, und meinen Käse hatte ich schon auf dem Wagen aufgegessen. Ich hätte so gern einen Penny dabeigehabt – nicht um was zu kaufen, nur um ihn in die Luft zu werfen und drüber entscheiden zu lassen, ob ich nach rechts oder nach links gehen sollte. Ich versuchte es mit flachen Steinchen, fand sie aber nicht wieder, wenn sie runtergefallen waren. Schließlich ging ich nach links, ohne bestimmten Grund, nur weil ich an der linken Hand einen kleinen silbernen Ring trage, den mir meine Mutter geschenkt hat. In diese Richtung führte auch eine Art Fußpfad, und ich dachte, vielleicht könnte ich ja um Hagsgate herumlaufen und mir dann überlegen, was weiter tun. Ich bin gut zu Fuß. Ich kann überall hinlaufen, wenn man mir genug Zeit lässt.
Nur dass es auf einer richtigen Straße leichter ist. Der Pfad hörte nach einer Weile auf, und ich musste mich zwischen dichten Bäumen durchzwängen und dann durch so viel Brombeergesträuch, dass mir lauter stachlige Zweigstückchen im Haar hingen und meine Arme brannten und bluteten. Ich war müde und verschwitzt und kurz davor – aber nur davor – zu heulen, und sobald ich mich hinsetzte, um mich auszuruhen, krabbelten Käfer und anderes Getier auf mir herum. Dann hörte ich irgendwo in der Nähe Wasser plätschern, und davon kriegte ich sofort Durst, also ging ich dem Geräusch nach. Wobei ich allerdings die meiste Zeit kriechen musste und mir Knie und Ellbogen ganz fürchterlich aufschrammte.
Es war nicht gerade ein großartiger Bach – an manchen Stellen ging mir das Wasser kaum über die Knöchel –, aber ich war so froh, als ich ihn gefunden hatte, dass ich ihn regelrecht küsste und umarmte, mich auf die Knie fallen ließ und das Gesicht im Wasser vergrub wie in Malkas stinkigem alten Fell. Und ich trank, bis nichts mehr in mich reinging, und setzte mich dann auf einen Stein, ließ die winzigen Fische meine wunderbar kühlen Füße kitzeln, fühlte die Sonne auf den Schultern und dachte weder an Greife noch an Könige noch an sonst irgendwas.
Ich sah erst auf, als ich ein Stück bachaufwärts die Pferde wiehern hörte. Sie spielten nach Pferdeart mit dem Wasser, machten Blubberblasen wie kleine Kinder. Ganz gewöhnliche Reitgäule, einer mehr braun, der andere eher grau. Der Reiter des Grauen war abgesessen und guckte sich den linken Vorderfuß des Pferds an. Ich konnte nicht viel sehen – beide Reiter trugen schlichte dunkelgrüne Mäntel, und ihre Hosen waren so abgewetzt, dass man die Farbe nicht mehr erkennen konnte –, deshalb merkte ich nicht, dass einer von ihnen eine Frau war, bis ich dann die Stimme hörte. Eine hübsche Stimme, tief wie die von Silky Joan, über die ich meiner Mutter nicht mal Fragen stellen darf, aber auch irgendwie rau, als könnte die Frau wie ein Falke schreien, wenn sie wollte. Sie sagte: »Da ist kein Stein zu sehen. Vielleicht ein Dorn?«
Der andere Reiter, der auf dem braunen Pferd, antwortete: »Oder eine Druckstelle. Lass mich mal schauen.«
Diese Stimme klang heller und jünger als die der Frau, aber dass der Reiter ein Mann war, wusste ich, weil er so groß war. Er stieg von dem Braunen, und die Frau trat zur Seite, damit er den Fuß ihres Pferdes anheben konnte. Bevor er das tat, legte er dem Pferd die Hände an den Kopf, eine auf jeder Seite, und sagte etwas, das ich nicht verstehen konnte. Und das Pferd sagte etwas zu ihm. Kein Wiehern oder Schnauben oder sonst ein Geräusch, das Pferde machen, nein, es war, wie wenn jemand mit jemand anderem redet. Besser kann ich es nicht ausdrücken. Dann bückte sich der große Mann, hob den Fuß des Pferdes hoch und guckte ihn sich eine ganze Weile an, und das Pferd bewegte sich nicht, schlug nicht mit dem Schweif und nichts.
»Ein Steinsplitter«, sagte der Mann schließlich. »Nur ein ganz kleiner, aber er ist tief in den Huf eingedrungen, und jetzt schwärt es. Ich verstehe nicht, warum ich es nicht gleich gemerkt habe.«
»Nun ja«, sagte die Frau. Sie berührte ihn an der Schulter. »Man kann nicht alles merken.«
Der große Mann schien ärgerlich auf sich selbst, so wie mein Vater, wenn er das Weidegatter nicht richtig zugemacht hat und der schwarze Widder von unserem Nachbarn reinkommt und mit unserem armen alten Brimstone einen Kampf anfängt. Er sagte: »Ich schon. Ich habe es zu können.« Dann drehte er dem Pferd den Rücken zu, beugte sich über den Vorderhuf, wie es unser Schmied tut, und machte sich daran zu schaffen.
Was er machte, konnte ich nicht genau sehen. Er hatte keine Hufmesser oder Hufkratzer wie der Schmied, und ich kann nur sagen, ich glaube, er sang dem Pferd etwas vor. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es richtig gesungen war. Es klang eher wie der erfundene Singsang, den ganz kleine Kinder von sich geben, wenn sie allein im Dreck spielen. Keine Melodie, nur rauf und runter, di-da, di-da-di … Langweilig selbst für ein Pferd, hätte man meinen sollen. Das machte er ziemlich lange, den Huf immer noch in den Händen. Plötzlich hörte er auf zu singen, richtete sich auf, hielt etwas hoch, das in der Sonne glitzerte wie der Bach, und zeigte es als Erstes dem Pferd. »Da«, sagte er, »das war es. Jetzt ist es wieder gut.«
Er warf das kleine Ding weg, hob den Huf wieder an, sang aber diesmal nicht, sondern berührte ihn nur leicht mit einem Finger, strich immer wieder drüber. Dann setzte er den Huf wieder ab, und das Pferd stampfte einmal fest auf und wieherte, und der große Mann wandte sich der Frau zu und sagte: »Trotzdem sollten wir hier unser Nachtlager aufschlagen. Sie sind beide müde, und mir tut der Rücken weh.«
Die Frau lachte. Ein tiefes, tönendes, langsames Lachen. So ein Lachen hatte ich noch nie gehört. Sie sagte: »Der größte Zauberer der Welt, und dir tut der Rücken weh? Heile ihn, so wie du meinen geheilt hast, damals, als der Baum auf mich fiel. Ich glaube, dazu hast du ganze fünf Minuten gebraucht.«
»Länger«, antwortete der Mann. »Du warst nicht bei Sinnen, hast es gar nicht mitbekommen.« Er berührte ihr Haar, das zwar fast ganz grau, aber dick und hübsch war. »Du weißt doch, wie ich dazu stehe«, sagte er. »Ich bin immer noch zu gern sterblich, um Zauberkräfte auf mich selbst anzuwenden. Das verdirbt es irgendwie – verwässert das Gefühl. Das habe ich dir doch schon erklärt.«
Die Frau sagte: »Mmpff«, so wie ich es von meiner Mutter tausendmal gehört habe. »Also, ich bin schon mein Leben lang sterblich, und es gibt Tage, da …«
Sie sprach nicht zu Ende, und der große Mann lächelte auf eine Art, die sagte, dass er sie necken wollte. »Da was?«
»Nichts«, sagte die Frau, »nichts, nichts.« Sie klang einen Augenblick lang gereizt, berührte dann aber den Mann an den Armen und sagte mit einer anderen Stimme: »An manchen Tagen – manchmal frühmorgens –, wenn der Wind nach Blüten riecht, die ich nie sehen werde, und in den nebligen Obstgärten Kitze tollen und du gähnst und brummelst und dich am Kopf kratzt und knurrst, dass wir noch vor dem Abend Regen kriegen werden und wahrscheinlich auch Hagel … an solchen Tagen wünsche ich mir von ganzem Herzen, wir könnten beide ewig leben, und ich finde, du warst ein Riesennarr, das aufzugeben.« Sie lachte wieder, aber jetzt klang es ein bisschen zittrig. Sie sagte: »Dann wieder erinnere ich mich an Dinge, an die ich mich lieber nicht erinnern würde, und mein Magen muckt, und alles Mögliche zwickt und zwackt mich – egal, was es ist und wo es wehtut, ob in meinem Körper, meinem Kopf oder meinem Herzen. Und dann denke ich, nein, wohl doch nicht, vielleicht nicht.« Der große Mann nahm sie in die Arme, und einen Moment lang legte sie den Kopf an seine Brust. Was sie noch sagte, konnte ich nicht hören.
Meiner Meinung nach hatte ich kein Geräusch gemacht, aber der Mann hob die Stimme ein wenig und sagte, ohne in meine Richtung zu schauen oder auch nur den Kopf zu heben: »Kind, hier gibt es etwas zu essen.« Zuerst war ich vor Schreck wie gelähmt. Durchs Gebüsch und die ganzen Erlen konnte er mich nicht gesehen haben. Und dann fiel mir wieder ein, wie hungrig ich war, und ohne dass ich wusste, was ich tat, ging ich auf sie zu. Ich guckte auf meine Füße und sah, wie sie sich bewegten, wie die Füße von jemand anderem, als ob sie diejenigen wären, die Hunger hatten, nur dass sie mich brauchten, um zu dem Essen zu gelangen. Der Mann und die Frau standen ganz still da und erwarteten mich.
Von nahem sah die Frau jünger aus, als ihre Stimme geklungen hatte, und der große Mann älter. Nein, das stimmt so nicht, das meine ich nicht. Sie war überhaupt nicht jung, aber das graue Haar machte ihr Gesicht jünger, und sie hielt sich kerzengerade, so wie die Lady, die kommt, wenn Leute bei uns im Dorf Kinder kriegen. Die hält auch ihr Gesicht ganz steif und starr, und ich mag sie nicht besonders. Das Gesicht dieser Frau hier war wohl nicht schön, aber es war ein Gesicht, an das man sich in einer kalten Nacht ankuscheln möchte. Besser kann ich es nicht sagen.
Der Mann … Im einen Moment sah er jünger aus als mein Vater und im nächsten älter als alle Menschen, die ich je gesehen habe, vielleicht sogar älter als Menschen eigentlich werden. Er hatte kein graues Haar, nur jede Menge Falten, aber das meine ich auch nicht. Es waren die Augen. Seine Augen waren grün, grün, grün, nicht wie Smaragde – ich habe mal einen Smaragd gesehen, eine Zigeunerin hat ihn mir gezeigt – und erst recht nicht wie Äpfel oder Limonen oder so was. Vielleicht wie das Meer, aber das habe ich noch nie gesehen, deshalb weiß ich’s nicht. Wenn man tief genug in den Wald reingeht (nicht in den Midwood natürlich, aber in jeden anderen Wald), kommt man früher oder später wohin, wo selbst die Schatten grün sind, und so waren seine Augen. Zuerst machten sie mir Angst.
Die Frau gab mir einen Pfirsich und sah zu, wie ich reinbiss, zu hungrig, um danke zu sagen. Sie fragte mich: »Was machst du hier, Mädchen? Hast du dich verirrt?«
»Nein, hab ich nicht«, murmelte ich mit vollem Mund. »Ich weiß nur nicht, wo ich bin, das ist was anderes.« Sie lachten beide, aber es war kein gemeines Lachen, kein Auslachen. Ich erklärte ihnen: »Ich heiße Sooz, und ich muss zum König. Er wohnt doch hier irgendwo in der Nähe, oder?«
Sie guckten sich an. Ich konnte ihnen nicht ansehen, was sie dachten, aber der große Mann hob die Augenbrauen, und die Frau schüttelte leicht den Kopf. Sie sahen sich eine ganze Weile an, bis die Frau dann sagte: »Nun ja, in der Nähe nicht gerade, aber auch nicht so weit weg. Wir sind selbst auf dem Weg zu ihm.«
»Gut«, sagte ich. »Oh, gut.« Ich versuchte zu reden, als wäre ich so erwachsen wie sie, aber das war schwer, weil ich so froh darüber war, dass sie mich zum König bringen konnten. Ich sagte: »Dann werde ich mit euch gehen.«
Die Frau war schon dagegen, ehe ich die ersten Wörter draußen hatte. Sie sagte zu dem großen Mann: »Nein, das geht nicht. Wir wissen nicht, wie die Lage ist.« Sie schien traurig, dass es so war, aber entschieden. Sie sagte: »Mädchen, es ist nicht deinetwegen. Der König ist ein guter Mensch und ein alter Freund von uns, aber das ist lange her, und Könige verändern sich. Könige verändern sich noch mehr als andere Menschen.«
»Ich muss aber zu ihm«, sagte ich. »Dann reitet eben ohne mich weiter. Ich geh nicht nach Hause, bevor ich bei ihm gewesen bin.« Ich aß den letzten Rest Pfirsich, und der Mann gab mir ein Stück Dörrfisch und lächelte die Frau an, als ich mich drüber hermachte. Er sagte leise zu ihr: »Wir dürften uns doch beide dran erinnern, wie es ist, unbedingt auf eine Fahrt mitzuwollen. Ich kann nur für mich sprechen, aber ich habe gebettelt und gefleht.«
Doch die Frau gab nicht nach. »Wir könnten sie in große Gefahr bringen. Das Risiko kannst du nicht eingehen, es wäre nicht recht!«
Er setzte an, ihr zu antworten, aber ich platzte dazwischen – meine Mutter hätte mich geohrfeigt, dass ich durch die halbe Küche geflogen wäre. Ich schrie sie beide an: »Ich komme aus großer Gefahr. Im Midwood nistet ein Greif, und er hat Jehane gefressen und Louli und … und meine Felicitas …« Und jetzt fing ich wirklich an zu weinen, aber es war mir egal. Ich stand einfach nur da und schluchzte und heulte und ließ den Dörrfisch fallen. Ich versuchte, ihn wieder aufzuheben, obwohl ich ihn vor lauter Tränen nicht sehen konnte, aber die Frau hielt mich fest und gab mir ihren Schal, damit ich mir die Augen trocknen und die Nase schnäuzen konnte. Er roch gut.
»Kind«, sagte der große Mann immer wieder, »Kind, ereifre dich doch nicht so, das mit dem Greif wussten wir nicht.« Die Frau hielt mich im Arm, strich mir übers Haar und funkelte ihn an, als wäre es seine Schuld, dass ich so heulte. Sie sagte: »Natürlich nehmen wir dich mit, Liebes – ist ja gut, natürlich tun wir’s. Das ist was Schreckliches, ein Greif, aber der König wird wissen, was dagegen zu tun ist. Der König verspeist Greife zum Frühstück – schmiert sie auf Toast, mit Orangenmarmelade, und verputzt sie dann, ich versprech’s dir.« Und so fort, albernes Zeug, das mich aber tröstete, während der Mann immer noch vernünftig auf mich einredete, dass ich nicht weinen solle. Ich hörte schließlich auf zu weinen, als er ein großes rotes Taschentuch hervorzog, es zur Form eines Vogels schlang und knotete und davonfliegen ließ. Onkel Ambrose kann Tricks mit Münzen und Muschelschalen, aber so was kann er nicht.
Er hieß Schmendrick, was ich immer noch den komischsten Namen finde, den ich je gehört habe. Die Frau hieß Molly Grue. Wir brachen nicht gleich auf, wegen der Pferde, sondern schlugen da, wo wir waren, ein Nachtlager auf. Ich wartete drauf, dass der Mann, Schmendrick, es per Zauberkraft errichten würde, aber er machte nur Feuer, breitete ihre Decken aus und holte Wasser vom Bach wie jeder andere auch, während sie den Pferden die Vorderbeine mit Riemen fesselte und sie grasen schickte. Ich sammelte Feuerholz.
Die Frau, Molly, erzählte mir, dass der König Lír hieß und dass sie ihn als ganz jungen Mann gekannt hatten, bevor er König geworden war. »Er ist ein wahrer Held«, sagte sie, »ein Drachentöter, ein Riesenbezwinger, ein Retter bedrängter Jungfrauen und Löser unlösbarer Rätsel. Er ist vielleicht sogar der größte aller Helden, weil er auch ein guter Mensch ist. Das sind sie nicht immer.«
»Aber du wolltest nicht, dass ich mit zu ihm gehe«, sagte ich. »Warum nicht?«
Molly seufzte. Wir saßen unter einem Baum und sahen zu, wie die Sonne unterging, und sie bürstete mir Zeug aus dem Haar. Sie sagte: »Jetzt ist er alt. Schmendrick hat Probleme mit der Zeit – warum, erzähle ich dir eines Tages, das ist eine lange Geschichte –, und er versteht nicht, dass Lír vielleicht nicht mehr der ist, der er war. Es könnte ein trauriges Wiedersehen werden.« Sie fing an, mir das Haar um den Kopf zu flechten, damit es aus dem Weg war. »Ich hatte bei dieser Reise von Anfang an ein ungutes Gefühl, Sooz. Aber er hat sich in den Kopf gesetzt, dass Lír uns braucht, also sind wir jetzt hier. Man kann nicht mit ihm debattieren, wenn er so ist.«
»Eine gute Ehefrau hat nicht mit ihrem Mann zu debattieren«, sagte ich. »Meine Mutter sagt, man wartet, bis er aus dem Haus ist oder schläft, und macht dann, was man will.«
Molly lachte, dieses tönende, lustige Lachen, das sie hat, wie ein tiefes Glucksen. »Sooz, ich kenne dich erst ein paar Stunden, aber ich würde jeden Penny, den ich im Moment besitze – und auch Schmendricks ganzes Geld – darauf verwetten, dass du mit dem Mann, den du mal heiratest, schon in der Hochzeitsnacht debattieren wirst. Außerdem sind wir nicht verheiratet, Schmendrick und ich. Wir sind zusammen, weiter nichts. Wir sind schon ganz schön lange zusammen.«
»Oh«, sagte ich. Ich kannte keine Leute, die einfach zusammen waren, nicht so, wie sie es sagte. »Aber ihr wirkt verheiratet. Irgendwie.«
Mollys Gesicht blieb unverändert, aber sie legte den Arm um mich und zog mich kurz an sich. Sie flüsterte mir ins Ohr: »Ich würde ihn nicht heiraten, und wenn er der letzte Mann auf der Welt wäre. Er isst im Bett wilde Rettiche. Knurps, knurps, knurps, die ganze Nacht – knurps, knurps, knurps.« Ich kicherte, und der große Mann, der gerade am Bach einen Topf spülte, guckte zu uns rüber. Das letzte Sonnenlicht lag auf ihm, und diese grünen Augen leuchteten wie ganz junge Blätter. Eins zwinkerte mir zu, und ich fühlte es, so wie man einen winzigen Lufthauch auf der Haut fühlt, wenn es heiß ist. Dann scheuerte er wieder an dem Topf herum.
»Werden wir lange brauchen bis zum König?«, fragte ich sie. »Ihr habt doch gesagt, er wohnt nicht so weit weg, und ich habe Angst, dass der Greif noch jemanden frisst, während ich weg bin. Ich muss nach Hause.«
Molly war jetzt mit meinem Haar fertig und zog sachte meinen Hinterkopf runter, damit ich aufblickte und ihr in die Augen sah. Sie waren so grau, wie Schmendricks Augen grün waren, und ich wusste schon, dass sie je nach Mollys Stimmung dunkler oder heller grau wurden. »Was erwartest du dir davon, den König zu treffen, Sooz?«, fragte sie zurück. »Was hast du dir vorgestellt, als du dich auf den Weg zu ihm gemacht hast?«
Ich war überrascht. »Na ja, ich werde ihn dazu bringen, dass er mit mir in mein Dorf kommt. All diese Ritter, die er schickt, richten überhaupt nichts aus, also muss er sich selbst um diesen Greif kümmern. Er ist der König. Das ist seine Aufgabe.«
»Ja«, sagte Molly, aber so leise, dass ich es kaum hören konnte. Sie tätschelte mir kurz den Arm, ganz leicht, stand dann auf und ging davon, um sich allein ans Feuer zu setzen. Sie tat, als ob sie die Glut für die Nacht bedecken wollte, machte es aber nicht wirklich.
Früh am nächsten Morgen brachen wir auf. Molly nahm mich eine Weile vor sich auf ihr Pferd, aber dann nahm mich Schmendrick die meiste Zeit auf seins, um den wunden Huf des anderen Pferds zu schonen. Er war bequemer zum Anlehnen, als ich gedacht hatte – knochig an manchen Stellen, schön nachgiebig an anderen. Er redete kaum, sang aber viel, während wir so dahinritten, manchmal in Sprachen, von denen ich kein Wort verstand, manchmal aber auch einfach erfundene, alberne Liedchen, um mich zum Lachen zu bringen. Eins ging so:
Soozli, Soozli,
Pfiffikusli,
erheiterst mich bis in die Schuhsli.
Soozli, Soozli,
Magus-Musli,
machst mich ganz konfusli-wusli.