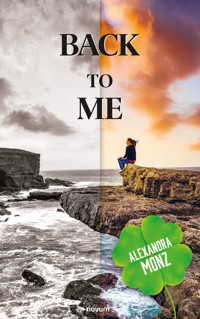15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marie dachte bisher, sie sei mit ihrem Leben zufrieden. Doch als ihr Partner sie betrügt, erkennt sie die Chance, sich von ihrem bisherigen Leben zu lösen und reist zu dem Ort, an den die Sehnsucht sie bereits seit ihrer Kindheit hingezogen hat. Bereit und mit genug Mut im Herzen, den Schritt ins Ungewisse zu wagen, beschließt sie, dass ihr neues Leben in Irland beginnen soll. Dort warten neue Herausforderungen auf sie, außerdem eine Handvoll herzlicher Menschen, vielleicht eine neue Liebe. Vor allem aber die große Frage, die sie sich selbst beantworten möchte: "Wer bin ich und was möchte ich mit meinem Leben anfangen?" Wird sie die Antwort finden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-7116-0174-2
ISBN e-book: 978-3-7116-0175-9
Lektorat: Naemi Hofer
Umschlagabbildungen: Vaclav Volrab, Patryk Kosmider | Dreamstime.com, Alexandra Monz
www.novumverlag.com
Widmung
Für all die lieben Menschen, die zu meinem Leben gehören und so unendlich wichtig für mich sind, und an alle, die bereits gegangen sind.
Für meine ganze große, liebevolle Familie, die in jeder Lebenslage hinter mir, meinen Entscheidungen und meinen fixen Ideen steht.
Für meine Freunde – jene, die ein Leben lang an meiner Seite stehen, ebenso wie jene, die mich ein Stück meines Weges begleiten.
Für J. und S., die Mädels, die mich darin bestärkt haben, mein Manuskript an einen Verlag zu schicken.
Für meine zwei Radiergumminasen, LUNA und HECTOR, die mein Leben auf eine Art bereichern, die ich nicht in Worte fassen kann.
Für den BESTEN PAPA und die WUNDERVOLLSTE SCHWESTER der Welt – mit eurer Liebe wird mir jeder Schritt immer etwas leichter fallen.
Und zu guter Letzt für die Person, von der ich mir am allermeisten wünschen würde, sie wäre noch bei uns, um mein Buch und alles, was noch kommt, lesen zu können. Ich weiß genau, du bist immer bei mir und gibst mir den Mut und die Kraft, alles zu schaffen, was ich mir vorgenommen habe.
Vorwort
Da stehe ich nun, vor dem riesigen Flughafengebäude, mit meiner riesigen „Marry Poppins“-Reisetasche in der Hand, in meinem liebsten königsblauen Jumpsuit, die langen braunen Haare fein säuberlich zu zwei Zöpfen geflochten, damit sie mir während des Fluges nicht auf die Nerven gehen.
Ich blicke hinunter auf meine Hand in der ich das Flugticket halte, ein leichter Schauer überkommt mich, ich bin nicht Sicher ob es an dem nahenden Unwetter liegt oder an meiner Angst, aber eins ist sicher und ich sage es mir laut vor: „Du wirst diesen Flug nehmen, jetzt oder NIE!“.
Kapitel 1
An dem Abend, als mir Philipp – meine „große Liebe“, mein Verlobter – gestand, dass eine seiner Partnerinnen in der Kanzlei, Franziska, ein Kind von ihm erwartet und er schon seit längerer Zeit ein Verhältnis mit ihr hat, schockierte mich das zu tiefst. Es war der schlimmste Moment seit damals, als ich mit großem Entsetzen feststellen musste, dass ich niemals den Weihnachtsmann heiraten würde, da dieser schlicht und einfach nicht existiert.
Erst war es einfach ein Tag mehr, an dem ich unzufrieden von der Arbeit nach Hause gekommen war, gekocht hatte, Philipp und ich uns an den Tisch setzten, aßen und uns von unserem schrecklichen Tag, auf der schrecklichen Arbeit in dieser schrecklichen Stadt mit diesem schrecklichen Verkehr und den schrecklich schlecht gelaunten Menschen erzählten.
So lief nahezu jeder Abend ab, seit wir zusammen nach Frankfurt gezogen waren.
Nur an diesem Abend war irgendetwas anders … Philipp stocherte nur stumm mit der Gabel in seinem vollgepackten Teller mit Pesto Spaghetti, eigentlich sein Lieblingsgericht, herum und war nicht halb so energisch wie sonst bei der Diskussion dabei, ob nun Fahrradfahrer oder Fußgänger die größeren Verkehrssünder waren. Alles, was er zum Thema von sich gab, waren ein paar Grunzgeräusche, die wohl ein Zeichen der Gleichgültigkeit darstellen sollten sowie das ein oder andere „Hm, ja, da könntest du recht haben“.
Weil ich nicht willens gewesen war, eine Unterhaltung mit mir selbst zu führen, da ich das ja ohnehin den halben Tag auf der Arbeit tat, wenn mein Chef sich mal wieder nicht für meine Meinung interessierte, beendete ich das Gespräch mit einem „Na ja, der blöde Radfahrer hat es auf jeden Fall überlebt“, und widmete mich weiter meinem Essen.
„Sie ist schwanger!“, hörte ich Philipp plötzlich kleinlaut sagen.
„Wer ist schwanger?“, gab ich zurück, ohne genau zu wissen, wie der plötzliche Themenwechsel zustande gekommen war.
„Franziska!“, sagte er noch etwas leiser.
„Das ist doch wunderbar! Freut mich sehr für sie. Ich wusste nicht, dass sie mit jemandem zusammen ist, davon hast du nichts erzählt. Dann sollten wir uns gleich morgen um ein angemessenes Gesche…“, weiter kam ich nicht, denn Philipp fiel mir barsch ins Wort:
„Ich bin der Vater, es ist mein Kind, es tut mir leid.“
Ich muss immer wieder an diesen einen Satz denken: „Ich bin der Vater, es ist mein Kind, es tut mir leid!“ Es tut ihm leid … Na ja, ich würde eher sagen, mir tut es leid, dass ich so lange auf diesen Mistkerl hereingefallen bin.
Philipp und ich waren seit der 7. Klasse ein Paar gewesen. Er hatte mir im Winter in der Mittagspause auf dem Schulhof einen riesigen Schneeball direkt ins Gesicht befördert, woraufhin ich mich auf ihn gestürzt hatte, um ihm mit Schnee den Mund auszuwaschen, was unweigerlich dazu führte, dass wir beide uns das nächste Mal zum Nachsitzen wiedersahen. Seit diesem Tag war es dann um uns geschehen.
Fünfzehn Jahre lang haben wir gemeinsam schlimme Zeiten überstanden und schöne Augenblicke genossen.
Ich mache ihm keine Vorwürfe, denn ich bin der Meinung, dass jeder für seinen Weg selber verantwortlich ist. Ich hatte mich gerne dafür entschieden, meine Wünsche hintanzustellen, bis er in seinem Beruf Fuß gefasst und sich einen Namen gemacht hätte, Hauptsache wir waren zusammen.
Seine Karriere lief mittlerweile super, genauso wie sein Liebesleben ganz offensichtlich, und ich quälte mich von Tag zu Tag ins Büro und machte meine Ausflüge durch die ganze Welt in meinen Träumen. Meine Zeit würde irgendwann kommen.
Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass mein geliebter Freund sich nicht im Geringsten für meine Träume und Wünsche interessierte und auch niemals vorhatte, mich dabei zu unterstützen. So fällt man eben auf die Nase.
Nun stehe ich hier, eine Woche später, noch immer sehr verletzt, noch immer sehr wütend, noch immer fühle ich mich hintergangen, aber mit der Gewissheit, dass mein Leben nun eine Wende nehmen würde. Ich habe meinen Job gekündigt, der mir von vornherein nie besonders viel Freude bereitet hat, habe mein ganzes gespartes Geld zusammengekratzt, ein Flugticket nach Irland gekauft und mir einen Plan gemacht, was ich alles sehen und erleben möchte, was, um es genau zu betrachten, absolut unnötig war, da meine Pläne so gut wie nie aufgehen.
Womit wir wieder am Anfang wären.
Noch eine Stunde, bis der Flieger in den Himmel steigt. Und ich mittendrin. Sollte ich nicht doch noch in einem Anflug von Vernunft oder fürchterlicher Angst einen Rückzieher machen, bei meinem Chef zu Kreuze kriechen und ihm sagen, dass es nicht ernst gemeint war, dass er ein „Speichelleckender Vollpfosten ist, der nichts anderes kann, als die Menschen um sich herum zu manipulieren und seine schlechte Laune an seinen Angestellten auszulassen“.
Ich schaue noch ein letztes Mal auf mein Telefon. Eine weitere verzweifelte Nachricht von meiner Mutter: „Hast du auch daran gedacht, genug warme Kleidung einzupacken? Es soll sehr kalt werden in den nächsten Tagen!“ Ich muss grinsen … meine Mami.
Als ich meinen Eltern von meinen Plänen erzählt habe, ist meine Mutter in Tränen ausgebrochen und seufzte etwas von: „Du kannst doch nicht einfach so ohne einen Job oder ein Dach über dem Kopf ganz alleine nach Irland fliegen“, und, „du kannst doch auch bei uns wohnen, hier hast du doch alles, was du brauchst.“ Was ich natürlich in den ersten beiden verheulten Tagen und Nächten in Erwägung gezogen habe. Dann bin ich aber zu dem Entschluss gekommen, dass ich nicht wieder in mein Kinderzimmer zurückziehen, sondern das Beste aus der Situation machen und endlich an meine Träume und Visionen denken möchte, und dass nun die allerbeste Gelegenheit dazu ist.
So hatte das ganze Drama dann doch wenigstens eine gute Seite.
Mein Vater hat mir nur anerkennend auf den Rücken geklopft und „Gut, dass du den Volltrottel los bist. Viel Spaß in Irland!“ gebrummt, was ihm ein „TIM!“ sowie einen abschätzigen Blick von meiner Mutter eingebracht hat, woraufhin er den Mund hielt und mir nur zum Abschluss noch ein letztes Mal zu zwinkerte.
Der Flieger hebt ab. Ich habe es geschafft einzusteigen, ohne mich zu übergeben oder panisch zu werden und wegzurennen. Ich bin stolz auf mich und genieße es nun, dass die Last der letzten Tage mit jedem kleinen Zentimeter, den sich der kleine Punkt auf dem Bildschirm vor mir weiter von Frankfurt entfernt, zu schwinden beginnt.
Reinhard Mey hatte recht: Über den Wolken ist die Freiheit grenzenlos!
Und ich bin gerade unterwegs in meine eigene kleine Freiheit.
Kapitel 2
Als ich aus dem Flugzeug steige und in die gewaltige Flughafenhalle am Dublin Airport trete, überrollt mich eine Welle von „Wow, ich habe es wirklich getan“, „Oh mein Gott, was zum Geier habe ich mir dabei gedacht, einfach so ohne Job, Wohnung und mit einem doch sehr begrenzten Budget (für die ersten zwei Wochen würde ich mich im schlimmsten Fall über Wasser halten können, aber dann wird’s Zeit) in ein fremdes Land durchzubrennen“ und „Tieeeeef durchatmen, du schaffst das, alles wird gut“.
Nachdem ich es geschafft habe, den Weg aus dem Labyrinth aus Terminals und Gepäckausgabe zu bahnen, geht das Abenteuer mit der Suche nach dem richtigen Bus, der mich zum richtigen Hotel oder zumindest in die ungefähre Richtung befördert, weiter.
Überglücklich, dass ich mich doch von meiner Mutter dazu habe überreden lassen, mir für die ersten Tage ein Hotelzimmer zu buchen, falle ich nach einer kurzen Busfahrt und ein paar Schritten zu Fuß, absolut geschafft ins Bett und schlafe tief und fest ein.
Das Clifton Court Hotel ist ein uriges kleines Bed and Breakfast mit krummen Wänden, verwinkelten Fluren, die auch als Drehort für einen „Harry Potter“-Film genutzt werden könnten, und winzigen Zimmern mit noch kleineren Bädern. Aber es ist sauber und alles in allem hat es sehr viel Charme und alles, was man braucht, um sich wohlzufühlen.
Nach meinem kurzen Zwei-Stunden-Powernap ist es inzwischen dunkel geworden und ich beschließe, mich auf die Suche nach etwas Essbarem zu machen.
Im hoteleigenen Pub suche ich mir die gemütlichste und am weitesten hinten gelegene Ecke mit der besten Übersicht über das kleine Lokal und die gut gelaunten Gäste, und bestelle mir erst einmal ein großes Glas Guinness. Nach einer Portion Fish and Chips, dem zweiten Guinness, einem Glas Cider und mehreren Diskussionen mit dem Barkeeper darüber, ob ich den zweiten Bowmore noch trinken sollte oder nicht, bin ich froh, dass mein Bett nur zwei Stockwerke entfernt ist.
Als ich am nächsten Morgen wach werde, bereue ich den Whiskey gänzlich und verfluche den Barkeeper. Der hatte mir, nachdem ich jämmerlich zu weinen begonnen und ihm von meinem schrecklichen Verlobten, Moment, Ex-Verlobten, erzählt hatte, doch noch Whiskey Nummer drei und vier eingeschenkt und gesagt, dass ich das jetzt wirklich nötig hätte.
Eine weitere Stunde Schlaf später mache ich mich mit einem Kater und dem Vorsatz, nie wieder einen Tropfen Alkohol anzurühren, auf den Weg in die Stadt, um mich nach Jobs und Wohnungen umzuschauen. Ich hatte mir sagen lassen, dass das die beste Art sein sollte, eines von beidem oder mit viel Glück beides zu finden. Und nun stehe ich tatsächlich gleich am Eingang zur Temple Bar, dem Kneipenviertel in Dublin, vor einem Souvenirladen, in dessen Tür ein „Help wanted“-Schild hängt.
Da mein Englisch nicht das allerbeste ist, werde ich von diesem Souvenirladen, zwei weiteren sowie einem kleinen Supermarkt und einem kleinen Pub, der den Eindruck vermittelt, er wäre eher ein Treffpunkt für die örtlichen Satanisten als eine Bar, weggeschickt. Also mache ich das Beste aus dem Rest des Tages und unternehme einen langen Spaziergang durch St. Stephen’s Green und mir wird bewusst, dass ich seit ewigen Zeiten das erste Mal wieder ganz alleine unterwegs bin. Und ich finde es großartig! Es macht mir keine Angst, im Gegenteil, ich genieße es, dass ich gerade nicht weiß, was vor mir liegt.
Später am Abend stehe ich vor meinem Bett, auf welchem ich meine Reisetasche entleert habe, und suche mir ein ausgehtaugliches sowie warmes Outfit zusammen, denn ich habe beschlossen, mich nicht den mitleidigen Blicken des Barkeepers von gestern Abend auszusetzen. Als ich aus der Hoteltür trete, habe ich mich für meine Lieblingsjeans, eine dunkelgrüne Bluse und eine Strickweste, die man bei Bedarf auch als Picknickdecke hätte benutzen können, entschieden und marschiere los in Richtung Innenstadt zur Temple Bar. Ich lasse mich vom abendlichen Getümmel der vielen verschiedenen Menschen durch das Viertel leiten, lasse mir hier und da einen Drink ausgeben und genieße die gelassene Stimmung in den Straßen und den Pubs. Ich liebe es, die unterschiedlichen Menschen zu beobachten.
Gegen Mitternacht beschließe ich, dass es Zeit ist „nach Hause“ zu gehen und mache mich auf den Weg zum Hotel. Ich nehme den Weg über die Ha’penny Bridge, eine alte Fußgängerbrücke aus dem 19. Jahrhundert, weil ich abseits des Getümmels noch ein paar Minuten in Ruhe an der frischen Luft spazieren möchte.
Ich habe Glück, denn fernab der Straßen der Temple Bar sind nicht viele Menschen unterwegs. Außer einem Pärchen, das sich im Schein des Mondlichts leidenschaftlich auf der Brücke küsst und sodann auf der anderen Seite der Liffey ins Dunkel der Straßen verschwindet, begegne ich niemandem. Ich kann in Ruhe meinen Gedanken nachhängen und mich auf meine Atmung konzentrieren. Ein erneutes Gefühl von Freiheit überkommt mich schlagartig und ich spüre, wie die frische kühle Nachtluft meine Lungen füllt. Mir wird bewusst, dass ich seit sehr langer Zeit nicht mehr so frei geatmet habe. Ein Bewusstsein, dass eine Träne über meine Wange rollen lässt. Zum einen eine Träne des Bedauerns darüber, wie unbedacht ich in den letzten Jahren mit mir selbst umgegangen bin, und zum anderen eine Träne des Stolzes darüber, dass ich mich endlich auf den Weg gemacht habe, mein Leben in die eigene Hand zu nehmen und die Verwirklichung meiner Träume anzugehen.
Auf dem Weg zurück zu meinem Hotel bin ich weiter in Gedanken versunken, da sehe ich vor einer kleinen Bar ein Mädchen stehen, es könnte in meinem Alter sein, das sich die Augen aus dem Kopf zu weinen scheint. Ich stecke den Kopf in meine Handtasche, die eigentlich nicht sonderlich groß ist, in der ich aber grundsätzlich erst einmal ewig nach etwas kramen muss, fische ein Taschentuch heraus, trete vor die hübsche zierliche Frau und halte ihr das Tuch vor die Nase.
„Alles in Ordnung?“, frage ich unsicher und hoffe, dass sie mich nicht für zu aufdringlich hält. Aber ich kann eben nicht einfach an weinenden Menschen vorbeigehen.
„Sehe ich so aus?!“, faucht die blondgelockte Frau, die mir gerade bis zur Nasenspitze reicht.
Vielleicht hätte ich einfach weiter gehen sollen … Erschrocken starre ich sie an, auch weil ich eher mit einer leisen, hohen Stimme, passend zu ihrem schmächtigen Erscheinungsbild, als mit einer lauten, kratzigen gerechnet hatte.
„Ich dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe. Entschuldigen Sie bitte, es geht mich auch wirklich nichts an.“ Ich will mich umdrehen und gehen, als sie mich am Arm greift und festhält. Mein erster Gedanke: „Oh mein Gott, jetzt haut sie mir eine runter.“
Mit zugekniffenen Augen drehe ich mich um, die Hände schützend vor meinem Körper positioniert und hoffe, es geht schnell vorbei. Denn mich zu wehren wäre aussichtslos, da ich vermutlich sogar einer Schmeißfliege unterlegen wäre. Ein paar Sekunden stehe ich so da und wundere mich, dass nichts geschieht, als ich plötzlich ein Kichern, dann ein lautes Lachen höre. Vorsichtig öffne ich erst ein Auge, dann das andere. Das kleine, bei näherer Betrachtung, feenhafte Geschöpf steht vor mir und lacht. Sie lacht, einfach so, ich glaube, sie lacht mich aus. Was soll denn nun das?!
„Ent…tschuldige bi…bitte, i…ich w…wollte dich nicht er…schrecken“, bringt sie heraus, schon aus der Puste vor lauter Gelächter.