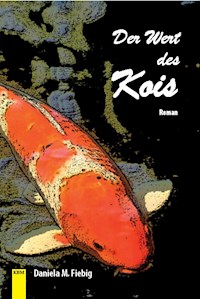
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Nach dem Suizid ihres guten Freundes Dennis wird Johanna von Selbstvorwürfen getrieben: Sie muss eine Erklärung für Dennis' erschütternde Tat finden, muss wissen, dass sie nichts hätte tun können, um die Tragödie zu verhindern. Letztlich führt sie die Suche nach Antworten in die eigene Vergangenheit, die eine verhängnisvolle Verknüpfung beider Familien verbirgt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Wert des Kois
TiteleiDas Buch / Die AutorinImpressumWidmung Teil 1, Kapitel 1Teil 1, Kapitel 2Teil 1, Kapitel 3Teil 1, Kapitel 4Teil 1, Kapitel 5Teil 1, Kapitel 6Teil 1, Kapitel 7Teil 1, Kapitel 8Teil 1, Kapitel 9Teil 1, Kapitel 10Teil 1, Kapitel 11Teil 1, Kapitel 12Teil 1, Kapitel 13Teil 1, Kapitel 14Teil 1, Kapitel 15Teil 1, Kapitel 16Teil 1, Kapitel 17Teil 2, Kapitel 1Teil 2, Kapitel 2Teil 2, Kapitel 3Teil 2, Kapitel 4Teil 2, Kapitel 5Teil 2, Kapitel 6Teil 2, Kapitel 7Teil 2, Kapitel 8Teil 2, Kapitel 9Teil 2, Kapitel 10Teil 2, Kapitel 11Teil 2, Kapitel 12Teil 2, Kapitel 13Teil 2, Kapitel 14Teil 2, Kapitel 15Teil 3, Kapitel 1Teil 3, Kapitel 2Teil 3, Kapitel 3Teil 3, Kapitel 4Teil 3, Kapitel 5Teil 3, Kapitel 6Teil 3, Kapitel 7Teil 3, Kapitel 8Teil 3, Kapitel 9Teil 3, Kapitel 10AppendixTitelei
Daniela M. Fiebig
DER WERT DES KOIS
Roman
Das Buch / Die Autorin
Irgendwann muss sich wohl ein jeder den unbequemen Wahrheiten des Lebens stellen. Das erfährt allzu schmerzlich auch die 33-jährige Johanna, die sich nach dem frühen Unfalltod ihrer Mutter emotional verschlossen hat. Als sich ihr guter Freund Dennis, Mitarbeiter einer Koi-Farm, aus rätselhaften Gründen das Leben nimmt, sind sie wieder da, die Selbstvorwürfe und die quälende Frage nach dem Warum. Johanna muss eine Erklärung für den Suizid des Freundes finden, muss wissen, dass sie nichts hätte tun können, um die Tragödie zu verhindern. Johannas Suche nach Antworten fördert nicht nur überraschende Details aus Dennis‘ Leben zutage, sondern auch Erinnerungen an ihre Jugend an der Ostsee. Letztlich ist die Fahrt zur Beisetzung des Freundes an eben jene Küste immer mehr auch eine Reise in die eigene Vergangenheit, die eine tragische Verknüpfung beider Familien verbirgt. Dass sich Johanna ausgerechnet jetzt verliebt und ausgerechnet in den Psychotherapeuten Sebastian Falkner, der eine nebulöse Verbindung zu Dennis‘ Familie unterhält, ist natürlich nicht in ihrem Sinne.
Daniela M. Fiebig lebt und arbeitet in ihrer Heimatstadt Berlin. Nach einer kaufmännischen Laufbahn absolvierte sie eine Weiterbildung zur Drehbuchautorin und wirkte in verschiedenen Formaten des kreativen Schreibens, bevor sie sich als Romanautorin positionierte.
Impressum
Originalausgabe, Mai 2020 © 2020 Daniela M. Fiebig, Berlin c/o pdk, Winfriedstraße 9, 14169 Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung oder jegliche andere Verwertung nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin.
Lektorat: Die Buchplauderer Durchsicht und Korrektur: K. Jacobs, Berlin Gestaltung und Bildmaterial: Die Konzept-Buch-Manufaktur, Berlin Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
www.danielamfiebig.de
Widmung
Zum Gedenken an Matthias.
Teil 1, Kapitel 1
Den neunzehnten Juni sollte es nicht geben. Wenigstens sollte er übersprungen werden, wie das dreizehnte Stockwerk eines Hochhauses und die Sitzreihe dreizehn in Flugzeugen. Der Tag forderte immer einen Tribut, und seine Forderung wurde stetig höher. Früher begnügte er sich, mir Kopfschmerzen oder eine Sommergrippe zu bescheren, doch vorletztes Jahr hatte ich einen Unfall mit dem Wagen und im vergangenen Jahr knickte ich auf dem Weg zur Arbeit um und zerrte mir die Bänder. Entsprechend meiner Befürchtung für den heutigen neunzehnten Juni, war meine Nacht unruhig und von Albträumen bestimmt. Kurz nach fünf Uhr früh riss mich einer davon aus dem Schlaf. Ich wusste nur noch, dass ich im Traum auf der Suche gewesen war. Keine Ahnung wonach, aber ich war fast irre geworden, weil ich »es« nicht finden konnte und wachte schweißgebadet auf. Natürlich hatte ich mich längst daran gewöhnt, dass meine Mutter nicht mehr da war; ihr Unfall lag schon lange zurück ... Aber an manchen Tagen war ich wieder so verletzlich wie der von allen verlassene Teenager, als den ich mich damals sah. Dabei konnte ich die Gedanken an Mams Tod doch die meisten Tage im Jahr erfolgreich ausblenden. Doch an den unvermeidbaren Feier- und Familientagen, die mir das Erinnern an die Vergangenheit aufzwangen, und heute, am Jahrestag ihres Todes, legte mein Verlust an Gewicht zu, dass er sich nicht mehr ignorieren ließ.
Eine Stunde lang quälte ich mich durch den Tagesspiegel, aber keine einzige Meldung blieb in meinem Kopf hängen. Trotz der großen Menge Koffein, die meinen Puls rasen ließ, war ich noch immer schlaftrunken, zumindest redete ich mir das ein. Meiner falschen Logik folgend nahm ich mir eine weitere Tasse Kaffee, er schmeckte bitter und brandig, weil der Espressokocher zu lange auf dem Herd gestanden hatte. Kalt war er inzwischen auch. Seufzend goss ich den Kaffeerest in den Ausguss. Ablenkung suchend setzte ich mich an meinen Esstisch, der mir auch als Zeichentisch diente. Aus dem Kinderbuch-Manuskript Nanu, der kleine Koi, das ich für die Autorin Elke Schlupf illustrieren wollte, wählte ich einen Abschnitt, den ich bisher vermieden hatte: Nanu entdeckt, dass sein Freund auf der Seite liegend und mit stumpfen Augen an der Wasseroberfläche treibt und von einer merkwürdig aussehenden Fächerkoralle, die in Wahrheit ein Köcher ist, aus dem Teich gefischt wird. Nanu zittert und versteckt sich im Sumpfgras. Meine Zeichnung sollte die Angst des jungen Fisches transportieren, ohne bedrohlich zu wirken. Ich gestaltete die Szene auf grobem Papier. Mit fahrigen, viel zu kräftigen Strichen, dass meine Zeichenkohle unter dem Druck bröselte – und der Entwurf war hinüber. Verärgert schlug ich meinen Skizzenblock zu, so ungestüm, dass ich eine Ecke des Deckblatts abknickte. Grübelnd strich ich mit dem Finger über den Knick, der den Werbeaufdruck verunstaltete. Zeit für Kreatives. S.N., lautete er. Es waren der Slogan und das Logo meines Arbeitgebers. Wieder stieß es mir sauer auf, wie wenig Einfluss ich bei Nörthens auf die Gestaltung der Kampagnen hatte. Die engen Vorgaben ließen meiner Kreativität jedenfalls keinen Raum. Ich fragte mich immer häufiger, ob Felix recht gehabt hatte, als er sagte, ich würde mein Talent verschwenden. Den Illustrationsauftrag für Elke Schlupfs Buch hatte er mir vermittelt, wofür ich ihm sehr dankbar war. Aber leider war dieser Auftrag auch Anlass für unbehagliche Begegnungen, denn erst Felix‘ Fachwissen in Sachen Koihaltung und –zucht ermöglichte mir die authentische Umsetzung der Geschichte – folglich trafen wir häufiger aufeinander, als es mir seit unserer Trennung lieb war. Ich schob den Zeichenblock energisch von mir weg. Mittlerweile war es Zeit, mich für meine »richtige« Arbeit bei Nörthens fertig zu machen und ich ertappte mich bei dem Wunsch, bis zum nächsten Morgen im Büro durcharbeiten zu können. Auch wenn mein Schädel schon jetzt brummte; lauter als die fette Fliege, die gegen den transparenten Stoff meines Vorhangs kämpfte. Ihre Irrwege sind wenigstens nur Falten, dachte ich. Ich bereitete der Fliege den Weg in die Freiheit, doch sie traktierte mit dickköpfiger Beharrlichkeit die Scheibe des einzig geschlossenen Fensters. Mit der Zeitung dirigierte ich sie nach draußen; über den Dächern der Stadt flirrte die Luft: es würde ein heißer Tag werden. Schon wieder. Gedanklich wühlte ich in meinem Schrank nach einer Kopfbedeckung. Ich suchte nach etwas Passenderem als dem grellroten Käppi, das im Flur auf der Anrichte lag. Vielleicht sollte ich mir einen Strohhut zulegen, überlegte ich und skizzierte einen großen, geschwungenen Hut auf eines der Schmierblätter, die meine Wohnung belagerten. Dann kritzelte ich ihn wieder aus. Seine Ähnlichkeit mit Mams Lieblingshut war zu schmerzlich. Die Zeichnung mit den Fischen riss ich trotz der Flecken aus dem Block, versah sie mit der Seitenzahl des Textes und steckte das Blatt zu den anderen Entwürfen in die abgegriffene Mappe mit der Aufschrift Johanna Leisinger.
Teil 1, Kapitel 2
Mein Arbeitstag war aufreibend und die Zeit schneller vorangeschritten als ich erwartet hatte. Seit einer Woche arbeitete ich an der Werbekampagne für das Modelabel der Versandkette Fliessmann. Schon morgen, zwei Tage vor dem eigentlichen Abgabetermin, hatte ich die fertigen Entwürfe meinem Chef Sven Nörthen präsentieren wollen ... Wäre heute früh nicht dieser Anruf des Auftraggebers gewesen. Fliessmann hatte unvermittelt die Vorgabe für das Plakat »Herbst 3« geändert und nun durfte ich mich noch einmal an die Arbeit machen. In meiner freiwillig verkürzten Mittagspause lief ich in die Arkaden zum Asia-Markt, die Thai-Nudeln aß ich aus der Pappbox und im Stehen. Beinahe hätte ich das Zitronengras liegengelassen, das ich kaufen musste, weil ich vergessen hatte, die Grundlage meines Lieblingsgetränks selbst anzupflanzen. Zeit, mich über meine Schusseligkeit zu ärgern, war nicht. Dennoch überkam mich ein stilles Bedauern, dass die bloßen Stängel aus dem Markt dem Geschmacksvergleich mit frischen Halmen nicht standhielten. Darauf trank ich im Büro gleich noch einen Kaffee, der mir langsam auf den Magen schlug – vielleicht war es aber auch nur dieser verdammte neunzehnte Juni, den ich endlich hinter mich gebracht haben wollte. Um Viertel nach zwei fiel es mir immer schwerer, mich auf die Bilder zu konzentrieren, die über den Monitor flogen. Gerade zeigten sie Hunde. Kleine, große, struppige und elegante, rassige und Mischlinge. Sie witschten im Sekundentakt vorbei. Ich rieb mir die Augen und für einen Moment war mein Blick wieder klar. Er blieb an einer Deutschen Dogge hängen, sie war hochbeinig und mit kurzem Fell, das Graublau glänzte. Ich nahm die neue Vorgabe von Fliessmann noch einmal in die Hand, die Papierausdrucke waren von keiner so guten Qualität wie die alten Hochglanzunterlagen, aber als Inspiration ausreichend. Auf dem Modeplakat »Herbst 3« sollte nicht nur ein anderes Model abgebildet werden, es hatte auch ein neues Thema bekommen, jetzt war es also Im Aufbruch. Der Hund passte nicht, er zeigte zu viel Präsenz. Ich durchforstete unser Bildarchiv weiter nach dem passenden »Accessoire«. Nicht zu groß, nicht zu klein, und bloß nicht zu auffällig, damit das Model darauf ja nicht aus dem Blickwinkel des Betrachters fiel. Nach den Tieren folgten Koffer und Taschen, Fahrräder, Kinderwagen und Einzelmöbel. Dann erschien das Foto eines plüschigen Sessels auf dem Bildschirm, schlammgrün, mit ausgefransten Armlehnen und bunten Stickern an den Seiten. Ich schaute wieder auf die Vorlage und stellte mir den Sessel mit dem langbeinigen dünnen Model darin auf einem verwaisten Provinzbahnhof vor: die Frau provozierte mit einem kühlen Blick und übereinandergeschlagenen, weit ausgestellten Beinen, die Ruhelosigkeit andeuten sollten. Ich dachte dabei spontan an Flucht, aber sicher könnte ich meinem Chef die Szenerie mit dem Slogan Mode im Aufbruch sitzt! schmackhaft machen. Ich schloss das Computerprogramm, auf die anstrengende Bildschirmarbeit konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Und außerdem rückte mein Feierabend näher, den ich heute vorgezogen hatte. Denn vor dem Pflicht-Abendessen mit meinem Vater wollte ich noch auf den Friedhof, Mams Grab besuchen. Ich wusste aus langjähriger Erfahrung, dass ich heute zu nervös zum Autofahren sein würde und war am Morgen mit den Öffentlichen zur Arbeit gekommen. Um fünfzehn Uhr wollte mich mein guter Freund Dennis bei Nörthens abholen und zum Friedhof und später dann auch zum Essen mit meinem Vater fahren. Erst hatte ich ablehnen wollen, als Felix‘ Bruder mir anbot, für mich den Chauffeur zu spielen, aber dann siegte mein Egoismus – Dennis‘ Begleitung würde mir die Zeit vertreiben und den Gang auf den Friedhof erleichtern. Auch fand ich, dass unsere freundschaftliche Beziehung schon genug unter dem Liebes-Ende von Felix und mir litt. Was kein Grund hätte sein sollen, Dennis zu meiden. Und doch hatte mich die Sehnsucht nach der alten Verknüpfung viel zu oft Nein zu ihm sagen lassen. Ich ordnete meinen Schreibtisch und wollte die Zeit dahinter absitzen, bis Dennis mir signalisieren würde, dass er vor unserem Bürohaus stand. Ich legte mein Handy empfangsbereit auf den Tisch, daneben Stift und Papier – rein symbolisch, ich hatte nicht vor, letzteres heute noch zu benutzen. Dann lehnte ich mich zurück und wartete. »Hey.« Ich schreckte hoch. Kerstin. »Hey«, gab ich zurück. Bleib unverbindlich, sagte ich mir. Kerstin setzte sich auf den Besucherstuhl vor meinem Schreibtisch und reichte mir ein Papier. »Kannst du mir die Rechnung bitte abzeichnen? Sie ist über Limit.« »Sicher.« Ich nahm das Blatt und tat so, als würde ich den Text darauf sorgfältig studieren. Ich fühlte, wie ihr Blick nach mir griff. Schließlich setzte ich mein Namenskürzel neben die Rechnungssumme und reichte das Papier zurück. »Sonst noch was?« Kerstin blickte aus dem Fenster. »Ich ... ja, ich wollte noch fragen, ob ich dir irgendwie – beistehen kann? Ich meine, weil deine Mutter doch heute ...« »Nein«, schoss es aus mir heraus. »Nein danke, alles gut.« Ich presste die Lippen zusammen, sog einen Teil der Unterlippe ein und biss mit den Zähnen an dem Wulst. »Wird wie jedes Jahr. Also fast, Dennis kommt mich auch gleich abholen, ich mache heute schon um drei Schluss.« Ich leckte über die Wunde, sie brannte und es schmeckte nach Eisen. »Oh. Ja dann.« Kerstin machte keine Anstalten, mein Büro zu verlassen und schaute mich mit großen Augen erwartungsvoll an. Ich wand mich unter ihrem freundlichen Blick, aber eine ebenso freundliche Erwiderung oder Geste, war mir nicht möglich. Schon gar nicht heute. Die Freundin musste warten. Doch, ich bezeichnete meine Kollegin Kerstin Berger noch immer als Freundin, auch wenn sich unsere Freundschaft abgekühlt hatte. Ich hatte mich dazu durchgerungen, ihr Interesse an meinem Ex Felix als unbedeutend abzutun. Aber es hatte mich verletzt und unserem früheren, herzlichen Verhältnis einen Dämpfer versetzt. Ich blickte verstohlen auf die Wanduhr, sie zeigte zehn Minuten vor drei an. Ich schloss alle Computerdateien und fuhr das Gerät herunter. Beschäftigung simulierend richtete ich die Schreibtischutensilien und meine Unterlagen neu aus, obwohl auf meinem Schreibtisch längst Ordnung herrschte. Dann stellte ich demonstrativ meine Handtasche auf den Tisch. Ich lächelte Kerstin schwach an, nah dran an einer Entschuldigung, da vibrierte mein Smartphone. Dennis war angekommen. »Ich muss dann los«, sagte ich, tippte auf meine Armbanduhr und stand hastig auf. Kerstin nickte und erhob sich ebenfalls. »Dein Monitor ist noch an.« Gedanklich war ich längst auf dem Weg nach unten, langte aber noch schnell über den Schreibtisch, um den Schalter zu betätigen. Prompt stieß ich meine Tasche vom Tisch. Meine Schultern rasten abwärts und ich spürte, wie die Kraft schwand, die meine Fassade aufrecht hielt. Missmutig blickte ich auf das Sammelsurium zu meinen Füßen. »Nein! Lass nur«, sagte ich abwehrend, aber während ich noch starrte, war Kerstin schon in der Hocke und sammelte mein Taschenwirrwarr auf: Lippenstift, Kugelschreiber, Augentropfen, ein kleines Schweinchen aus Keramik mit einem Kleeblatt in der Schnauze. Ein Geschenk von Kerstin. Sie behielt es kurz in der Hand und packte es dann zu den anderen Sachen auf den Tisch. Ich dankte ihr zerstreut, warf meine Habseligkeiten in die Tasche und drückte sie fest an mich. Dann mahnte ich mich zur Ruhe, holte geräuschvoll Luft durch die Nase und machte einen Schritt in Richtung Abend. Dabei kickte ich etwas Weiches – eine Packung Papiertaschentücher –, sie war Kerstin verborgen geblieben. Ich pflückte sie vom Boden, würde ich sie brauchen, fragte ich mich. Kerstin stand verloren im Raum, sie selbst sagte nichts, aber ihre Haltung viel. Wir mussten dringend reden, wusste ich, und irgendwann war ich sicher bereit dazu, aber nicht jetzt. Auf keinen Fall jetzt! Und dann wollte ich Dennis natürlich nicht unnötig warten lassen. Was für eine wunderbare Ausrede. »Kerstin, du, ... Ich muss jetzt wirklich los.« Geschlagen hob sie die Hände. »Schon gut.« Ich nickte verabschiedend und verließ noch vor ihr mein Büro. »Einen schönen Abend mit deinem Vater!«, rief sie mir nach. Ein Stich, mitten ins Herz. War es Absicht oder nur Gedankenlosigkeit von Kerstin, das Abendessen mit meinem Vater als nettes Familientreffen abzutun? Ich warf einen kühlen Blick über die Schulter, es war keine Zeit, den Gehalt ihrer Freundschaft zu schätzen.
Was Dennis mir auf dem Weg zum Friedhof erzählte, rauschte ungehört an mir vorbei. Sicher versuchte er mich aufzuheitern, was ihm heute nicht gelingen konnte. Er würde am Eingang auf mich warten, sagte er beschwingt, die beklemmende Umgebung schien seiner guten Laune nichts anzuhaben. Ich wunderte mich wieder, dass es so viele Menschen gab, auf die Friedhöfe keinerlei Eindruck machten; so viele, die in ihnen einen Ruhepol sahen, einen Ort zum Entspannen und In-sich-gehen. Für mich war dieser Ort einfach nur der Inbegriff von Tod. Der heutige Besuch war daher eine selbstauferlegte Pflicht, die ich dreimal im Jahr brav erfüllte: zum Geburtstag und Todestag meiner Mutter und an Weihnachten. Es waren Tage voller Grübeleien und Selbstvorwürfe, weil es mir nur allzu bewusst war, dass mein Groll gegen Vater auf der Verstocktheit einer Siebzehnjährigen beruhte. Aber schon morgen würde die Verdrängung ihre Arbeit wieder aufnehmen Trotz meiner Ablehnung musste ich anerkennen, dass der Friedhof Zehlendorf eine parkähnliche Freundlichkeit ausstrahlte. Eine gewaltige Hainbuchenhecke umrundete ihn und die größeren Wege wurden von Eichen oder Birken gesäumt. Ich betrachtete die Umgebung mit den gepflegten Einzel- und Familienruhesitzen – kleine Gärten, in denen Ehemänner, Geschwister, Väter und Mütter ruhten. Doch kaum war ich abseits der architektonisch wertvollen Grabfelder und Ehrengrabstätten, wurde die Atmosphäre unbehaglich und bedrückend und dann spürte ich wieder die toten Augen, die mich aus dem Verborgenen zu beobachten schienen, abweisend und ohne Mitgefühl. Ich ließ meinen Blick über das Feld der Ungenannten schweifen. Steinfliesen führten auf eine Anhöhe, auf der mehrere Gruppen zu je drei Stelen aus grauem Beton hoch aufragten. An den schmalen Säulen waren Metallschilder befestigt, auf jedem stand nur ein einzelnes Datum, kein Name. Die unteren Schilder waren verwittert und die Gravuren kaum noch zu erkennen; die neueren zuoberst glänzten sauber in der Sonne. Es würde nicht lange dauern und Mams Todestag wäre nicht mehr zu entziffern. Ich sollte ein neues Schild in Auftrag geben, dachte ich und wusste zugleich, dass ich auch dieses Vorhaben wieder verdrängen würde. Mein Blick wanderte die Säule hinunter und auf den kargen Boden des Hügels. Vermooste Steine, die einmal glatt und hell gewesen sein mussten, zierten die Umrandung aus kleinwüchsigem Buchs. Mit seinen grünen Fingern umklammerte er unansehnliche Grabvasen. In der einen welkten farbige Margeriten, Drahtstäbe, die sich eng um ihre Stile wanden, hielten sie aufrecht, in der anderen steckte ein kränklicher Strauß frischer hellroter Teerosen. Ich wusste, von wem dieser stammte, von meinem Vater. Dabei müsste er doch wissen, dass die alten, rissigen Steckvasen das Wasser nicht mehr hielten und die Schnittblumen aushungerten. Im Hintergrund sah ich fleißige Trauernde, sie wässerten Gräber und zupften welke Blätter, aber hier, zwischen immergrünen Hecken und pflegeleichten Sträuchern, war die Friedhofsverwaltung zuständig, und die wenigen, blühenden Pflanzen waren nahe am Verdursten. Ich notierte auf meiner imaginären To do-Liste, dass ich mich über die nachlässige Pflege beschweren sollte. Dann wurde mir bewusst, dass meine Überlegungen Vater einschlossen, dankbar, dass er für die Ruhe meiner Mutter kein Einzelgrab gewählt hatte, das sicher ich hätte pflegen müssen. Schnell stieß ich den Gedanken von mir, es gab nichts, das mich hätte verleiten können, mir die noch immer währende Verbundenheit mit meinem Vater einzugestehen. Sie war seit der Beerdigung meiner Mutter tief in meinem Inneren vergraben und ich wehrte mich heftigst dagegen, dass sie wieder ans Licht kam. Und ehe ich mich versah, hatten sich meine Gedanken verselbstständigt und zerrten Erinnerungen aus meiner Jugend hervor, die ich für gemeinsam mit meiner Mutter begraben gehalten hatte.
»Wo ist Mam?«, hatte ich gefragt und war aufgedreht durch unser Haus gerast. Nur Vater hatte mich von der Fernbusstation am Messedamm abgeholt. Seltsam wortkarg war er gewesen, aber ich hatte kein Gespür für seine Veränderung, war ich doch selbst viel zu aufgeregt und konnte es kaum erwarten, meiner Mutter vom Schüler-Austausch zu erzählen. Aber Mam war nicht im Wohnzimmer und auch nicht in der Küche, sie war gar nicht daheim. Vater schleppte mein Gepäck ins Obergeschoß und stand anschließend wie verloren im Wohnzimmer. »Johanna, setz dich doch bitte einen Moment zu mir«, bat er. Ich wollte nicht, musste ich doch dringend meiner Freundin Silke Bescheid geben, dass ich wieder im Lande war. Aber etwas in Vaters Stimme ließ mich aufhorchen. Und auch nannte er mich sonst nie bei meinem vollen Namen. Ich kam der Aufforderung nach, obwohl ein bockiger kleiner Gnom in meinem Bauch forderte, ich müsse dringend das Haus verlassen. Während mein Vater seine Fingernägel inspizierte, suchte ich den Garten mit Blicken nach Veränderungen ab. Waren die Pfingstrosen schon abgeblüht und waren die ... »Johanna«, unterbrach er meine Gedanken, »deine Mutter ... also sie ...« Er seufzte schwer, holte tief Atem und wischte sich wie ein alter Mann über die Augen. »Es tut mir ja so leid«, flüsterte er. Den Autounfall zwei Tage zuvor hatte meine Mutter nicht überlebt. Dass Vater sich dagegen entschieden hatte, mir die Nachricht über ihren Unfall sofort, also noch während meines Aufenthalts im Elsass, zukommen zu lassen, nahm ich ihm lange sehr übel – vielleicht tue ich das sogar heute noch. Ein bisschen bestimmt. »Du hättest auf die Schnelle nicht heimkommen können«, argumentierte er, »und fernab der Heimat nicht gewusst, wohin mit deiner Trauer.« Seine Umarmung war schmerzhaft, wörtlich und im übertragenen Sinne. Mein schlaffer, schmaler Körper hing darin wie in den Greifern einer Schraubzwinge. Später behauptete Vater, mir die letzten Tage der Reise nicht hatte verderben wollen. Er wusste, dass mir Mams Tod ein Leben lang auf der Seele brennen würde. Besonders, da ich kurz darauf Geburtstag hatte. Es war der siebzehnte. Und es war mein allererster Geburtstag ohne Mam an meiner Seite. Eine Feier hatte es nicht gegeben. Nie wieder. Die Beisetzung wenige Tage zuvor hatte sich in mein Gehirn geätzt und die Zukunft unmöglich gemacht. Sie war in einer Endlosschleife zwischen Gegenwart und Vergangenheit gefangen, in der vor meinen geistigen Augen nur Vater erschien. Und ich musste so immer und immer wieder mit ansehen, wie er die bewegende Rede der Trauerbegleiterin steif und mit stummer Miene über sich ergehen ließ, während ich mich tränenüberströmt nach Beistand sehnte. Warum nur hatte er keinerlei Regung gezeigt? Irgendetwas musste doch auch er gefühlt haben?! Vielleicht hätten wir zueinandergefunden statt auseinanderzudriften, hätte er seine Gefühle nicht verborgen, sondern sie mit mir geteilt. Dann hatte sich mein Schock gelegt und der Wut Platz gemacht. Sie entlud sich mit aller Härte und traf auch Mam, weil sie mich im Stich gelassen hatte. Dann bekam ich ein schlechtes Gewissen, denn es gehört sich nicht, auf seine tote Mutter wütend zu sein. Ich lenkte meine Wut auf Vater um, der meine Launen mit übertriebener Nachsicht erduldete und mich mit seinen gesprächsbereiten, freundlichen Blicken ungewollt nur noch mehr an meinen »Verstoß« erinnerte, was mein schlechtes Gewissen verstärkte: Wie konnte ich mich amüsieren, mit Freunden feiern, flirten,während Mam ... Aber es bist du, der dafür die Verantwortung trägt, du hast mich nicht von der Reise zurückgeholt! Ganz mit ihm zu brechen, hatte ich mir gewünscht, aber nicht in die Tat umsetzen können. Hass und Liebe stehen sich eben doch näher als man annimmt, und insbesondere lässt sich die Liebe einer Tochter zu ihrem Vater niemals völlig löschen – und mochte er in ihren Augen einen noch so schwerwiegenden Fehler begangen haben.
Ich zwang mich zurück in die Gegenwart, setzte die Sonnenbrille ab, hinter deren Gläsern ich mich hatte verstecken wollen, und rieb mir die trockenen Augen. Tränen flossen schon lange keine mehr. Mit dem Wasser aus der Flasche, die ich bei mir trug, aber trotz der Hitze nicht angerührt hatte, kühlte ich mir das Gesicht und schüttete den Rest über den ausgedörrten Boden. Dann setzte ich meinen Schutzwall, die Sonnenbrille, wieder auf und ging mit festem Schritt zur Feierhalle und über die kurze Fichtenallee entlang zurück zum Haupteingang des Friedhofs. Als ich Dennis dort entdeckte, konnte ich wieder lächeln. Er stand nahe dem Tore und studierte die Aushänge in den Schaukästen. Erleichterung überkam mich, sein Angebot, mich zu fahren, doch noch angenommen zu haben. Die unaufdringliche und fröhliche Zwanglosigkeit, die zwischen uns herrschte, verdrängte schlimme Grübeleien. Sogar heute war ich allein durch seine Anwesenheit etwas weniger bedrückt. Der Kies knirschte unter meinen Schuhen, aber Dennis ließ sich beim Lesen nicht stören. »Können wir?«, fragte ich. »Hier liegen eine Menge Künstler«, sagte er und deutete auf die Infotafel. »Heinrich George zum Beispiel, der war früher mal Intendant vom Schillertheater, und Schauspieler, wie sein Sohn. Der liegt jetzt übrigens auch hier, du weißt schon, der Götz.« »Ja, weiß ich«, antwortete ich, »und noch viele andere Künstler.« »Hm. Ob die mich wohl in ihrem feinen Kreis aufnehmen würden? Das könnte mir gefallen.« »Dafür muss man sich aber erst qualifizieren.« »Ach ja? Und wie?« »Du musst den Löffel abgeben.« Dennis grinste. Ich lächelte. Dann schaute er mich besorgt an. »Alles klar?« Ich nickte. »Lass uns gehen.«
Teil 1, Kapitel 3
Nach dem Friedhofsbesuch duschte ich ausgiebig. Aber trotz des belebenden Wechsels von heißem und kaltem Wasser war noch immer Nebel in meinem Hirn. Ich hätte mit heiß abschließen sollen, dachte ich, zu spät, denn nun verdampfte die Erfrischung. Dennis giggelte frech, als ich ihn anschließend, nur mit einem Bademantel bekleidet, aufforderte, mich in mein Schlafzimmer zu begleiten. »Bilde dir bloß nichts ein, ich brauch‘ dich lediglich als Entscheidungshilfe für mein Outfit«, rückte ich ihm den Kopf zurecht. Artig kommentierte er meine Auswahl: »Zu streng; zu grau; zu geschäftsmäßig; ...« Also suchte ich meinen Schrank weiter nach der passenden Kleidung für den Abend mit Vater ab, missgelaunt. »Wie ist deine Mutter denn gestorben?«, fragte Dennis gelangweilt. »Autounfall.« »Und dein Vater?« »Der nicht.« »Du hast es wohl nicht so mit Familie, oder?« »Nicht mehr.« Die ärmellose, dunkelrote Longbluse mit der schmalen Taille und dem tiefen Einblick hielt seinem Urteil stand. Viel zu weiblich, fand ich, aber letztlich war schlicht einfarbig für den heutigen Anlass immer noch besser als die nach Urlaub duftenden Blumenmuster der anderen Oberteile. »Wir haben uns nicht mehr viel zu sagen«, deutete ich das komplizierte Verhältnis zu meinem Vater an. »Hm. – Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen?« Ich überlegte lang. »Irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr«, vermutete ich laut. »Irgendwann. Zwischen? Also nicht mal an Heiligabend, dem Tag für die liebe Familie?!« »So ist es.« »Aber er ist dein Vater, er hat doch nur noch dich, vielleicht war er am Heiligen Abend ganz alleine!«, sagte Dennis gespielt theatralisch. Und wenn schon,dachte ich bockig, war ich ja schließlich auch. Dank Felix, der mich kurz vor den Feiertagen hatte sitzen lassen. Mit einer fadenscheinigen Begründung, was schon schlimm genug war, aber das Timing setzte dem die Krone auf. Die Armbanduhr, die ich ihm als Weihnachtsgeschenk gekauft hatte, lag verpackt noch immer in meinem Nachtschrank, nur das Grußkärtchen mit meinem Liebesgeständnis hatte ich mitsamt der roten Schleife abgerissen. Das Fest hatte ich mit einer Flasche Rotwein verbracht, es war die letzte des Kartons und mein Tränengemisch aus Kummer, Wut und Verzweiflung war endlich ertränkt. Zurück blieb nur der schmerzende Knoten in meinem Herzen, vielleicht ein Geschwür aus dem Unfassbaren, das sich in mir ausbreitete. Meinem Vater hatte ich bei dem weihnachtlichen Anruf, den ich mir wenige Tage zuvor abgerungen hatte, von einem Bescherungsumtrunk mit Freunden erzählt; er mir von einer Weihnachtsfeier, zu der er angeblich eingeladen war. »Das ist ein halbes Jahr her«, sagte Dennis. Ich zog kurz die Achseln hoch. »Aber wir telefonieren öfter.« Dass die Gespräche lächerlich unbedeutend waren, sagte ich Dennis nicht. Ich erzählte meinem Vater nie viel Privates, höchstens von meiner Arbeit bei Nörthens, und dann manchmal auch von meiner Unzufriedenheit wegen der kreativen Unterforderung. Damit wollte ich dem Gespräch eine persönliche Note geben, einen Anschein von gegenseitigem Interesse, ohne auf nicht kalkulierbare Fragen eingehen zu müssen. Worte ploppten in mir auf – Geborgenheit, Schutz, Fürsorge –, sie beschrieben die »gemeine Familie« und die Verbundenheit innerhalb dieser so wichtigen Gemeinschaft. Aber damit wollte ich mich nicht auseinandersetzen, ich fragte mich nur, warum bei Wikipedia diesbezüglich nichts über Verlust, Geheimnisse und Unwahrheiten geschrieben stand. Ich schüttelte meine Gedanken ab und zwang meinen Blick zurück in den Schrank, wo ich ihn blind über die Kleidung streichen ließ. Meine Haut war rot und kribbelte, vielleicht wegen meiner Grübeleien, vielleicht von der Hitze. Ich weitete den Ausschnitt meines Bademantels und fächerte mir Luft zu. Schließlich hatte ich genug von der Kleidersuche und zog ein schlichtes, orangefarbenes Sommerkleid aus dem Schrank, das ich lieblos auf das Bett warf. Orange macht eine kränkliche Hautfarbe, sollte mein Vater sich ruhig um mich sorgen. Dennis nahm das Leporello mit den Fotos vom Nachttisch. »Selbstgemacht«, sagte ich »Hm?« »Das Leporello. – Das Ding in deinen Händen.« »Oh. Klar. Schön.« Ich rollte mit den Augen. »Banause«, schimpfte ich ihn freundschaftlich. »Das sind alles Fotos von dir und deiner Mutter.« »Ja. Und?« »Nicht eines zeigt deinen Vater.« Ich widmete mich betont emsig den Schuhschachteln auf dem Schrankboden. »Irgendwer musste ja den Apparat bedienen.« Dennis stellte das Leporello zurück auf den Nachttisch. »Wenn du meinst.« »Ich will nicht darüber reden, okay?« »Verstehe.« »Nichts verstehst du«, blaffte ich ungewollt. »Unser Familienzug ist abgefahren, als ich nach Kassel in die Kunsthochschule bin. Und er hält erst wieder in meiner Station, wenn mein Vater mir das nicht mehr vorwirft.« »Verstehe ich nicht.« »Sag ich doch.« »Nein, ich meine, warum sollte er dir das denn vorwerfen?« Ich druckste. »Hab das Studium ja nicht mal abgeschlossen.« »Naja, aber das ist ...« »Wir reden nicht mehr viel, sagte ich doch«, unterbrach ich schroff. »Schon gut, aber was ist denn Schlimmes passiert?!« Meine Schultern sackten hinunter. »Meine Mutter ist gestorben, das ist schlimm genug, oder?« Dann der Streit mit Vater. Vorwürfe, gespeist von der eigenen Unzulänglichkeit, und schließlich meine »Flucht« ... Sie hatte eine Distanz geschaffen, die zur Alltagsroutine geworden war. Dennis fingerte nach meiner Hand. Ich ließ mich neben ihn auf das Bett plumpsen, ein Weilchen starrten wir wortlos an die Decke. »Ich war nicht da gewesen, als meine Mutter den Unfall mit dem Auto hatte und sie gestorben ist«, flüsterte ich. »Sie hatten sich trennen wollen, hat mein Vater mal angedeutet ...« Mir fehlten die Worte. Sie waren da, irgendwo, tief in mir vergraben, das spürte ich genau, aber ich kam nicht an sie ran. Dennis‘ Fragerei drängte mich, danach zu suchen. Nur allzu gerne wollte ich ihm eine Erklärung geben, die auch mich zufriedenstellen würde. Ich grub und grub und kratzte schon fast am Fundament ... Aber als meine ranzige Vergangenheit durch das Loch im Vakuum an die Luft drängen wollte, bekam ich Panik und steckte rasch einen Stöpsel darauf. Schnell zurück ins Koma mit dir! Ich schwang mich energisch vom Bett. »Egal«, sagte ich und legte Leichtigkeit in meine Stimme, »heute ist bestimmt nicht der passende Tag, mich damit zu beschäftigen.« Ich grinste schief. »Oder gerade?« Dennis lüpfte eine Braue. Ach, was weiß er denn schon, dachte ich. Dennis blieb mit den Augen an dem klobigen Holzbilderrahmen hängen, der neben dem Leporello stand. Mit in Falten gelegter Stirn griff er nach dem Rahmen und studierte das Foto. Es zeigte meine Mutter und mich in unserem Garten, wir deuten stolz auf die Sonnenblumen, die mich an Größe überragen. »Wo ist das?«, fragte er. »Bei uns am Haus. Also da, wo wir früher gewohnt haben.« »Die Gegend sieht so nach Ostsee aus.« »Logisch, wir haben früher ja auch in der Nähe des Bodstedter Bodden gewohnt, in Pruchten.« »Echt?! Ich bin aus Niederborn!« »Weiß ich doch.« »Ach ja: Felix.«Ja, Felix! Ich nickte. »Ich dachte, du bist eine waschechte Berlinerin?!« »Bin ich auch, aber meine Eltern waren der Meinung, ihr Kind sollte nicht in der bösen großen Stadt aufwachsen und dann sind wir halt an den Bodden gezogen.« »Und wann seid ihr da wieder weg?« »Ist schon lange her.« Ich musste tatsächlich überlegen, obwohl die Anzahl der Jahre mir gerade heute bewusst sein sollte. »Fünfzehn Jahre wohl. Meine Mutter war noch nicht lange tot.« »Deine Mutter ist wann genau gestorben ...« Die Frage schien prophylaktisch, denn er wartete meine Antwort nicht ab: »Also vor so ... vor sechzehn Jahren, ungefähr?« »Ja, sogar genau vor sechzehn Jahren, heute. Bei einem Autounfall, sagte ich doch schon.« Dennis‘ Blick war unergründlich, schweifte wild umher und flatterte dann aus dem Fenster. Ich konnte dort nichts Interessantes erkennen. »Ist da was?« Ich rückte näher, berührte ihn an der Schulter, er zuckte nur. »Dennis?« »Weiß nicht.« Er tastete nach meinem Kleid. »Nicht anfassen«, schimpfte ich spielerisch, »deine Hände riechen fischig!« Ich stupste ihn in die Seite. »In der Küche ist eine angefangene Zitrone – auf der Fensterbank.« Ich raffte meine Sachen zusammen und Dennis verließ das Zimmer, er schien mir seltsam abwesend. Gerade wollte ich mich anziehen, da schellte die Türklingel. Um diese Zeit konnte es nur Werbung sein, dachte ich, oder es war meine Nachbarin, das wäre nicht ungewöhnlich. »Dennis«, rief ich durch die Räume, »kannst bitte mal du an die Tür ...?« Ich widmete mich wieder meinen Sachen, aber schon läutete es erneut, es klang nach der Wohnungstür. »Dennis?!«, rief ich ihn noch einmal, er gab keine Antwort. Ich schmiss mein Kleid aufs Bett und ging selbst an die Tür. Der Spion verzerrte das Bild. Ich sah einen überlangen Körper und einen riesigen, gesenkten Kopf mit raspelkurzem, dunkelblonden Haar, das sich nie aus der Form bringen ließ: Felix. In mir glühte es noch ob unserer früheren tiefen Beziehung, aber Felix‘ Besuch passte jetzt nicht. Eigentlich passten mir seine Besuche überhaupt nicht mehr. Warum nur, fragte ich mich erneut, dachte er, unser Beziehungsaus berühre meine Arbeit nicht?! Eine so saubere Trennung, wie sie ihm anscheinend gelang, bekäme ich niemals hin, seine Besuche wühlten mich immer noch auf. Felix war in letzter Zeit ein paar Mal bei mir gewesen, meistens, um mir neues Bildmaterial für meine Illustrationen zu bringen, aber bisher war er nie unangemeldet bei mir aufgetaucht. Ich richtete meine Locken, schlang den Bademantel enger und öffnete ihm die Tür. »Felix, hallo. Was gibt es denn so Dringendes? Ist gerade ein bisschen ungünstig, weißt du, weil heute doch ...« »Schon klar. Deshalb bin ich ja hier – auch. Ich dachte, du könntest ein wenig Zerstreuung gebrauchen. Besonders heute.« Er drückte sich an mir vorbei in die Wohnung. »Und ich habe die neuen Aufnahmen für dich!« Er wedelte mit einem großen, braunen Umschlag. Schon war ich abgelenkt, das neue Material hatte ich bereits herbeigesehnt, denn mir fehlte noch immer eine passende Vorlage für Elke Schlupfs kleinen Koi Nanu. »Oh. Ja okay, super.« Ich folgte Felix zum Esstisch, auf dem er die Fotos ausbreitete. Eines sprach mich sofort an, ich nahm es in die Hand und strich darüber. »Der hier, der ist toll, das Schwarzweiß passt, aber ... Eigentlich ist er viel zu schön.« »Das weiß ich doch. Das Foto soll dir auch nur zeigen, wie ein prächtiger, erwachsener Shiro Utsuri aussieht. Das Sumi ist tiefschwarz und die weiße Zeichnung makellos. Siehst du hier«, er fuhr mit dem Finger über den Koi, »als würde sich das Schwarz vom Bauch her nach oben ziehen.« Er legte das Foto weg und zog eine andere Aufnahme vor. »Und so sieht ein etwa Zweijähriger aus.« Das Foto zeigte einen jungen Fisch mit einer unauffälligen, hellgrauen Zeichnung. »Wenn wir Glück haben, wird aus dem Grau ein kräftiges Schwarz.« »Der ist perfekt. Genauso unscheinbar habe ich mir den kleinen Nanu vorgestellt. Ich danke dir.« Beinahe wäre ich Felix um den Hals gefallen, schnell trat ich einen Schritt zurück. »Hallo Felix.« Sein Kopf raste herum. Dennis lehnte in der Tür und trocknete sich mit einem Küchenhandtuch die Hände. »Dennis ist so nett, mich zu fahren«, sagte ich, ohne den Zwang einer Erklärung. »Zum Essen mit meinem Vater, du weißt schon.« Felix nickte schwerfällig. »Dennis«, presste er als Gruß heraus und blickte zwischen uns hin und her, seine Augen waren schmal und dunkel. »Na dann«, sagte er hart und räumte die Fotos zusammen, schmiss sie aber gleich wieder auf den Tisch. »Kannst sie natürlich behalten, wenn du magst, oder hat dir Dennis schon genügend Bilder gebracht?« Er hatte kein Recht, wütend zu sein. Ich legte meine Hand auf Felix‘ Arm. »Lass gut sein, ja?« Felix schaute an mir vorbei. »Schon okay, tut mir leid, deine Wahl«, murmelte er. Seine unangebrachte Eifersucht verblüffte mich. »Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?« Felix drehte sich zum Gehen. »Tut mir wirklich leid.« »Sagtest du schon.« Ich verharrte niedergeschlagen und statt meiner folgte Dennis seinem Bruder zur Tür. Die beiden wechselten ein paar Worte, ich wollte nichts davon hören, der heutige Tag wühlte mich schon mehr als genug auf. »Puh«, sagte Dennis, nachdem sich die Tür hinter Felix geschlossen hatte. »Der hat ja wieder eine Laune.« Ich schüttelte den Kopf, ich wusste schon lange nicht mehr, was ich von Felix‘ Anwandlungen halten sollte. Ich legte die Fotos auf den Stapel Papier, Nanu, der kleine Koi stand in Elkes krakeliger Handschrift in Großbuchstaben auf dem Deckblatt. Die Wand hinter meiner Zeichenecke war mit Kork bezogen, Notizen, Skizzen und Fotos pinnten daran, ich steckte die beiden unterschiedlichen Shiro Utsuris dazu. Das Foto des kleinen Grauen schien beschmutzt, ich kratzte mit dem Fingernagel an dem dunklen Punkt an seiner Flosse. »Das ist ein Neuzugang«, sagte Dennis. »Felix hat ihn natürlich Nanu getauft!« Er schüttelte den Kopf. »Ich glaub ja nicht, dass die Hoffmanns mit dem Glück haben, die Stelle da«, er zeigte auf den Fleck, den ich hatte wegkratzen wollen, »die wird sich rot färben, da bin ich mir sicher. Und dann ist seine Zeichnung futsch.« Plötzlich fasste er mich am Arm und erzwang meine Aufmerksamkeit. »Ich weiß ja nicht, was da alles zwischen euch vorgefallen ist, dass ihr euch getrennt habt, Jona, aber ich hasse es, als Puffer fungieren zu müssen.« Ich machte mich frei. »Die Frage ist doch eher, was zwischen euch Brüdern nicht in Ordnung ist«, erwiderte ich grantig. Dennis schaltete unvermittelt um und blätterte scheinbar interessiert in Elkes Manuskript. »Ach«, sagte er lapidar, »der war schon immer so. Na ja, fast immer, jedenfalls seit er seine Handballkarriere hat an den Nagel hängen müssen.« »Felix hat Handball gespielt? Wusste ich gar nicht.« »Er redet nicht gerne darüber. Hatte sich das Handgelenk gebrochen und aus die Maus.« Dennis starrte auf eine der Textseiten. »Er gibt mir die Schuld«, fügte er an, leise, wie nur für sich selbst. »Was ist passiert?«, fragte ich vorsichtig. Er winkte ab. »Ach, dumme Sache, Jungen-Kram. – Solltest du dich nicht langsam fertig machen, es ist gleich sechs.« »Oh, schon?!« Keine Zeit zum Nachhaken. Ein andermal, sagte ich mir und stürzte Richtung Schlafzimmer. Nach zwei Schritten kehrte ich zu Dennis zurück und überraschte ihn mit einem Schmatzer auf die Wange. »Danke, dass du für mich da bist und mich fährst, du bist wirklich ein guter Freund.« »Da bin ich mir nicht mehr sicher«, sagte er ernst.
Teil 1, Kapitel 4
Dennis hatte mich vor der Antipasteria Garbatella abgesetzt und war gleich weiter, unschlüssig, ob er noch bei seinem Kumpel Marvin vorbeischauen würde, der ihm laut WhatsApp ein Bier oder zwei spendieren wollte. »Bock habe ich nicht«, hatte er gesagt, dabei aber verschmitzt gegrinst. Ich setzte mich auf die Terrasse linker Hand an unseren Stammtisch, der seit meiner Heimkehr nach Berlin vor knapp sieben Jahren an jedem neunzehnten Juni für Vater und mich reserviert war. Die Terrasse war fast leer, nur ein einzelner Herr mittleren Alters mit einer sapperlatzgroßen roten Krawatte saß an einem der Ecktische; ich konnte nicht wegsehen. Der Mann trank einen Espresso, in dem er eine Unmenge Zucker schaufelte, und rauchte Zigarre. Der Mief kroch mir in die Nase. Ich hielt ihn nicht aus und wechselte den Tisch. Toni kam und servierte unaufgefordert »unseren« Wein, den Cerasuolo d’Abruzzo. Meine Finger wollten nicht still halten, also ließ ich sie mit der Tischdekoration spielen, einer schmalen, altmodischen Keramikvase in der eine einzelne lachsfarbene Rose prangte. Ich hatte warten wollen, aber nun schenkte ich mir doch ein Glas des Vino Rosatoein und trank, ohne das fruchtige Aroma wahrzunehmen. Ein Tropfen Rosé rutschte wie in Zeitlupe vom Schnabel des Glaskruges und fiel auf die vergilbte Klappkarte, die ich mitgebracht und an die Vase gelehnt hatte. Der rosa Fleck breitete sich schnell und heller werdend aus, er überschritt den dicken schwarzen Rand und zeichnete Umrisse auf das Bütten, kunstvoll wie ein Aquarell. Mit der Serviette versuchte ich den Schaden zu beheben. Ein unnützer Vorgang, den ich nicht unterbinden konnte. Schon touchierten Farbschlieren den Namen meiner Mutter: Meret. Noch ein Schluck Wein. Im November, kurz vor unserem Beziehungsaus, war Felix auf die Idee gekommen, mich hierher auszuführen. Ich sagte nein. Er fragte nicht warum. Nicht schon wieder italienisch, gab ich vor, und wir waren, dem Überangebot mediterraner Küche folgend, zum Spanier gegangen. Erst spät am Abend erzählte ich meinem damaligen Freund weinselig, dass auf dem Friedhof gegenüber des Garbatella meine Mutter beerdigt ist. Vater hatte gleich nach ihrem Tod beschlossen, Pruchten den Rücken zu kehren und wieder nach Berlin zu ziehen. Mams Beerdigung auf dem Friedhof in der Onkel-Tom-Straße folgte seiner Logik und Tante Iris, Mams Schwester, Zehlendorferin, noch quicklebendig und ohne Darmkrebsdiagnose, unterstützte diese Wahl. Der Leichenschmaus hatte in der Antipasteria Garbatella stattgefunden. Ein Ort, der meine Trauer aufleben ließ. Mit dem Fingernagel rubbelte ich eine Falte aus der Tischdecke und verrückte den Bierdeckelständer. Dabei drehte ich unauffällig das Handgelenk, um die Zeiger meiner Armbanduhr lesen zu können, obwohl ich meinen Kontrollblick vor niemandem verbergen musste. Zehn Minuten nach sieben. Vater reklamierte mal wieder die akademische Viertelstunde für sich. Er habe einen weiten Weg, begründete er regelmäßig, und der Verkehr!Ach ja, aus Teltow?! Meine Finger spielten mit dem Stiel des Weinglases. Dann sah ich ihn kommen und ärgerte mich, dass mir ein Lächeln ins Gesicht geschossen war. Mein Vater war ein stämmiger Mann von siebenundsechzig Jahren, schlaffe Schultern und ausweichende Augen ließen ihn kraftlos erscheinen, doch ich wusste, dass er zäh ist. Jetzt hatte er mich an dem ungewohnten Katzentisch entdeckt, ich bemerkte die Andeutung eines Nickens und ein flüchtiges Lächeln. Er nahm sich Zeit für Worte des Grußes an den Kellner, der die Kreidetafel mit den Spezialitäten des Abends auf die vordere Terrasse trug, wohin eine hungrige Vierergruppe verschwunden war, dann steuerte er auf mich zu. Mit großer Geste legte ich mein Handy gut sichtbar auf den Tisch, hektische Blicke hinein sollten mein ach so wichtiges Leben betonen. Vater schnaufte Luft durch die Nase, als ob er in Eile gewesen wäre. Er rückte einen Stuhl umständlich ab und setzte sich ans andere Ende des Tisches. »Oh, gut, du hast nicht extra auf mich gewartet«, sagte er nach einem Blick auf mein Glas, in dem eine Pfütze Rosé schwamm. Zu meinem Erstaunen waren seine Worte ohne Sarkasmus. Toni servierte Mini-Bruschetta und ein Schälchen Oliven. »Das Übliche?«, fragte er. »Das Übliche«, bestätigte Vater, ich bejahte mit einem leichten Kopfwiegen. Unerwartet sprang Vater wieder auf und um den Tisch herum, er hauchte einen Kuss auf mein Haar. »Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe, aber ich bin im Stau hängen geblieben.« »Schon okay«, sagte ich betont fröhlich, »ein Freund hat mich hergefahren und mir noch ein wenig Gesellschaft geleistet.« »Dein Freund?! Warum ist er nicht mehr da? Ich hätte ihn kennenlernen wollen, wie du dir denken kannst. Oder hatte er keine Lust, den Todestag deiner Mutter mit uns zu feiern?« »Zu feiern? Wie das klingt!« »Du weißt, wie ich das meine. Ich vermisse deine Mutter sehr, noch immer.« Ich schwieg dazu, ich wollte weder, dass Mams Tod Mittelpunkt unserer Unterhaltung war, noch ihr Leben. Auch heute nicht. Friedhofsluft wehte herüber. »Ein Freund«, stellte ich richtig, um dem Gespräch eine andere Richtung zu geben, ungeachtet dessen, wohin sie mich führen könnte. Toni brachte die Pappardelle– Bandnudeln mit hausgemachter italienischer Fenchelwurst und Steinpilzen. Mam hatte dieses Gericht geliebt, also war es ein Teil unseres stillen Tributs an sie geworden. Wir aßen schweigend. »Was ist das nun für ein Freund«, fragte Vater überraschend, ich hatte nicht erwartet, dass er die Bemerkung wieder aufgriff. »Ist es was Ernstes oder nur wieder so eine lockere Sache? Deine Mutter und ich ...« Nicht dieses Thema! Ich drehte mich rasch zur Bedienung. »Kann ich bitte eine Pfeffermühle haben?«, fragte ich Toni, der damit sofort zur Stelle war. Mit einem aufgesetzten Lächeln wandte ich mich wieder Vater zu. »Oh, entschuldige«, sagte ich vorgeblich zerstreut. Er verstand, dennoch schien er sich heute nicht zurückhalten zu wollen. »Nun?«, bohrte er. Ich schaute an ihm vorbei und schenkte Wein nach. Mein Schweigen verstopfte nicht nur mir die Kehle, er resignierte. »Lass uns nicht streiten.« »Aber wir streiten doch gar nicht.« »Ich will doch nur das Beste für dich, Jona«, sagte er nach einer Weile leise, lustlos im Essen stochernd. Ich bekam Angst, mein Ausweichen könnte Vater auf falsche Gedanken bringen, mein Liebesleben war das Letzte, was ich mit ihm diskutieren wollte. »Wir sind nur gute Freunde, Dennis und ich«, erklärte ich, »sozusagen Gleichgesinnte.« Ich sprach den Kommentar zu meinem inneren Rückblick unbeabsichtigt laut aus. »Naja, wir sind beide in der öden Bodden-Gegend aufgewachsen. Das prägt.« Ich musste grinsen. »Ach ja?« Vaters Ton war unverbindlich. »Ja.« Der Wein machte mich redselig. »Die Maiwalds, also Felix‘ Eltern, die ...« Ich brach ab, in der Annahme, das Vater sich nicht für Fremde und unwesentliche Details zu ihnen interessierte, doch er hakte nach. »Maiwald? Dennis und Felix?!« Vater schaute hoch, verwirrt, wie mir schien, mit großen Augen und aufmerksam gespitzten Ohren. »Dennis‘ Eltern«, korrigierte ich mich dümmlich, »Felix ist ... ach, unwichtig. Das ist sein Bruder.« Ich hatte meinem Vater nichts von meiner Beziehung mit Felix erzählt, da ich ursprünglich hatte warten wollen, bis zwischen uns alles klar war und wir den nächsten Schritt wagten. Aber nun ... Mit Felix war es aus, das Thema jetzt unverfänglich. »Na jedenfalls sind die Maiwalds, also Dennis und Felix, aus Niederborn, lustig nicht?« Ich wartete. Vater schwieg. Er blickte stumm in das Schälchen mit den Oliven, Falten überzogen seine Stirn. Auf wundersame Art beschwingt klaubte ich mir die letzten drei schwarzen Oliven aus der Schale. Dann eben nicht, dachte ich und schob meinen Teller in die Tischmitte. Die Nudeln waren inzwischen kalt, wir hatten beide unser Gericht kaum angerührt. Vater sah kurz hoch, aber durch mich hindurch. Er fuhr sich mit der Serviette über den Mund, faltete sie sorgsam zusammen und legte sie unter sein Besteck auf den Teller. Alles ohne auch nur einen Mucks von sich zu geben. »Ich bin gleich wieder da«, sagte ich und erhob mich. Zeitverzögert murmelte er: »Ja, ja, geh nur.« Als ob ich seine Erlaubnis bräuchte! Auf die Toilette musste ich nicht wirklich. Ich trödelte dort Zeit ab, starrte mein Spiegelbild an, spritzte mir Wasser ins Gesicht und starrte wieder in den Spiegel. Keine Veränderung, die roten Flecken waren immer noch da. Dann ging ich wieder nach draußen an unseren Tisch, Vater sagte kein Wort. Wo war er nur mit seinen Gedanken?, fragte ich mich. Ich konnte mich kaum noch auf dem Stuhl halten und leerte schnell mein Glas. »Wollen wir?« »Was?« Jetzt war er wieder da. »Gehen.« »Ach, Jona –« »Ich muss morgen früh raus«, log ich. Versöhnlicher ging es nicht, doch Vater schien mein Unbehagen nicht zu spüren, ich hatte nicht gedacht, dass es mich verletzte. »Du übernimmst das«, fragte ich rhetorisch. Er nickte müde. Ich flüsterte einen Abschiedsgruß, deutete eine Umarmung an und verließ die Terrasse mit bleiernen Füßen. Ich kam nur bis zur Straßenecke.





























