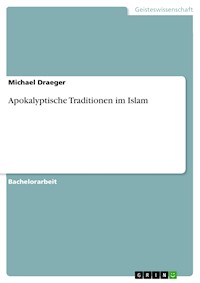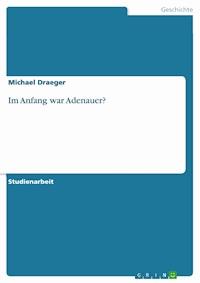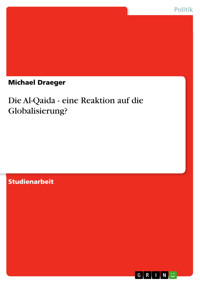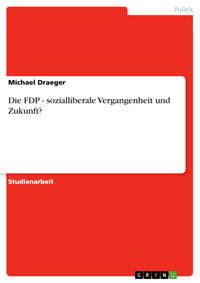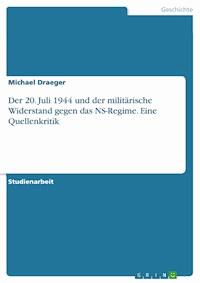13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Geschichte Europas - Mittelalter, Frühe Neuzeit, Note: 1,0, Universität Rostock (Historisches Institut), Veranstaltung: Proseminar, Sprache: Deutsch, Abstract: Der dreißigjährige Krieg gilt als eine der größten Zäsuren der deutschen Geschichte. Über seine Ursachen und die Ziele der einzelnen Parteien haben Historiker immer wieder gestritten und ihm zur Klassifizierung zahlreiche Beinamen gegeben. Die Folgen des Krieges waren nicht nur demographischer, wirtschaftlicher und sozialer, sondern auch politischer Art. Eben weil es sich auch um einen Staatsbildungskrieg und einen Kampf um ständische und absolutistische Herrschaft handelte, führte der Westfälische Frieden von 1648 auch diese Konflikte zumindest einer Teillösung zu. Im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wandelte sich die Bewertung des Westfälischen Friedens von Zustimmung in Ablehnung. Denn die Geschichtsschreibung band sich an die nationale Bewegung. Der starke Zentralstaat wurde zum Ideal erhoben und damit das nachwestfälische Reich zum negativen Gegenbild des gewünschten Einheits- und Machtstaates. Der Westfälische Friede wurde zum absoluten Tiefpunkt der deutschen Geschichte. Erst nach dem zweiten Weltkrieg und unter den Erfahrungen des zweiten Weltkrieges und der europäischen Einigung gelang eine schrittweise Umbewertung. Der wissenschaftliche Ertrag des Jubiläumsjahres 1998 betont die über die einzelnen Verhandlungsergebnisse hinaus „vorwärtsweisende ordnungspolitische Bedeutung“ (Johannes Burkhardt) des Friedens für Europa. Vor allem das Verhältnis Kaiser und Reichsstände erfuhr eine Neubewertung. Mit ihr setzt sich auch diese Arbeit auseinander. Im Zentrum steht die Frage, ob der Westfälische Frieden den Kaiser schwächte und zu seiner oft beklagte Machtlosigkeit führte, oder ob er eine sinnvolle Reaktion auf die Verhältnisse im Reich darstellte. Es wird sich zeigen, dass das, was mit dem Unglück des deutschen Volkes gemeint war, nämlich die angebliche landesherrliche Souveränität, eine Erfindung der späteren Geschichtsschreibung war. Der Westfälische Frieden legt in keinem Punkt die Souveränität der Landesherren fest, sondern versuchte im Gegenteil, sie und den Kaiser in ein System gegenseitiger Abhängigkeit zu stellen, wie es seit langer Zeit schon Brauch war. Nicht der Westfälische Frieden mit seinem Dualismus, sondern die kaiserlichen Absolutismus-Bestrebungen während des Krieges waren der Bruch mit der Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede – Das Verhältnis Kaiser - Reichsstände im Wandel?
2.1 Der Dreißigjährige Krieg
2.2 Der Westfälische Friede
2.3 Der Westfälische Frieden und das Kaiserreich – die Festlegung der Doppelstaatlichkeit
3. Ergebnis und Ausblick
4. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Der dreißigjährige Krieg gilt als eine der größten Zäsuren der deutschen Geschichte. Über seine Ursachen und die Ziele der einzelnen Parteien haben Historiker immer wieder gestritten, und dem Krieg zur Klassifizierung Beinamen wie „Konflikt zweier Machtblöcke“, „Staatsbildungskrieg“, „Kampf um ständische und absolutistische Herrschaft“ und „Konfessionskrieg“[1] gegeben. Diese Klassifizierung verweist dabei „auf Probleme, die in Deutschland wie beinahe überall in Europa zur offenen Austragung drängten.“[2] Jedoch schließen sich diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten nicht aus, sondern geben lediglich die Hauptintention des Historikers wider. Erst ihre Summe vermag zu erklären, warum der „Krieg der Kriege“[3], bestehend aus „mindestens 13 Kriege[n] und 10 Friedensschlüsse[n]“[4] millionenfachen Tot, Verwüstung und Leiden über Europa, hauptsächlich jedoch Deutschland, brachte. Warum Zeitgenossen bereits nach 18 Jahren dichteten: „Wir sind doch nunmehr gantz / ja mehr denn gantz verheeret!“[5]
Die Folgen des Krieges waren aber nicht nur demographischer, wirtschaftlicher und sozialer, sondern auch politischer Art. Eben weil es sich auch um einen Staatsbildungskrieg und einen Kampf um ständische und absolutistische Herrschaft handelte, führte der Westfälische Frieden von 1648 auch diese Konflikte zumindest einer Teillösung zu. So wurde der Westfälische Frieden von den Zeitgenossen noch bejubelt, da er einen über eine Generation dauernden Krieg beendete. Er galt „als Grundlage des europäischen Staatensystems und Meisterwerk der internationalen Diplomatie“.[6] Doch im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wandelte sich das Bild in sein Gegenteil.[7] Denn die Geschichtsschreibung band sich an die nationale Bewegung. Der starke Zentralstaat wurde zum Ideal erhoben und damit das nachwestfälische Reich zum „negativen Gegenbild“ des gewünschten Einheits- und Machtstaates.[8] Der Westfälische Friede wurde zum absoluten Tiefpunkt der deutschen Geschichte, der den endgültigen Verlust von Elsaß an Frankreich brachte. Erst nach dem zweiten Weltkrieg und unter den Erfahrungen des zweiten Weltkrieges und der europäischen Einigung gelang eine schrittweise Umbewertung. Der wissenschaftliche Ertrag des Jubiläumsjahres 1998 betont die über die einzelnen Verhandlungsergebnisse hinaus „vorwärtsweisende ordnungspolitische Bedeutung“ des Friedens für Europa.[9] Vor allem das Verhältnis Kaiser und Reichsstände erfuhr eine Neubewertung. Mit ihr setzt sich auch diese Arbeit auseinander.
Zunächst wird ein allgemeiner Überblick über die Entstehung und den Verlauf des Krieges gegeben. Auch hierbei wird das Augenmerk immer wieder auf das Verhältnis zwischen Kaiser und den Reichsständen gelegt.
Im Anschluss wird knapp der Inhalte des Westfälischen Friedens erläutert. Nachfolgend soll genauer auf die Bedeutung des Westfälischen Friedens für das Kaiserreich und die Machtverteilung im Reich eingegangen werden. War der Westfälische Frieden wirklich der Anfang vom Ende der kaiserlichen Macht? Konnte nichts als Kleinstaaterei nach dem Friedensschluss entstehen? Hierfür sind besonders die mächtepolitischen und verfassungstechnischen Regelungen des Vertrages von Bedeutung. Die Ausführungen zu religiösen Aspekten sind zwar nicht minder interessant, könnten aber auf Grund des gegebenen Rahmens nur unzureichend behandelt werden. Daher muss hier auf andere Darstellungen zum Thema verwiesen werden.[10]
Im Zentrum dieser Arbeit soll die Frage stehen, ob der Westfälische Frieden den Kaiser schwächte und zu seiner oft beklagte Machtlosigkeit führte, oder ob er eine sinnvolle Reaktion auf die Verhältnisse im Reich darstellte.
2. Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede – Das Verhältnis Kaiser - Reichsstände im Wandel?
2.1 Der Dreißigjährige Krieg