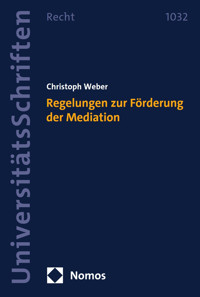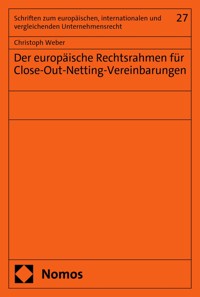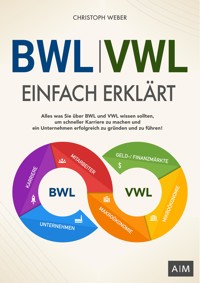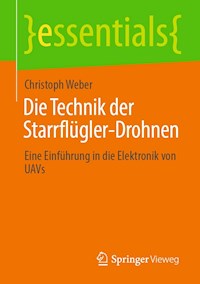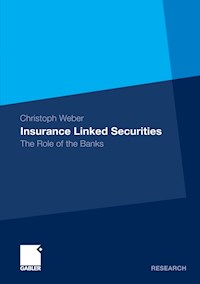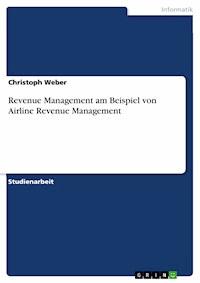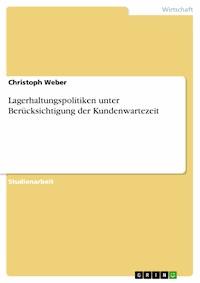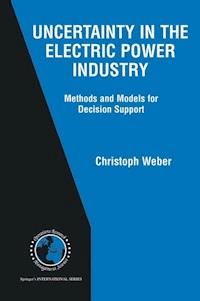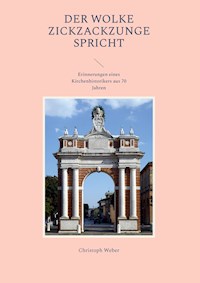
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Erinnerungen eines Kirchenhistorikers aus 70 Jahren, verknüpft mit Texten verschiedener Art. Als Professor für Neuere Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf etablierte Christoph Weber seinen Ruf als eine Autorität zu den Themen Kirchenstaat und Kurie durch zahlreiche Veröffentlichungen. Monografien, Editionen und Werke aus seiner Feder sind beredte Zeugen einer Liebe zu Büchern und Literatur, die in vorliegendem Werk anhand autobiografischer Episoden noch deutlicher zutage tritt. Parallel zu den geschilderten Leseerfahrungen nimmt uns Christoph Weber zu einer Zeitreise von der Stunde 0 der BRD bis heute mit, nie ohne Tiefsinn, stets mit stilistischer Sicherheit, die uns deutlich macht, dass Literatur alles und jeden durchdringt und selbst oder gerade die Menschen betrifft, die kein literarisches Leben im Sinne Borges' führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein Großvater Johannes Weber leitete von 1929 bis 1936 die Borromäus-Bücherei der Pfarrei St. Joseph in Koblenz, also bis zu ihrer Auflösung durch das NS-Regime.
INHALT
VORWORT
DICHTER 1
1. Thomas Bernhard und das österreichische Deutsch
2. Virginia Woolfs drei beste Bücher
3. Hans Magnus Enzensbergers unverkäuflicher Kiesel
4. Eine Erbteilung unter Geschwistern: die „Klassiker”-Ausgaben nach dem Tode meines Vaters
DIE ZEIT VOR 1943
5. Meine Herkunft aus Böhmen und anderen Ländern der k.u.k. Monarchie
6. Pfarrer, Ordensprofessoren und ein Prälat: die Basis des „sozialen Aufstiegs“
7. Der Bau der neuen Universität Graz
8. Lungentuberkulose und „Herz-Jesu”-Verehrung: das frühe Ende der Yvonne v. Zambaur
9. Zwei Geheimagenten im Kampf um Österreich-Ungarns Existenz (18961918)
10. Ein Selbstmord in der Reisnerstraße
11. Wallfahrten und fromme Bücher: Meine Großmutter Maria Diehl
12. Ein Trostbüchlein angesichts zweier im 1. Weltkrieg gefallener Brüder
13. Mein Vater in der Weimarer Republik
14. Zwischen Reichsvizekanzlern und Gauleitern: Die Heilig-Rock-Wallfahrt 1933
15. Literaturgeschichte in Rom studieren! Meine Mutter an der
Sapienza
1937/1938
16. Ein Brief meines Großvaters über den „Anschluss” Österreichs
17. Damals waren Doktorarbeiten noch kürzer: Meine Mutter als Promovendin und Journalistin
DICHTER 2
18. Ein Lehrbuch der Literaturkritik (Jörg Drews)
19. Hans Christian Andersens himmelblaue Fledermäuse
20. Der Alchimist und die Sibylle, oder: was von Rilke bleibt
21. Roddy Martindales ödes Geschwätz (John le Carré)
DIE JAHRE VON 1943 BIS 1963
22. Der Tod meiner Mutter. Dann einige ihrer hinterlassenen Bücher.
23. Eine klassische Geschichte der deutschen Literatur (Scherer/Walzel)
24. Erste Buchprojekte und ihr Scheitern
25. Weitere zwecklose Projekte: die Kaisergenealogien und ein Verfassungsentwurf für Deutschland
26. Wilhelm Hausenstein, Konrad Adenauer und dessen Handlanger
27. Das Zentrum war eine konfessionelle Partei. Hausenstein zur französischen Eroberungspolitik
28. Welche Chance hat Österreich-Ungarn in einem Krieg mit Rußland? (Ludwig Janski 1871)
29. Prägende Einflüsse: Christopher Dawson, Theodor Häcker, G.K Chesterton, Bruce Marshall und Reinhold Schneider
30. Kunstbetrachtungen mit meiner Großmutter
31.
Die Residenzstadt Coblenz und ihre Umgebung
32. Ein Karnevalsprinz, in Kamellen aufgewogen
33.
Die Epochen der deutschen Geschichte
(Johannes Haller)
34.
Die Geschichte des byzantinischen Staates.
Abitur 1963. Ein Wohltäter
DICHTER 3
35.
Der Wolke Zickzackzunge spricht: ich bringe Dir, mein Hammel, Licht
36. Marie Louise Kaschnitz am Strand von Torre San Lorenzo
37. Borges über Swedenborg
38. Ein
wirklich
moderner Dichter: Jürgen Becker in Köln
DIE JAHRE VON 1963-1975
39. Einige Historiker der Bonner Universität, die ich 1963/64 hörte
40. Der
Bund Neudeutschland
und die katholische Studentengemeinde in Bonn
41. Nicht ins Germanicum, nicht promovieren: Trierer Enttäuschungen
42. Gibt es die
Materia Prima
? – Bernhard Lorscheids Zweifel
43.
Die neuplatonische Seinsphilosophie
, neu gesehen von Klaus Kremer
44. Etwas Bodenständiges:
Siedlung und Pfarrorganisation im alten Erzbistum Trier
(Ferdinand Pauly)
45. Franz Petri und der
Magister Artium
(1968)
46. Das
Auxiliarcorps
Österreichs gegen Rußland im Winter 1812
47. Horst Lademacher, mein wohlwollender Gönner am Institut für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande
48. Franz Böckles gründliche Zerstörung der Moral, mein alter Pfarrer Joh. Luxem und eine Dominikanerpredigt
49. Von Karl Theodor Schäfer, von der Tradition und der Bibel, von ertrunkenen Schweinen und der Kreuzestheologie zweier Oberst-Bischöfe
50. Der Wert der römischen Messe
51. Meine Doktorarbeit, mein erster wertvoller Quellenfund. Eine falsche Berufswahl? Promotion meiner Schwester
52. Im
Campo Santo Teutonico
und in der Via della Lungara (1970-1972). Richard Mathes und Pater Ambrosius Eszer O.P.
53. Zwei weitere freundliche Gönner: Gerd Tellenbach und Philipp Anton Brück in Rom
54. Der Germanico-Camposantiner Lic. Klaus Jockenhövel, der Jansenismus und die lamentierenden Verdammungen des römischen Hofes
55. Privatdozent, Oberassistent, Nichtordinarius
56. Parkinsons Gesetz und
die ältesten päpstlichen Staatshandbücher
(16291715)
DICHTER 4
57. Ernst Jandl und die Sackgasse der „konkreten Poesie“
58. ein lilienweißer brief aus lincolnshire (H.C. Artmann)
59.
Tagung der internationalen Konferenz für technologische Psychiatrie
(W. Burroughs)
60. Eine italienische Ghost-Story (Fruttero/Lucentini)
61. Das letzte Geschenk von Alexander Baldus, eine Literaturgeschichte Griechenlands
DIE JAHRE VON 1975-2010
62. Außerplanmäßiger Professor
63.
Der Schauplatz der Wahrheit und Gerechtigkeit
des Kardinals G.B. de Luca (1614-83)
64.
Das römische Urteil über Georg Hermes
(H.H. Schwedt)
65. Santa Maria Assunta di Carignano, oberhalb von Genua
66. Auf den Index! Die Kardinalsbiographien des Arciprete Gio. Palazzi von 1703
67.
Wie der Papst unfehlbar wurde
(A.B. Hasler)
68.
Die Territorien des Kirchenstaates.
Und was Gustav Meyrink zu derartigen Forschungen zu sagen hatte
69.
Die Weltanschauung des Thomas von Aquin
(Johannes Hessen)
70. Die Legaten und Gouverneure des Kirchenstaates im
Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
71. Genealogien von Kalifen- und Sultansdynastien sowie von Papst- und Kardinalsfamilien.
72. Von den Strafgerichten der Generalvikare und von den bischöflichen Gefängnissen
73. Gottfried Benn. Zwei Rückblenden aus den Fotokartons.
74. Vierhundertsiebenundvierzig
Opuscula
aus dem Umfeld des römischen Vikariates
75. Robert Blum, Fürst Alfred Windischgrätz und die Rückeroberung Wiens im Oktober 1848
76.
Ein lebhaftes Gewehrfeuer von der Barricade empfing die Sturmkolonne
77. Römische Nachmittagtees und frugale Abendessen
78. Heinrich Brüning zwischen Hitler und Pius XII.
79. Bibliophile Leckerbissen: zehn Buchwidmungen von der Hand der Autoren
80. Schattierungen der göttlichen Gnade
81. Krambambuli, Bauschan, Flush und Lilly (meine Jack-Russel-Hündin)
82. Philipp Eulenburg, Sybille Bismarck und ein musikalisches Hündchen
DICHTER 5
83.
Monolog eines ins Zeitgeschehen verwickelten Hundes
, ein spätes Glanzstück W. Szymborskas
84. Ernst Jandl,
es gab den stab schon früher
85. Robert Gernhardt,
St. Horten in Ahaus
86. Michel Houellebecq in der Krypta Europas
87. Johannes Groß: die Tiefenschicht des preisgekrönten Krawattenträgers
88. Schopenhauers Lehre von Adam, dem Teufel und dem Kern des Christentums
89. Charles Bukowskis Bild vom Menschen
90. Exercitium intertextuale: T.S. Eliot,
Das Wüste Land. –
Colin Dexter,
Eine Messe für all die Toten
VORWORT
Zwanzig Zwerge üben Handstand zehn im Wandschrank zehn am Sandstrand
Die folgenden Blätter sind ein Zufallsprodukt, denn sie entstanden vom September 2020 bis zum August 2021, also in der Zeit der Corona-Pandemie, als mehrere Umstände meine sonstige Arbeit zum Erliegen brachten und ich mich praktisch auf meine vier Wände reduziert sah.
Die 90 Texte beruhen zum größten Teil auf Erinnerungen, die sich dem 77jährigen Autor beim Blättern in seiner Bibliothek einstellten. Ratlos vor meinen Regalen stehend, zog ich das eine oder andere Buch heraus und überlegte, ob eine erneute Lektüre mir wohl Abwechslung bringen könnte. Hinzutraten in wenigen Ausnahmefällen einige Briefe und Zeitungsausschnitte aus meinen Sammelkartons.
Meine Tagebücher und Korrespondenzen blieben ganz unberücksichtigt, zu befremdlich erschien mir alles, was ich da im Alter von 16 Jahren aufzuschreiben begonnen hatte. Noch ferner lag mir der Anspruch einer Autobiographie; hatte ich doch ein Leben geführt, das ich zum größten Teil am Schreibtisch, in den Bibliothekssälen und vor den Handschriften der Archive verbracht hatte.
Stattdessen, so schien es mir, boten viele merkwürdige Bücher, die ich besaß oder noch besitze, Einblicke in die letzten Jahrzehnte, teilweise selbst die beiden letzten Jahrhunderte und sogar darüber hinaus, die sonst in dieser Kombination nicht jedem unmittelbar möglich sind.
Der Aufbau unserer Texte ist so gestaltet, daß von dem Titel eines bestimmten Werkes ausgehend mein Verhältnis zu ihm dargestellt wird. Danach greife ich gerne weiter aus und erzähle von Vorgängen und Personen, von Aufenthalten in Italien und Österreich, stets bemüht, meine persönliche Sicht der Dinge alleine vorzutragen.
Im ersten Drittel erzähle ich von meinen Eltern und Großeltern und verschweige nicht die schwierigen Situationen, die für Menschen der Generationen nach 1870 fast zwangsläufig auftraten.
Wer sich für meine Familiengeschichte nicht interessiert, kann die Texte 5 bis 17 vorerst weglassen (am Ende wird er sie doch lesen wollen). Lebende Personen behandele ich nur wenige, und zwar solche, bei denen ich vermuten kann, daß es ihnen nicht unangenehm ist, mit mir in Verbindung gebracht zu werden. Böse Menschen erscheinen nur am Rande oder gar nicht. Ich hätte vielleicht die eine oder andere Charakterskizze geboten, aber das heutige restriktive Persönlichkeitsrecht steht als mächtiger Block der Zensur jedem Autor, also auch mir, im Wege. Selbst eine realistische Kritik an Verstorbenen ist kaum mehr möglich. Ich habe einmal (1984) eine kleine Studie über„Kirchengeschichte, Zensur und Selbstzensur” veröffentlicht; damals war ich noch in der Illusion befangen, in der Bundesrepublik gebe es keine Zensur mehr.
Tatsächlich ist sie heute (2021) de facto wieder tätig: zwar ohne offizielle Zensurapparate bei den Polizeibehörden, wohl aber über alle Ebenen verteilt in Rechtsprechung, Ministerien, Redaktionen, Verlagen. Ein falsches Wort über Ethnien, Religionen („Islamophobie!”), Minderheiten und du bist erledigt!
Bei all den Einschränkungen verzichte ich aber nicht auf den Blick eines Historikers, der sich um Unparteilichkeit bemüht. Jahrzehntelang wurde von einer ganzen Generation meiner Fachgenossen die Unmöglichkeit der „Objektivität” als neue Offenbarung verkündet: dabei ging und geht es doch immer nur um Unparteilichkeit, eine dem Menschen sehr wohl erreichbare Haltung. Aber in diesen Texten fälle ich ja nie absolute historische Urteile, sondern berichte über meine Erinnerungen anhand von Büchern.
Mit Anerkennung wird der Leser feststellen, daß er mit keinerlei namedropping konfrontiert wird. Zu meiner Erziehung gehörte es, sich keinesfalls an Höhergestellte heranzudrängen, sich ihrer flüchtigen Bekanntschaft zu rühmen, anhabig, wie es im Österreichischen heißt, zu werden. Tatsächlich lebte ich in Düsseldorf seit 1972 quasi im Verborgenen. Auf wissenschaftlichen Kongressen zeigte ich mich nur selten, besonders im Jahrzehnt nach 1980, was vielleicht ein Fehler war. Gerne erinnere ich mich an zwei Kongresse in Trient und an zwei Tagungen der École française de Rome, bei denen meine Arbeiten zustimmend erwähnt wurden. Hinzukamen noch einzelne Einladungen nach Löwen, Lublin und natürlich zu deutschen Kongressen unterschiedlicher Wichtigkeit. Ein magerer Ertrag internationaler Anerkennung.
Allerdings habe ich auch viele Vortragseinladungen abgelehnt, ins Ausland ebenso wie in Deutschland. Allein im Jahre 1989 verzichtete ich auf Vorträge in vier Kongressen. Für jeden Vortrag berechnete ich einen Monat Arbeit, und für meine Langfristprojekte war das ein zu großer Verlust.
In Düsseldorf merkte ich auch allmählich, daß ich nicht zur gehobenen, sondern zur unteren Mittelschicht gehörte und keinerlei Zutritt zur „Gesellschaft” hatte. Eine meiner Cousinen, bei einem Abendessen neben dem Rektor der Universität, Prof. Kaiser, platziert, vermied es, ihm gegenüber meinen Namen zu erwähnen, wie sie es mir gegenüber durchblicken ließ. Sie zweifelte an meiner Professorenqualität, da ich im Telefonbuch ohne diese Bezeichnung aufgeführt sei. Sie war mit einem reichen Likörfabrikmanager verheiratet, aber ansonsten strohdumm.
Pater Ambrosius Eszer O.P., zeitweise Direktor des römischen Instituts der Görresgesellschaft, sagte mir einmal, als wir uns in die Linie 64 quetschten in Richtung Vatikan: „Wir bleiben bescheiden!”, und er meinte damit, daß Wissenschaftler gut daran tun, sich wirklich nicht nach vorne, geschweige denn nach oben zu drängeln (ich glaube mich zu erinnern, daß er das im Vergleich der Dominikaner mit den propagandagewaltigen Jesuiten meinte).
Bescheiden bleiben! – Leichter gesagt als getan, denn Gelehrte streben notwendigerweise nach Beachtung, ja nach Ehre und Ruhm, und sei es auch nur im engsten Fachkreise. Niemand war mir deshalb unangenehmer, als Kollegen, die absichtlich meine Bücher auch da nicht zitierten, wo es unbedingt nötig gewesen wäre.
Aus der Korrespondenz Paul Feyerabends mit Hans Albert läßt sich an vielen Stellen konstatieren, daß nichts unsere Leute mehr verletzt als ein solches Vorgehen. Ich habe es oft zu spüren bekommen, besonders von seitens der Gefolgschaft der Großhistoriker Repgen und Morsey, die systematisch und absolut meine Bücher und Aufsätze zur Geschichte der Zentrumspartei ignorierte; sie tat das ja auch mit „linken” und „rechten” Autoren, die ihr nicht passten. Daß diese Kohorte sich dadurch aus der Wissenschaft selbst entfernte, beachtete sie nicht. Ideologische Gegner nicht zu zitieren, galt ihr als legitimes Kampfmittel.
Noch eine weitere Entscheidung wird der Leser mit Erleichterung zur Kenntnis nehmen: hier werden keine Intima ausgebreitet, niemand wird entblößt, ich selbst nicht und auch sonst niemand. Zu abschreckend sind Autobiographien, in denen sich die Schamlosigkeit älterer Männer austobt; kümmerlicher Ersatz für eine tatsächlich verlöschende Libido; man werfe einen Blick in die Memoiren Klaus Kinskis und anderer!
Drittens sollte der Leser sich vor Augen halten, daß jede autobiographische Bemühung eine Last mit sich trägt, die da heißt Selbststilisierung. Nicht der Erdenrest, zu tragen peinlich (oft genug mehr als ein Rest und auch nicht nur einer) macht Autobiographien schwierig, manchmal unglaubwürdig, sondern der unwiderstehliche Drang des Sicherinnernden, seinem Lebenslauf einen Entelechie zu geben, auf deutsch: eine Zielsetzung, eine endgültige Versöhnung, Reife, Vollendung.
Ich habe dieser Versuchung zur Lebenslüge so gut ich konnte, widerstanden; ob mit Erfolg, bleibt dahingestellt. Man prüfe große Autobiographien unter dieser Fragestellung.
Die Reihenfolge der Abschnitte ist im großen und ganzen chronologisch. Es gibt vier Hauptkapitel, die jeweils mehrere Jahrzehnte überspannen, und fünf kleinere Kapitel, in denen ich meine Lieblingsdichter behandle; absolut subjektiv und ohne im geringsten etablierte literaturwissenschaftliche Übereinkünfte zu beachten.
Der Großteil meiner Texte befasst sich, wie der Titel sagt, mit der Lektüre bedeutender Dichter, entlegener, aber überzeugender Historiker und Theologen unterschiedlicher Tendenzen, mit Etappen meines Lebens, mit wohlwollenden Menschen, mit Landschaften Italiens, mit meinen erlebten Städten und Lieblingsarchitekturen, mit nie endenden philosophischen, theologischen und historischen Fragen.
Im Gegensatz zu den Literaten ist es einem Wissenschaftler nicht peinlich, Einflüße, ja Abhängigkeiten zuzugeben, ja sich ihrer sogar zu rühmen.
Der Dichter sieht sich als Unikat, der Wissenschaftler ist stolz auf die goldenen Kette seiner Vorgänger. Daher fällt es mir auch nicht schwer, fünf Bücher und ihre Autoren zu nennen, von denen ich dankbar-abhängig bin:
Arthur Schopenhauer. Sein Hauptwerk und seine Parerga erbte ich von meinem Großvater Zambaur; besonders seine Empfehlungen zur Lebensweisheit waren für meine Großmutter und meinen Vater fast täglicher Lesestoff. Ich selbst fand in Schopenhauers „handschriftlichem Nachlaß”, herausgegeben von A. Hübscher eine unerschöpfliche Quelle der Belehrung und Belustigung; den vollen Titel gebe ich später.
Zweitens liegt stets vor mir die Textsammlung von Nicolás Gómez Dávila, Einsamkeiten. Glossen und Texte in einem, Karolinger Verlag 1987. Was ich sonst immer vermeide, tat ich hier ungehemmt: brillante Stellen anstreichen. Meine Äußerungen zur Religion, zu Riten und theologischen Desaster hätte ich ohne Don Nicolás nicht niederschreiben können. Selbstverständlich besitze ich noch mehrere andere seiner Werke.
Drittens verdanke ich Jörg Drews (1938-2009) Entscheidendes: sein dunkel glänzendes Büchlein Dichter beschimpfen Dichter (2006) hat mir den Mut gegeben, über längst kanonisierte Bücher kritische Urteile zu fällen (Text 18). Man lernt überhaupt viel aus dieser locker edierten Zitatensammlung. Der tierische Haß, der Friedrich Schiller von so vielen Zeitgenossen entgegengebracht wurde, war mir unbekannt gewesen; nur als Beispiel.
Viertens umschwebten mich viele Jahre lang die Notizen, Zitate, Aphorismen von Johannes Groß (1932-1999), dem ich Text 87 widme und der gelegentlich eine kristalline Helligkeit erreicht, die man umgangssprachlich Brillanz nennt: tatsächlich aber ist es eine Illumination, die einem, wie gesagt wird, die Schuppen von den Augen fallen läßt. Dabei verliert er nie seinen liebenswürdigen Ton, was ihn dann im Endeffekt über Autoren, die eine grimmige Zeitkritik üben, hinaus erhebt.
Fünftens erwähne ich dankbar das Buch von Michael Maar, Heute bedeckt und kühl. Große Tagebücher von Samuel Pepys bis Virginia Woolf, München 2013. Die Gattung, die uns Maar erleuchtet, ist zwar eine andere als die meiner 90 Texte, sie ist aber doch so nahe verwandt, daß ich glaube, auch aus diesem schimmernden Werk einiges Licht empfangen zu haben.
Vielleicht noch mehr hat meine Schreibart beeinflußt M. Maars Essay-Band Die Glühbirne der Etrusker, Köln 2003, den ich seitdem immer wieder zur Hand genommen habe. Glänzender kann man die die delikate Aufgabe des Rezensierens nicht erfüllen!
Was die Druckerlaubnis der jüngeren Gedichte angeht, so hat der Suhrkamp-Verlag mir diese ausdrücklich erteilt. Die Kontaktaufnahme mit anderen Verlagen scheiterte leider im Vorfeld. Da von diesem Buch kaum mehr als ca. 100 Exemplare verkauft werden, entfällt aber diese Problematik eo ipso. Sollte jemand mir gegenüber Ansprüche erheben, möge er sich an meine Privatadresse wenden: 40227 Düsseldorf, Eisenstr. 60.
Besonderer Dank gebührt Herrn Stephan Hain in Düsseldorf-Itter, der die mühsame Arbeit der Texterfassung geleistet hat. Frau Gabriele Becker übernahm die Aufgabe, das Layout, insbesondere die Einfügung der Abbildungen, mit gewohnter Meisterschaft zu besorgen.
Düsseldorf, im Dezember 2021 C.W.
Dichter 1
1 THOMAS BERNHARD UND DAS ÖSTERREICHISCHE DEUTSCH
THOMAS BERNHARD, HOLZFÄLLEN. EINE ERREGUNG, SUHRKAMP VERLAG 1984, HIER TB 1992
Weltberühmtes Buch, und zwar wegen des literarischen Skandals, den dieser Schlüsselroman in Wien erregte: vor allem wegen der grausamen „Abschlachtung” des früheren Freundes und Gönners von Bernhard, des Komponisten Lampersberg, der sich – zu Recht – schwerstens diffamiert fühlte. Auch die anderen Personen, die Bernhard als niederträchtige Charaktere darstellte, waren in Wien leicht und sicher identifizierbar.
Unangenehm wirkt auch, daß Bernhard so macht, als ob er um Verzeihung bitten wolle und eine große letzte Versöhnung erstrebe, wozu die ersten neun Zehntel seines Buches im krassen Gegensatz stehen.
Nicht dieser merkwürdige Zusammenhang zwischen Diffamierung, Selbstanklage und Versöhnungswunsch hat mich fasziniert, sondern nur die sprachliche Meisterschaft im Beobachten des menschlichen Versagens. Man lese vor allem die Schilderung der Beerdigung einer alten Künstlerfreundin in einem nieder-österreichischen Marktflecken, bei der sich praktisch alle Beteiligten derartig „danebenbenehmen”, daß die Diskrepanz von hohem Anspruch und trauriger Realität schreiend ans Licht tritt (Pardon für die Katachrese).
Die Wiener Trauergesellschaft nimmt an dem Totengottesdienst für eine Selbstmörderin teil, ohne noch taktfest in den Zeremonien einer Hl. Messe zu sein; im Regenguss erweist sich die Bekleidung der Wiener als völlig ungeeignet; aber auch der ländliche Lebensgefährte der Toten erregt durch seine Tischmanieren den Ekel des Autor-Beobachters: beim Mittagessen spricht er das Wort Kartoffelsalat in einer Weise aus, die Bernhard starken Abscheu einflößt. Warum, wird nicht gesagt, vielleicht hat der Lebensgefährte mit vollem Mund gesprochen. Oder aber er hat, wie nicht selten im Ostbajuwarischen, besonders dem Steiermärkischen, die Vokale a, e und o zu einem allerdings übelklingenden Brei (pardon) vermischt.
So wie Virginia Woolf, von der wir bald reden werden, besitzt Bernhard eine Beobachtungsgabe – in diesem Falle von sich selbst –, die eine Bagatelle zu einem mächtigen Gefühl hinauftreibt –, und die ich weder bei Musil noch bei Doderer, noch bei Bachmann oder Handke vorfand.
Demgegenüber nehme ich die ganze verfehlte Konstruktion, nämlich seine Bitte um Verzeihung und seine Selbstanklagen im letzten Abschnitt des Werkes, gar nicht ernst. Wenn er wirklich Abbitte für seine eigenen Niederträchtigkeiten hätte leisten wollen, hätte er das ja mühelos privatim und ohne an die Öffentlichkeit zu gehen, machen können. Auch seine Leugnung, das Buch sei ein Schlüsselroman – was er unzweifelhaft beweisbar ist – ehrt ihn nicht.
Aber der unwiderstehliche Sog, der von dem Weltgericht auf dem Ohrensessel ausging (wie ein Rezensent es nannte), zieht den Leser immer aufs neue in diesen Roman hinein.
Was ich aber zu Bernhard sonst noch sagen muß, ist Folgendes: die Sprache, die ich von meiner Großmutter erlernte, in prima infanzia, der dezidierte Ton, die Artikulation, der Wortschatz etc., fand ich in „Holzfällen” wieder. Auch das Insistierende, Scharfe in der Aburteilung des Nebenmenschen – das Wort bevorzugte man vor dem Mitmenschen – all das kannte ich von Kindesbeinen auf.
Auch die konkrete Direktheit, mit der Th. Bernhard beschreibt, kannte ich schon: er insistiert die ganze Länge des Buches hindurch auf einer kritischen Beschreibung der Tischmanieren der diversen Personen seines Zoos. Die eine Schriftstellerin spreizt beim Halten des Kaffeetäßchens den kleinen Finger ab, der andere Schauspieler steckt sich die Serviette in den Kragen und nimmt sich eine zweite Portion Plattenseefogosch (≡Zander). Und der Hausherr betrinkt sich so sinnlos, daß er die meiste Zeit schläft. Das Auslöffeln einer Kartoffelsuppe wird auch auf dem künstlerischen Abendessen aller Beteiligten zum ästhetischen, letztlich moralischen Problem. Dieser kritische Punkt entschied von vornherein darüber, ob jemand dazugehörte oder nicht.
Allerdings hat meine Großmutter die Regeln ungefähr wie folgt moderiert: wenn es ein Backhendl gab – selten! – durfte man die Knochen mit der Hand anfassen, um sie abkiefeln zu können. Zweitens: Äpfel mußten nicht geschält werden. Man schnitt sie in vier Teile, schnitt den Kern heraus und aß dann frohgemut die Viertel. Drittens: Oberstes Gebot war die Geräuschlosigkeit beim gesamten Essen; schlürfen war abscheulich, schmatzen unter Todesstrafe verboten. Viertens: Das richtige Halten der Bestecke. Als kleine Kinder hatten meine Schwester und ich ein silbernes Kinderbesteck, mit einem kleinen Schieber. Wo ist es geblieben?
Ich habe gezögert, das folgende Zitat aus dem Holzfällen hier noch vorzulegen. Aber es ist nötig, wenn ich meine Attraktion durch Th. Bernhard verständlich zu machen hoffen will. Es geht um seine Beobachtungsgabe:
Ich selbst habe ja vor Jahren, dachte ich auf dem Ohrensessel, den seit dreißig Jahren nur noch betrunkenen Auersberger dabei beobachtet, wie er mit einer mir nicht bekannten etwa vierzigjährigen, tatsächlich verkommenen, ja ganz offensichtlich verwahrlosten Frau mit langen Haaren und abgetretenen Lederstiefeln durch die Rotenturmstraße gegangen ist, habe den Auersberger hinter ihm her gehend beobachtet, alles an ihm und an seiner Begleiterin mehr oder weniger durch und durch beobachtet und habe die ganze Zeit gedacht, ob ich ihn ansprechen solle oder nicht und habe ihn schließlich nicht angesprochen, mein Instinkt hat mir gesagt, du darfst ihn nicht ansprechen, sprichst du ihn an, macht er eine widerliche Bemerkung und zerstört dich auf Tage und ich habe ihn auch nicht angesprochen, habe mich beherrscht, ihn beobachtend bis auf den Schwedenplatz hinunter, wo er mit dieser Frau in einem alten abbruchreifen Haus verschwunden ist. Die Scheußlichkeit seiner Beine habe ich die ganze Zeit beobachtet, die in grobgestrickten grauen Trachtenstutzen steckten, seinen von nichts als von Perversität rhythmisierten Gang, seinen haarlosen Hinterkopf. Er paßte sehr gut zu seiner total verkommenen Begleiterin, einer Künstlerin wahrscheinlich, ausgemergelten Sängerin, arbeitslosen Kellerschauspielerin, wie ich damals dachte, dachte ich im Ohrensessel. Ich erinnerte mich im Ohrensessel, daß ich mich von Ekel geschüttelt umdrehte Richtung Stephansplatz, als die beiden in dem Abbruchhaus auf dem Schwedenplatz verschwunden waren, tatsächlich hatte ich meine Abscheu gegenüber den beiden so weit getrieben, daß ich mich, um zu übergeben [sic], an die Wand vor dem Aidakaffeehaus gedreht hatte; aber da schaute ich in einen der Aidakaffeehausspiegel und sah direkt in mein eigenes verkommenes Gesicht und sah meinen eigenen verkommenen Körper und es ekelte mich vor mir selbst viel mehr, als mich vor dem Auersberger und seiner Begleiterin geekelt hatte. (S.24-26).
Ich las Holzfällen seit 1992 in fast jedem Jahr einmal, wahrscheinlich aber schon vorher, da ich diese Buch gern verschenkt habe.
Allerdings erlebte ich dabei, daß es bei Reichsdeutschen auf geringe Begeisterung stieß: tatsächlich sogar auf Unverständnis. Leser, die letzten Endes vom norddeutschen Idealismus geprägt sind – und dazu gehört keineswegs eine Lektüre der dorthin gehörigen älteren Autoren –, gleichgültig ob Thomas Mann oder Gottfried Benn oder Günter Grass auf ihrem Hausaltar stehen, haben den Kontakt zur oberdeutschen Sprache verloren. Und dies auch, wenn in keiner Weise der ostbajuwarische Dialekt mehr ins Spiel kommt.
Für den Anfänger in der Thomas-Bernhard-Lektüre empfehle ich seinen leicht lesbaren Band Der Stimmenimitator von 1978. Hingegen sei gewarnt vor den bandwurmartigen Großromanen, besonders vor Auslöschung. Ein Zerfall von 1986, in denen sich Manierismus mit politischen Opportunismus paaren. Dazu noch einige Worte in Text 18.
2 VIRGINIA WOOLFS DREI BESTE BÜCHER
1. ZWISCHEN DEN AKTEN, ORIGINALAUSGABE 1941, HIER FISCHER TB 1978
2. EIN VERWUNSCHENES HAUS. ERZÄHLUNGEN, FISCHER TB 1990
3. FLUSH, EINE BIOGRAPHIE, FISCHER VERLAG 1993
Die Autorin hinterließ das fertige Manuskript von Zwischen den Akten auf ihrem Schreibtisch, bevor sie ins Wasser ging, und ich kann nur vermuten, daß sie das tat, weil ihr plötzlich Zweifel an diesem Buch gekommen waren. Dabei ist es neben Flush ihr bestes Buch. Ich habe mich mit viel Mühe durch ihre Wellen gekämpft, manch anderes nach kurzem Blättern beiseite gelegt – aber Zwischen den Akten und Flush sind unsterbliche Meisterwerke, trostvoll und von tiefer Humanität erfüllt.
Der literarische Wert von Zwischen den Akten liegt in der geradezu unheimlichen Beobachtungsgabe, über die Virginia Woolf verfügt: eine Detailsichtigkeit, die den Leser überwältigt, eine atmosphärische Verdichtung, die ihn wie ein Lichtstrahl überfällt. Nur ein Beispiel: Vater und Sohn teilen sich die Bögen einer Tageszeitung mit einem einzigem geschickten Griff mit den Fingernägeln, so daß der Alte den politischen, der Junge den Wirtschaftsteil erhält. Nur eine Nebensache? Aber bei Virginia Woolf trifft man dauernd auf solche Lichtstrahlen; es ist ihre Stärke. Unübertroffen ist dementsprechend auch ihre Gabe, menschliche Gefühle in ihren feinsten Nuancierungen auszudrücken.
Virginia Woolfs Tagebücher habe ich lange studiert (alle Bände in der Übersetzung) und fand eine von sozialen Vorurteilen lebenslang gebeutelte Frau. Ihre Abneigung gegen Oxford-Absolventen und gegen die Nobility ist grotesk. Einmal war sie bei einer Countess Howard eingeladen. Da war sie entrüstet darüber, daß diese Dame – aus irgendeiner Nebenlinie der vornehmsten Familie Englands stammend – sie mit größter Freundlichkeit und Hochachtung empfangen hatte. Sie hielt das für eine besonders hinterhältige Art, ihr zu begegnen: Keinen Anlaß gab die Gräfin, sie des Hochmuts zu bezichtigen (der nach Virginia Woolf ja doch auf jeden Fall vorhanden gewesen sein mußte)! Die Angehörigen der Unterschicht sieht Virginia nur als Diener(innen) und Handwerker, deren Leistungen unzureichend, langsam oder störend waren.
Zum Virginia-Woolf-Fan wurde ich spätestens 1978, als ein Fischer-Taschenbuch mit ihren Erzählungen erschien. Darin fand ich den nur anderthalb Seiten langen Text Monday or Tuesday (auf deutsch, mein Englisch reichte stets nur für Fachliteratur, nicht für Dichtungen). Man erlebt hier die Genialität der Autorin, die in bloß circa 60 Zeilen eine ganze Welt in einem einzigen Augenblick hinein zu zaubern versteht: eine Impression, die das alte Wort vom Mundus in gutta realisiert. Wer das gelesen hat, erlebt eine Vereinigung mit demKosmos. Die Mystikerin Virginia überwindet hier alle ihre Begrenzungen und Belastungen.
Flush habe ich mindestens viermal gelesen; es ist der schönste Hunderoman überhaupt; noch über Ebner-Eschenbachs Krambambuli stehend, ein Werk ebenfalls von hoher Qualität, und auch Thomas Manns Herr und Hund vorzuziehen, der auch nicht schlecht ist. Und ein Mensch, dem ein Hund fehlt, ist arm dran. Wir kommen noch darauf zurück.
In den fünf Bänden des Nachlasses von Arthur Schopenhauer findet man etliche Bemerkungen zu den Qualitäten der Hunde. Daß der Philosoph ein totaler Hundeliebhaber war, ist erzbekannt. Daß er Experimente machte, um die Erkenntniskraft des Hundes zu erforschen, schon weniger. Eines Tages hob er seinen Pudel und hielt ihn aus dem Fenster: festzustellen war, daß der Hund vor Angst zitterte; ergo besaß er ein Raumverständnis, denn er erkannte die Gefahr der Tiefe.
Ein anderes Mal bedauerte Schopenhauer, daß er dem geliebten Tier keine andere Freude machen könne, als ihm Leckerbissen zu reichen, also dessen Willen zum Leben zu befriedigen. Wir erkennen hier eine der Wurzeln zur Philosophie des großen Vollenders der Weltanschauung Kants.
3 HANS MAGNUS ENZENSBERGERS UNVERKÄUFLICHER KIESEL
H.M.E., REBUS. GEDICHTE, SUHRKAMP VERLAG 2009, P. 120
Dieser Gedichtband stellt einen späten Höhepunkt des Dichters dar; ebenso wie die frühere Sammlung Die Geschichte der Wolken von 2003.
Enzensberger schätze ich vor allem deshalb so hoch ein, weil er sich konsequent vom sogenannten Hermetismus der Avantgarde fernhält. Seine unbedingte Verständlichkeit hat er vielleicht aus seinen jüngeren Jahren beibehalten, als er noch ein linker Agitator war, der unbedingt „das Volk” erreichen wollte. Sein „Abfall” von linken Utopien hat ihm viel Kritik seitens alter Gesinnungsgenossen eingebracht. Aber heute besitzt er den Ruhm, der bedeutendste deutsche Lyriker seit Benn zu sein; oder will jemand ernsthaft behaupten, Rühmkorf käme ihm gleich?
Um den Geist Enzensbergers zu verstehen, genügt es, folgendes ältere Gedicht auf sich einwirken zu lassen:
KONSISTENZ
Der Gedanke hinter den Gedanken
Ein Kiesel, gewöhnlich,
unvermischt, hart,
nicht zu verkaufen.
Löst sich nicht auf,
steht nicht
zu Diskussion
ist was er ist
nimmt nicht zu oder ab.
Unregelmäßig,
nicht bunt, geädert
nicht neu, nicht alt.
Braucht keine Begründung,
verlangt keinen Glauben.
Du weißt nicht, woher
du ihn hast, wohin
er geht, wozu er
dient. Ohne ihn
wärst du wenig.
(Hans Magnus Enzensberger, Gedichte 1950-1995), Frankfurt/M. 1996, p.127
HANS MAGNUS ENZENSBERGER, GEISTERSTIMMEN ÜBERSETZUNGEN UND IMITATIONEN, SUHRKAMP VERLAG 1999
Enzensberger, hat nach seinen eigenen Gedichten ein zweites bedeutendes OEuvre vorgelegt: seine Übersetzungen moderner außerdeutscher Dichter. Neben seinem zweibändigen „Museum” (das mich nicht so sehr ansprach) bietet der hier genannte Band Grandioses!
Mir wären alle diese Gedichte unzugänglich geblieben. Nie hätte ich Apollinaire, Gustavson, Neruda (den mit dem Stalinhymnus, daher von mir beiseite getan), Parra, Sarajlić, Simic (mir nur aus einem späten nicht sehr brillanten Bändchen bekannt, hier aber überzeugend!), oder Vallejo kennengelernt. Daß so manches schon vorher von Enzensberger veröffentlicht worden war, z.B. aus den Gedichten von W. C. Williams, hat man in Kauf zu nehmen.
AN EINEN RATSUCHENDEN
Aromatherapie, Eheberatung, Diät
oder immerzu Lotto spielen,
an der Pforte des Trappistenklosters läuten,
um ein neues Leben anzufangen,
das alles ist auch keine Lösung.
Dein Zweitstudium hast du hinter dir,
und in Tibet warst du auch schon einmal.
Einmal ist keinmal, glaubst du.
Nur zu, alter Esel! Uns aber
bleibe gefälligst vom Leib
mit deinem Gewinsel.
Auf so einen wie dich
können wir nämlich verzichten.
Hans Magnus Enzensberger, Leichter als Luft. Moralische Gedichte, Suhrkamp Verlag,Frankfurt 1999, S. 79, und: Rebus. Gedichte, Suhrkamp, Frankfurt 2009, S. 47.
Dass Gedichte am Ende eine überraschende Wendung aufweisen müssen, ist naheliegend, denn die strenge Form zielt unweigerlich auf eine Auflösung, auf eine Lösung.
Dieses Erfordernis erfüllt Enzensberger hier in dramatischer, fast explosiver Weise. Der altväterliche Titel, der vorgibt, einen naiven Leser in die Irre führen zu wollen – eine doppelte Inszenierung ist impliziert – lässt eine behäbige Verkostung schöner Lebensweisheiten mit einem desillusionierenden Ende erwarten (z.B.„Ehrlich währt's am längsten, bis Du reich bist“), oder aber eine Parodie auf schöne klassische Verse von Ludwig Höltys „Üb immer Treu und Redlichkeit“ bis zu Gottfried Kellers und Theodor Fontanes schönen, tröstenden Altersgedichten, ich meine Gedichten, in denen Alte über ihr Alter getröstet werden.
Aber schon bald, d.h. in der ersten Zeile spürt man, dass da etwas nicht stimmt. Schon die ersten drei Worte alarmieren jeden denkenden Menschen darüber, dass wir im Milieu des endlosen Psychogelabers gelandet sind: ein lieber Kollege würde mir noch die Begriffe „neue spirituelle Bewegungen“ und „alternative Religiösität“ entgegenhalten, während ich schon die Ohren zuklappe.
Lottospielen, Trappistenkloster, Zweitstudium und Tibet machen die Zahl sieben voll an aussichtslosen Sackgassen der „Identitätsfindung“ eines wenigstens nicht unvermögenden noch jüngeren Mannes, der einen Weg noch nie versucht hat: den Weg der ernsten Berufsausübung, die auch in den höheren Besitzklassen nicht ohne Anstrengung möglich ist. Hier hapert es offensichtlich: der junge Mann gehört zu den beklagenswerten Richtungslosen, denen es schlicht und einfach materiell zu gut geht und die – so Schopenhauer – eben deshalb von einer qualvollen Langeweile befallen werden. Dieser Philosoph hat den Zustand des Nichts-mit-sich-anfangen-könnens ernst genommen, Gottfried Benn hat es noch brutaler ausgedrückt.
Enzensberger, der als führender Intellektueller sicher sehr oft mit solchen Gestalten konfrontiert war, wagt es, einen Schnitt zu machen: Keine weitere Beratung mehr, kein Händchenhalten, kein Mitleid, keine weitere Esoterik (es stehen ja noch die Bach-Blüten und die Edelsteintherapie aus), nicht einmal die an sich wertvolle Gesprächstherapie bietet er dem Ratsuchenden noch an. Wer kennt ihn nicht, den befreienden Schluss der Debatte. Er ist für alle beide am besten.
Enzensberger übertrifft alle seine zeitgenössischen Dichterkollegen an messerscharfer Zeichnung linksliberaler Psycho-Milieus. Er erinnert mich da an die geniale französische Karikaturistin Claire Brétécher, bei der auch die alkoholisierten emanzipatorischen Beziehungs- und Sinnfleddereien kein Ende nahmen.
Man versteht aber jetzt auch, dass Enzensberger bei der linken Schickeria nach und nach unbeliebt wurde, vielleicht sogar verhasst. Im Jahre 2010 erschienen zwei Tagebuchbände von Martin Walser und Fritz J. Raddatz, in denen Enzensberger kritisiert wird: der eine bezeichnet ihn als Kunsthandwerker, der andere als „Nurejew der Lyrik“. Ebenso vernichtende wie ungerechte Urteile. Keiner der beiden kann ihm im entferntesten das Wasser reichen, beide aber gehören in selten deutlicher Form zu den Jammer-Künstlern, die Tag und Nacht ihre ach so traurige Lage als große Unverstandene und nicht Gewürdigte beklagen. Im Vergleich dazu schmecken Gedichte von H.M.E. wie ein Glas frisches Mineralwasser.
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, daß in dem ominösen Jahr 1968 Enzensberger im Kursbuch 15 den Tod der bürgerlichen, illusionsstiftenden Erzählliteratur forderte (vgl. Reclams Romanlexikon 5, 2000, p. 238). Aber hat jemals, auch nur ein einziges Mal, ein romanlesender Bürger die Illusion gehabt, die Geschichte die er las, sei wahr? Hier liegt doch ein kolossales Mißverständnis vor! Der bürgerliche Leser wollte doch nicht eine reale Information über wirkliche Menschen. Wie konnte man ihm das unterstellen? Er wollte für ein paar Stunden entführt werden, wohl wissend, daß er bald danach zu seinen Geschäften zurückkehren würde. Wo soll da eine Illusion sein? Der Bürger wurde sehr wohl Opfer von Illusionen, z.B. bei dem Börsenaufschwung nach 1871, der zwei Jahre später in dem Ruin vieler Existenzen endete; aber doch nicht im Roman; auch nicht auf dem Theater, wo ein Bösewicht von der Erde verschlungen wurde, oder in der Musik, wo ihn süße Töne oder machtvoller Trompetenschall für zwei Stunden bewegten.
Noch zwei weitere, schwere Illusionen des „Bürgers”: er glaubte, die Kolonialpolitik des Deutschen Reiches werde äußerst lukrativ sein; sie war alle Jahre von 1884 bis 1918 ausweglos defizitär; sodann: Wir Deutsche fürchten Gott und sonst nichts auf der Welt; die verheerendste Illusion von allen.
Dem Irrtum der literarischen 68-er liegt ein falscher, polemischer Illusionsbegriff zugrunde. Eine echte Illusion ist gefährlich, zerstörerisch, sträflich. Diesen Begriff auf die Werke von Dichtern, Schauspielern, bildenden Künstlern aller Richtungen, ja selbst Priestern und „Illusionisten”anzuwenden, eine ungerechte Polemik.
Um es noch deutlicher auszudrücken: Wilhelm II. und Nikolaus II. hatten furchtbare Illusionen über die Stärke ihrer Monarchien. Wenn hingegen ein Fontane, Th. Mann oder Gerhard Hauptmann breit angelegte Romane schrieben, so erregten sie niemals irgendwelche Illusionen, ja oft genug hörte man doch bei ihnen ein Knistern im Gebälk.
4 EINE ERBTEILUNG UNTER GESCHWISTERN: DIE „KLASSIKER”-AUSGABEN NACH DEM TODE MEINES VATERS
GOETHES WERKE ..., HERAUSGEGEBEN VON THEODOR FRIEDRICH, BÄNDE 1- 4, LEIPZIG, (RECLAM), OHNE JAHRESANGABE
Nachdem von der Bibliothek meiner Grazer Großeltern nur noch wenige Reste übriggeblieben waren, bot sich meiner Schwester und mir die kleine, aber ausgesuchte Büchersammlung meines Vaters in Koblenz an, im Haus der rheinischen Großeltern, die dort in zwei oder drei Glasschränken verwahrt über alle Bombenangriffe gerettet blieb. Da gab es vor allem Klassikerausgaben, von Stifter über J. Paul, Mörike, Hebbel und Cäsar Flaischlen („Hab Sonne im Herzen, obs stürmt oder schneit”!) bis hin zu einigen Bänden von Thomas Mann. Aus Österreich war noch eine ca. 12-bändige Grillparzer-Ausgabe gerettet worden: diese ebenso wie eine ca. 10-bändige Schiller-Ausgabe überließ ich bei der Erbteilung meiner Schwester. Viele kleinere Dichterausgaben sind meinem Gedächtnis entfallen. Noch geistert durch meine Regale aus der Serie "Meyers Volksbücher in eleganten Liebhaber-Leinenbänden" (offenbar eine spezielle Konkurrenz zu den billigen Reclam-Bändchen) ein Büchlein "Gedichte von Ernst Moritz Arndt", Leipzig und Wien o.J., aber vor 1914. Da ich meiner Schwester die beiden umfangreichsten „Klassiker” überlassen hatte, erhielt ich die oben genannte vierbändige Goethe-Ausgabe, d.h. die ersten vier Bände einer 10-bändigen Goethe-Edition von Theodor Friedrich. Auf dem Vorsatzblatt war eine gedruckte Widmung eingeklebt mit folgendem Wortlaut:
Aber so wende nach innen, so wende nach außen die Kräfte Jeder: Da wär' es ein Fest, Deutscher mit Deutschen zu sein.
ZUR ERINNERUNG AN GOETHES 100. TODESTAG
FÜRTheodor Weber
Der preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
Berlin, den 22. März 1932 [handschriftlich:] Grimme
Es ist eine schöne, in blaues Leinen gebundene Ausgabe; aber warum nur 4 von 10 Bänden? Preußen war damals von der Wirtschaftskrise betroffen usw. usf., so stelle ich es mir es jedenfalls vor: über das Geld, sich die fehlenden sechs Bände zu kaufen, verfügte der Unterprimaner Th. Weber offensichtlich nicht. Er las zwar, tief beeindruckt, Gundolfs berühmtes Goethe-Buch, aber dieses ging irgendwie und irgendwann verloren.
Außerdem wählte ich bei unserer kleinen Erbteilung die dreibändige Shakespeare-Ausgabe des Reclam-Verlags von 1882:
WILLIAM SHAKESPERES [!] SÄMMTLICHE DRAMATISCHEN WERKE IN DREI BÄNDEN. ÜBERSETZT VON SCHLEGEL, BENDA UND VOẞ.
Trotz des schönen Einbandes ist es eine Billig-Edition, denn das Papier ist aus purem Holz, der Druck ist eng und die Herstellungsqualität bescheiden. Behalten habe ich sie nur, weil sie den Stempel meines Urgroßvaters trägt: Carl Kratochwil, Ingenieur-Graz (damals gab es noch nicht Unterschied von Dipl-Ing. und Ing.FH).
Ob er je in der Ausgabe gelesen hat, weiß ich nicht. Vielleicht kaufte er sie, um Shakespeare-Aufführungen in Graz mit Verständnis besuchen zu können. Vielleicht war es nur eine Edition für die Vitrine, denn Carl Kratochwil war beruflich im höchsten Grade angespannt, als Architekt und Bauunternehmer. Wie sollte er sich da durch die Königsdramen fressen, die oft genug zäh wie Leder den Leser ermüden. Begeistert war ich als Kind nur von Macbeth und Julius Cäsar. Andere Versuche gab ich bald auf: King Lear stieß mich sogar direkt ab: so dumm wie dieser König konnte doch niemand sein! So sah ich es jedenfalls, ahnungslos von der Not alter Menschen, die sich die Liebe ihrer Kinder glauben erkaufen zu müssen und zu können. Jetzt ist es zu spät, noch einmal eine echte, vollständige Shakespeare-Lektüre anzufangen.
MATHIAS MAYER, ADALBERT STIFTER. ERZÄHLEN ALS ERKENNEN, STUTTGART 2001.
Zwei Beispiele für Dichter, um die ich mich lesend redlich mühte, um sie zu verwerfen: Jean Paul und Adalbert Stifter. Alle 15-20 Jahre gibt es Anläufe, sie „wiederzuentdecken”, großspurige Interpreten mühen sich ab, ihre „Aktualität” freizulegen, usw. usf. Aber es ist vergeblich! Dabei, lese ich, soll Jean Paul seiner Zeit große Resonanz gefunden haben! Umständlich, all diese Bellarmino, diese Wult und Walt, ein Wust von krampfhafter Suche nach Originalität.
In der Ehrenrettung Adalbert Stifters spielt ein lobendes Diktum Nietzsches eine große Rolle. Obwohl es schwer vorstellbar ist, daß Stifter meinen Urgroßonkel Carl Zambaur, den Erzdechanten von Krumau und Liebhaber der südböhmischen Kulturdenkmäler nicht gekannt habe, ärgere ich mich über den Anspruch an Lebenszeit, den Stifter seinen Lesern zumutet. Ich kann nur Autoren lieben, die kurz und bündig zur Sache kommen. In der Kürze liegt die Würze!!
Hinzu kommt der Maler Nolten von Mörike. Gemeinsam ist diesen drei Autoren, daß ich ihre „Klassikerausgaben” meiner Schwester überließ. Dabei findet sich im Maler Nolten , wenn ich mich recht erinnere, das geheimnisvolle Gedicht Orplid. Dies ist zwar unverständlich, aber von bezwingender Kraft.
Wieso aber werden J. Paul und A. Stifter oder der Prosaschriftsteller Mörike als unsterblich verehrt? Reden wir lieber über weitere Pleiten: da ist Heinrich von Kleist. Ich besitze aus dem schmalen Nachlaß von meiner Mutter (mit ihrem Besitzvermerk in grüner Tinte von 1938): enthaltend den zerbrochenen Krug und (als erstes) Das Käthchen von Heilbronn oder die Feuerprobe. Ein großes historisches Ritter-Schauspiel in fünf Aufzügen (Zuerst aufgeführt auf dem Theater an der Wien 1810).
HEINRICH VON KLEISTS GESAMMELTE SCHRIFTEN. HERAUSGEGEBEN VON LUDWIG TIECK. ZWEYTER BAND, WIEN (FRANZ LUDWIG) 1827,
Ich mache nicht viele Worte um meine Enttäuschung über dieses Spektakel mit seinen nichtigen Intrigen, unglaubwürdigen Peripetien und lächerlichen Figuren (Kunigunde „Giftmischerin”). Was mag meine arme Mutter sich gedacht haben, als sie 21-jährig dieses Buch antiquarisch erwarb und las?
Viele helle Kritiker haben schon darauf aufmerksam gemacht, daß die großen Nationalepen langweilig zu lesen sind. Einige davon bietet uns Jürgen Drews (hier Text 18). Zu den unlesbaren gehören Homer, Dante, Cervantes, Tasso, Miltons Paradise lost, das Nibelungenlied, Klopstocks Messias; die Russen kenne ich zu wenig, um zu urteilen. Als ich einmal Krieg und Frieden zu lesen versuchte, stießen mich die französischen Dialoge ab.
Hören wir dazu Johannes Groß (Notizbuch, 1985, p. 182):
Allmählich und gegen mich murrend, finde ich mich damit ab, daß Bemühungen um manche Meisterwerke der Literatur vergeblich bleiben. Ich kann sie nicht aufmerksam zu Ende lesen. Die Göttliche Komödie, der Cervantes, das meiste von Dostojewski und Dickens. Von Finnegans Wake prägen sich ganze Passagen dem Gedächtnis wörtlich ein, aber das Buch mag ich nicht lesen, die Dechiffrierung lohnt nicht. Noch nicht aufgegeben habe ich die „Suche nach der verloren Zeit”. Dafür immer wieder glückliche Funde, Leopardi in der schönen zweisprachigen Ausgabe von Artemis; die Cahiers von Valéry.
GERHARD HAUPTMANN, DAS DRAMATISCHE WERK. SECHS TEILE IN DREI BÄNDEN. - DAS EPISCHE WERK. SECHS TEILE IN ZWEI BÄNDEN; S. FISCHER-VERLAG 1932-1935
Abgesehen von Schiller, Grillparzer, Mörike, Stifter, Hebbel und Cäsar Flaischlen besaßen wir – nach meiner Erinnerung – keine weiteren Gesamtausgaben. Diese Hauptmann-Bände datierte meine Mutter in der von ihr ständig bevorzugten grünen Tinte auf Weihnachten 1939. Wieso sie gerade diesen 5 dicken Bänden ihr eigen nannte, weiß ich nicht. Sie sehen unbenützt aus.
Lesen wir also den Anfang des Romans Der Narr in Christo Emanuel Quint:
An einem Sonntagmorgen im Monat Mai erhob sich Emanuel Quint von seiner Lagerstätte auf dem Boden des kleinen Hüttchens, das der Vater mit sehr geringem Recht sein eigen nannte. Er wusch sich mit klarem Gebirgswasser, draußen am Steintrog, indem er die hohlen Hände unter den kristallenen Strahl hielt ...
Man muß zugeben, daß nach Th. Manns Zauberberg unser Blick auf Gerhard Hauptmann verstellt ist. Ich vermute, daß niemand, also weder meine Mutter, noch mein Vater, Schwester und Großeltern jemals Emanuel Quint gelesen haben. Vierhundertachtzig Seiten dieses Kalibers sind einfach zuviel! Aber ist der Joseph-Roman von Thomas Mann wirklich besser als die Dickschiffe des anderen Nobelpreisträgers? Ist der tiefe Brunnen der Vergangenheit wirklich dem klaren Gebirgswasser vorzuziehen? Ich halte beide für gleich sentimental. Damit bekenne ich mich schuldig, auch Thomas Mann nicht wirklich hochzuschätzen. Auf seinen Grundfehler komme ich später noch zu sprechen. Daß ich gerade diejenigen seiner Werke mit Genuß gelesen habe, die von der Germanistik als weniger gelungen abgelehnt werden, ist bezeichnend.
Vielleicht aber sind sich Hauptmann und Mann viel näher, als sie und ihre jeweiligen Verehrer glauben mochten – abgesehen natürlich davon, daß der erste ein großer Dramatiker war, während der zweite um die Kunst der Muse Melpomene einen großen Bogen machte.
Die Zeit vor 1943
5 MEINE HERKUNFT AUS BÖHMEN UND ANDEREN LÄNDERN DER K.U.K. MONARCHIE
SCHEMATISMUS DER OESTERREICHISCH-KAISERLICHEN ARMÉE FÜR DAS JAHR 1812, WIEN. MILITÄR-SCHEMATISMUS DES ÖSTERREICHISCHEN KAISERTHUMS, WIEN, 1815.
Mein Urgroßvater Eduard Ritter von Zambaur (1827-1911) erhielt in den späten 80er-Jahren drei Großkreuze vom Zaren, dem deutschen Kaiser und dem König von Portugal als Dank für seine kluge Vorsorge gegen anarchistische Attentäter zur Zeit der Staatsbesuche der drei Monarchen in Österreich.
Dies sind die beiden ältesten gedruckten Kataloge, in denen ich meinen Ur-Urgroßvater Valentin Zambaur auf den Seiten 155, resp. 486 genannt finde. Eingetreten war er 1809 als Freiwilliger, als Student oder Absolvent eines Ingenieurstudiums (oder so ähnlich) an der Universität Prag, in die damals aufgebotene böhmische Landwehr und hatte auch an der Schlacht (oder bloß Gefecht) von Abensberg teilgenommen.
Im Schematismus von 1812 erscheint er als Fähnrich im renommierten und alten Regiment der Erbach-Infanterie (Nr. 42), im Handbuch des Jahres 1815 als Bauadjunkt der Siebenbürgischen Militär-Gränz-Bau-Direction, wobei er sich ausdrücklich den Offizierscharakter vorbehalten hatte. Er starb 1851 als Oberstleutnant und Gränz-Baudirektor der slavonischen Militärgrenze.
Vor etwa 25 Jahren sprach mich ein älterer Herr an einer Bushaltestelle unvermittelt darauf an, ob ich aus Kroatien stammte. Ich war zu verblüfft, um mit ja zu antworten, und so endete dieser rätselhafte Vorstoß unmittelbar. Aber es muß etwas an und in mir gewesen sein, das den unbekannten Frager an den Typus des österreichisch-kroatischen Offiziers erinnerte. Die Ausstrahlung, die ich gewiß hatte, nützte und schadete mir gleichzeitig in umfassender Weise. Nur selten wagten es Menschen, mich anzupöbeln, aber oft fühlten sich Gesprächspartner abgestoßen; unabhängig davon, daß ich am Anfang Menschen für mich einnehmen konnte; eine Attraktion, die sich nicht viel später in Ablehnung, ja Haß verwandelte. Schwierige Bedingungen, unter denen ich zu leben gezwungen war.
Im Jahrgang 1889 des Militärschematismus findet man unter den aktiven Feldmarschall-Leutnants meinen Urgroßvater Eduard Ritter von Zambaur und seinen Cousin Ludwig Janski. Rein militärisch betrachtet, war dies der Höhepunkt meiner (mütterlichen) Familie, aus Bergreichenstein (oder doch eher aus Budweis) stammend, von wo aus sie den Weg der Offizierslaufbahn, aktiv 1809-1919 (!) eingeschlagen hat, also während 110 Jahren. Immerhin hatte sie vorher schon im Königreich Böhmen dem Bürgerstand angehört, was um 1800 noch ein realer „Stand” gewesen war, nämlich das Bürgerrecht beinhaltend, und das sah so aus: um es in irgendeiner Stadt zu erhalten, mußte man den Nachweis führen, nicht mehr Untertan einer Herrschaft zu sein („Erbuntertänigkeit”); zweitens mußte man so vermögend sein, daß man ein Haus kaufen und ein anerkanntes Gewerbe eröffnen konnte (oder bereits hatte), drittens mußte man einer christlichen Konfession angehören.
Erfüllte einer diese drei Bedingungen, so wurde seinem Ansuchen um die Aufnahme in die Bürgerschaft stattgegeben. Er nahm dann auch an den Rechten der Stadt teil, z.B. in Bergreichenstein, einer königlichen freien Stadt mit ca. 4500 ha Waldbesitz, an den Zuteilungen von Holz, was soviel bedeutete, daß nicht nur das Haus geheizt, sondern auch das Handwerk mit Energie versorgt wurde.
Andere meiner böhmischen Vorfahren waren im 18./19. Jahrhundert noch ganz offiziell Untertanen einer adligen Herrschaft; Verhältnisse, die bekanntlich bis 1848 weiterlebten. Bergreichenstein war ansonsten eine arme und kleine Stadt (um 1800), aber sie war eben eine Königliche Freistadt, ohne Feudalherren.
Böhmische Landwehr aus der k. Hauptstadt Prag (1809)
Nur kurz erwähne ich meine Herkunft aus Troppau, wo einige meiner Vorfahren Tuchmachermeister und „fürstliche Kammerdiener” waren (bei wem, ist nicht überliefert). Aus dieser Landschaft – österreichisch-Schlesien – wurde der Name Hedwig über 4 bis 5 Generationen als Traditionsname für die Frauen weitergegeben.
6 PFARRER, ORDENSPROFESSOREN UND EIN PRÄLAT: DIE BASIS DES „SOZIALEN AUFSTIEGS”
SCHEMATISMUS FÜR DAS KÖNIGREICH BÖHMEN AUF DAS GEMEINE JAHR 1815. ERSTER THEIL, PRAG (GOTTLIEB HAASE, BÖHM. STÄND. BUCHDRUCKER)
Der älteste Geistliche meiner mütterlichen Vorfahren war ein Piarist in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, der Professor der Katechetik und Pädagogik am Budweiser Priesterseminar oder einem Ordensstudium war, namens Zambaur. Gleichzeitig existierte um 1758 ein Pfarrer Josef Zambaur in der kleinen Pfarrei Obermoldau im Böhmerwald; einem bescheidenem Dorf, das um 1728 vom Fürsten Adam Franz von Schwarzenberg durch eine Zustiftung zu einem kleinen Benefizium in den Rang einer vollen Pfarrei erhoben wurde, jetzt unter dem Patronat des Fürsten; ein erster Beleg für die klientelare Abhängigkeit der bürgerlichen Zambaur von den Fürsten, eine Abhängigkeit, die aber hohen Nutzen einbrachte, wie ersichtlich.
Vielleicht ist dieser Pfarrer, der 1758 in Obermoldau einen Kreuzweg anlegte, identisch mit dem, der 1762-1785 in der bedeutenderen Pfarrei Prachatitz amtierte. Der bürgerliche Stand der Zambaur ergibt sich aus verschiedenen anderen Positionen und Besitztümern, von denen ich nur noch den Dr. der Medizin und Chirurgie und Magister der Geburtshilfe (so hieß es damals immer!), Ignaz Zambaur, Stadtarzt in Wollin, erwähnte. Kehren wir zu den Geistlichen zurück, die meine Vorfahren begleiteten.
Über den Erzdechanten Karl Zambaur (†1851) von Krumau hat Prof. Huber bereits geforscht; über seine historisch-philologischen, kirchenmusikalischen, literarischen und pomologischen Neigungen, den Bau einer erzdechantischen Orangerie und seine Sorge um den Erhalt der Hohenfurter Chronik habe ich schon berichtet; daß er seine Ausbildung 1797 in Passau begann (oder abschloß) war mir noch unbekannt.
In dem oben genannten Schematismus wird ein Status des Klerus in ganz Böhmen geliefert: mindestens 25 Prälaten dieses Königreichs (außerhalb Prags) waren mit der Mitra geschmückt, wahrscheinlich aber mehr, weil die Angaben z.T. undeutlich sind; es gab noch 11 Archidiakonate, vulgo Erzdechanteien, davon von diesen 11 Erzdechanteien waren aber nur zwei „infuliert”: Krumau und Politz (letzteres der Sitz des legendären „Hockewanzel”, der durch seinem Kampf um seine Mitra sowie eine violette Kleidung mit dem mißgünstig-machtbessessenen Bischof von Leitmeritz bekannt wurde). „Infuliert” bedeutet, daß der betreffende Geistliche das Recht besaß, den Hirtenstab, ein Brustkreuz, einen edelsteingeschmückten Ring und auf dem Haupt eine Mitra zu tragen, m.a.W. mit
5 im Erzbistum Prag (Pilsen, Falkenau, Schlan, Beraun und Glatz)
3 im Bistum Leitmeritz (Politz, Saatz und Leitmeritz)
2 im Bistum Budweis (Krumau und Bischofsteinitz)
1 im Bistum Königsgrätz (Kuttenberg)
Karl Zambaur (1775-1851). – Pfarrhof Krummau (Foto: Raimund Paleczek, 2008)
den Abzeichen eines Bischofs feierlich die Hl. Messe zu feiern, zu „pontifizieren”, wie man sagt. Der infulierte Prälat verfügte also über ein Amtscharisma, das auf die Pharaonen in Ägypten und die Auguren im alten Rom zurückreichte, vom Hohepriester ganz abgesehen.
Ich brauche nicht lange darüber zu debattieren, daß die kirchlichen Ämter ein „Aufstiegskanal” für Familien aller Stände waren. Eine andere Frage ist aber die, ob die Energie und Intelligenz, die so viele „aufstrebende Jünglinge” in die Sacra Theologia investierten, nicht vorteilhafter auf wirtschaftliche Unternehmungen hätten verwandt werden können. Die Menschen des 18. Jahrhunderts dachten eben anders: eine Priesterweihe, ein Pfarrbenefizium, ein Doktorgrad, eine Mitra sogar schienen grundsätzlich vorteilhafter als ein neuer Handwerksbetrieb, ein neuer „Handel” oder einige neue Landwirtschaften. Man dachte so, und dabei blieb es in diesem blühenden Königreich. Die dahinterstehende Mentalität kann man sich am deutlichsten in Werfels Roman Der veruntreute Himmel (1939) und dessen Verfilmung (mit Anni Rosar in der Hauptrolle) von 1958 zu Gemüte führen.
Wie eng aber kirchliche Karrieren mit Besitzerwerb verbunden sein konnten, zeigt der Umstand daß im Jahre 1844 – also zur Zeit des Prälaten Zambaur – ein Johann August Zambaur als Besitzer der landtäfligen Herrschaft Desky in der Bezirkshauptmannschaft Kaplitz, 20 km von Krumau entfernt, erscheint. Die Herrschaft, de facto ein größerer Hof von 183 Joch Umfang (≈ 60 ha), war früher Krumauer Kirchenbesitz gewesen, allerdings schon vorher an Private verkauft worden. Lange können sich die Zambaur dort nicht gehalten haben: die 22 Rinder und 120 Schafe boten wohl nicht genug Einkommen; und nur ein Drittel des Gutes war Ackerland. Der eigentliche Wert dieses Besitzes muß in seiner Eigenschaft der „Landtäfligkeit” bestanden haben, m.a.W. seiner Qualität als Herrschaft. Um die ging es. Es war der erste Versuch, dieser wohlsituierten Familie, sich in den Adelsstand zu erheben.
7 DER BAU DER NEUEN UNIVERSITÄT GRAZ
FESTSCHRIFT ZUR FEIER DER SCHLUẞSTEINLEGUNG DES NEUEN HAUPTGEBÄUDES DER GRAZER UNIVERSITÄT AM 4. JUNI DES JAHRES 1895.
Das Werk besteht aus zwei Teilen, nämlich:
I. Die Grazer Universität 1886-1895. Ihre Entwicklung und ihr gegenwärtiger Bestand. Von Prof. Dr. Franz Krones Ritter von Marchland und:
II. Geschichte der räumlichen Entwicklung der Universität Graz. Von Prof. Dr. Max Ritter von Karajan.
(Herkunft nicht nachgewiesen; aus einer illustrierten Zeitung von 1895)
Mein Urgroßvater Ing. Carl Kratochwil stammte aus Böhmen, wie der Name schon sagt, und beherrschte ebenso wie seine Frau Hedwig Taubenthaler beide Sprachen dieses Königreichs perfekt. Sein Vater war Finanz-Inspecteur eines Kreises gewesen und hatte seinen Sohn, wahrscheinlich als ersten seiner Familie, studieren lassen können, und zwar gewiß am Prager Polytechnikum, in dem zu seiner Studienzeit. (ca. 1875) noch ungeteilt von Professoren beider Sprachen in beiden Sprachen unterrichtet wurde. Erst 1879 erfolgte die Trennung in zwei getrennte Hochschulen.
Es besteht daher auch kein Zweifel daran, daß Carl Kratochwil von dem bedeutenden Prof. Emanuel Ringhoffer (1823-1903) ausgebildet wurde. (Nach zwei Staatsexamen erhielt man den Titel Ingenieur). Basis für sein Studium war zweifelsfrei folgendes Werk:
Lehre vom Hochbau.Ein Compendium für Vorlesungen und zum Selbstunterricht von Emanuel Ringhoffer, ord. öffent. Professor der Bauwissenschaften an der k.k. techn. Lehranstalt in Brünn, Brünn (Buschak & Irrgang)1862. Ringhoffer war, dem üblichen Itinerar folgend, von Brünn nach Prag berufen worden.
Aus diesem, wiederholt neu aufgelegten, mit 32 „Figurentafeln” ausgestatteten Lehrbuch schöpfend, hat mein Urgroßvater den Bau der neuen Universität Graz hochgezogen.
Die Neue Universität Graz
8 LUNGENTUBERKULOSE UND „HERZ-JESU”-VEREHRUNG: DAS FRÜHE ENDE DER YVONNE V. ZAMBAUR
ANNA CORETH, LIEBE OHNE MAẞ. GESCHICHTE DER HERZ-JESU-VEREHRUNG IN ÖSTERREICH IM 18. JAHRHUNDERT, MARIA ROGGENDORF 1994.
Eines der wenigen Bücher zu dem Thema „Herz-Jesu”, das wissenschaftlichen Charakter beanspruchen kann. Ich hatte bei meinen Jansenismus-Studien wiederholt Anlaß, auf das Thema zu sprechen zu kommen. Es gehört zu dem Devotionskreis der „Unbefleckten Empfängnis” Mariens, den Lourdes- und Fatima-Kulten, der Unfehlbarkeit des Papstes und der Himmelfahrt Mariens.
Der Kult der „Unbefleckten Empfängnis” (von Protestanten öfters mit der jungfräulichen Geburt Jesu verwechselt) besagt, daß Maria ohne Erbsünde empfangen wurde. Diese einigermaßen absurde Theorie machte Maria zu einer Quasi-Göttin und zerstörte dadurch die echte Menschwerdung des Logos. Der Dominikanerorden – unter anderem – hat sich daher so lang als irgend möglich gegen diesen letzten Endes häretischen Kult gewehrt.
Mit C.G. Jung und E. Neumann (Ursprungsgeschichte des Bewußtseins, 1949, geniales Werk, zahlreiche Neuauflagen und Übersetzungen) stehe ich heute milder als früher diesen Weiblichkeitskulten gegenüber, die eine notwendige Kompensation zu der jedenfalls in der Dogmatik rein männlich definierten göttlichen Trinität bedeutete. C.G. Jung begrüßte sogar das Himmelfahrtdogma Pius’ XII. von 1950: nun werde aus der unvollkommenen Trinität eine perfekte Quaternität.
Ich kann die Gültigkeit solcher Spekulationen nicht beurteilen; was ich weiß (weil ich die Originaltexte der Stifterin des ausgereiften Herz-Jesu-Kultes, M. M. Alacoque, genau gelesen habe), ist folgendes: Die imaginierten nächtlichen Begegnungen der Nonne mit Jesus waren wirklich erotischer Natur.
Nicht nur deshalb, sondern wegen des unerträglichen Kitsches aller Herz-Jesu-Darstellungen war mir dieser Komplex stets widerlich.
Yvonne v. Zambaur war das älteste Kind ihrer Eltern, die als Angehörige des konsularischen Dienstes pausenlos auf dem Balkan unterwegs waren, auf entlegenen Posten, wie Antivari, Üsküb oder Mitrovitza im Sandschak Novipasar. Da war es naheliegend, das Kind nach Österreich in ein Pensionat zu geben – und welche Schule konnte vornehmer sein als jene der Salesianerinnen in Wien, am Rennweg, im 3. Bezirk, umgeben von Palästen und Parkanlagen. Das Kloster war eine Stiftung der Witwe nach Kaiser Joseph I. und zweifellos für den weiblichen Adel von Wien und Österreich bestimmt. Man würde gerne wissen, wie hoch der Pensionspreis für die edlen Jungfern im Monat gewesen ist.
Leider erkrankte Yvonne bald an der Lungentuberkulose: die Eltern erkannten zu spät, dass hier jenes Verhängnis eintrat, das, – wie man es hätte vorher wissen können, wissen müssen – darin bestand, daß junge Menschen, die von der Adria her, also aus dem sonnenüberglänzten Dalmatien, nach Wien kamen, leicht an Tuberkulose erkrankten. Wir haben herzzerreissende Berichte über das Voranschreiten der Krankheit. Warum die Eltern sie nicht in ein Sanatorium in der Bergeshöhe brachten, weiß ich nicht. Es kann doch nicht am Geld gelegen haben. Wieder einmal standen die Menschen vor einem unerforschlichen Ratschluß Gottes.
Nachher ist man klüger: hätten die Eltern, ehrgeizgetrieben wie sie waren, ihr Kind nicht nach Wien zu den Edelfräulein gegeben, sondern zur Familie der Großeltern mütterlicherseits (Reglia-Ohmučević) nach Zara, hätte sie überlebt. Der beiliegende Totenzettel ist nicht schwarz, sondern silberfarben umrändert, um die Jungfräulichkeit der Verblichenen anzudeuten.
9 ZWEI GEHEIMAGENTEN IM KAMPF UM ÖSTERREICH-UNGARNS EXISTENZ (1896-1918)
GENERALMAJOR MAX RONGE, ZWÖLF JAHRE KUNDSCHAFTSDIENST. KRIEGS- UND INDUSTRIESPIONAGE, WIEN (AMALTHEA) 1930, PP. 384 + 16 SKIZZEN
Max Ronge (1874–1953), während des ersten Weltkriegs Chef des Evidenzbüros und der Nachrichtenabteilung des österreich-ungarischen Armeeoberkommandos, wird heute wegen seiner scharfen Maßnahmen in Galizien verurteilt, die nach heutigen Kriterien als verbrecherisch eingestuft werden. Ronge war ein Geheimdienstmann mit allen paranoiden Zügen, die in diesem Metier aufzutreten pflegen, aber man darf auch darauf beharren, daß er sofort nach dem „Anschluß” ins KZ Dachau kam, wo er aber nur bis zum August bleiben mußte. Er hatte sich geweigert, der SS beizutreten.
In welcher Beziehung stand Ronge zu meiner Familie? In einer doppelten: die beiden Nachkommen unseres Valentin Zambaur, Adolf R. v. Zambaur und Georg Sertić, gehörten beide, wenn auch in unterschiedlichen Positionen, zu seinen Zuarbeitern, wenn man will, Spionen, vor allem aber Abwehroffizieren. Es war die Zeit in der Oberst Freiherr Giesl von Gieslingen die österreichische Spionage lenkte. Damals ging es um die Abwehr panslawistischer Bestrebungen auf dem Balkan, und in Wien hielt man Adolf v. Zambaur, nacheinander Vizekonsul, Konsul und Generalkonsul in Üsküb, Antivari, Mitrovitza (hier 1904 -1909), zuletzt in Skutari und Athen für einen vorzüglichen Berichterstatter (p. 21).
Sein Cousin Georg Sertić behandelte dieselbe Agenda von der inneren Grenze aus, nämlich an der Grenze von Bosnien zu Serbien, und half dabei die serbischen Spionagenetze, und, was wichtiger war, die serbischen Aufstandsbestrebungen in diesem Gebiet zu zerschlagen.
Seine prominente Position während des 1. Weltkrieges haben inzwischen mehrere Autoren im wesentlichen klargestellt (p. 249), aber sie wußten alle nichts von der Verwandtschaft der beiden Männer.
Aus den Erzählungen meiner Großmutter und aus Briefen meiner Mutter weiß ich aber, daß man noch lange Zeit freundschaftlichen Kontakt mit Gisl von Gieslingen und besonders zu Oberst von Urbanski hielt (letzterer in Graz ansässig), jenem Offizier, der (mit anderen) dem Landesverräter Redl nach seiner Enttarnung die Pistole ins Hotelzimmer brachte, auf daß er sich selbst entleibe (1913).
Adolf R. v. Zambaur, 15.9.1917
Eins ist jedenfalls klar, Adolf von Zambaur, zuerst Generalstabsoffizier, dann Konsul auf dem Balkan, war eine typische Figur im verzweifelten Abwehrkampf gegen die russischen, französischen, auch italienischen Balkanagitationen. Und bei Oberst Georg Sertić muß man doch einmal ernsthaft fragen, ob ein Verbleiben Bosniens in der Monarchie nicht in den 100 Jahren nach deren Zerstörung durch die Entente, den dort lebenden Menschen, gleich welcher Nationalität, unendliches Leid erspart hätte. Hier ist eine historische Kritik im großen Stil vonnöten, die z. B einmal seriös nach der französischen Balkanpolitik in den letzten Jahrzehnten vor 1914 sich zu fragen erlaubte. Und das heißt: Wie bewerten wir heute die französische Politik in Serbien, die nachweislich die dortigen kriegstreiberischen Kräfte förderte und stets aufs neue daran arbeitete, das Dreieck Paris – St. Petersburg – Belgrad auf einen gemeinsamen Kriegseinsatz vorzubereiten. Die angelsächsischen Historiker haben diese Fragen inzwischen energisch aufgegriffen, in Deutschland und Österreich herrscht eine schamhafte Verzagtheit.
10 EIN SELBSTMORD IN DER REISNERSTRASSE
CHRISTOPH WEBER, DAS MILITÄR- JUBILÄUMSKREUZ, HAMBURG 200