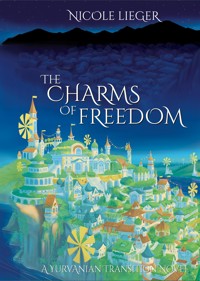8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
“Märchenhaft inspirierend”
Eine blühende Stadt voller Windräder, Dachgärten und Gemeinschaft – das ist, was der junge Magier Enim kennt. Doch als er hinaus in die Berge zieht, schlägt ihm das Elend ins Gesicht.
Prompt wird Enim Teil einer Familie aus Freundinnen, die entschlossen sind, den Minenbesitzern zu trotzen, die Bergleute zu befreien und ein gutes Leben für alle zu schaffen. Die genauen Schritte zur Weltrettung sind noch ein wenig unklar. Doch das hindert niemand daran, vorwärts zu stürmen!
Und während sie ihr freies und kraftvolles Zuhause voller Waisenkinder bewahren, jonglieren sie mit politischen Prozessen und inneren Dämonen, mit verworrenen Liebesbanden und drohender Gewalt. Diesmal müssen sie es schaffen, noch vor Sonnwend...
„Ein Lied vom Ringen um eine lebensfreundliche Welt, mit einem schelmischen Lächeln im Refrain.“
„Perfekt für Fans von Studio Ghibli, Becky Chambers und Ursula K. LeGuin.“
Zieht es dich hin zu
-) Charakteren mit Vision aber ohne Plan
-) der stillen Weite der Berge
-) haarsträubend sturem Optimismus
-) frei aufwachsenden Kindern
-) Reichtum jenseits von Juwelen
-) magischen Spiegeln, die neue Bilder einer alten Welt zeigen?
Dann bist du hier richtig... :-)
Willlkommen bei einem zauberhaften Märchenroman!
Titel der englischsprachigen Ausgabe: The Charms of Freedom - A Yurvanian Transition Novel
Weitere Bücher aus der Reihe Yurvanische Wandelromane: Schatten aus Sternenlicht / The Starlight of Shadows
Diese Bücher können unabhängig voneinander in beliebiger Reihenfolge gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Der Zauber der Freiheit
Ein Yurvanischer Wandelroman
Nicole Lieger
Alle Kinder sind unsere Kinder.
Gründer der SOS-Kinderdörfer
Ein Hintergrund-Glossar-Geplauder
der yurvanischen Welt
findet sich auf meiner Webseite:
nicolelieger.eu/yurvania
Inhaltsverzeichnis
Der Zauber der Freiheit
Ein Hintergrund-Glossar-Geplauder
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Vielen Dank für die gemeinsame Reise! :-)
SCHATTEN AUS STERNENLICHT
Impressum
Lust auf mehr?
1
Die weißen Segel der Windmühlen drehten sich gemächlich über einem Gewirr ausDachgärten. Der Wandel war anmutig in die Verspieltheit und die pompöse Selbstbeweihräucherung der alten Villen hineingewachsen. Das Grün um ihre Mauern war so verschlungen und lebendig wie die Verwürfelung von Freunden und Familien, die sich nun die alten Prunkräume teilten. Reife Früchte grüßten von Türmchen und Nischen, von Erkern und Wendeltreppen. Eine Gruppe Hühner gackerte auf einem überwucherten Balkon und blickte herab auf die tief unter ihnen stehenden Menschen. Die Strahlen der Morgensonne badeten Varoonya in mattem Gold.
Doch hinter schweren Samtvorhängen voller Staub und Geschichte herrschte schummriges Zwielicht. Dumpfe Stille erfüllte den Saal. Die Wände der Halle ragten schier endlos in die Höhe, bis hin zum Firmament einesdüsteren Gewölbes. Enim blinzelte nach oben. Von der Galerie blickten dieausdruckslosen Gesichter vonfünfPrüferinnen schweigend zu ihm zurück.
Enim räusperte sich. Nun denn.
Er wandte sich wieder dem kunstvollen Arrangement auf dem Boden zu. Sein prüfender Blick glitt noch einmal über die schimmernden Kristalle, die fein geschlungenen Glasfäden. Alles schien am richtigen Platz.
Enim hob seinen Zauberstab. Seine Augen wurden schmal. Imnächsten Moment war die Welt für ihn verschwunden. Er kannte nichts mehr als die Runen in seinem Geist, den Fluss der Magie in seinen Adern. Voll und rund rollten die Silben über seine Zunge, archaische Laute der Macht, intoniert mit der Perfektion jahrelanger Schulung. Genau mit dem letzten Ton flammte ein Pentagramm auf, aus heiser knisternder Glut, und tauchte Enims Gesicht in seinen unsteten Schein.
* * *
}}} Kaya kauerte im Gebüsch undduckte sich tief in den Schatten des Berges. Rund um die Mine war es dunkel. Schwarze Wolkenfetzen peitschten über den Himmel, rissen auf und enthüllten die fahle, dünne Sichel des Mondes. Ein kalter Wind blies harsch und böig.
Lhut tauchte neben ihr auf, leise wie ein Geist, und nickte Kaya zu. Der Weg war frei. Kaya spähte hinter den Zweigen hervor. Auf ihrer Seite war die Wache gerade eben vorbei gegangen. Jetzt oder nie. Kaya warf Lhut einen kurzen Blick zu und sprintete los. Geduckt rannten sie bis zum Eingang der Mine und schlüpften in die Dunkelheit des Berges ohne anzuhalten. Sie kannten den Weg gut genug. Nicht umsonst hatten sie jahrelang hier geschuftet, Tag für Tag.
Erst als sie weiter abstiegen, entzündeten sie ihre Laterne. Tiefer und tiefer ging es in die Tunnel, Biegung um Biegung in das unterirdische Labyrinth. Schließlich hielten sie inne. Sie waren fast da.
Kaya lauschte und spähte dann vorsichtig um die Ecke.
Ja! Ihr Herz machte einen Sprung.
Alle waren da. Sie waren wirklich gekommen.
Im flackernden Licht einer Fackel schienen die Menschen, die in der Tunnelhöhle standen, nicht mehr als dunkle Gestalten und unsichere Schatten. Aber Kaya wusste, das waren ihre Leute. ›Wir sind alle gekommen, heute Nacht‹, dachte sie stolz. ›Wie erschöpft wir auch sein mögen nach langen Schichten in der Mine. Wie verängstigt wir auch sind, nach verdeckten und dann immer offeneren Drohungen. Wir sind gekommen, trotz alledem.‹
Kayas Gesicht trug einen seltsamen Ausdruck irgendwo zwischen einem Lächeln und fest zusammengebissenen Zähnen. »Alsdann.« Kayas Stimme war leise, doch klar wie Glas. Sie ergriff die Hand der Frau neben ihr. Lhut nahm die andere, und so schloss sich der Kreis, rundum eine Hand in der anderen, in einer feierlichen Geste der Stärke und Entschlossenheit.
Und in der Stille dieses Rituals hörten sie es kommen.
Zunächst ein tiefes Grollen, ein Stöhnen tief im Gestein. Ein Ächzen und Ziehen irgendwo im Inneren des Berges. Und dann – berstende Balken und ein Riss in der Decke.
Ein Schrei gellte durch die Luft. Schwarze Gestalten rannten Richtung Ausgang. Sie stolperten, fielen. Steinbrocken regneten auf sie herunter, ein Hagel aus Geröll, der gnadenlos alles bedeckte, was ihm unterkam.
Kaya stieß gegen zwei junge Männer, die sich gegenseitig aufhalfen, weiterliefen inmitten aufwallender Staubwolken und nochmals zu Boden stürzten. Ein riesiger Klotz verpasste Kaya um Millimeter, als sie sich instinktiv in eine Nische presste. Ein anderer Brocken traf sie an der Stirn. Blut lief über ihr Gesicht.
Im grauen Nebel tauchte Lhut vor ihr auf und zog sie vorwärts. Doch dann war das Krachen direkt über ihm. Die Welt brach über Lhut zusammen und riss seine Hand aus Kayas Griff. {{{
Kaya erwachte mit einem Schrei.
Ihr Atem kam stoßweise. Schweiß stand auf ihrer Stirn. Gehetzt blickte sie um sich, doch alles, was sie sah, war das Mondlicht, das durch das kleine Fenster ihrer Kammer fiel. Alles, was sie hörte, war das Rasen ihres eigenen Herzens.
Kaya atmete tief durch. Sie rieb über die Narbe an ihrem Kopf.
Allmählich verlangsamte sich ihr Herzschlag, fand zurück zu seinem gewohnten Rhythmus.
»Alles gut. Alles in Ordnung. Es ist vorbei«, sagte sie leise. Steif legte sie sich zurück auf ihr Bett und starrte in die Dunkelheit.
Es stimmte nicht. Nichts war gut. Nichts war in Ordnung.
Kaya hieb mit der Faust auf die Matte, erstickte einen Schrei in ihrem Kissen.
Dann zog sie das Kissen zur Seite. Ihre Augen glänzten. »Es ist nicht in Ordnung! Und: Es ist nicht vorbei!«
Ihr nächster Schrei gellte mit aller Kraftdurch die Nacht. Eine Wehklage, ebenso wie ein Eid, ein Versprechen, ein unauflöslicher Schwur.
* * *
Langsam und behäbig wand sich der Roonfluss um den Fuß des Hügels von Varoonya. Am Rande der Stadt, wo die Ufer wieder breit und grün wurden, verklang das laute Treiben des Hafens allmählichzueinem leisen Hintergrundgemurmel, um schließlich ganz im sanften Plätschern der Wellen aufzugehen.
Auf einer der Wiesen flanierten Menschen in farbenfrohen Gewändern, standen lachend und plaudernd in kleinen Gruppen beisammen, ein Glas und eine knusprige Knabberei in der Hand. Ketten magischer Laternen antworteten mit warmem Leuchten auf die Streifen von Violett und Rosenrot, die sich über den Abendhimmel zogen.
Zufrieden ließ Enim sich umhertreiben zwischen seinen Gästen, zwischen Glückwünschen und Abschiedsliedern, zwischen freundlichem Schulterklopfen und Fragen nach seiner Zukunft. Schlank und schlaksig wie er war, tanzte Enim mit mehr Begeisterung als Anmut, aber sein feines Lächeln und sein jungenhafter Charme brachten ihm doch mehr als einen Kuss ein.
Enim hatte sich für den feierlichen Anlass in die am wenigsten abgetragene seiner üblichen blauen Pluderhosen geworfen, und die dunklen Falten fielen weich um seine Beine, bis sie über den Knöcheln zusammengerafft wurden. Die kurze rote Weste über Enims Hemd hingegen war genau die gleiche wie immer. Das ging nicht anders, wegen ihrer hundert kleinen Taschen voller Phiolen und Kristalle und magischer Nützlichkeiten. Enim würde nicht ohne seine Ausstattung außer Haus gehen. Den Zauberstab in den breiten Gürtel gesteckt, der sich um seine Taille wand, war Enim daher ganz genau so, wie ihn alle kannten. Und feiern wollten!
Lachend zog Enim die Kappe vom Kopf und strich sein schwarzes Haar aus der Stirn, als er plötzlich erstarrte.
Eine Wolke aus goldenem Licht stieg zu seinen Füßen auf.
Verwirrt blickte Enim um sich.
Und einen Moment später hatte er die Quelle der Magie entdeckt.
Yoor reckte die Arme gen Himmel. Die weiten Ärmel seiner Robe fielen zurück und entblößten das schimmernde Blau seinerHaut. Ein Hauch von Violett mischte sich darunter, tanzte in zarten Mustern über Yoors samtigen Körper.
In einem großen, majestätischen Kreis senkte Yoor den Arm und tausend kleine Sterne umtanzten Enim, erhoben sich und formten hoch über seinem Haupt die Säulen und Bögen eines schlanken Lichttempels, erfüllt mit dem triumphalen Gesang himmlischer Chöre.
Enim starrte mit aufgerissenen Augen hinauf. Dann begann er zu lachen. »Yoor, ich bitte dich! Genug ist genug.«
Die Musik verklang, und der Tempel fiel als Goldregen zu Boden, wo er einen strahlenden See rund um Enims Füße bildete, bevor auch dieser sich auflöste und im Nichts verschwand.
»Du meine Güte«, grinste Enim, als er Yoor umarmte. »Ich habe bloß graduiert. Nicht den Aufstieg zu den Göttern gemacht.«
»So gut wie«, murmelte Yoor in Enims Haar.
Torly tanzte heran und warf sich an Enims Rücken, wo sie ihn in eine feste Doppelumarmung drückte, bevor sie ihn freigab und sich an Yoors Schulter lehnte.
Zahlreiche Menschen hatten sich zu ihnen umgedreht, mit erhobenen Brauen und lächelndenAugen. Schmetterlingsmenschen waren rar, und Yoors schillernde Haut wurde genauso bereitwillig bewundert wie die Magie seiner Illusionen. Als Yoor die auf ihn gerichtete Aufmerksamkeit bemerkte, verneigte er sich nach links und rechts mit verhaltener Demut und überschwänglicher Extravaganz. Diamanten glitzerten in seinem perlweißen Haar.
Torly lachte. »Yoor! Du bist wirklich für die Bühne geboren!«
»Danke.« Yoor richtete sich auf. »In zwei Tagen stehe ich wieder drauf.« Er hakte er sich bei Enim unter. »Aber was ist mit dir? Wo gehst du hin, nun, da du die Akademie verlässt?«
Ein schiefes Lächeln stahl sich in Enims Gesicht. »Ziemlich weit weg. Ich gehe in die Berge.«
»In die Berge!« Yoors Augen weiteten sich. »Aber warum denn das? Was willst du denn dort? Da ist doch nichts!«
»Da ist nicht nichts. Nirgendwo ist nichts. Es ist bloß ein Ort, über den du noch nie nachgedacht hast.« Enim fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Aber um ehrlich zu sein, ich weiß auch nicht, was dort ist. Deswegen gehe ich ja hin. Ich bin hier in Varoonya aufgewachsen. Ich will einmal etwas anderes sehen. Auch wenn es ...« Enim schlang seine Arme um die Brust. »Ich weiß nicht, was mich erwartet. Aber ich will gehen.«
»Meiner Treu«, sagte Yoor beeindruckt. »Was für ein Abenteurer! Du hättest ja genauso gut hier Arbeit finden können. Aber nein. Du ziehst hinaus ins Unbekannte. Ans Ende der Welt, geradezu. Wer hätte das gedacht! Ich muss zugeben, ich habe dich immer für eher zahm und brav gehalten. Jemand, der sich an die Regeln hält und alles richtig macht. Wie habe ich mich getäuscht!«
»In die Berge zu gehen verstößt nicht gegen irgendwelche Regeln«, stellte Enim klar. »Sonst würde ich es natürlich nicht tun.«
»Weil du tatsächlich glaubst, dass Regeln immer richtig sind?«
Enim stutzte. »Ja, natürlich. Was denn sonst? Dazu sind Regeln doch da. Regeln halten fest, was richtig ist, und was richtig ist, wird eine Regel. Wenn selbst die Definition des Richtigen nicht richtig wäre, wie sollte sich dann noch wer auskennen und irgendwas funktionieren?«
Yoor legte den Kopf schief und bedachte Enim mit einem schrägen Blick. »Ich fürchte, dir stehen noch böse Überraschungen bevor, mein Freund.«
Torly zwickte Yoor in den Arm. »Sei da mal nicht so sicher! Enim hat seine eigene Sicht der Dinge und ist nicht so leicht aus der Bahn zu werfen. Es würde mich nicht wundern, wenn er mit seiner felsenfesten Überzeugung sogar die Wirklichkeit umstimmt. Die sich dann seinem Willen beugt und genau so wird, wie Enim gesagt hat. Richtig, eben.«
»Das nenne ich wahre Magie«, sagte Yoor mit Inbrunst. »Ich wünschte, sie hätten uns das an der Akademie gelehrt.«
2
Auf dem Weg in die Berge war Toan die letzte Stadt, die von der Postkutsche aus Varoonya angefahren wurde. Von hier aus musste Enim allein zurechtkommen.
Sorgfältig wählte er auf dem Pferdemarkt eine braune Stute aus und traf sogar eine Bäuerin, die sein Gepäck mitnehmen würde. Gemächlich ritt Enim neben ihrem Karren her, durch eine sanfte Hügellandschaft voller Felder und Auen. Dörfer und Scheunen zogen vorbei, glitzernde Bächlein, Schafe und Enten. Enim kam das alles vor, als würde er eine Reise durch ein Bilderbuch machen. Hübsch, aber nicht ganz real. Und auch nicht von Dauer. Schon bald würde das Bilderbuch sich schließen und Enim sich in der wirklichen Welt wieder finden. Nur, dass die wirkliche Welt, die Welt, in der er lebte, nun in den Bergen sein würde.
Was immer das heißen mochte.
Enim rutschte unruhig im Sattel hin und her.
Er hatte sein ganzes bisheriges Leben in der Hauptstadt verbracht. Das war, was er kannte. Wo alle seine Freundinnen lebten. Wie würde es sein, in einer vollkommen neuen Welt anzukommen? Überhaupt niemanden zu kennen?
Enim biss sich auf die Lippe.
Im Tal von Shebbetin gab es Diamanten, soviel wusste er. Und Minen, in denen Tonnen von Stein bewegt wurden, mit Hilfe magischer Traptionen. Als Almecha, der Traptionen erschaffen und reparieren konnte, würde ihn doch sicherlich jemand anheuern wollen? Auch wenn alles, was Enim an der Akademie gelernt hatte, nur Modelle und Übungen gewesen waren. Eine echte Traption, die wie einalter Riese aus Zahnrädern und Magie tief im Inneren eines Berges saß, war vielleicht doch noch einmal etwas anderes. Würde er damit überhaupt zu Rande kommen, wenn er ganz allein unten im dunklen Tunnel stand?
Enim straffte die Schultern und trieb sein Pferd vorwärts.
*
Nach zwei Tagen erreichte Enim Hebenir, das letzte Dorf, das sich auf dieser Seite der Berge an den steilen Hang schmiegte. Dahinter führte nur noch ein schmaler Pfad hinauf zum Pass.
Alle Handelstreibenden übernachteten in Hebenir. Es war möglich, Shebbetin von hier aus an einem Tag zu erreichen, doch es musste ein ziemlich langer Tag sein, vor allem, wenn man mit einem Karren unterwegs war.
Und so war es noch vor Sonnenaufgang, als der Wagen der Krämerin in den Hof hinaus polterte. Enim, froh über die ortskundige Führung, ritt auf seinem Pferd hinterher.
Im matten Licht der Laternen folgten sie dem Weg, der sich hinter dem Dorf durch die letzten Felder und Weiden bergauf wand. Gerade als das erste Morgenlicht den Himmel anhauchte, verschwand der Pfad zwischen dichten Bäumen und damit wieder in Finsternis.Nur hier und da fiel ein Strahl durch dieKronen bis auf den Boden hinunter, vereinzelte Finger aus Licht, seltsame Säulen, die sich zwischen die schwarzen Stämme mischten. Die Dämmerung tauchte den Wald in einen vagen, unwirklichen Schein, der Enim das Gefühl gab, sich wie durch einen Traum zu bewegen.
Dunkle Riesen standen um ihn herum, Gefährten eines wortlosen Liedes, das der Wind durch die Zweige flüsterte. Der Pfad wurde immer steiler und steiler. Von allen Seiten drängte das Unterholz auf den Weg und hinderte ihre Reise. Alles fühlte sich eng und schwierig an.
Und dann, ganz plötzlich, waren sie durch.
Als sie den Kamm überschritten, explodierte das Sonnenlicht in Enims Augen, ein unfassbar helles Leuchten über dem weiten, offenen Hochland. Ein endloser Himmel dehnte sich über ihm, die Tiefe des Kosmos nur dünn verschleiert von ein paar rosigen Wolken. Am Horizont schimmerten schneebedeckte Gipfel. Ein kalter Wind blies Enim ins Gesicht, trieb Tränen in seine Augen und Haare in seine Stirn. Hoch über ihm schrie ein Falke.
Enim schüttelte den Kopf, als würde er versuchen, aufzuwachen.
Kein Zweifel.
Er war da.
Das waren die Berge.
Den ganzen Tagritten sie schweigend über das weite Hochland, in mattgrüne Täler und auf einsame Kuppen, immer entlang des Pfades, der sich wie ein dünner Faden durch das Gewebe dieser endlosen Landschaft zog. Zwei kleine fahrende Gestalten, die sich leiten ließen von einer riesigen, alten, grenzenlosen Welt.
Enim fühlte das Auf und Nieder der Hänge unter sich wie den zeitlosen Atem der Erde. Allmählich wurden die Schatten lang und dunkel. Schließlich reichten sie sogar hinauf bis in den Himmel, reckten ihre Finger nach unendlichen Fernen über dem Land. Noch nie hatte Enim so viele Sterne gesehen. Aus der Schwärze des Kosmos sprachen sie zu ihm mit leisen, singenden Stimmen, mit einem Lied, das aus den Tiefen von Zeit und Raum kam. Der Weg unter den Hufen der Pferdewar kaum noch zu sehen im matten Schein der Laterne. Enim war froh, als der Mond aufging, unfassbar groß, direkt über der kantigen Linie der Berge. Gebadet in die silbrige Stille, die nun über Gräsern und Felsen lag, reisten sie weiter durch die Nacht.
Plötzlich hielt der Karren an.
Enim stutzte.
Er ritt vor, um zu sehen, was es gab.
Im Dunkel des Tales fanden seine Augen die Konturen nur mit Mühe.
Doch da, kein Zweifel.
Zunächst waren es nur ein paar Hütten, die sich an den Abhang schmiegten. Aber weiter hinten drängte sich ein Schattengewirr aus Ecken und Nischen, aus Dächern und Gassen im silbrigen Mondenschein. Auf einer Seite des Tales waren Lichter zu sehen, Herdfeuer, die durch die Fenster schimmerten.
Enim atmete tief ein.
»Shebbetin«, flüsterte die Krämerin mit belegter Stimme, so als ob selbst sie das Gefühl hätte, an einem Weltentor zu stehen.
Enim blickte hinunter auf die verworrenen Umrisse der Stadt. Er konnte nicht sehen, nicht verstehen, was da vor ihm lag. Gerade mal erahnte er vage, mysteriöse Konturen des Lebens, das sich hier vor ihm erstreckte und verbarg. Ein riesiges, wunderliches Wesen, das sich in die Kuhle zwischen den Bergen presste.
Sacht drückte Enim die Flanken seines Pferdes und ritt hinab ins Ungewisse.
* * *
Weiches Morgenlicht fiel in die Kammer des Gasthofes.
Enim stolperte verschlafen die Treppe hinunter, auf der Suche nach einem Frühstück. Doch was ihn in der Wirtsstube erwartete, war keine stille Tasse Tee, sondern der Trubel einer aufgekratzten Gruppe, die laut lachte und scherzte – auf Vanisch.
Enim blinzelte.
Die Wirtin stand mittendrin, redete genauso lebhaft wie alle anderen, und genauso sehr auf Vanisch.
Enim wurde bewusst, dass es letzte Nacht die Krämerin gewesen war, die alle Gespräche mit der Wirtin geführt hatte, auf dem Weg hinaus zu den Ställen. Es war Enim nicht in den Sinn gekommen, auf ihre Sprache zu achten. Was hätte es anderes sein sollen als Kokisch, das doch seit dem Wandel überall gesprochen wurde?
Ein Windstoß fuhr in die Stube, als die Tür aufging und die trubelige Gruppe sich schubsend und rufend auf die Straße hinaus drängte.
Eine greifbare Stille blieb zurück.
Langsam driftete der Staub durch die schrägen Lichtstreifen zu Boden. Das Echo vergangener Zeiten und einer Sprache, die schon zu Geschichte wurde, hingen noch in der Luft.
Enim sandte ein stilles Dankgebet zu seinen altmodischen Eltern, die die aufgegebene Sprache zu Hause noch gesprochen hatten. Vielleicht würde er es schaffen.
Er räusperte sich.
»Guten Morgen«, begann Enim in seinem besten Vanisch.
Die Wirtin schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. »Guten Morgen!«
Prächtig. Und nun? Enim durchsuchte seine Kindheitserinnerungen nach weiteren Worten. Nach der sich aufdrängenden Frage. »Du sprecht Vanisch?«
»Natürlich. Das tut doch ganz Shebbetin.«
Fassungslos starrte Enim sie an.
Enim schüttelte den Kopf, über sich oder Shebbetin oder die Welt. So etwas Grundlegendes, Offensichtliches! Und doch hatte es ihm niemand gesagt. Er hatte auch nicht danach gefragt. Es war ihm nie in den Sinn gekommen. Heutzutage sprachen doch alle Kokisch, oder?
Nein. Nicht alle.
Oder: nur wenig. Das Kokisch der Wirtin entpuppte sich als noch brüchiger und holpriger als Enims Vanisch. Aber alle die Tsechen, die vornehmen Leute, denen die Minen gehörten, sprachen fließend Kokisch, versicherte die Frau, während sie die Hände an der Schürze abwischte. Nur die einfachen Menschen nicht, die Bergleute und so.
Enim rieb sich den Hinterkopf.
Die Unterteilung der Menschheit in vornehme und einfache Leute glitt an seinem Bewusstsein zunächst einmal einfach vorbei.
Aber Vanisch …
Kokisch war die Sprache seines Herzens, und auch seines Kopfes. In dieser Sprache war er zum Almecha geworden, und sie war es, die nachts in seine Träume kam. Würde er sie nun nicht mehr sprechen können, in diesem neuen Leben, das ihn erwartete?
Enim seufzte. Er würde sich wohl auf eine Zeit des Stotterns und der Sprachlosigkeit einstellen müssen. Und auf eine steile Lernkurve. Das hier würde sein Ankommen in der neuen Welt nicht gerade einfacher machen.
Nun denn. Er würde es schaffen. Sein Vanisch war eingerostet, aber die Basis darunter war stark und stabil. Hoffte Enim jedenfalls.
Die Wirtin machte Frühstück.
Enim sah schweigend zu.
Da fiel ihm noch etwas ein. Etwas Gutes! Und das konnte er jetzt auch gebrauchen. Vielleicht gab es ein Willkommensgeschenk, das hier auf ihn wartete. Denn ein paar Freundinnen, die es nicht zu seiner Abschiedsfeier geschafft hatten, wolltenstattdessen Briefe nach Shebbetin schicken. Vielleicht waren die schon da? Ein Lächeln erhellte Enims Gesicht.
Er nahm noch einen Anlauf mit seinem holprigen Vanisch. »Bitte, wo … äh … Briefe haben? Post! Post abholen!« Die Worte stiegen gerade noch rechtzeitig aus Enims Unterbewusstsein auf.
»Die nächste Poststation ist in Behrlem.«
»Behrlem …« Enim zögerte. »Wo, bitte?«
Die Wirtin, die gerade Bohnen auf einen Teller schaufelte, blickte kurz auf. »Behrlem ist südlich von Hebenir. So etwa zwei, drei Stunden zu Pferd.«
Enim sah sie verwirrt an. »Aber …« Enim wechselte zurück ins Kokische. »Was ich meine, ist die lokale Poststation von Shebbetin. Wo die Kuriere des Landes ihre Beutel abladen und die Leute ihre Briefe holen kommen.« Und dann sagte er all das noch mal, so gut er konnte, auf Vanisch.
»In Behrlem«, wiederholte die Frau nickend, während sie die Kartoffeln anrichtete.
»Aber … Ich kann nicht drei Tage Reise für mein Brief!« Unverständnis und Bestürzung lagen in Enims Stimme.
Die Wirtin hatte Mitleid mit ihm. »Nun ja. Für dich gibt es vielleicht einen Weg. Wenn du die Tsechen bittest. Die haben ihren eigenen Kurier, der einmal pro Woche nach Behrlem reitet. Wenn du artig fragst, nehmen sie dich vielleicht in ihre Gruppemit auf. Wo du doch immerhin ein Almecha bist, von der Akademie in Varoonya.«
Enim blickte die Frau verständnislos an. »Aber … Wieso bitten? Wieso Tsechen? Tausende Menschen hier in Shebbetin. Wie sie bekommen Briefe?«
»Bekommen sie nicht«, gab sie trocken zurück. »Es sei denn, sie haben Glück und eine Händlerin nimmt die Post aus Behrlem mit.«
Enim starrte sie entgeistert an. »Aber das … das nicht möglich. Menschen in Shebbetin so weit weg. Und dann kein Post? Nein.« Enim schüttelte den Kopf. »Das nicht richtig. Es gibt Regel für das. Das Land bringt Post. Für alle. Es muss sein.«
Die Wirtin wandte sich ab. Sie goss kochendes Wasser in eine Teekanne.
Enim appellierte noch einmal an sie. »Natürlich, muss Land sagen. Schreibstuben, in Varoonya. Natürlich sie machen das richtig, ganz bald. Sie machen Poststation in Shebbetin. Und Briefe gut für alle.« Enim sah die Frau eindringlich an.
»Schau her«, sagte diese etwas defensiv. »Das hier ist ein Gasthof und ich bin die Wirtin. Ich habe dir gesagt, was ich weiß, und das ist alles.«
»Aber–«
»Hier, dein Frühstück.« Sie schob das Tablett mit einer abschließenden Geste zu Enim hinüber. »Ich bin dann hinten in der Küche, falls du mich brauchst.«
*
Die einzigen Gäste, die sonst noch in der Wirtsstube waren, hockten dicht beisammen, ganz hinten in der Ecke.
»Hast du das gehört?«, fragte Kaya mit gedämpfter Stimme.
»Und ob.« Lhut lehnte sich vor. »Der Kerl ist ungewöhnlich.« Lhut ließ seinen Blick über Enims Rücken schweifen, während der still und in sich gekehrt sein Frühstück aß. »Er kommt aus Varoonya, aber kann Vanisch sprechen. Und ist sich nicht zu schade, das auch zu tun. Obwohl er stammelt und stottert und nach Worten ringt. Er hätte das ganze Kopfzerbrechen einfach auf die Wirtin abwälzen können, indem er das Gespräch auf Kokisch führt. Aber nein. Er hat die Anstrengung sich selbst auferlegt, nicht anderen. Und hatte nicht einmal Angst, komisch zu klingen.« Lhut nickte respektvoll. »Da ist jemand mit einem starken und freundlichen Geist, würde ich sagen.«
Kayas Augen wurden schmal. »Er hat ein Problem gesehen und sich aufgeregt. Er hat sich nicht sofort abgeseilt mit einer rein persönlichen Lösung, die nur für ihn geht. Obwohl esihm sofort angeboten wurde. Nein.Er hat weiterhin an alle gedacht. Und sogar daran, was getan werden müsste.«
Lhut stieß Kaya mit dem Ellbogen. »Los! Noch hat er keine Ahnung. Wir holen ihn uns, bevor andere ihn auch nur zu sehen kriegen.«
*
»Entschuldigung.«
Enim schreckte aus seiner Versunkenheit hoch.
Eine drahtige Frau stand an seinem Tisch, mit schwarzer Haut und kurzem krausen Haar. Eine lange Narbe lief von ihrer Stirn bis hinunter zum Ohr.
»Ja?«, sagte Enim zögernd. Aber auf Vanisch, so wie sie.
»Mein Name ist Kaya.« Sie nickte zum hinteren Ende des Raumes, wo ein muskulöser Mann mit braunen Locken und freundlichen Augen zu ihnen herüber lächelte. »Würdest du mit mir und meinem Freund Lhut gemeinsam frühstücken?«
Enim ging gerne mit. Was könnte ihm Besseres passieren, als ein paar erste Bekanntschaften zu schließen und eine kompetente Einführung in das Leben von Shebbetin zu bekommen? Die konnte er wahrlich brauchen.
»Ich weiß, dass Vanisch neu für dich ist«, sagte Kaya. »Ich werde langsam sprechen, mit kurzen Sätzen. Und wenn ich vergesse, gib mir bitte ein Zeichen.« Sie hob entschuldigend eine Schulter und zwinkerte ihm zu. »Ich werde leicht mitgerissen von meinen eigenen Reden.«
Enim legte den Kopf zur Seite. »Ich kann besser verstehen, schwer sprechen. Es ist in Ordnung. Du kannst sprechen wie normal. So ich lerne.« Er lächelte er tapfer. »Und wenn nicht, ich winke und sage.«
Tatsächlich konnte Enim Kayas Erzählungen folgen. Und die Anstrengung, die ihn das kostete, war nur zum Teil der Sprache geschuldet. Auch im Inhalt reihte sich eine Unbekannte an die andere, und Enim musste wieder einmal nachfragen. »Was ist ein Warmling?«
Kaya lächelte. »So nennen wir die hier. Es sind eigentlich nur warme Steine, die die Leute im Winter unter die Decke stecken. Ich habe einen Ofen am Stadtrand, wo ich sie aufheize. Und dann fahren wir mit dem Tretkarren durch die Gassen und verkaufen sie. Es ist ein kleines Geschäft, wie die Küchen oder die Marktstände.«
Dankbar erinnerte Enim sich an den heißen Stein im Bett eines kalten Zimmers, das ihn am Ende seiner Reise im Gasthof erwartet hatte. Er nickte.
»Und früher haben wir beide in einer Mine gearbeitet«, schaltete Lhut sich ein.
»Ah!« Enim fühlte ein Stück vertrauten Bodens unter den Füßen. »Das gut! Vielleicht ihr könnt mir zeigen? Ich werde sehr gerne ein echte Mine sehen, mit Leuten, die wissen! Weil ich auch will arbeiten in Mine, mit Traptionen.«
Lhut und Kaya tauschten einen Blick. Lhut räusperte sich. »Wir wollendir auf jeden Fall eine Mine zeigen und dir sagen, was wir davon halten. Nichts, was wir lieber täten. Aber wir brauchen etwas Zeit. Wir müssen das erst arrangieren.«
Enim nickte und fragte gleich weiter. »Warum ihr nicht jetztweiterarbeitet in Mine? Wegen Mine? Oder nur wegen eure neue Arbeit?«
»Wegen der Mine.« Lhut faltete seine Hände in einer langsamen, bedachten Geste. »Weißt du, es gab einen Unfall, vor drei Jahren. Und ich wurde verletzt.«
»Oh?« Enims Brauen schossen in die Höhe. »Das tut mir leid. Und ich glücklich zu sehen, dass du gut geheilt!«
Lhut hielt kurz inne. »Nun«, sagte er. »Meine Beine sind nicht so gut geheilt.«
»Nein?« Enim neigte sich zur Seite, um unter den Tisch zu lugen. »Sind noch Schmerz–« Enim brach ab. Er hatte die beiden Stümpfe gesehen, das Einzige, was noch von Lhuts Beinen übrig war.
3
Enim lag auf seinem Bett und starrte an die Decke. Es war später Vormittag. Lhut und Kaya waren längst zu ihrem Tagesgeschäft gegangen, allerdings mit dem Versprechen, ihn wieder zu treffen, sobald sie Zeit fanden. Eigentlich hatte Enim inzwischen hinausgehen wollen, um sich bei den ersten Minen vorzustellen. Aber er war nicht in Stimmung für neue Bekanntschaften. Er konnte sich jetzt nicht präsentieren, weder als liebenswerter Mensch noch als kompetenter Almecha.
Unruhigwarf er sich auf dem Bett herum.
›Außerdem‹, dachte er, ›wie kann es sein, dass Lhut noch immer so mit seinen Beinstümpfen dasitzt? Ich weiß, dass man manchmal erst die Wunde heilen lassen muss, bevor man Hilfen anbringen kann. Aber doch wohl nicht drei Jahre?‹ Enim drehte sich auf den Bauch. ›Ich werde ihn das fragen, wenn ich ihn wieder sehe.‹ Und als wäre dieser Entschluss die Antwort auf alle Zweifel, schlief Enim ein.
* * *
»Willkommen im Schlösschen! Dem Herzen Shebbetins!«
Kaya breitete die Arme in einer triumphalen Geste aus. Sie grinste über ihre Schulter zurück zu Enim.
Enimerkannte das Durcheinander aus Winkeln und Dächern wieder, das er bei seinem ersten Blick auf Shebbetin gesehen hatte, als er vom Hügel hinab auf Nacht und Mondschatten blickte. Im hellen Licht des Nachmittags sah das Viertel immer noch wirr und verschlungen aus, und nur ein klein bisschen weniger mysteriös.
»Im Grunde ist es ein Haufen Häuser, die zusammengewachsen sind«, erklärte Kaya. »Leute, die hergezogen sind, haben immer noch ein Haus oder zumindest ein Zimmer hinzugebaut und zum Schluss einfach nur noch die verbleibenden Zwischenräume überdacht. Und so sind die Gassen zu den Gängen unseres Schlösschens geworden.«
Kaya ließ ihre Finger über die raue Wand gleiten. »Ich habe es immer schon gemocht. Es ist eine gute Nachbarschaft, mit Leuten, die sich gegenseitig zur Seite stehen. Ein freundlicher, vertrauenswürdiger Ort.« Kaya zögerte. »Was die Menschen betrifft. Die Häuser, so charmant sie auch aussehen mögen, sind eine Todesfalle. Und alle wissen das. Bring einen Funken ins Schlösschen, und du hast alle darin getötet. Das Stroh der Dächer würde sofort in Flammen aufgehen und ein Labyrinth aus Steinwänden alle fangen, die zu fliehen versuchen. Deshalb ist Feuer in und um das Schlösschen strikt verboten.«
Kaya schlug mit der flachen Hand auf einen Dachvorsprung. »Sehr förderlich für mein Geschäft«, sagte sie mit beißendem Unterton. »Niemand hier hat einen Herd zu Hause. Das gibt massig viel Nachfrage für Warmlinge von außen.«
Enim duckte sich unter einem Steinbogen durch und wäre fast in Kaya hineingelaufen, die in einem offenen Innenhof stehen geblieben war. Topfpflanzen säumten den Rand und Beerenranken wanden sich zwischen blühenden Bohnen entlang der Wände. Mit all den Spuren von Spiel und Handwerk, die auf dem Boden verstreut lagen, wirkte es wie ein Mittelding aus Bauerngarten und gemütlichem Dorfplatz.
Kaya deutete auf die Haustür zu ihrer Linken und streifte bereits die Schuhe ab. »Lass uns kurz hineingehen, damit du sehen kannst, was Lhut so macht mit seinem Leben.«
Sobald Enim über die Schwelle trat, tauchte er ein in ein lebendiges Brummen und Summen. Ein gutes Dutzend Kinder jeglichen Alters kugelte auf Decken und Grasmatten herum, krabbelte über den Boden oder saß um niedere Tische, tief versunken in Rätsel, die Enim nicht kannte. Mit konzentriertem Blick und gerunzelter Stirn waren sie am Malen und Bauen, am Reden und Zuschauen, am Feilen und Weben. Rund um sie drängten sich Kreidezeichen und Bilder auf den Schiefertafeln an der Wand.Hinten in der Ecke saß Lhut umringt von drei Mädchen, die ihm mit eindringlichen Blicken und ausladenden Gesten etwas erklärten.
Kayas Stimme floss durch das Gewusel des Raumes. »Das hier ist Cahuan. Sie hat diese Laube gegründet, und sie Kuschellaube getauft.«
Enim drehte sich um und erstarrte. Cahuan war ein Schmetterling, wie Yoor. Enim rang nach Luft. Er hatte das nicht kommen sehen und wurde völlig unvorbereitet getroffen. Sie schien ihm unwirklich, feenhaft. Ihre zarte, samtige Haut schimmerte in Gold- und Grüntönen. Unter langen dunklen Wimpern sahen ihre Augen ihn an wie tiefe grüne Seen, in denen er vielleicht ertrinken konnte, oder aber mit dem Sonnenlicht schwimmen, das in goldenen Strahlen um eine dunkle Mitte tanzte. Wie wogende Unterwasserpflanzen fiel ihr Haar in sanften Wellen über ihren Rücken, und selbst zwischen den dunklen Strähnen schienen goldene Punkte zu schimmern wie winzige Fische, die zwischen Algen hin und her schossen. Cahuan war voll und rund, und ihr ganzer Körper hatte eine ruhige, gemächliche Anmut, die Enim wieder an einen Unterwassertanz erinnerte. ›Vielleicht ist sie eine Meerjungfrau‹, dachte er stupide. ›Eine Schmetterlings-Meerjungfrau.‹
Enim riss sich zusammen. Er wusste nicht, wie lange er Cahuan schon angestarrt hatte, oder wie offensichtlich. Aber die anderen starrten nicht alle zu ihm zurück. Also war es vielleicht nicht so arg gewesen.
Enim gewann wieder an Fassung und an Fähigkeit, den Raum und das Gespräch rund um ihn wahrzunehmen.
»Er spricht hauptsächlich Kokisch«, erklärte Kaya gerade.
»Oh prima!« Ein zwölfjähriges Mädchen mit Zöpfen voller Federn und Perlen strahlte Enim an. Das bunte Fleckengewirr, das ihre Tunika darstellte, wippte mit Rüschen und Lappen und Bändern vor Enims Augen. »Wirst du mit uns reden? Und uns Geschichten vorlesen? Wir haben dieses eine Buch, weißt du? Pulan …« Sie ruderte farbenfroh mit der Hand durch die Luft. Das Mädchen neben ihr, mit breiten Wangen und extrem kurzen Haaren, pfiffdurch die Zähne und schoss davon, während Enim weitere Erklärungen bekam.
»Wir schreiben immer die Wörter ab, aber wir können sie nicht so recht aussprechen, weil niemand hier weiß wie, verstehst du? Aber jetzt bist ja du da!«
Pulan kam zurück, pfiff einen triumphierenden Abschluss und baute sich breitbeinig vor Enim auf. Ohne Umschweife hielt sie ihm das offene Buch vor die Nase. Erwartungsvolle Blicke bohrten sich in Enims Stirn.
»Äh …« Enim starrte auf die Buchstaben, die wenige Fingerbreit vor seinem Gesicht verschwammen.
»Äh. Ja. Ich kann Kokisch lesen.«
Das buntflockige Mädchen warf sich für eine kurze aber heftige Umarmung an seinen Hals.
»Großartig!!!«
Dann fügte sie hinzu: »Ich bin Som.«
*
Als Kaya und Enim das Schlösschen hinter sich ließen, wurde der Abstand zwischen den Häusern wieder größer, bis schließlich nur noch ein paar letzte Hütten über den Hang verstreut lagen, den sie hinaufstiegen.
Kaya drehte sich halb zu Enim um. »Wir können jetzt nicht in die Mine hinein. Aber du kannst schon mal dran vorbeigehen, einen Blick auf den Eingang werfen und auf ein paar der Bergleute. Es ist zumindest ein erster Eindruck.«
»Ja, wunderbar.« Enim war es recht. Für ihn war ohnehin alles neu und sehenswert.
Schon bald tauchten zwei kleine Gebäude auf, die den Eingang der Mine flankierten. Sie sahen ganz gewöhnlich aus, fand Enim, diese selbe Art von strohgedecktem Steinhaus, wie er sie in Shebbetin schon so oft gesehen hatte. Einige Leute standen davor, und ein paar weitere kamen gerade aus der Mine.
Doch dann lief eine Schockwelle durch die gesamte Gruppe. Ein schriller, durchdringender Schrei gellte aus den Tiefen des Berges.
Kaya riss an Enims Arm. »Nachtling«, keuchte sie. »Lauf!«
Kaya sprintete los. »Schau nicht zurück!«, rief sie über die Schulter.
Enim schaute sofort zurück. Er konnte nicht anders. Aber er sah bloß Menschen, die in alle Himmelsrichtungen davonstoben.
Enim setzte Kaya nach, so schnell er konnte. Er rannte über die unebene Wiese, stolperte, fing sich und eilte weiter. Kaya war weit voraus. Das hohe Gras strich um seine Beine, drohte ihn zu verstricken.
Enim hörte eineBewegung hinter sich. Etwas Großes, Schnelles, das ihm folgte, das aufholte.
Diesmal blickte Enim sich nicht um.
Er rannte aus Leibeskräften. Er fühlte den Schatten mehr als dass er ihn sah, links hinter sich, immer näher. Enim drehte nach rechts ab, den Hügel hinab. Und kam zu Fall. Den Fuß in einer Wurzel verfangen, stürzte Enim kopfüberden Abhang hinunter. Er fing sich hart mit den Armen ab, rollte und kugelte mit der Macht des Aufpralls, ein Spielball der Schwerkraft, ohne Kontrolle, ohne Orientierung.
Schließlich kam der lawinenartige Impuls zum Erliegen. Die Hände ins Gras gekrallt gelang es Enim, die Welt still zu halten.
Er riss den Kopf hoch.
Doch der Schatten war nicht über ihm.
Der Nachtling war allein weitergezogen, weit oben am Hang.
Enim konnte ihn nun deutlich sehen. Sein schwarzes Fell schimmerte in der Sonne und ließ das perfekte Spiel seiner Muskeln erkennen, als er in wilder Jagd dahinschoss, sein langer, schlanker Körper elegant wie der einer Raubkatze. Der Nachtling war riesig, viel größer als ein Mensch, aber er schien leicht, fast schwerelos. Er hob den Kopf und ließ einen gellenden Schrei ertönen. Enims Nackenhaare stellten sich auf. Er konnte das Zittern bis ins Mark seiner Knochen spüren.
Dann hob der Nachtling ab.
Enims Augen wurden weit.
Mit einem letzten Satz hatte der Nachtling sich in den steilen Abgrund geworfen, in den Auftrieb des Windes. Er breitete Flügel aus, zwei Segel aus glänzend schwarzem Leder, ein perfekter Halbmond in den Farben der Nacht.
Die Luft schien das gewaltige Wesen mühelos zu tragen. Der Nachtling glitt auf der Brise dahin, stieg mit einem plötzlichen Windstoß auf, drehte hoch droben wieder ab. Er strich durch den Himmel wie eine Schwalbe, leicht und grenzenlos, eine anmutige Schönheit jenseits der Erdenschwere.
Doch dann kam er zurück.
Im Tiefflug glitt der Nachtling über die Wiese, gerade über den Spitzen der Gräser, sein Mund ein riesiges schwarzes Loch, so weit wie sein ganzer Körper. Mit atemberaubendem Tempo schoss er auf Enim zu. Und vorbei.
Enim lag auf dem Rücken, fest gegen die Erde gepresst. Sein Atem ging flach undkeuchend.
Über ihm stieg der Schatten in den Himmel.
Aber diesmal kam er nicht zurück. Er ließ sich davontragen wie ein Tänzer, ein schlanker, graziler Umriss, der schwerelos seine Kreise zog, hinaufschoss in luftige Höhen, ein Gefährte des Windes. Enims Blicke folgten seinen Pirouetten, bis der Nachtling in Wolken und Himmelslicht verschwand.
Enim schloss die Augen. Er fühlte die Festigkeit der Erde unter sich. Er atmete tief ein. Und aus. Sein Herz versuchte, zu einem Rhythmus zurückzufinden. Enim legte seine Hand auf die Brust, um zu helfen.
Als er die Augen wieder aufschlug, war Kaya bei ihm.
»Alles in Ordnung?«
Enim nickte.
Kaya sah ihn skeptisch an. Dann schüttelte sie den Kopf. »Du stehst unter Schock. Du hast keine Ahnung, ob du verletzt bist.« Mit einer herrischen Geste drückte sie Enim zurück in die Wiese, als er Miene machte, aufzustehen. Fast unglaublich zart hingegen war ihre Berührung an seiner Hand, wo sie ein fragiles Gelenk nach dem anderen abtastete, jedes einzeln bewegte, so vorsichtig, als wäre es ein Schatz aus geblasenem Glas.
Ein tiefes Seufzen stieg aus Enims Brust. Sein Kopf war leer. Willig gab er sich Kayas Anweisungen hin, beugte die Elle, hob die Schulter, drehte den Arm. Er zog die Schuhe aus, die Hose, das Hemd.
Kayas konzentrierte Aufmerksamkeit trug ihn mit sich fort, ließ ihn jede einzelne Zehe wieder spüren, jeden Wirbel seines Rückens. Ihre tastenden Hände zeigten Enim, dass er eine Leber hatte, einen Magen, einen weichen Bauch voller Leben. Und ein Herz, das seinen Rhythmus wieder gefunden hatte.
»Gratuliere. Du hast überlebt!« Kaya grinste ihn an. »Schrammen und blaue Flecken«, fügte sie mit einer wegwerfenden Handbewegung hinzu.
Enim atmete tief durch. »Danke.« Er fühlte sich wieder ein bisschen mehr wie er selbst. Im umliegenden Kleiderhaufen wühlte er unterder kostbaren Weste nach seiner Pluderhose.
»Das war ein guter Zug, dich so den Hügel hinunter zu werfen.«Kaya klang beeindruckt.
Enim lachte auf, wenn auch ziemlich zittrig. »Danke an meine Füße. Oder an die Wiese.« Enims Finger deuteten eine hügelige Fläche an. »Ich sicher nicht das geplant.«
Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Aber sag mir: Warum wir laufen? Nicht so, dass wenn du läufst, Jäger fangen an zu jagen?«
»Ja. Wenn es denn ein Jäger ist. Aber der Nachtling ist keiner. Oder«, schränkte Kaya ein, »zumindest jagt er nichts, was annähernd so groß ist wie du und ich. Er frisst Insekten.«
»Oh.« Enims Kopf war noch nicht ganz an seinem gewohnten Platz angekommen. Enim schüttelte ihn vorsichtig. »Aber so auch: Warum wir laufen? Wenn Nachtlinge nicht gefährlich. Nicht für uns.«
»Sie sind gefährlich. Sehr sogar. Wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen. Die Nachtlinge verkriechen sich zum Schlafen in Höhlen, und wenn man sie dort überrascht, werden sie panisch.«
Kaya blickte zurück zur Mine. »Das hier könnte übel gewesen sein.« Sie drückte die Arme fest um die Brust.
Dann stand sie mit einer raschen, zornigen Bewegung auf und hielt Enim die Hand hin. »Komm!«
*
Stöhnen und Schreie erfüllten die Luft. Verletzte stolperten aus der Mine, stützten sich schwer auf die Arme der Helfenden. Ihre Lippen waren bleich, ihre Augen weit vor Schmerz.
Ein großer, stämmiger Mann kauerte auf dem Boden und schluchzte hemmungslos, den leblosen Körper seines Sohnes in den Armen. Drei andere knieten bei ihm, hielten sich an den Händen und sangen eine raue Wehklage, ein Requiem, ein Gebet.
Eine dicht gedrängte Gruppe bahnte sich ungestüm einen Weg aus der Mine, eine Spur roter Tropfen hinter sich lassend. Die wimmernde Frau, die sie auf die Wiese betteten, war jung und kräftig. Aber ihr rechtes Bein war in Stücke gerissen. Blut wallte über die Hand des Bergmannes, der versuchte, die Arterie zuzudrücken. Er lehnte sich mit vollem Gewicht auf die Wunde. Das jammervolle Stöhnen der Frau wurde zu einem lauten Schrei, der plötzlich abbrach. Ihr Kopf rollte zur Seite.
»Ohnmächtig«, zischte das Mädchen neben ihr zwischen den Zähnen hervor. Sie riss einen Stoffstreifen von ihrem Hemd und wand ihn eng um den Schenkel, bevor sie ihn mit einem Aststück festzurrte.
»Sie wird das überleben«, sagte das Mädchen trotzig. »Wir müssen nur das Bein amputieren lassen.«
4
In der hinteren Ecke der Kuschellaube saß ein alter Mann und sang langgezogene Klagelieder der Berge, melancholische Weisen von Leiden, Sehnsucht und Ewigkeit. Som lag in seinem Schoß und weinte, ein trauriger bunter See, unter dem zarte Schultern zitterten.
Rund um Lhut lagen grob gerissene Stoffstreifen auf dem Boden. Zwei Kinder übten weiterhin mit ihm, Bandagen zu machen, zu lösen und sorgfältig wieder aufzuwickeln. Die meisten aber hatten schon genug. Lasa und Lunin, die Zwillinge, waren sowieso gleich dazu übergangen, selbst zu Nachtling und fliehenden Menschen zu werden, wobei sich eine ganze Menge aufgerüttelter Emotionen in Schreien und Ducken, in Rennen und Versteckenim Hof übersetzte. Dazwischen aber gab es aber auch Beratungen zum Szenario. Und dem realen Verhalten von Nachtlingen, einem Thema, zu dem die beiden Siebenjährigen immer wieder bei Cahuan nachfragten.
Im Moment war der Nachtling gerade dabei, sich durch die nutzlose Eingangssperre vor einer Mine zu graben.
»Ja. Es ist sehr schwer, Barrieren zu bauen gegen Wesen, die mit ihren Klauen durch Stein wetzen können«, bestätigte Cahuan. »Fast unmöglich, würde ich meinen. Aber vielleicht ist es gar nicht nötig. Manche Minen haben nämlich ganz leichte Holzgitter über allen Eingängen, auch über allen Luftschächten und so. Und vor jeder Schicht geht jemand alles ab und kontrolliert. Falls irgendwo durchgebrochen wurde, wird Alarm geschlagen und die Leute gehen nicht in die Mine.«
Lasa hörte auf zu graben und drehte sich um, eine Frage in ihren dunklen Augen. »Aber was passiert dann? Sie arbeiten nie wieder dort?«
»Doch. Sie lassen zuerst eine kleine Traption hinein krabbeln, die viel Lärm macht. Dann warten sie gut versteckt ab, bis sie sehen, wie der Nachtling aufgeschreckt aus der Mine flieht. Und erst danach gehen sie selberrein. Und reparieren außerdem das Holzgitter.«
Lasa und Lunin nickten und begannen sofort, eine Mine mit mehreren Eingängen und Gittern aufzubauen.
»Aber warum dann Menschen sind überrascht heute in die Mine mit Nachtling? Wenn sie haben sollen Alarm?«, fragte Enim.
»Weil diese Mine keine Holzgitter hat«, presste Kaya zwischen den Zähnen hervor. »Und auch sonst kein System. Weil es Naydeer die Mühe nicht wert ist.«
Enim sah den Ausdruck auf Kayas Gesicht und zögerte. »Das Naydeers Mine?«, fragte er vorsichtig.
»Ja. Und es war Naydeers Mine, die über uns zusammengebrochen ist. Und auch nicht zufällig.« Kayas Augen wurden schmal.
Enim runzelte die Stirn. »Wie meinen, nicht zufällig?«
»Ich meine«, sagte Kaya mit schneidender Stimme, »dass eine Tonne Gestein auf Leute niedergeregnet ist, die drauf und dran waren, Naydeer zur Rechenschaft zu ziehen.«
Lhut war zu ihnen herüber gekommen. »Es hatte eine Menge Unfälle gegeben in Naydeers Minen. Sie hat beim Stützholz gespart und bei den Luftschächten. Und der Preis dafür war Leib und Leben der Bergleute.«
Lhut setzte sich hin, seine kurzen Beine vor sich ausgestreckt. »Wir wollten Naydeer zwingen, zumindest das Minimum zu tun. Genug Luft und Tunnel, die nicht einstürzen. Wenigstens das. Und solange sie nicht einmal dafür gesorgt hatte, wollten wir den Betrieb der Mine stoppen.«
Mit geballten Fäusten starrte Kaya in die Ferne, in die Vergangenheit. »Naydeer musste herausgefunden haben, was wir planten. Sie wusste natürlich, dass wir mehr Sicherheit in der Mine wollten. Weil wir sie in einem ersten Versuch einfach darauf angesprochen hatten. Naive Narren, die wir waren!«
Kaya lachte bitter. »Naydeer hat uns bloß in den Bauch getreten. Und mehr angedroht. Aber wir haben nicht aufgegeben. Zu viele Menschen waren schon in der Mine gestorben. Die Leute waren bereit, waren wütend genug, um etwas zu unternehmen. Und so haben wir uns zusammengetan – und in dem Moment ist Naydeers Mine auf uns herabgestürzt, mit aller Wucht.«
Enims Hände umklammerten seine Oberarme, so fest, dass es fast das Blut absperrte. »Aber bitte, du sagst nicht, dass Naydeer hat die Mine kaputt gemacht? Mit Absicht? Dort, wo die Menschen sind? Das kann sie nicht machen. Das Mord!«
Kaya blickte ihn an, mit Augen kalt wie Stahl.
*
Still und in sich gekehrt saß Enim in einer Ecke des Hofes vor der Kuschellaube und aß. Eine öde Leere hatte sich in seinem Kopf breitgemacht. Kayas Worte hallten darin nach, mit einem gespenstischen Echo, das keine Heimat fand.
Enim beschloss, es zu ignorieren. Vielleicht würde er sich später irgendwann einen Reim darauf machen können. Im Moment konnte er damit nicht umgehen.
Dankbar überließ sich Enim für einen Moment der Weisheit seines Körpers, fühlte die wohlige Wärme von Linsen und Kartoffeln in seinem Bauch, den würzigen Geschmack von Wildkräutern auf seiner Zunge. Er lehnte die Schultern gegen die Wand, spürte die Festigkeit des Steins in seinem Rücken, die sanfte Berührung der Sonne auf seinem Gesicht.
Er atmete tief durch.
Sein Blick wanderte hinüber zu den drei Kindern, die an diesem Tag für das Mittagessen verantwortlich waren und gerade mit sichtlicher Routine den Abwasch aufbauten. Zwei Mädchen, die noch im Schlösschen unterwegs gewesen waren, rannten herbei und hofften auf eine Portion für Spätankömmlinge. Kaya, Lhut und Cahuan saßen an der Seitenwand auf den Stufen einer Treppe.
Enim gab sich einen Ruck und ging zu ihnen hinüber.
Cahuan rutschte beiseite, um Platz zu machen. »Hast du schon mit einer von den Tsechen gesprochen? Kaya sagt, du willst für sie arbeiten?«
»Ja, ich will«, sagte Enim zögerlich. »Ich wollte. Ich will.« Seine Finger trommelten unruhig auf den Tellerrand. »Aber, nein, ich noch nicht gesprochen mit Tsechen. Ich weiß nicht, wie anfangen.«
Ein strahlendes Lächeln erhellte Cahuans Gesicht. »Geh zu Manaam! Er ist mit Abstand der Beste!«
»Er Freund von dir?«
Cahuan nickte, das frohe Leuchten noch immer in den Augen. »Ja. Wir sehen uns nicht oft, aber wir sind uns sehr nahe.«
Kaya ließ den Löffel etwas zu hart auf den Teller klirren. »Manaam zahlt die meisten Ausgaben der Kuschellaube. Auf die Art haben Lhut und Cahuan und alle hier zu essen. Außerdem stürzen in Manaams Minen die Tunnel nicht ein. Also großartig, für hiesige Verhältnisse.« Kaya stellte ihren Teller weit hinter sich auf die Treppe, wie um sicher zu gehen, dass er nicht zu Schaden kam.
»Manaam betreibt auch einen Heilbeutel für seine Bergleute«, schaltete Lhut sich ein. »Nach den gleichen Prinzipien, die Kaya erfunden hat, als sie in unserer Mine den ersten Heilbeutel gründete.«
»Was ist Heilbeutel?«, fragte Enim, unvermeidlicherweise.
»Es ist ein Weg, wie Leute sich gegenseitig aushelfen im Fall von Krankheit«, erklärte Lhut. »Eine große Zahl an Menschen zahlt jeweils einen kleinen Beitrag in den Beutel, und wenn jemand krank oder schwer verletzt ist, so wie ich damals, dann kann man einen größeren Betrag aus dem Beutel nehmen, um zu einer Heilung zu gehen.«
Enim blinzelte. »Alle gehen zu Heilung. Alle, die brauchen. Alle, die krank. Nicht nötig Beutel für das.«
Schweigen senkte sich über ihre kleine Gruppe.
Enim blickte auf Lhuts Beinstümpfe, dann in seine Augen. Ein Klumpen formte sich in Enims Kehle. Seine Stimme war rau. »Nicht hier?«
»Nein. Nicht hier.« Lhut fuhr mit den Fingern über den Rand seines Schenkels. »Wir mussten eine Heilerin bezahlen. Damit sie meine zerschmetterten Glieder abnimmt und ich nicht sterbe. Aber das war alles. Mehr gibt es für uns nicht. Und für viele nicht einmal das.«
Enim wandte sich ab. »Nein.« Es war nur ein Wispern. Ein Widerspruch, an die Welt gerichtet, in den Wind gesprochen. »Nein. Das kann nicht sein.«
5
Sanfte Nachmittagssonne wärmte die breiten Alleen, wo Enim gediegene Villen und grüne Gärten bestaunte, die die Gegend ganz anders erscheinen ließen als das Viertel rund um das Gasthaus. Es war fast ein wenig wie eine eigene kleine Stadt, mit ihrer eigenenStimmung und Architektur, ein Stück weit entrückt vom Rest Shebbetins.
Manaams Haus war leicht zu finden. Behutsam klopfte Enim an die Tür.
Eine sehnige Frau unbestimmten Alters öffnete und führte Enim in einen Salon mit polierten Holzböden und kunstvollen Tuschezeichnungen.
»Nur einen Moment, bitte. Ich werde erfragen, ob Manaam verfügbar ist.«
Unruhig ging Enim im Zimmer auf und ab. Seine Kehle fühlte sich trocken an. Mühsam räusperte er sich.
Da öffneten sich die Doppeltüren und Manaam flanierte herein.
In die schlichte Eleganz fließender, tief ausgeschnittener Seidengewänder gehüllt, hieß er Enim mit warmer Stimme willkommen. Enim fühlte eine Welle der Erleichterung durch seinen Körper laufen. Und das war nicht nur dem Umstand geschuldet, dass Manaam fließend Kokisch sprach. Enim fühlte sich einfachsofort wohl mit ihm.
Und Manaam schien ebenso erfreut, als er Enims Vorstellung hörte. »Jemand mit deinen Kompetenzen in Shebbetin zu haben ist ein Segen!«, lobte er. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, mit wie viel Mühe ich Almechas im Tiefland nachgelaufen bin, als ich vor ein paar Jahren eine Traption für meine Mine haben wollte! Niemand war bereit, mit mir hinauf in die Berge zu kommen. Schließlich habe ich eine Almecha gefunden, die die Traption in Behrlem zusammengebaut hat. Und es dann mir überlassen, wie ich das Ding nach Shebbetin bringe und in der Mine zum Laufen kriege. Eine Aufgabe, die die lokalen Kompetenzen an ihre Grenzen gebracht hat, kann ich dir versichern!«
Manaam öffnete eine reich verzierte Holztruhe an der Wand und blickte nachdenklich hinein. Dann griff er zu. »Ah! Das ist es.« Er zog eine große Pergamentrolle heraus. »Zumindest in der Theorie.«
Er breitete das Blatt auf dem Tisch aus. »Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, was all das bedeutet.« Manaam deutete auf Muster aus unzähligen zarten Linien, die sich auf dem Pergament ineinander schlangen, versetzt mit symbolhaften Pentagrammen und engem Gekritzel. »Aber du schon?«
Enim leckte sich die trockenen Lippen. Seine Augen wurden schmal, als er sich über das Blatt beugte und auf die feinen Striche fokussierte. Seine Blicke wanderten durch ein endloses Labyrinth aus Kreuzen und Schleifen, suchten nach seinem Kern.
Die Stille zog sich hin.
Schließlich richtete sich Enim auf.
Ein stilles Lächeln hatte sich in seine Miene gestohlen.
»Ja. Ich schon.«
Manaam nahm Enim gleich mit auf eine Reise in die Realität des Bergwerks. Und so fanden sie sich tief unter der Erde wieder, im Herzen von Manaams Mine. Die Wände ringsum waren gut mit magischen Laternen bestückt, und die Traption präsentierte sich im besten Licht.
»Ich habe Leute für Routinesachen wie dies hier«, berichtete Manaam. »Bloß den Vim-Stein austauschen. Aber da du nun schon einmal hier bist, als Teil deiner Besichtigungstour, kannst du ja auch gleich dein Können zur Schau stellen.« Er grinste. »Du wirst noch mit ganz anderen Dingen zu tun bekommen. Ich warne dich! Manche der Tsechen hier sind nicht sehr darauf bedacht, immer die neuesten Traptionen in ihren Minen zu haben. Erst wenn ihre alten ganz und gar zum Stillstand kommen, lassen sie jemanden rufen.« Manaam legte die Hand auf Enims Schulter. »Du wirst hier Sachen begegnen, die du noch nie zuvor gesehen hast. Traptionen, älter als du selbst!«
Enims Brauen schossen in die Höhe. Er wusste nicht recht, ob er das als Witz auffassen sollte. Die Traptionen hatten sich in den letzten Jahren mit einem solchen Tempo weiterentwickelt, dass welche, die schon Jahrzehnte alt waren– »Hier bitte!«, unterbrach Manaam Enims Gedanken.
Er hatte bereits den Deckel der Traption abgenommen.
Die untere Hälfte der großen Messingkugel war mit feinsten Glasfäden durchzogen, die glänzende Kristalle in ihren Schlingen hielten.
Enim kauerte sich nieder und versuchte, das Muster von der Pergamentrolle in dem ätherischen Labyrinth wiederzuerkennen. Und fast gelang es ihm. Er war sich nicht mehr sicher, welcher Zauberspruch in welchem Kristall geborgen lag. Obwohl, wenn das Muster hier hinten begann …
Versunken in seine Betrachtungen bemerkte Enim erst mit gehöriger Verspätung, dass Manaam ihm einen Arm entgegen streckte. Ein perfekt geschliffener Amethyst lag in seiner Hand.
»Ah ja.« Enim nahm den Kristall an sich und rollte ihn vorsichtig zwischen den Fingern. Er wollte erst noch besser verstehen, wie alles zusammenhing, bevor er irgendwie in dieses delikate Gewebe eingriff. Enim richtete sich auf und schaute auf die enormen Zahnräder an der Wand, dann hinunter in den Minenschacht. Eine Reihe voll beladener Waggons stand auf den Schienen, die in die Tiefe führten. Geduldig hielten sie sich an einer schweren Kette fest und warteten, dass die Räder sich wieder zu drehen begannen.
»Hier also wird die Kraft hingeleitet«, murmelte Enim.
»Äh. Ja.« Manaam hatte dem Offensichtlichen nicht viel hinzuzufügen.
Ein paar Bergleute guckten um die Ecke, um zu sehen, wie die Dinge standen und ob es bald wieder losgehen würde.
»Nun gut.« Konnte ja nicht so schwer sein. Bloß ein Vim-Stein. Normalerweise brauchte es nicht einmal echte Almechas, um so einen Austausch vorzunehmen.
Enim räusperte sich.
Er zog seinen Zauberstab aus dem Gürtel und richtete ihn auf das Zentrum der Traption, wo ihm ein Amethyst genau wie der in seiner Hand entgegen leuchtete. Enims Pupillen verengten sich. Er sprach nur ein Wort.
Und der Amethyst schwebte aus der gläsernen Wolke direkt in Enims Schoß. Mit einer flüchtigen Handbewegung schickte Enim den neuen Kristall auf die Reise. Lautlos zog der zweite Amethyst seine Bahn zwischen den unsichtbaren Fäden, ohne die Symmetrien zu stören. Sanft wie eine Schneeflocke setzte er sich an genau den richtigen Platz.
Enim hielt den Atem an, wie um die Stille und die zarte Zerbrechlichkeit des Gewebes zu bewahren.
Aber dann brach die Hölle los.
Mit Donner und Getöse schlugen riesige Zahnräder aufeinander, ächzten die Ketten, spuckten Waggons Geröllladungen auf die Halde. Bergleute schrien und winkten.
Enim fuhr herum. Seine Blicke flogen zu den rasselnden Ketten, dann wieder zum Funkeln der Glaswolke. Aber eine Hand an seiner Schulter zog ihn zurück.
»Du wirst noch Zeit genug haben, dir alles anzuschauen«, rief Manaam ihm ins Ohr. Er war es gewesen, der die Traption wieder in Gang gesetzt hatte. Da der Vim-Stein ja ganz offensichtlich getauscht war, hatte Manaam es für das Beste gehalten, wenn die Arbeit sofort weitergehen konnte.
Enim atmete tief aus.
Manaam zog ihn mit sich fort, zurück in den ansteigenden Tunnel. Umständlich kletterten sie die schwarzen Eingeweide des Berges hinauf bis zum offenen Maul, aus dem sie schließlich wieder hinaus krochen.
Enim reckte seine Arme gen Himmel und sog die frische, klare Bergluft ein. Der Wind spielte mit seinen Haaren, und eine blasse Sonne schob ihre Finger zwischen die vorbeiziehenden Wolken.
»Wunderbar!« Manaam steckte den leeren Vim-Stein, der nun wieder befüllt werden musste, in die Tasche. »Ich glaube, ich sollte ein Diner zu deinen Ehren veranstalten. Dann kannst du auch andere Tsechen kennenlernen und ihnen deine Dienste anbieten. Ich kann dir versichern, du wirst höchst willkommen sein.«
Enim nickte. Ein zufriedenes Grinsen machte sich auf seinem Gesicht breit. Vielleicht war es ja doch nicht so schwer, sein neues Leben hier zu beginnen!
Er pfiff einem vorbeifliegenden Vogel nach.
Und dann konnte er ja womöglich auch gleich diese anderen Dinge angehen, die ihn seit seiner Ankunft in Shebbetin so verunsichert hatten. Wie das mit der Poststation. Das zumindest musste doch leicht in Ordnung zu bringen sein, oder?
Enim fragte Manaam danach.
Manaam sah ihn seltsam an, mit einem schrägen Seitenblick. Er räusperte sich. »Nun ja. Du kannst natürlich eine Anfrage nach Varoonya schicken. Aber es wird vermutlich nichts geschehen, und ganz sicher nicht schnell.«
Enims Stirn legte sich in Falten. »Na, wenn es lange dauert, dann sollten wir rasch beginnen, denke ich.« Er trommelte mit den Fingerspitzen auf seinen Schenkel. »Und wenn die Tsechen ohnehin jede Woche einen privaten Kurier nach Behrlem schicken, dann könnte jader inzwischendie Post für alle Menschen mitnehmen, oder? Das wäre doch nicht so viel mehr Aufwand, selbst falls er extra Lastpferde mitführen müsste?«
Manaams Miene schwankte zwischen Überraschung, Lachen und Wut. Das Lachen gewann letztendlich die Oberhand, aber Enim spürte doch einen kleinen Stich darunter.
Manaam verschränkte die Arme fest über der Brust und musterte Enim aus schmalen Augen. »Schau her«, sagte er schließlich etwas gepresst. »Du kannst mir alle möglichen radikalen Vorschläge machen. Es stört mich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich will es hören. Aber bitte nicht beim Diner. Wenn du versuchst, die Ressourcen der Tsechen umzuverteilen und die Regeln unserer kleinen Gruppe zu ändern, bevor du überhaupt